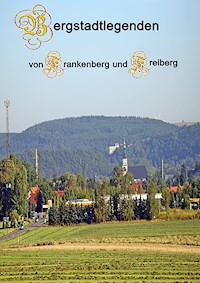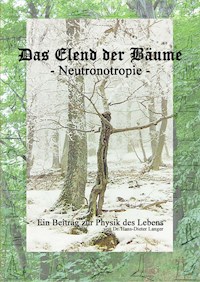
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Bäume faszinieren in vieler Hinsicht Laien wie Wissenschaftler, doch hat wohl noch niemand ihr vermeintliches Elend entdeckt. Jedenfalls unterstellt der Autor der Spezies Baum eine bisher unbekannte Leidensgeschichte, die sich in der Bewegungsphysiologie und Formenvielfalt spiegelt. Nach seinen Erkenntnissen ist der Geo- und der Phototropie der Pflanze, die den paradiesischen Photonengarten hervorbrachten, das Phänomen Neutronotropie überlagert, welches auf die lebensfeindlichen Wirkungen der natürlichen irdischen Kernstrahlung zurückzuführen ist. Man gerät mit diesem Beitrag in den Einzugsbereich der jungen Disziplin Physik des Lebens, der eine Tür zum bisher unbekannten Neutronengarten Erde öffnet. Das unterhaltsame Fachbuch könnte zwar Irrtümer enthalten, doch öffnet es auf jeden Fall eine neue Sicht auf die Natur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Falk-Uwe
Dank
Obgleich viele einschlägige Experten und Wissenschaftler mehr oder weniger rein emotional oder spektakulär ihr Veto eingelegt haben, möchte der Autor gerade ihnen danken, denn sie haben paradoxerweise den Fortschritt der Forschungsarbeit nicht gebremst, sondern eher den Autor herausgefordert und seinem Ziel nähergebracht. So fühlte man sich oft unverstanden, weshalb sich die Bemühungen vermehrten, die Dinge umso kritischer, gründlicher und anschaulicher zu bearbeiten.
Wenn die Bäume sprechen könnten, wäre es vielleicht ebenso kontrovers zugegangen, weshalb der Autor auch ihnen dankbar ist, dass sie schwiegen, denn Physik ist weder sozial, noch demokratisch, selbst wenn es um das eigene Befinden im Universum geht.
Einigen digitalen Medien muss der Autor dagegen wirklich nicht danken. Sie haben sich unverdient der gedruckten Fachzeitschriften bemächtigt und bereichern sich daran, obgleich das darin abgelegte Wissen vom Steuerzahler finanziell längst beglichen worden ist.
Ganz anders dagegen das freie Internet: Der Autor ist allen unendlich zu Dank verpflichtet, die der Verlockung der Medien entgehen und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse kostenlos dem ganzen Erdball zur Verfügung stellen!
Nun muss man vorsorglich auch noch dankbar an jene denken, die sich vielleicht durch das Buch so heftig provoziert empfinden werden, dass sie sich einst zur Überprüfung der Inhalte mit besseren physikalischen Mitteln entschließen. Mögen sie ein Auge zudrücken, wenn der Autor auf dem anderen blind gewesen ist!
Und wie immer, wenn Berge von Text, Bildern, Tabellen, Diagrammen und Formeln anstehen und vor allem zwei Jahre lang bewältigt werden müssen, spielen zwei Frauen eine entscheidende Rolle: Die eine, die Schwägerin Helgard Langer, kämpfte sich mutig durch den Korrekturdschungel und die andere, die Ehefrau Ellentraud Langer, meinte fast schon verzweifelt, dass sie sich das Leben im Alter anders vorgestellt hätte, wenngleich es diesmal sogar um die Physik dieses Phänomens ging. Namentlich ihnen, aber auch allen nicht Benannten, die ebenfalls wertvolle Impulse gegeben haben, sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt.
Gleiches gilt jenen, denen die Augen für das Elend der Bäume geöffnet werden konnten. Zu ihnen gehört unbedingt Frau Caro Ruttmann, die dem Autor das Foto auf dem Deckblatt geschenkt hat.
Inhalt
Einführung
Das freie Neutron - ein kurzer Exkurs durch die Physik- und Kulturgeschichte
Neutronen-Signale, die keiner verstehen will
Biologische Relevanz der natürlichen Neutronenstrahlung
4.1 Ein Streifzug durch den Photonengarten Erde
4.2 Das Mysterium des freien Neutrons in der Biosphäre
Das freie Neutron in der Biosphäre
5.1 Sekundärneutronen (n
Sek
) der Kosmischen Strahlung
5.2 Terrestrische Neutronen (Geoneutronen, n
Geo
)
5.3 Energieverteilung der Neutronen in der Biosphäre
5.4 Höhenabhängigkeit in der Erdatmosphäre
5.5 Streuung und Einfang langsamer Neutronen
5.6 Das dynamische n
Sek
-n
Geo
-Feld in der Biosphäre
5.7 Begrenzte Lebensdauer des freien Neutrons
Besondere Eigenschaften der Neutronen
Anmerkungen zur Bewegungsphysiologie des Baumes
Charakterisierung von Bäumen
Bizarre Baumformen, artenübergreifend und weltweit
Elitewachstum
Extrem-Beispiele von Bäumen mit Beulen
Die Suche nach den Ursachen
Simulation der Neutronen-Streuung an der Realstruktur der Erdkruste und Messstrategie
Gerätetest
Messungen der Zeitabhängigkeit der natürlichen n-Strahlung und Messgenauigkeit
15.1 Zeitabhängigkeit
15.2 Messgenauigkeit
Schutzfunktionen im Zeichen der n-Streuung und n-Absorption
16.1 Flucht und Verteidigung von Pflanzen
16.2 Absorption und Streuung von Neutronen
Bäume im Feld der Geoneutronen
Gradientenwuchs der Bäume im Feld der Geoneutronen
Die Flucht der Bäume vor Geoneutronen-Strahlen
19.1 Ein Testbaum, der einen einzelnen Neutronenstrahl abbildet
19.2 Spezieller Nachweis der kausalen Beziehung n-Strahl/Borke, Beule und Leiste
19.2.1 Messtechnischer Nachweis
19.2.2 Modelle zur n-Streuung an Beulen, Leisten, Borken
19.3 Das Beulen-Phänomen im Kontext mit anderen Abnormitäten
19.4 Strahlmodelle in Verbindung mit der Korrelation Flucht-Beule
Der Elitestandort
20.1 Messungen im Gelände
20.1.1 Zu den geologischen Strukturinhomogenitäten im Untergrund
20.1.2 Zur natürlichen Radioaktivität von Boden- bzw. Baustoffen
20.1.3 Abschirmeffekte von Bauwerken bzw. Bauwerksteilen
20.1.4 Zeitliche Schwankungen der natürlichen Kernstrahlung
20.2 Messungen im Baumumfeld
20.3 Standort-Untersuchungen an Elitebäumen
20.3.1 Große Eiche zu Frankenberg/Sa.
20.3.2 Große Linde zu Mühlbach/Sa.
20.3.3 Auferstehungs-Linde zu Annaberg-Buchholz/Sa.
20.3.4 Esche an der Kirche St. Joachim und St. Anna zu Jachymov/Tschechien
20.3.5 Kirchenlinde zu Trebsen/Sa.
20.3.6 Friedhofslinde zu Collm/Sa.
20.3.7 Kirchenlinde zu Dresden-Kaditz/Sa.
Bodennahe Phänomene
21.1 Diffuse Streuung in der bodennahen Luft
21.2 Der Baumstamm im quasi diffusen n-Feld
21.2.1 Bäume im ungerichteten, diffusen n-Feld
21.2.2 Modell der Erosion im diffusen n
Geo
-Strom
21.3 Das rätselhafte Böschungs-Phänomen
21.4 Das Sockelproblem
Die beeindruckende Vielfalt der Wellen, Bögen und Asymmetrien
Erklärungsansätze zu Kriechverhalten, Astausladung, Knickwuchs
Brücken und Scheinknoten am Limit des Begreifbaren
Drehwuchs der Bäume - ein elektromagnetisches Phänomen?
25.1 Die Drehwuchs-Naturerscheinung
25.2 Ein physikalisches Modell zum Drehwuchs-Phänomen
25.2.1 Polarisierte Neutronen in der Biosphäre
25.2.2 Inhomogenes Magnetfeld eines geraden elektrischen Leiters bei Stromdurchfluss
25.2.3 Inhomogenes Magnetfeld von Bäumen
25.2.4 Modell der magnetischen Neutronen-Abwehr
Kollektiveffekte
Epilog
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einführung
Wir stellen zwei Fragen und zwei Antworten voran:
Können Bäume leiden?
Vielleicht, aber sie können auf Reize reagieren!
Ist Kernstrahlung für Bäume ein physiologischer Reiz?
Vielleicht, und genau dem wird hier mit physikalischen Mitteln nachgegangen!
Selbstverständlich kann sich ein Physiker irren. Der naturwissenschaftliche Vorstoß in unbekanntes Terrain ist schon immer mit diesem Risiko behaftet. Der Autor interessiert sich jedenfalls seit Jahrzehnten für den Einfluss der natürlichen Kernstrahlung in der Biosphäre auf das Siedlungsverhalten von Lebewesen und meint, dass Bäume davon besonders betroffen sind. Sein Risiko ist sogar zweifach, denn zum Unbekannten gesellt sich scheinbar die fachliche Unzuständigkeit. Da das Leben ein typisches Thema der Biologie, genauer der Fachrichtung Bewegungsphysiologie der Pflanzen sein sollte, fühlt er sich selbstverständlich als Physiker unsicher im fremden Terrain. Naturgemäß sucht man in dieser Situation den Kontakt zu einschlägigen Fachleuten. Das sind wohl in erster Linie Biologen und Forstwissenschaftler. Es schlugen aber alle ernsthaften Kontaktversuche fehl, Angebote zur Zusammenarbeit wurden ignoriert, und man fühlt sich bis heute unverstanden. So kristallisierte sich schließlich der Eindruck heraus, dass Kernstrahlung, zumal die vom Autor favorisierte Neutronenstrahlung, offenbar nicht das Ding der sognannten Baumexperten ist. Hat man sich nämlich als neugieriger Alleingänger im Dschungel der neuen Erkenntnisse verfangen und versucht sie anderen zur Diskussion vorzulegen, regt sich schnell umso stärkerer Widerstand, je abenteuerlicher oder fundamentaler die Ergebisse sind, die man den vermeintlichen Kollegen zu servieren versucht. Das war schon immer so, und speziell in der langen Geschichte der Naturwissenschaften. Einerseits ist heftige Kritik, wenn sie mit vergleichbaren Voraussetzungen geführt wird, absolut zielführend. Nimmt sie jedoch den Charakter einer Aburteilung durch konservative, ungeprüfte oder gar emotionale Einstellungen an, so wird der wissenschaftliche Fortschritt gebremst. Man muss andererseits bedenken, dass experimentelle Ergebnisse in der Physik - selbst wenn sie unzureichend erschlossen oder falsch interpretiert worden sind - früher oder später zumindest präzisierte Fragestellungen an die Natur zur Folge hatten, die schließlich weiterführten, und zwar gerade in scheinbar völlig artfremden Disziplinen. Das setzt natürlich voraus, dass die Forschungsresultate allgemein zugänglich veröffentlicht worden sind. Und genau deshalb wagte der Autor, nach einigen Vorveröffentlichungen und Aufsätzen in seiner Internetseite www.drhdl.de, dieses vorliegende Werk zu schreiben. Es gab für das Buchprojekt noch ein weiteres Leitbild: Der englische Physiker James Chadwick entdeckte im Jahr 1932 das Neutron, was jedoch zunächst heftig umstritten wurde. So trug sein erster Aufsatz vom 27. Februar 1932 die Überschrift „Possible Existence of a Neutron“1.1), was man auch als bange Frage „Habe ich?“ verstehen kann. Jedoch wenige Monate später, nämlich am 1. Mai 19321.2), war sich Chadwick seiner Sache ganz sicher: „The Existence of a Neutron“(!), und er hatte das Recht auf seiner Seite. Die Neider, die Nörgler und die ewig Gestrigen blieben also in diesem Fall sehr bald auf der Strecke. Wie gesagt, der Autor möchte sich hier keinen Vergleich mit diesem Nobelpreisträger anmaßen, sondern lediglich - auch aus anderen, naheliegenden Gründen - den unbewussten Ideengeber für den vom Autor geprägten Begriff Neutronotropie benennen. Vielleicht wird dieses vom Autor biologisch-physiologisch definierte „Phänomen“ niemals Eingang finden im Tempel der Anerkennung. Doch sollte man die Falsifikation mit den wissenschaftlichen Mitteln der Physik durchführen, also mit Hilfe der exakten Naturwissenschaften! Bliebe es jedoch bei der bisherigen, biologisch-konservativen Interpretation, so hätte der Baum lediglich nach den Gesetzen der Schwerkraft (Geotropie) und des Lichtes (Fototropie) zu wachsen, womit die Physik im Wesentlichen in diese ihre baumbotanische Nische verbannt wäre. Alles andere hätte man eher rein biologisch, zutiefst ökologisch, allenfalls chemisch, notfalls auch mystisch einzuordnen: „Es ist halt so!“ Dabei häufte zumindest die Zellbiologie ein ungeheures Wissen zum Thema Schäden, Mutationen und Wachstumsstörungen von Pflanzen durch Kernstrahlung auf1.4, 1.5). Und welche Schlüsse zog man daraus? Nun, wegweisende Antworten hätten zum Beispiel Auszüge aus einer Veröffentlichung der biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft anregen können1.6), siehe Bild 1.1. Von wegen „Beeinträchtigung“ (!), leider erfolgte tatsächlich auch seither kein durchgreifender Versuch, um das unübersehbare Elend der Bäume, wie es der Autor beobachtet und bezeichnet, genau einmal dieser Kernstrahlung zu unterstellen. Um daher dem Dilemma der erklärten Unzuständigkeit für das was er im Metier tut, zu entgehen, möchte der Autor sein Forschungsgebiet nicht der Biologie unterstellen, sondern ausdrücklich der Siedlungsphysik und der Physik des Lebens. Nur so kann man vielleicht polemischem Hader entgehen und sich umso eher der erhofften ´Kritik mit physikalischen Mitteln´ stellen. Trotzdem lädt er ausdrücklich Biologen und Forstwissenschaftler ein, seinen Gedankengängen und Interpretationen zur „Neutronotropie“ zu folgen. Er ist sich zudem sicher, dass gerade die zahllosen unbedarften Naturfreunde unter uns die neue Sichtweise in diesem Buch ungeachtet naturwissenschaftlicher Dispute mit Interesse zur Kenntnis nehmen und zumindest ab sofort das Erscheinungsbild des Baumes völlig anders oder bewusster als bisher erfassen werden.
Bild 1.1: W. Friedt von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft scheint den möglichen Strahlenschäden von Pflanzen sehr viel mehr zuzumuten als man es offenbar in den einschlägigen Wissenschaften wahr haben möchte.
2. Das freie Neutron - ein kurzer Exkurs durch die Physik- und Kulturgeschichte
Die Idee ist hier, einige Begebenheiten, Weisheiten und Leitsätze aufzugreifen und zu kommentieren, die dem freien Neutron gewidmet worden sind. Selbstverständlich bleibt es nur bei einer Auswahl.
Es ist nicht lange her, da rangen die Physiker noch um das Verständnis des Atomkerns, von dessen Existenz sie inzwischen überzeugt waren. Denn wie ist es möglich, dass sich die positiv geladenen Protonen im Kern nicht abstoßen? Welche Kräfte halten zusammen, welche stoßen ab? Das waren damals wirklich wichtige Fragen. Ernest Rutherford postulierte zwar bereits im Jahr 1920 ein vermittelndes neutrales Kernteilchen2.1), doch da war die Struktur des Atomkerns noch umstritten und experimentelle Nachweise fehlten weitgehend. Ausgerechnet der unscheinbare Beryllium-Atomkern, dem nach späterer Erkenntnis so manches natürlich-freie Neutron tatsächlich sein kurzes Leben verdankt, verführte zudem die deutschen Physiker im Jahr 1930 zu einer für sie ruhmschwächenden Fehlinterpretation: Aber sie hatten doch zumindest schon seinerzeit das Neutron anhand seiner Wirkung definitiv im Visier!
Selbst der eigentliche Entdecker, James Chadwick, war zwei Jahre später noch ziemlich verunsichert, wie wir gemäß Abschnitt 1 wissen. Es ist daraufhin dennoch ein naturwissenschaftlicher Dammbruch erfolgt, und trotz des schier Unmöglichen erwuchs aus dem winzigen Kernteilchen ein Wirkungsriese, der insbesondere die Physik noch heute bis in die Grundfesten beschäftigt. Bald reifte freilich die Erkenntnis, dass sich dieses Neutron und das Proton, sein Partner im Atomkern, ihrerseits aus Quarks-Elementarteilchen zusammensetzen, die sich mit einer ungeheuren Bindungsenergie aneinanderklammern: Die Starke Kernkraft - neben der Gravitation und der elektromagnetischen die dritte Grundkraft der Natur - geriet nun in den Fokus der Physik. Und wieder entschlüpfte das elektrisch neutrale Ding sprichwörtlich durch ein Schlüsselloch dieser Disziplin bis diese die Lösung in der Gleichung seines sogenannten Beta-Minus-Zerfalls (ß--Zerfall) fand, denn das Neutron in gewissen instabilen Kernen wandelt sich letztlich spontan in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino um. Inzwischen steht aber fast alles fest, und man weiß sogar, dass Neutronen diesem ß--Zerfall nicht nur gelegentlich im angedeuteten Bindungszustand, sondern gerade auch in der Freiheit unterliegen, siehe Abschnitt 5. Dort, also auch in der Biosphäre, haben sie allerdings nur eine Lebensdauer von ca. 15 Minuten2.2). Und fast nebenbei kam man so der verantwortlichen vierten Grundkraft der Physik, der Schwachen Kernkraft, auf die Spur. Außerdem erkannte man, dass Neutronen doch einer elektromagnetischen Wechselwirkung unterliegen und somit elektronische Wirkungsquerschnitte aufweisen, denn sie haben ein magnetisches Moment (μn)2.3), was ihren Quarks zuzuschreiben ist. Diese Eigenschaft in Verbindung mit ihrer Ladungsneutralität nach außen macht die freien Neutronen z.B. in Konkurrenz mit Röntgen- und Elektronenstrahlen in der Materialstruktur-Diagnostik einzigartig2.4, 2.5), denn ihr μn korrespondiert auch mit den Elektronen der Atomhüllen. Jene kombinierte Wechselwirkung mit Bindungselektronen und mit Atomkernen ist infolge der zum Teil sehr großen Wirkungsquerschnitte vielleicht zudem die eigentliche Existenzgrundlage biologischer Materie, indem sie deren strukturelle Stabilität und die Lebensdauer vielleicht entscheidend bestimmt, siehe unten.
Wenn wir auf die Waage treten, so wissen wir heute als gebildete Menschen, dass etwa 50 % des angezeigten Gewichts die in den Atomkernen gebundenen Neutronen leisten. Sie sind für uns unverzichtbar, unschädlich und halten sogar als Bindungspartner der Protonen unseren Feuertod im Krematorium aus, denn die atomaren Kernkräfte sind so unvergleichlich viel stärker als die elektromagnetische Coulomb-Kraft, die der Flamme zugrunde liegt.
Völlig anders sind dagegen die freien Neutronen einzuordnen, um die es im vorliegenden Buch geht: Wir werden unterscheiden kosmische Sekundärneutronen (nSek) und terrestrische Geoneutronen (nGeo). Die freien Neutronen gewannen seinerzeit so schnell an Popularität, dass der Schweizer Professor der Physiologischen Chemie, J. F. Miescher2.5), schon im Jahr 1947 seinen missverständlichen Beitrag „Das Neutronengas“ mit dem Satz „Das Neutronengas, das man auch das Element Null nennen kann, ist etwas außerordentlich interessantes.“ einleitete. Ganz klar, ihn und die übrige damalige physikalische Laienschaft faszinierte die Kernenergie: „… so sind diese Neutronengasfabriken zugleich technisch interessante Wärmequellen.“ O Gott, der ahnungslose Miescher rührte unbedarft am Thema der Kernkraftwerke (seit 1954) und hatte offenbar noch keine richtige Vorstellung von den radioaktiven Auswirkungen der schon vor Jahren über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben. Gerade dies müsste ihm nämlich zu denken gegeben haben, denn er war doch von Hause aus Mediziner! Nun, seine Kollegen unterschätzen wohl heute noch - auf Kosten der Gesundheit ihrer Patienten - die Kernkraft bei niedrigen Strahlungsdosen.
Einiges änderte sich freilich in den nächsten 20 Jahren nach dem phantasiegeladenen Ausflug J. F. Miescher`s. Ausdruck dessen ist zum Beispiel die Tatsache, dass der gesellschaftskritische Journalist A. A. Guha im Jahr 1977 - mitten im Kalten Krieg - seine berühmte Buchüberschrift „Die Neutronenbombe oder Die Perversion menschlichen Denkens“2.6) wählte. Dazu animierte ihn das inzwischen nicht nur unter Spezialisten verbreitete Wissen, wonach Neutronen mineralische Stoffe, wie Bausteine und Beton sowie sogar Stahl und Blei quasi zerstörungsfrei durchdringen, jedoch Menschen, die sich dahinter verbergen, töten können. Als man dies erfuhr, ist man damals sehr erschrocken, und das mysteriöse freie Neutron geriet einerseits auf den Index des Bösartigen, drang aber auch als lebensfeindliches Agens endgültig in das Bewusstsein der Menschheit ein. Es gibt jedoch aus dem medizinischen Umfeld zumindest für bestimmte Tumorerkrankungen auch scheinbar gute Nachrichten, denn „Neutronen haben sich bei der Behandlung … im nationalen und internationalen Vergleich mit anderen Strahlenarten als deutlich effektiver erwiesen, so dass etwa 15 % der radioonkologischen Patienten von der Neutronentherapie profitieren konnten.“2.7). Dieser positive Schein trügt aber, denn schließlich beruht ja das Verfahren auf der Zerstörung von Zellen mit Neutronen, denen der Unterschied bösartig/gutartig allfällig völlig gleichgültig ist! Daher bleibt die Neutronen-Therapie weiter umstritten. In neueren Veröffentlichungen der biophysikalischen Forschung und der Neutronen-Tumortherapie fielen nämlich inzwischen nicht weniger beunruhigende Sätze aus der Feder von Physikern auf, die das Grauen des A. A. Guha noch viel verständlicher machen:
* “Schon eine einzige Einfangreaktion beschädigt die Desoxyribonukleinsäure im Zellkern so stark, dass die Zelle abstirbt.“2.8)
* “Ein Photon (Röntgenstrahl) führt in der Zelle zu einer sehr lockeren Ionisation. Ein Neutron verursacht dagegen im Zellkern sehr viele, dichte Ionisationspunkte und damit auch mehr Schäden.“2.9)
* “Im Vergleich zu konventionellen Strahlen - gemeint sind Röntgen- und Gammastrahlungen - erzeugen Neutronen wesentlich mehr nicht oder schwer reparierbare DNS-Veränderungen (Doppelstrangbrüche).“2.10)
Es kam die Erkenntnis hinzu, dass die Zellfusion2.11) „auch durch Neutronen beeinflusst werden kann, die in der Erdkruste generiert werden“2.12). Das ist vor allem für Embryonen eine tödliche Gefahr. Um dieses lebenswichtige Phänomen zu verstehen, muss man sich einmal das biophysikalische Geschehen in einer lebenden Zelle wie folgt vergegenwärtigen: Das „elektronisch“ regierte Leben existiert in dem thermischen Fenster zwischen etwa -60o und +42o Celsius (wir schränken absichtlich etwas ein). Das entspricht etwa dem schmalen Energieband von 0,02 bis 0,03 eV, in dem sich die molekularen Bindungs-, Transport- und Massenaustausch-Prozesse abspielen. Bei zu niedrigen Temperaturen stoppen die Mechanismen der Zellteilung und des Wachstums. Um dies jedoch im mittleren Energiebereich zu ermöglichen, sind Massen- und vor allem Energieeinträge gleicher Größenordnung aus der Umgebung notwendig2.13). Wie wir später noch erfahren werden, siehe Abschnitt 5, befinden sich die meisten freien Neutronen in der Biosphäre durch die sogenannte Thermalisierung energetisch gerade in diesem Zustand. So kann man behaupten, dass diese Neutronen - die ja auch ständig in die Zellen gelangen - für die zellularen Lebensprozesse sogar notwendig sind, indem sie zwar infolge der Elektron-Neutron-Wechselwirkung schädliche Anregungszustände erzeugen oder Moleküle zerstören, jedoch gerade dadurch die so wichtigen molekularen Reparaturmechanismen stimulieren. Es sind nämlich auch die viel energiereicheren, nicht thermalisierten Teilchen aus irdischen Quellen und der nSek der Kosmischen Strahlung (KS) mit einem hohen molekularen Schadenspotential der Kernwechselwirkungen beteiligt. Denn was sind schon Bindungszustände im Niveau um 1 eV gegen die kinetische Energie von 1.000.000 eV-Geschossen? Wenn jedenfalls die Reparatur der scharenweise angeregten und/oder zerstörten Moleküle nicht sofort erfolgt, kommt es unweigerlich zur Zellzerstörung und zu degenerativen Folgen.
Seit geraumer Zeit baut man ein die Erde umspannendes System von Bodenstationen zur Messung der nSek als erdgebundenem Maß der KS auf. Es trägt den Namen Cosmic Ray Neutron Monitor (CRNM) System2.14) - in Europa als EU FP7-Förderprogramm unter www.nmdb.eu zugänglich - siehe Bild 2.1. Der Autor nutzt in der Regel die Echtzeitwerte der Bodenstation in Oulu/Finnland.
Bild 2.1: Das CRNM-System ist ein globales Netzwerk zur Messung der Sekundärneutronen am Boden, womit man erdgebunden die relative Intensität der Kosmischen Strahlung bestimmt.2.14)
Die Daten im Minutentakt sind im Internet verfügbar, und jeder kann mit ihnen Forschung betreiben. So gilt zumindest nach den Worten überzeugter Astrophysiker, dass man bedrohliches „Weltraum-Wetter durch die Analyse der Verteilung thermischer Neutronen auf derErdoberfläche“ vorhersagen könne2.15). Es heißt zudem, dass auch die Prognose von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Bergrutschen, Schlammlawinen u.s.w. aussichtsreich sei, weil solchen Naturereignissen quasi als Vorwarnung irdische Neutronenschauer vorausgehen2.16).
Das CRNM-System rief unter anderem die sogenannten Weltraum-Mediziner auf den Plan, die damit bedrohliche Zusammenhänge der KS z.B. mit Todesfällen, Herzkrankheiten und schweren Missbildungen untersuchten. Anfangs betrachteten sie dies noch als extraterrestrische Korrelation, doch dann erhärtete sich der Verdacht, dass nicht kosmische Strahlungsparameter an sich, sondern ihre terrestrischen Folgeprodukte in Form der nSek und nGeo dafür verantwortlich sind2.17, 2.18). (Das nGeo-Symbol wird hier ausnahmsweise als kurzgefasste Bezeichnung der Geoneutronen und formelmäßig als ihre Raumdichte verwendet.) Deshalb wollen sich offenbar immer weniger Leute, die durch die Ereignisse in Tschernobyl und Fukushima geschockt sind, auf die Baustoffe Wasser und Beton verlassen, womit man Neutronen daran zu hindern sucht, aus der Reaktorhölle in die Umwelt zu gelangen2.19). Es ist sogar so, dass ständig mehr Kernkraftgegner darauf drängen, die ominösen „Neutronengasfabriken“ des J. F. Miescher ganz abzustellen. Sollte dies weltweit tatsächlich gelingen, so würde erstmals in der Menschheitsgeschichte das freie Neutron einen Teilrückzug antreten müssen. Der Autor glaubt jedoch nicht daran, dass es in der Biosphäre ausstirbt, und hofft auch nicht auf einen Todesstoß im technischen Anwendungssinne, denn es träfe ausgerechnet Forschungsfavoriten der modernen Physik, was auch den Fortschritt der Hochtechnologien, ja der ganzen Menschheit entscheidend bremsen könnte. Ehrlicherweise sei allerdings mit Hinweis auf Abschnitt 5 festgehalten, dass sich die vordersten Fronten der Experimentalphysik ebenfalls - und das ziemlich kostenaufwändig - mit dem Störfaktor „freies Neutron“ herumschlagen, indem sich Laboratorien bereits 4.000 m ins Innere der Erde verkriechen müssen, um einen akzeptabel niedrigen neutronogenen Rauschhintergrund zu erzielen. In vielen Fällen fundamentaler Physik-Experimente (z.B. Nachweis Dunkler Materie) sind nämlich tatsächlich „Neutronen die wichtigste rauschinduzierende Störquelle“2.20).
Es wäre allerdings vollkommen falsch verstanden, wenn man den freien Neutronen in der Physik nur den Status des Störenfriedes zuordnen wollte. Vielmehr gelten sie an anderer Stelle als wahre Segensbringer. Man denke nur an die bereits benannte Neutronen-Strukturdiagnostik von wissenschaftlichen, technologischen, biologischen und medizinischen Objekten. Sobald es um biologische Materie geht, kommt nämlich der Wasserstoff mit seinen vielfältigen molekularen Beziehungen sprichwörtlich in den Fokus. Nachdem man die besondere Rolle des freien Neutrons als empfindliche und hochauflösende Sonde für leichte Kerne (eben z.B. Wasserstoff!) erkannte, begann in Konkurrenz zum Elektronenmikroskop die Entwicklung des Neutronenmikroskops, was sich zwar als ein äußerst schwieriges Projekt herausstellte. Es waren dann jedoch deutsche, dänische und amerikanische Physiker2.21, 2.22), die in den Jahren 1985 und 1998 erstmals über Erfolge berichten konnten. Bezüglich irdisch-technischer Szenarien klang es fast wie eine Vermenschlichung, als der Universitäts-Professor und damalige Leiter des Physik-Instituts an der Universität Leuben, Friedemar Kuchar, im Jahr 1998 zur Feder griff und einen Review-Beitrag mit „Neutronen - Die Alchimisten der Halbleitertechnik“ überschrieb2.23). Er hatte immerhin das Recht auf seiner Seite, denn was wäre heute die Halbleitertechnik ohne das Dotierungsvermögen der Neutronen, die bei Beschuss von Werkstoffen im Inneren Atome nach gewissen Kernreaktionsregeln umwandeln, so dass daraus erst die wirklich brauchbaren Halbleiter entstehen? Leider stänkert selbst in dieser Branche vorerst das freie Neutron in bedenklicher Weise. Alle Mikroelektroniker und Computerexperten wurden nämlich alarmiert als in den Jahren um 2004 die Nachricht endgültig auf die Weltreise ging, wonach im Zuge der fortgeschrittenen Miniaturisierung „terrestrische Neutronen die Hauptursache für ´sigle event upsets´- sprich Software-Fehler - der Mikroelektronik geworden sind“2.24).
Angesichts solcher Überschriften wie „Die Erfolgsgeschichte eines Spaltprodukts“2.25) und „Das freie Neutron - Geschenk der Natur“ in einer Präsentation der Internet-Plattform `Welt der Physik`2.26) werden jedoch Physik und Technik sicher auch dieses Problem überwinden, indem sie neue, bessere Technologien entwickeln. Es sind ja auch längst Monde und Planeten nicht nur im Visier des Neutronen-Teleskops, wie zum Beispiel in der Raumstation ISS installiert2.27). Ein solches Gerät ist übrigens nicht im Sinne optischer Teleskope zu verstehen, sondern es dient der richtungsabhängigen, spektralen Registrierung freier Neutronen. Man hat damit die Möglichkeit, die von der Erde oder von anderen Himmelskörpern zurück gestreuten Neutronen im Orbit zu untersuchen. So sorgen sich Visionäre unter anderem um die lebensfeindlichen Bedingungen, die die Raumfahrer zum Beispiel auf dem Mars erwarten. Es bewegt u.a. die bange Frage nach der dort herrschenden Kernstrahlung (insbesondere Neutronen2.28)), wobei der Untersuchung des dortigen Aufkommens langsamer Neutronen vorerst positive Bedeutung im doppelten Sinne zukommt. Während nämlich die Menschheit nicht nur mit den Wasserressourcen an ihre Grenzen stößt, hält sie Ausschau nach einem interplanetaren Ausweg, und dies unter dem faszinierenden Deckmantel der Frage „Gibt es außerirdisches Leben?“. Jedenfalls wurde diese den Mars betreffende Diskussion entsprechend dem Motto `Wasser ist Leben` entscheidend befeuert, während die Physiker auf eine kuriose Idee kamen: „Fragen wir doch die freien Neutronen!“ Das dafür von der KS geschaffene Szenario - siehe Bild 2.2 - spielt sich ja vor ihren Augen schon länger auch auf der Erde ab. Fehlende bzw. dünne Atmosphären machen es auf gewissen Monden und Planeten sogar möglich, dass Teilchen der Kosmischen Strahlung in die lunare bzw. planetare Materie direkt eindringen und dort schnelle Neutronen und γ-Strahlung freisetzen. Vor allem die im Boden des Himmelskörpers verlangsamten (moderierten) Neutronen werden per Einfangreaktion in Wasserstoff-Atomkernen absorbiert bzw. γ-Quanten nehmen charakteristische Energien an. Wenn also Wasser oder Eis vorliegen, gibt es weniger zurückgestreute Neutronen bzw. die energiespezifische γ-Strahlung, was man mit empfindlichen, eigens dafür in den Raumsonden installierten Messgeräten registriert. Aus den gescannten Messdaten errechnet abschließend der Computer Bilder mit beliebiger Farbzuordnung. Mit solchen Konzepten wurden bereits einige Raumsonden (u.a. Mondsonde „Prospector“, 19982.29); Marssonde „Odyssey“, 20012.30)) ausgestattet, und man erhielt endlich Gewissheit vom außerirdischen Wasser, vor allem dank der Neutronen!
Bild 2.2: Nachweise von Wassereis auf Mond und Mars u.a. mit Hilfe von Neutronen- und γ-Strahlung2.29, 2.30)
Und da wir inzwischen auf der Spur des Neutrons im Weltraum angekommen sind, sei an die Neutronensterne erinnert. Sie bestehen tatsächlich im Wesentlichen aus Neutronen und sind das sagenhafte Produkt der größten kosmischen Katastrophen, die wir kennen, den Nova-Explosionen und der Entstehung Schwarzer Löcher. In den Neutronensternen sind die Neutronen zwar alles andere als frei, doch halten sie die theoretisch und die experimentell arbeitenden Teilchen- und Astrophysiker in Atem, weil sich diese Teilchen im Inneren des rätselhaften Objekts womöglich in einem Quarks-Gluonen-Plasma auflösen. Dies legte erstmals eine Team-Veröffentlichung von 55 Physikern nahe, deren Überschrift allerdings einmal mehr mit einem Fragezeichen versehen war: „Quarks gluon plasma and color glass condensate at RHIC?“2.31). (Die Buchstaben RHIC bedeuten übersetzt „Beschleunigerring für relativistische Schwerionen“.) Damit sind wir fast beim Urknall angekommen, denn auch mit dem RHIC hofft man, per entsprechender Simulation der Geburt des Weltalls wieder ein Stück näher zu kommen. Und wieder sind die Neutronen dabei, und zwar diesmal mit gewaltigen Energien … oder nur in Form ihrer winzigen Quarks-Bestandteile.
Man kann somit getrost den freien Neutronen in vieler Hinsicht ein besonderes Zukunftspotential zuordnen. Dafür steht allein in Deutschland das ständige Komitee Forschung mit Neutronen, welches alle Wissenschaftler in der Bundesrepublik vertritt, die mit Neutronen arbeiten oder die der Forschung mittels Neutronen nahestehen.
3. Neutronen-Signale, die keiner verstehen will
Als L. D. Hendrick und R. D. Edge im Jahr 1966 in der renommierten Zeitschrift Physical Review den Satz (übersetzt vom Autor) „Sie sind hervorragend für solche Umweltstudien geeignet, wie die Untersuchung des Einflusses der Kosmischen Strahlung auf Pflanzen und Tiere, …“3.1) Meinten sie vielleicht die kosmischen Sekundärneutronen? Dies ist wohl tatsächlich ein zarter Hinweis auf mögliche neuartige Wirkungen freier Neutronen in der Biosphäre gewesen. Es kam aber in den folgenden Jahrzehnten zu keinem Andrang der einschlägigen Wissenschaftler, doch stellten immerhin um das Jahr 2009 britische Forstfachleute etwas fest3.2), was in den Medien wie folgt kolportiert worden ist (Übersetzungen des Autors): „The growth of British trees appears to follow a cosmic pattern, with trees growing faster when high levels of cosmic radiation arrive from space.“ (Das Wachstum britischer Bäume scheint ein kosmisches Phänomen abzubilden, wonach Bäume schneller wachsen, wenn höhere Pegel der Kosmischen Strahlung aus dem Weltraum anstehen.). An anderer Stelle heißt es3.3): „When the intensity of cosmic rays reaching the Earth’s surface was higher, the rate of tree growth was faster.“ (Wenn die kosmische Strahlungsintensität ansteigt, die die Erdoberfläche erreicht, nimmt die Wachstumsrate der Bäume zu.). Das hätte doch unter anderem eine bedeutsame forstwirtschaftliche Dimension3.4), denn man bedenke, welcher Forschungsaufwand betrieben wird, um im Wald die Erträge oder Qualitäten um Prozentbruchteile zu verbessern! Wohl auch infolge der unglückseligen n-Niedrigdosis-Diskussion und des aktuellen CO2-Syndroms im Zusammenhang mit der Erderwärmung wandte sich das Interesse der Umweltforscher und Ökologen trotzdem komplett völlig anderen Schwerpunkten zu. Dies könnte ein folgenschwerer Bewertungsfehler sein, denn die KS in Verbindung mit der Sonnenaktivität meldet sich immer wieder zurück, und zwar vor allem in ihrer Schicksalsgemeinschaft mit den freien Neutronen und dem Leben in der Biosphäre. Oder glaubt jemand, es seien nur englische Bäume betroffen? Die beobachtete Wuchskraftverstärkung der Bäume könnte zum Beispiel konform mit einem Ergebnis sein, dessen eigentlicher Forschungsansatz lediglich thermisch geartet war. Die australische Biologin Melanie Harsch3.5) interessierte sich im Zusammenhang mit der Erderwärmung für den Fortschritt bzw. Rückschritt von Baumpopulationen im Bereich der sogenannten Treelines (Baumgrenzen). Das sind extrem temperaturempfindliche Übergangszonen der Vegetation, die sich verständlicherweise in den polar- bzw. hochgebirgsnahen Regionen konzentrieren. Vergleicht man freilich die Fortschritt-Ja-Nein-Bewertung in ihrer Schlussübersicht aus dem Jahr 2009 gemäß Bild 3.1 mit den terrestrischen Schwerpunkten der KS (gemessen im erdnahen Orbit als Integraler Elektronen-Fluss in 380 km Höhe3.6)), so fällt eine bemerkenswerte Übereinstimmung auf. M. Harsch interpretierte dies - trotz systemischer Schwierigkeiten - natürlich als Temperatureffekt, doch drängt sich dem Autor eine völlig andere Erklärung auf, wobei er an die britischen Beobachtungen anknüpft und eigenen hier vorgreift. Wie nämlich im vorliegenden Buch klar herausgearbeitet werden wird, besteht der Hauptanteil der biologisch relevanten, galaktischen Teilchenstrahlung am Erdboden aus Sekundärneutronen. Ihre Flussdichte in der Atmosphäre wächst überproportional mit der Höhe über Normalhöhennull und generell in Polrichtung. Insofern korreliert das Forschungsergebnis von M. Harsch, siehe Bild 3.1, hervorragend mit der englischen Baumwuchsthese. Man sollte übrigens bei der Analyse des unteren Teilbildes nicht nur das Augenmerk auf die Übereinstimmung (rote/helle Ja-Punkte) lenken - und dabei die Hochgebirgslagen (Rocky Montains, Alpen, Himalaja, mittelasiatische Hochgebirge) beachten - sondern gerade auch die blauen/dunklen Nein-Punkte ins Blickfeld rücken: Sie befinden sich nämlich mehrheitlich in Treelines-Gebieten (Mittel-Nordamerika, West-Südamerika, Mittelmeer-Region) mit den niedrigsten n-Flussdichten gemäß dem oberen Teilbild!
Nun ist es das Anliegen des Autors, genau solche Wuchsphänomene anhand der Bäume, den größten Landlebewesen, weiter aufzuhellen. Aber … in den Jahrzehnten privater Forschung lernte er, dass man Neuland nur allein betreten kann. Vielleicht ist das aber auch gut so, denn wenn das Eis bricht, sind wenigstens keine Unschuldigen betroffen. So ähnlich mag es jedenfalls anfangs auch dem dänischen Physiker Henrik Svensmark ergangen sein, der den Zusammenhang zwischen der KS und der terrestrischen Wolkenbildung entdeckte3.7). Grundlage dieser Feststellung sind die beobachteten engen Korrelationen zwischen KS-Intensität - bestimmt anhand des Neutronenflusses in der Biosphäre - und den Wolkenbedeckungsgraden, gemessen von Satelliten aus. Da H. Svensmark dadurch andere, physikalisch plausiblere Ursachen der Erderwärmung erkannte als es die schon seit Jahren eingespielte CO2-Lobby wahrhaben möchte, geriet er schnell in Ungnade und muss bis heute - außer in Dänemark - um die internationale Anerkennung seiner Arbeiten bangen. Der volkswirtschaftliche Schaden der allein dem CO2 in diesem Fall zu Unrecht geschuldeten Investitionen wäre sicherlich weltweit beträchtlich, falls er eines Tages Recht bekommen sollte.
Bild 3.1: Protonen und Elektronen sind Bestandteile der galaktischen und extragalaktischen KS, die man jenseits der Erdatmosphäre mit Raumsonden registriert3.6), oberes Teilbild. Infolge ihrer extrem hohen kinetischen Energie werden natürlich jene erdnahen (Orbihöhe ca. 380 km!) Elektronen nicht mehr vom Erdmagnetfeld weit abgelenkt, sondern schlagen annähernd dort in die Erdatmosphäre, wo sie im Orbit registriert werden, wo sie biologisch relevante Sekundärteilchen-Kaskaden auslösen, unteres Teilbild3.5).
Als der Autor seinerseits glaubte, mit seinen Forschungsergebnissen zur Korrelation der freien Neutronen und des Baumwachstums in der Biosphäre an die fachliche Öffentlichkeit treten zu müssen, machte auch er eigene, böse Erfahrungen. Dabei ging er - mit den ohnehin üblichen Handicaps des privaten Forschers - konventionell vor, also zunächst persönliche Vorstellung bei Baum- und Forstfachleuten mit Vorschlägen zur Zusammenarbeit sowie Vorträge vor Fachgremien. Symptomatisch für den negativen Ausgang dieser Initiativen ist eine nachträgliche schriftliche Äußerung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland nach einem einschlägigen Vortrag, den der Autor vor einer Gruppe mittelsächsischer Mitglieder gehalten hat: Es gäbe Dinge, die „nicht sein können“ (wörtliches Zitat), sagen wir daher gleich, „weil sie nicht sein dürfen“.
Schließlich schlugen - mit wenigen Ausnahmen - Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften fehl, indem der Druck der eingereichten Beiträge regelmäßig abgelehnt worden ist. Auch die redlichen Bemühungen, an Forschungsfördermittel heran zu kommen, scheiterten letztendlich alle. Immerhin richtete sich der erste Projektantrag im Jahr 2001 aus naheliegenden Gründen an das damalige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (siehe Bild 3.2).
Symptomatisch für einige Versuche, Fördertöpfe bei Organisationen zu öffnen, die selbst Spenden einfordern, um naturwissenschaftliche Forschung zu unterstützen, ist zudem die abschlägige Reaktion der Karl-und-Veronica-Carstens-Stiftung im Stifterverband für Deutsche Wissenschaft (Bild 3.3). Diese Stiftung setzte ihren Schwerpunkt angeblich gerade auf die Förderung alternativer Forschungsansätze und warb immerhin um Spenden mit dem folgenden Satz: „Mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden an die Carstens-Stiftung: Natur und Medizin werden wichtige Forschungsprojekte finanziert, für die kein Geld der öffentlichen Hand bereitsteht.“
Wichtiger als die Meinung sogenannter Experten, die über die Grenzen ihres Fachgebietes nicht hinausschauen können, oder konservativer Beratungsgremien von Fachzeitschriften war dem Autor selbstverständlich eine gerätetechnische Aufrüstung. Die eigenen verfügbaren Mittel werden im Buch noch zur Sprache kommen, doch scheitert man in der physikalischen Forschung - zumal wenn es um Feldmessungen (also nicht im Labor) von Neutronen geht - schnell an solchen Kenngrößen wie Empfindlichkeit und Ortsauflösung. Daher wandte sich der Autor schon im Jahr 1997 an jene, die ausgezeichnete Messgeräte entwickelten bzw. herstellten.
Bild 3.2: Absage des Bundesministeriums
Bild 3.3: Absage der Karl und Veronica Carstens-Stiftung
An erster Stelle - im Weltmaßstab (!) - stand damals EG&G Berthold und steht heute die Firma Berthold Technologies GmbH & Co.KG. Ihr Angebot auf Nachfrage vom 27. Oktober 1997 war bezüglich der Eignung verlockend, doch kostenmäßig für den Autor einfach nicht tragbar. Leider war auch keine Geräteausleihe möglich. So suchte der Autor andere Stellen auf, und zwar in der Hoffnung auf Leihgeräte und/oder Projektpartnerschaft. Mit diesen Zielstellungen wurden nacheinander in den Jahren 2003 und 2004 - wenn auch leider erneut vergeblich - das Forschungszentrum Jülich GmbH (Bild 3.4) sowie die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB; Bilder 3.5 und 3.6) in Braunschweig kontaktiert. In Jülich kam es wenigstens auf Initiative von Herrn Professor J. Schelten nach einer Projektabstimmung (Anpassung eines vorhandenen Messgerätes) am Vortag zu einem Vortrag am 18. November 2003 mit dem Thema „Beobachtungen und Wirkungen von natürlicher terrestrischer Neutronenstrahlung“ vor ca. 40 Physikern und anderen Fachleuten, der jedoch mit einem merkwürdigen Eklat endete: Es gab keinen Beifall und auch kein Missfallen, sondern Totenstille im Saal! Als sich dann eine graue Eminenz in der vordersten Reihe plötzlich erhob und zum Ausgang ging, folgten ihr wortlos alle anderen, außer dem Diskussionsleiter Schelten. Also jämmerlich durchgefallen, und die Begründung kam mit der Post.
Wie also gemäß persönlichem Erleben einschlägige „wissenschaftliche“ Kommunikation in Deutschland funktioniert, wenn sich das Thema um unerwünschte Dinge dreht, möge die vorgestellte Dokument-Auswahl chronologisch mit Kurzkommentaren belegen.
Kommentare des Autors zu den vorgestellten Dokumenten:
Zu Bild 3.2
Mit Verlaub, Herr Dr. Meurin, von Geld war doch noch keine Rede.
Zu Bild 3.4
He, he, Herr Professor Schelten, ganz so „wild“ sind die Messdaten ja auch nicht gerade gewesen, standen doch dem Autor inzwischen seriöse Messgeräte zur Verfügung! Und phantasievolle physikalische Modelle, die natürlich der experimentellen Verifikation bedürfen, waren immer und sind auch heute noch notwendiger Usus in der Physik.
Bild 3.4: Absage des Forschungszentrums Jülich
Bild 3.5a: Antrag zur messtechnischen Unterstützung des Autors bei der PTB
Bild 3.5b: Antrag zur messtechnischen Unterstützung des Autors bei der PTB
Bild 3.6: Absage der PTB Braunschweig
Die Mission in Jülich sollte ja zudem gerade dazu dienen, mit besseren messtechnischen Voraussetzungen weiter zu machen. Es wird wohl eher die mögliche Schande im „Stadtpark“ gewesen sein, wenn die vermeintlich gemeinsame Sache schiefgegangen wäre.
Zu Bild 3.5
Der zweite Versuch, messtechnische Unterstützung zu bekommen, endete nicht weniger erfreulich, wie der Auszug aus dem Ablehnungsschreiben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig vom 1. August 2005 belegt (tatsächlich, fast ein Jahr später!). Aber, aber, Herr Professor Klein, von wegen „bisher unbekannte natürliche Neutronenstrahlung“!
Zu Bild 3.6
Mit der in 13 Folgejahren angehäuften „Weisheit“ kann der Autor zudem beim wiederholten Durchlesen seines damaligen Antrages die Begriffe „nebulös und wirr“ überhaupt nicht einordnen, zumal er beispielsweise mit entsprechenden „Vorhabenspunkten“ des Forschungsprogramms der Bundesrepublik Deutschland zum Strahlenschutz für den Zeitraum 2013 bis 2017 vergleichen kann:
„Wirkung und Risiko ionisierender Strahlung
Das Ziel ist die Bewertung gesundheitlicher Risiken des Menschen durch ionisierende Strahlung. … Im Fokus stehen neben Krebserkrankungen zukünftig auch Nicht-Krebserkrankungen in dem für den Strahlenschutz relevanten Niedrig-Dosis-Bereich.
Strahlenschutz bei natürlicher Radioaktivität
Der Mensch lebt seit jeher in einer strahlenden Umwelt. Mehr als die Hälfte der jährlichen Dosis der Bevölkerung Deutschlands beruht auf ionisierender Strahlung natürlichen Ursprungs. … Solche Situationen müssen aus Sicht des Strahlenschutzes bewertet werden. …
Überwachung und Bewertung der Umweltradioakivität
Die wesentliche Grundlage hierfür bilden die durch Messnetze zur Überwachung der Umweltradioaktivität gewonnenen Daten. Darauf aufbauend sind fachliche Empfehlungen zu erarbeiten und die gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. …“
Wo ist da ein qualitativer Unterschied zu den eigenen damaligen Arbeitsthesen gemäß Bild 3.5?
Ungeachtet dieser Rückschläge lief das „Schauspiel“ mit den Fachmedien. Ein am 8. Dezember 1997 als "Scientific Correspondence" entsprechend kurzer, bei der Zeitschrift Nature in London eingereichter Beitrag wurde aus „Platzmangel“ abgelehnt. Damit scheiterte der Versuch, Erstrechte einer vermeintlichen Entdeckung zu sichern. Über nGeo-Strahlen im natürlichen terrestrischen Neutronenfeld hat ja zum Beispiel bis heute - wir schreiben das Jahr 2018 - wirklich noch niemand berichtet. Zumindest kam es zu einer gewissen Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitschrift Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz in den Jahren 19973.8) und 20033.9). Doch leider wurde der weitere eingereichte Aufsatz „Das geophysikalische Standortproblem der Bäume - Gradientenwuchs der Bäume im Feld der Geoneutronen“ mit der Begründung gemäß Bild 3.7 dann doch nicht mehr angenommen.
Immerhin schrieb nach Erscheinen der Beitragsserie der damalige Paläontologe am Institut für Paläontologie & Geobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Professor Alfred Selmeier, dass schon der urzeitliche Bestand jene merkwürdigen Wuchsformen der Bäume, anhand von Versteinerungen nachweisbar, hervorgebracht habe. Der Autor konnte sich persönlich anhand des sogenannten „Versteinerten Waldes“ in Chemnitz davon überzeugen. Es ist dies wahrscheinlich ein wichtiges Indiz, wonach sich die Bäume vom Anfang der Evolution an mit dem natürlichen Kernstrahlungsfeld auseinandersetzen mussten, und dafür stand ihnen ein ungeheurer Zeitraum zur Verfügung. Man muss sich daher - zumal angesichts ihrer Standortfestigkeit und der großen Angriffsfläche - nicht wundern, wenn gerade sie eine entsprechend außergewöhnliche Sensibilität und Reaktionsvielfalt entwickelt haben könnten.
Wir sind allerdings noch immer im Jahr 2003, da der Autor den Beitrag „Neutronotropie - Eine Darstellung anhand des Referenzsystems der Bäume“ zur Veröffentlichung bei der Redaktion der Zeitschrift Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie der Fachhochschule Eberswalde einreichte, doch auch hier bekam er eine fadenscheinige
Bild 3.7: Ablehnung einer Veröffentlichung durch die Redaktion der Zeitschrift Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz
Absage. Irgendwann musste man doch daraufhin klug werden und die Versuche aufgeben, mit Forschungsergebnissen, die keiner haben will, an die offiziell-wissenschaftliche Öffentlichkeit zu treten. Es geschah auch dies in jenen Jahren, natürlich ohne in der Sache irgendetwas aufzuhalten. Vielmehr nutzte der Autor ab sofort für seine Veröffentlichungen nur noch seine Internetseite www.drhdl.de. Seither wird sie monatlich von 500 bis 1.000 Menschen in aller Welt besucht. (Welcher Beitrag in einer gedruckten Fachzeitschrift kann schon so eine Bilanz vorweisen?) Ungeachtet dessen fanden weiterhin Kontaktversuche zu einschlägigen Wissenschaftlern statt. Symptomatisch ist allerdings der negative Ausgang nach einem Gespräch und Informationsaustauch mit Herrn Professor Andreas Roloff vom Lehrstuhl für Forstbotanik, Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt, Technische Universität Dresden. Sein Handbuch für Baumdiagnostik3.10) wird allerdings im vorliegenden Werk noch eine gewisse Rolle spielen. Wir sind allerdings noch immer im Jahr 2003, da der Autor den Beitrag „Neutronotropie - Eine Darstellung anhand des Referenzsystems der Bäume“ zur Veröffentlichung bei der Redaktion der Zeitschrift Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie der Fachhochschule Eberswalde einreichte, doch auch hier bekam er eine fadenscheinige Absage. Irgendwann musste man doch daraufhin klug werden und die Versuche aufgeben, mit Forschungsergebnissen, die keiner haben will, an die offiziell-wissenschaftliche Öffentlichkeit zu treten.
So gesehen wirkt dieser Abschnitt eher wie eine Warnung. Der Autor hat seine Eindrücke in diesem Sinne extra für den Leser aufbereitet, damit er auf das Schlimmste vorbereitet ist. Wenn nämlich so viele Eminenzen anderer Meinung sind, dann muss man sich doch irren, oder? In der Geschichte der Physik ist das doch oft genug passiert. Den Vogel abgeschossen haben dürften freilich Zeitgenossen von Albert Einstein, deren Kritik an der Relativitätstheorie im Jahr 1912 in dem berüchtigten Buch „Hundert Autoren gegen Einstein“3.11) zusammengefasst worden ist. A. Einstein ließ das ungerührt und unkommentiert, zumal nur ein einziger Physiker als Fachkollege in der Broschüre zitiert werden konnte. Immerhin, im Jahr 1931 bemerkte Einstein dann doch noch dazu: „Wenn ich Unrecht hätte, wäre einer genug.“ Sie hatten aber alle Unrecht, denn - wie gesagt - ein Physiker kann sich irren, vor allem wenn er allein dasteht!
4. Biologische Relevanz der natürlichen Neutronenstrahlung
4.1 Ein Streifzug durch den Photonengarten Erde
Während die Anfänge der Biowissenschaften - „Es werde Licht!“ - von Beobachtungen und Systematisierungen geprägt waren, haben auch auf diesem naturwissenschaftlichen Gebiet quantitativ-methodische Beiträge (z.B. physikalische Modelle oder computergestützte Simulation anhand physikalischer Algorithmen) und/oder grundlegende Entdeckungen der Chemie und Physik in neuerer Zeit wesentlich zum Erkenntnisfortschritt beigetragen. Als prominente Physiker, die zur Biologie bahnbrechende Beiträge geleistet haben, seien genannt:
* Max Delbrück, der ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht nur die Biophysik, sondern auch die moderne Genetik begründete und
* Claus Mattheck, der seit den 90er Jahren des 21. Jahrhunderts die Baummechanik einführte.
Aus solchen Erfahrungen heraus setzte sich folgerichtig auch bei biologischen Themen zunehmend die interdisziplinäre Forschung durch. Der Autor muss leider trotzdem feststellen, dass Biologen, Mediziner und Fachleute angrenzender Disziplinen auch heute noch eher „den Kopf einziehen“, wenn man ihnen auch nur mit ungewohnten physikalischen Begriffen kommt. Die Bereitschaft hin zu hören bei entsprechenden neuen Denkansätzen zur Klärung biologischer Fragestellungen schwindet zudem mit der Länge Hände ringender Erklärungsversuche. So gerät man als physikalischer Willderer im Photonengarten Erde schnell und unverdient in die Nähe der Ächtung - wie es Galileo Galilei einst erging - nur dass man heute nicht mit dem Feuertod droht, sondern eher mit dem frustrierenden Satz „Es kann nicht sein, was nicht sein darf!“, siehe Abschnitt 3. Man muss daher kein Philosoph und gleich gar kein Prophet sein, wenn da behauptet wird, dass es der Biologie passieren kann, einst in der Physik aufzugehen. So beschrieb es jedenfalls der Biologe Marcus Anhäuser am 7. November 2009 in scienceblogs.de, denn „Heute stehen oft beide Welten in einem (biologischen) Labor.“ Er meinte ein Forschungsteam, das in einem Laboratorium des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik im Wesentlichen aus Biologen und einigen wenigen Physikern bestand, und er zitierte zudem den einzigen beteiligten Biochemiker Miguel Coelho mit diesen Worten: „Biologen interessieren sich mehr für das allgemeine Verhalten, während Physiker dazu neigen, Details und einzelne Mechanismen zu untersuchen.” So gesehen könnte man ja mit diesen beiden Aussagen noch leben (denn Arbeitsteilung ist das Wesen interdisziplinärer Kooperation), wenn da nicht eine Quintessenz des M. Anhäuser dagegen stünde: „Auch wenn es für einen Physiker einfacher zu sein scheint, sich in die Biologie einzuarbeiten als umgekehrt, gibt es durchaus ein paar Verständigungsprobleme.“
Wie gesagt, der Autor kann aus eigener Erfahrung den letzten Satz nur unterstreichen, zumal man ja auf dem eigenen physikalischen Gebiet im Berufsleben das Beobachten und Systematisieren am Beginn eines jeden Forschungsprojekts von der Pike auf gelernt hat. Wo ist da der grundsätzliche Unterschied im Vorgehen, wenn man etwa die Frage nach den Mechanismen des Wachstums dünner Schichten auf Substraten im Vakuum mit der nach der Bewegungsphysiologie eines Baumes auf dem Erdboden in der Biosphäre vergleicht? Wo so vieles schon bekannt ist (Studium der internationalen, auch der älteren Literatur!), wird man hier wie da tunlichst das Augenmerk auf Besonderheiten („Details“!) lenken müssen, um ins Unbekannte weiter vorzustoßen. Und seien Sie es versichert, werter Leser, am Ende kommt es wirklich auf die „einzelnen Mechanismen“ an!
Heute bewegt man sich ja in der fortgeschrittenen Biologie - nach den frühen Stadien des Makroskopischen und später des Zellularen - immerhin bereits teilweise auf dem makromolekularen Niveau. Biologie und Medizin neigen freilich jetzt, nachdem Jahrzehnte großzügig verschwendet wurden, euphorisch dazu, alles Unerklärliche genetisch, also molekular, zu interpretieren. Nun, wenn das mal kein erneuter Irrweg ist! Man sollte zudem beachten, dass die Physik im Naturverständnis bereits mehrere Erkenntnisebenen weiter vorgedrungen ist.