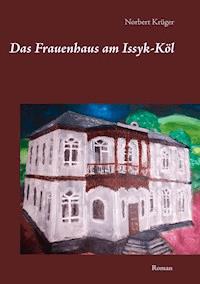Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die französische Studentin Suzanne wird während eines Korfu-Urlaubs vergewaltigt. Als sie merkt, dass ihr Pariser Freundeskreis zunehmend verständnislos auf ihr Trauma reagiert, setzt sie sich ins Ausland ab und wagt in Hamburg einen Neuanfang. Hier lernt sie den Filmkritiker Stephan kennen. Eine komplizierte Beziehung bahnt sich an. Wie erlebt Suzanne die Zeit nach der Vergewaltigung? Welchen Einfluss hat das Trauma auf ihre Beziehung? Und wie reagiert Stephan auf die Mauern, die sie aus Selbstschutz aufgebaut hat? Nur langsam erfährt der Protagonist des Romans, was sich drei Jahre zuvor auf Korfu abgespielt hat. Und er beschließt, auf die Insel zu fahren, um dort nach Antworten zu suchen, die ihm Suzanne nicht geben will oder kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Krüger
Das Ende der Leichtigkeit
Roman
Impressum
Copyright © 2022 bei Norbert Krüger
https://www.norbert-krueger.com
Coverfoto: lunad / pixelio.de
Alle Rechte an Text und Bild vorbehalten. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Autors strafbar. Dies gilt auch für die Vervielfältigung, Übersetzung und die Nutzung in elektronischen Systemen.
Sämtliche Namen, Charaktere und Handlungen sind frei erfunden und reine Fiktion der Autorin. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
„Meine dritte Maxime war, stets zu versuchen, lieber mich zu besiegen als das Schicksal und lieber meine Wünsche als die Ordnung der Welt zu ändern und ganz allgemein mich an die Überzeugung zu gewöhnen, dass nichts gänzlich in unserer Macht steht als unsere Gedanken. Haben wir also betreffs der Dinge, die außer uns sind, einmal unser Bestes getan, so ist alles, was uns an dem vollständigen Gelingen mangelt, für uns unbedingt unmöglich.“
René Descartes
Diskurs über die Methode
Kapitel 1
1
Jener Sommer auf Korfu hatte Suzannes Leben radikal verändert. Etwas war dort geschehen, dessen war Stephan sicher. Er verteilte die Fotos von ihr und der Insel auf dem Wohnzimmertisch. Kurz betrachtete er den verspielten Schnappschuss ihrer nackten Füße im Sand. Auf mehreren Bildern war eine alte Kirche inmitten eines Olivenhains zu sehen. Dann fand er die Großaufnahme eines überfahrenen Hasen.
Auf seine Bitte hin hatte Suzanne die Abzüge am vorigen Nachmittag mitgebracht. Statt sich die Bilder gemeinsam anzusehen, waren sie an der Elbe spazieren gegangen. Suzanne machte sich nicht viel aus Fotos. Sagte sie.
Eine Weile ließ er nun das Kaleidoskop von Urlaubsimpressionen auf sich wirken, das ausgebreitet zwischen einem vollen Aschenbecher und zwei leeren Rotweingläsern vor ihm lag.
Auch ein paar Kinderbilder befanden sich darunter, sowie eine ganze Reihe Aufnahmen von ihr als Twen: Suzanne am Strand. Suzanne am Schreibtisch, rauchend zwischen Stapeln von Büchern. Suzanne in Großaufnahme. Immer wieder dieses abenteuerlustige, unendlich schöne Gesicht. Die leuchtenden Augen, in denen sich das Leben spiegelte. Der volle, rosige Mund, immer zu einem Lachen aufgelegt. Das lange, braune Haar, mal straff zurückgekämmt, mal, wie auf dem Foto am Strand, vom Wind in alle Himmelsrichtungen zerzaust.
Und dann die anderen, neueren Bilder. Diejenigen, die nach dem Griechenlandurlaub entstanden waren. Das verschlossene Gesicht. Die adrette, aber langweilige Kleidung. Die steifen Gesten ohne jeden Hauch von Lebensfreude.
2
Kennengelernt hatte er sie auf einer Fahrt nach Paris. In der Avenue Junot am Montmartre hatte er sich eine kleine Wohnung gemietet: Ein Arbeitsraum und ein Schlafzimmer befanden sich darin. Da er ansonsten nicht viel Geld ausgab, konnte er sich in Hamburg eine zweite Bleibe leisten. In der Genossenschaftswohnung in der Nähe des Fischmarkts hatte er schon als Philosophiestudent gehaust, lange bevor er anfing, für verschiedene Zeitschriften zu arbeiten.
Suzanne hatte seine Telefonnummer von einer Mitfahrzentrale erhalten. An einem Donnerstagabend im April rief sie bei ihm an. Sie wollte am nächsten Morgen möglichst früh nach Paris aufbrechen, eine Vorstellung, die ihm aufs Äußerste missfiel. Er war ein Nachtmensch, dem es nichts ausmachte, bis morgens um sieben über ein Manuskript gebeugt am Schreibtisch zu sitzen, daraufhin die Morgenröte mit einer Schale Milchkaffee zu begrüßen und sich ins Bett zu begeben. Treffen vor elf Uhr waren ihm ein Gräuel. Leute, die solche Termine vorschlugen, ebenso.
Ihre Stimme am Telefon jedoch versöhnte ihn. Suzanne hatte einen leichten Akzent, der sie als Französin entlarvte. Sie sprach in einem ruhigen, fließenden Tonfall mit einem Anflug jener sympathischen Unsicherheit, die seinen Beschützerinstinkt aktivierte und ihn schließlich dazu brachte, sich für sieben Uhr morgens am Altonaer Bahnhof mit ihr zu verabreden.
An jenem Tag, als er sie zum ersten Mal sah, trug sie leicht verwaschene Jeans, dazu eine teuer wirkende brombeerfarbene Baumwollbluse und eine graublaue Weste. Vor allem aber trug sie ein halb eingefrorenes Ich-bin-ein-umgänglicher-Mensch-Lächeln, welches ihm von je her einen Schauer über den Rücken jagte. Ein Lächeln, zugleich fehlendes Selbstbewusstsein und gut gemeinte Kommunikationsbereitschaft plakativ ins Gesicht schreibend, sodass er für die Fahrt das Schlimmste befürchtete.
Diese Prognose schien sich zu bestätigen, als Suzanne, bald einen Smalltalk der unangenehmsten Art mit ihm begann. Sie wiederholte für ihn die Radionachrichten, erwähnte nebenbei die wichtigsten Ausstellungen, diein Paris zu sehen waren, gab eine kurze Wettervorhersage und erörterte schließlich eifrig die französische Lebenskunst.
Stephan brummelte eintönige Antworten, in der stillen Hoffnung, sie dadurch in ihrem Redefluss bremsen zu können. Diese Taktik verfehlte jedoch ihr Ziel: Er schien sie lediglich in ihrem Gefühl zu bestätigen, für eine lockere Unterhaltung sorgen zu müssen.
Das Problem löste sich, als er hinter Bremen von der Autobahn abbog, um bis Nordhorn über die Bundesstraße zu fahren. Er konnte damit den Winkel abkürzen, in dem die A30 nach Holland auf die Nord-Süd-Trasse traf. Suzanne verstummte, gab keinen Ton mehr von sich, sodass schlagartig das monotone Motorbrummen seines alten Renault Dauphines zum einzig vernehmbaren Geräusch im Wagen wurde. Kreidebleich und zur völligen Bewegungslosigkeit erstarrt klammerte sie sich an den Haltegriff.
Irritiert versuchte Stephan ihr munteres Geplapper der letzten Minuten zu rekapitulieren. Er konnte sich beim besten Willen nicht erklären, welche ihrer Ausführungen eine derart bedrückende Assoziation bei ihr ausgelöst haben mochte, dass es zu einem solchen Stimmungsumschwung kam.
„Wohin fährst du?“, fragte sie trocken.
Die Frage überraschte ihn. Seit er die Pariser Wohnung besaß, nahm Stephan für gewöhnlich dieselbe Strecke, die sich laut Landkarte als die kürzeste auszeichnete. Das Emsland, Geldern, Brabant und die Picardie waren ihm über die Jahre so vertraut geworden, dass er schon lange keinen Autoatlas mehr mitführte.
Neugierig sah er Suzanne an. Sie schwitzte, versuchte aber, bewusst gleichgültig zu wirken. Ohne eine Miene zu verziehen starrte sie auf die an ihnen vorbeihuschenden Kuhweiden. Ihr Atem ging schwer und ungleichmäßig. Erst jetzt begriff Stephan: Diese Veränderung hatte bei ihr genau in dem Augenblick eingesetzt, als er die Autobahn verließ.
Er erklärte seine Reiseroute.
„Hast du eine Karte?“, fragte sie.
Stephan gab zu, der Atlas schlummere friedlich zu Hause auf seinem Schreibtisch in der Avenue Junot. Ihm war klar, dass das nach einer Ausrede klang und keineswegs dazu geeignet war, in ihr neues Vertrauen zu wecken.
Ohne ihn anzusehen, nickte sie und bat um einen kurzen Stopp in der nächsten Stadt. Die wenigen Minuten Fahrt entlang der Wiesen und Äcker bis zur Ortschaft zogen sich schier endlos hin. Durch den Lüftungsschacht drang der Gestank von Gülle und Kunstdünger. Ein Gewitter lag in der Luft.
Natürlich erfuhr sie in Ahlhorn, seine Reiseroute sei nicht völlig abwegig und setzte sich wieder, eine konfuse Entschuldigung murmelnd, auf den Beifahrersitz.
Der bewölkte Himmel verdichtete sich zu einer schwarzen Unwetterfront, und kaum hatten sie die holländische Grenze passiert, fing es an, wie aus Eimern zu schütten. Der Regen verursachte ein bizarres Geräusch auf dem Wagendach. Dicke Tropfen vereinten sich vor der Windschutzscheibe zu einem undurchsichtigen Film, der es unmöglich machte, auch nur zwanzig Meter vor ihnen fahrende Fahrzeuge zu erkennen. Die Landschaft verschwand hinter einem Gazeschleier aus herabdrängendem Wasser und selbst die Leitplanken schienen sich langsam aufzulösen. Inständig hoffte Stephan, die Reise möge sich aufgrund dieser offensichtlichen Bosheit der Natur nicht noch zusätzlich in die Länge ziehen.
Die Straße war durch den plötzlich einsetzenden Regen spiegelglatt geworden. Suzanne schaute ihn an; er bemerkte es aus den Augenwinkeln, während er mühsam versuchte, nicht von der Fahrbahn abzukommen oder seinem Vordermann auf die Stoßstange zu setzen. Vielleicht ahnte sie, wie sehr er sich konzentrieren musste; durch ihre wachsende Unruhe jedoch machte sie deutlich, dass ihr irgendetwas auf dem Herzen lag.
Eine Zeit lang waren nur das dumpfe Geprassel des Regens und das rachitische Aufkrächzen der überarbeiteten Scheibenwischer zu hören, wohltuend gleichförmige Geräusche. Es war warm im Wagen und so langsam gewöhnte sich Stephan an die Fahrverhältnisse. Suzanne war weiterhin intensiv damit beschäftigt, ihn verlegen anzusehen. Jedes Mal jedoch, wenn er seinen Blick von der Straße auf sie richtete, heftete sie die Augen auf die Fahrbahn - ein Spiel, welches ihm zu einer anderen Zeit mit einem entspannteren Gegenüber eine gewisse Freude hätte bereiten können, unter den gegebenen Umständen allerdings nicht zur Verbesserung seiner Stimmung beitrug. Schließlich brach sie das Schweigen.
„Kann ich mir eine Zigarette anstecken?“
Ihre Bitte kam eigenartig hervorgepresst, ruckartig, sie stotterte, als habe sie sich den optimalen Wortlaut lange zurechtgelegt, und dadurch ihre Nervosität soweit gesteigert, dass jegliche Normalität aus ihrer Stimme gewichen war.
„Hast du mich deswegen die ganze Zeit über gemustert?“
„Ich war mir nicht sicher, ob du nicht zu den militanten Nichtrauchern gehörst. Die sind mir nämlich zu anstrengend.“
Ihre Sorge war unbegründet. Zigaretten belustigten ihn eher, als dass sie ihn störten. Er war Pfeifenraucher und zog eine raffinierte Blend jedem dieser in seinen Augen albernen Siebeneinhalb-Minuten-Röllchen vor.
Während sie sich erleichtert eine Filterzigarette in den Mund steckte, grübelte er über die Unruhe nach, die sie auf der Bundesstraße befallen hatte.
„Sag mal: Ist dir schon einmal ein Typ beim Trampen dumm gekommen?“, fragte er in die Stille hinein.
Suzannes Gesicht lief rot an. Mit leerem Blick zog sie an ihrer Zigarette.
„Einmal“, sagte sie zögernd. „Ich war damals neunzehn und habe noch auf dem Land gewohnt. An einem Freitagabend wollte ich zu Freunden nach Paris und habe mich an die Straße gestellt. Das ist bei uns in der Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, normalerweise kein Problem. Gerade am Wochenende findet man da immer einen Lift in die Stadt. Ein Mittvierziger in Anzug und Krawatte, den ich in der Gegend noch nie gesehen hatte, nahm mich mit. Irgendwo auf halber Strecke, fernab jeglicher Zivilisation, hielt er plötzlich an und erklärte mir, dass ich es jetzt entweder mit ihm machen oder zu Fuß weitergehen könne. Ich war so verdutzt, dass ich zuerst gar nicht begriff, was der Kerl von mir wollte. Dann aber, als er mit seinem schmierigen Blick deutlicher wurde, bin ich ausgestiegen. Es hat Stunden gedauert, bis ich von dort wegkam. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder per Daumen zu fahren.“
Er nickte. Lange schwiegen sie. Stephan ahnte, dass Suzanne mit ihren Erinnerungen beschäftigt war, und wagte nicht, sie mit weiteren Fragen zu behelligen.
Um die Stille zu übertönen, suchte er im Radio nach etwas Musik. Überall lief dieselbe eintönige Unterhaltungsberieselung. Endlich fand er einen Sender, der Oldies spielte, Screamin' Jay Hawkins, Tom Waits und andere raukehlige Sänger, die ihn an durchzechte Nächte seiner Studentenzeit erinnerten.
Zunächst tat Suzanne, als interessiere sie nicht, was sie hörte. Gedankenverloren starrte sie aus dem Fenster. Plötzlich aber, die Doors empfahlen gerade, sich einen langen Urlaub zu gönnen und die Kinder spielen zu lassen, schaltete sie mit einer Entschlossenheit, die er ihr nie zugetraut hätte, das Radio ab.
Er sagte nichts dazu. Aus den Augenwinkeln schaute er sich einen Moment ihr Gesicht näher an. Es war recht hübsch, hatte regelmäßige feine Züge, gekrönt von einer leichten Stupsnase und braungrünen Augen. Ihr volles Haar hatte sie straff zu einem Knoten hochgesteckt, ihr langer Hals war von der Frühlingssonne leicht gebräunt. Sein Blick glitt weiter abwärts und für einen Moment war er mit seinem Schicksal versöhnt.
„Was hörst du denn normalerweise?“, wollte er wissen.
Sie kramte in ihrer Tasche und zog eine Kassette heraus.
„Funktioniert dein Tapedeck?“
Er nickte und steckte ihr Band in den Rekorder.
Bis sie Frankreichs Grenze erreichten, hatten sie ihr gesamtes Kassettenrepertoire einmal durchgehört. Stephan begriff, dass sie rigoros alles mochte, was neu auf dem Markt war und mindestens eine Platzierung in den Top Ten hatte. Musik, die älter als fünf Jahre war, empfand sie als völlig unhörbar und über seine Stones-Aufnahmen, die er als eiserne Reserve mitgenommen hatte, konnte sie nur grinsen. Das ärgerte ihn, weil es genau der Sound war, den er beim Autofahren liebte.
So waren seine Gefühle recht gemischt, als sie spätabends auf der Pariser Ringautobahn ankamen. Auf ihre Bitte hin fuhr er sie zum Pont Neuf, Rive Gauche, wo er sie absetzte. Sie stellte ihr Gepäck auf den Bürgersteig und beugte sich noch einmal in den Wagen hinein, um sich zu verabschieden. Unsicher lächelnd streckte sie ihm ihre Hand entgegen, besann sich dann aber eines Besseren und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf beide Wangen. Verwirrt und ein wenig wehmütig sah er ihr nach, während sie den Quai überquerte und in der Rue Dauphine verschwand.
3
Der Wecker klingelte unverschämt früh am nächsten Morgen. Eine neue Arbeitswoche begann. Stephan kramte verschlafen eine Filtertüte aus dem Küchenregal. Mechanisch steckte er sie in den Filteraufsatz und nässte ihn unter dem Wasserhahn. Er zählte fünf Löffel Kaffee ab und gab ein wenig Kakao hinzu. Eine Prise Zimt und ein paar Krümel Salz rundeten die Komposition ab. Zufrieden goss er Wasser in die Kaffeemaschine, stellte sie an und ging einkaufen.
Sein erster Gang führte zum Bäcker, wo er ein noch warmes Baguette erstand. Von dort trottete er weiter zu seinem Lieblingskiosk, begrüßte Michel, dessen Besitzer, und kaufte einen Stapel Filmillustrierte, dazu den „Officiel des spectacles“, den „Canard Enchâiné“ und den „Figaro Littéraire“. So bepackt trat er den Rückweg an.
Im Briefkasten lagen mehrere Briefe. Das Elektrizitätswerk wollte seinen Zählerstand wissen und teilte ihm mit, ein Beamter habe schon mehrmals versucht, ihn anzutreffen. Eine kleine Fachzeitschrift fragte wegen eines 250-Zeilen-Essays über die Entwicklung Godards anlässlich dessen letzten Films „Allemagne Neuf Zéro“ an und einige Verleiher informierten über anstehende Pressepreviews. In jenem Jahr arbeitete Stephan bereits für verschiedene Zeitschriften, für die er die französische Szene beobachtete und kommentierte. Nebenbei tippte er an Romanfassungen derjenigen Filme, die sich in Paris als Kassenschlager erwiesen.
Er goss sich einen Kaffee in seine Bol und fing an, die Zeitschriften durchzublättern. Eric Rochant, der mit „Eine Welt ohne Mitleid“ einen beachtlichen Erfolg sowohl in Frankreich als auch in Deutschland erzielt hatte, brachte einen neuen Streifen heraus, „Entführung aus Liebe“, der gerade anlief. Die Kritiken waren geteilt und er hoffte für Rochant, dass der Film beim Publikum ankäme, denn er mochte dessen lakonischen Stil. So beschloss er, sich am Nachmittag ein eigenes Bild zu machen.
„Entführung aus Liebe“ lief in drei Kinos. Er entschied sich, zum „Action Christine“ unweit des Pont-Neuf zu gehen, einem versteckten, kleinen Kino in einer der ruhigeren Seitenstraßen des St. Germain, abseits der Touristenströme.
Die Geschichte überzeugte ihn, wenn sie auch nicht so genial umgesetzt war wie die „Welt ohne Mitleid“. Stephan dachte daran, dass es ihm schon bei Rochants erstem Werk nicht gelungen war, den deutschen Verlag von den Verkaufschancen einer Romanfassung zu überzeugen, obwohl der Film sich in Frankreich als Kassenhit entpuppt hatte und der Vorlauf dank der langen Synchronisationsdauer mehr als ausreichend war. Trotzdem wollte er es auf einen Versuch ankommen lassen und nahm sich vor, den Abend für diesen Plan zu verwenden.
Gemächlich ging er hinauf zur Rue des Grands Augustins. Hier, in der Nummer 7, hatte Picasso ab 1937 gelebt, hier war sein berühmtes „Guernica“ entstanden. Einer plötzlichen Laune folgend wandte Stephan sich dem Herzen des Viertels zu.
Er war erst ein paar Schritte gegangen, als er vor sich eine Frau mit langen braunen, im Knoten zusammengesteckten Haaren bemerkte, die in etwa Suzannes Statur hatte. Für einen Moment war er unsicher, wie er reagieren sollte; er wollte sie ansprechen, aber ihm fiel nichts ein, was er hätte sagen können.
Sie wäre nicht argwöhnisch geworden. Alle Welt traf sich in St. Germain. Die Läden hatten 365 Tage im Jahr geöffnet, die Cafés sogar bis tief in die Nacht. Kleinkünstler bevölkerten die Plätze und verdienten sich ihr Taschengeld. Und doch war ihm nicht klar, wie er ihr seine Anwesenheit hätte erklären können. Was zog ihn ausgerechnet in dieses Viertel, in dem er sie am Abend zuvor abgesetzt hatte?
Zögernd folgte er ihr, immer den Abstand von einigen Metern haltend, bemüht, sie zwischen all den bummelnden Urlaubern nicht aus den Augen zu verlieren. Sie hatte einen schnellen, energischen Gang, der ihm gefiel. Gerade als er sich entschloss, sie anzusprechen, blieb sie vor dem Schaufenster einer Boutique stehen, so dass er ihr Profil sehen konnte. Sie besaß ein attraktives Gesicht, aber es war nicht Suzannes.
So beschloss er, sich am Boulevard St. Michel in ein Café zu setzen, um den Film noch ein wenig nachwirken zu lassen und suchte sich einen kleinen Tisch im Freien. Von dort aus beobachtete er, genüsslich einen Café crème trinkend, die Menschen, die eilig an ihm vorüberzogen.
Es war trotz der späten Stunde angenehm warm für diese Jahreszeit. Die Leute trugen leichte Kleidung, T-Shirts, ärmellose Hemden, kurze Röcke. Er überlegte, wie wohl Suzanne in T-Shirt und kurzer Hose aussähe. Oder wie ihr offenes Haar stände.
Er saß eine ganze Weile in dem Café, stopfte sich eine Pfeife und suchte mit den Augen die Menge ab. Schließlich begriff er die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens und zahlte. Gerade wollte er aufstehen, da beobachtete er eine junge Frau, die offenbar von einem zudringlichen Verehrer belästigt wurde. Nachdem sie diesen mehrmals höflich, aber bestimmt abgewiesen hatte, packte sie ihn und warf den Verdutzten mit einem Schultergriff zu Boden. Stephan begab sich schmunzelnd auf den Weg nach Hause.
Er telefonierte mit Halpern, einem Mitarbeiter von „Le Monde“, der ihm gelegentlich mit Material aus deren Archiv aushalf. Wenn Stephan in Paris war, gingen die beiden oft gemeinsam einen trinken. Es tat ihm gut, mit Halpern in den Bistros zu versacken, von einer Bar zur nächsten ziehend bis in den Morgen hinein über Liebe und Tod zu philosophieren und sich, wenn auch der letzte Kneipenwirt seine Stühle auf die Tische stellte, an den Kantstein irgendeines Bürgersteiges zu setzen und den grüngekleideten Müllmännern bei der Arbeit zuzusehen.
Später machte er sich daran, noch einmal sämtliche Filmzeitschriften, die er am Morgen gekauft hatte, nach Rezensionen zu Rochants Film zu durchsuchen und die wichtigsten davon für seinen Verlag zu übersetzen. Bis nach Sonnenaufgang saß er an seiner Schreibmaschine und ließ die Finger über die Tasten tanzen.
Eigentlich war es eine simple Liebesgeschichte, ähnlich der „Welt ohne Mitleid“:Ein junger Mann möchte seiner in einiger Entfernung lebenden Freundin ein Zeichen seiner Liebe geben und fährt sie besuchen - mangels Geld entführt er zu diesem Zweck einen Schulbus. Zwar gelingt ihm sein Vorhaben, doch ist die Freundin nicht in der Lage, mit seinem eigentümlichen Liebesbeweis umzugehen: Der Film endet im Desaster.
Einige Besprechungen vermittelten den Eindruck, Rochant habe sich an einem Geiseldrama versucht. Mit dieser Erwartungshaltung jedoch war ein Verriss vorprogrammiert. Denn Rochant ging es nicht um Action, sondern um ein fein gesponnenes Psychogramm seines sympathischen Antihelden.
Die Sonne brannte bereits von Süden her in sein Fenster, als er wieder erwachte. Nachdem er gefrühstückt hatte, ging er hinunter zur Seine. Einige Bouquinisten hatten ihre Bretterbuden geöffnet und er durchstöberte ihre Kästen nach brauchbarer Literatur.
Er fand eine Monografie, die ihn interessierte, als ihm flussabwärts eine Gestalt auffiel, die ebenfalls in einer der Kisten stöberte. Wieder war es das braune, im Knoten zusammengesteckte Haar, das ihn an Suzanne denken ließ. Er ging ein paar Schritte auf sie zu und sah, dass es sich diesmal tatsächlich um seine Mitfahrerin handelte. Vorsichtig lehnte er sich an die Brüstung des Quais und tat, als läse er.
Suzanne ging in seine Richtung, sah ihn, zögerte, schritt aber an ihm vorbei. Er blickte auf. Jetzt war es an ihm.
„Suzanne?“, rief er halb fragend hinter ihr her.
Sie drehte sich um und lächelte verlegen. Auf seine Frage, wie es ihr gehe, erzählte sie von einer Fotoausstellung im Centre Pompidou, die sie gerade besucht hatte, und einem Sektfrühstück mit einem ehemaligen Kommilitonen. Aus Freude über ihr zufälliges Wiedersehen lud Stephan sie in eines der unzähligen Straßencafés ein. Sie setzten sich, ohne lange zu suchen, von der Seine nur durch den stark befahrenen Quai des Grands Augustins getrennt.
Stephan hatte von Anfang an den Verdacht, Suzanne bereite sich durch Zeitungslektüre und Ähnliches systematisch auf Kontakte mit anderen Menschen vor. Fehlte diese Vorbereitungszeit, waren die wenigen Novitäten, die als Konversationsstoff herhalten mussten, schnell verbraucht. In einer solchen Situation befanden sie sich jetzt. Ihm war es recht, Smalltalk lag ihm nicht. Eine Weile saßen sie herum, wussten nicht, wohin mit ihren Augen und lachten sich verlegen an.
Schließlich fragte er, wie lange sie vorhabe, in Paris zu bleiben. Sie hatte es ihm bereits auf der Hinfahrt erzählt, er jedoch nicht zugehört, was ihm nun, da er sich seiner Sympathie für sie bewusst geworden war, leidtat. Er wollte sich gern in einer freien Stunde noch einmal mit ihr an einem ruhigeren Ort treffen. Doch sie erzählte ihm, sie fahre schon in den nächsten Tagen zurück nach Deutschland.
So machte er den Vorschlag, sich in Hamburg wiederzusehen und bat um ihre Adresse. Sie war einverstanden und kritzelte etwas auf einen Zettel, den sie ihm über den Tisch zuschob. Es war eine Telefonnummer, nicht mehr.
Ein unbestimmtes Lächeln glitt über ihr Gesicht.
„Ich freue mich drauf“, sagte sie und entschwand.
4
Stephan blieb noch vierzehn Tage in Paris, sah sich einige Previews an und arbeitete meist bis spät in die Nacht. Die interessantesten Filme jenes Frühjahrs waren Literaturverfilmungen. Zwar hatte sein Hausverlag keine Skrupel trotzdem ein 'Buch zum Film' herauszubringen, in dem neben Szenenfotos die Filmhandlung nach der Drehbuchversion zu finden war, doch interessierte es ihn nicht, solche Arbeiten zu übernehmen. Wozu ein Buch schreiben, das jemand, der wesentlich talentierter war als er, schon längst geschrieben hatte?
Mit seinen Manuskripten im Gepäck fuhr er zurück nach Hamburg, um sich mit den Chefredakteuren und Feuilletonleitern über deren Bedarfe zu verständigen.
Schon nach wenigen Tagen bekam er Lust, Suzanne zu sehen. Er suchte in seinen Notizen nach dem Zettel, den sie ihm gegeben hatte. Das Papier jedoch war nirgendwo zu finden, weder in seinem Portemonnaie, noch zwischen den Stapeln auf seinem Schreibtisch, und erst recht nicht in seinem Adressbuch. Schließlich fand er es in einer Hemdentasche im Wäschekorb und rief sie an. Sie freute sich, von ihm zu hören, doch zu seinem Ärger war es, unabhängig vom Wochentag, völlig unmöglich, sich mit ihr für den späten Nachmittag oder gar den Abend zu verabreden. Sie hatte ihre eigenen Vorstellungen davon, zu welchen Zeiten ein Rendezvous mit ihr möglich sei. Am besten eignete sich ihrer Meinung nach der Vormittag. Das gefiel ihm gar nicht.
Suzanne war zu bestimmt in diesem Punkt, als dass es ein großes Ringen um den Termin gegeben hätte. Wieder schimmerte diese andere Seite ihrer Persönlichkeit durch, die ihn auf der Fahrt nach Paris so überrascht hatte: die selbstbewusste, entschlossen auftretende Frau, die mit einer ungeahnt resoluten Sicherheit sein Autoradio ausgeschaltet hatte, ohne nach seiner Meinung zu fragen.
Sie einigten sich darauf, dass er sie am späten Vormittag von der Uni abhole, um dann gemeinsam mit ihr irgendwo Essen zu gehen - für ihn eine Möglichkeit, das Frühstück nachzuholen, für sie, ihre Mittagspause sinnvoll zu nutzen.
Nicht ihr knapper schwarzer Lederrock oder ihre Flickenjacke verblüfften ihn bei dieser ersten Begegnung in Hamburg am meisten, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der Suzanne den Weg zur Mensa einschlug, während er im Kopf noch die Vorteile des „Arkadaschs“ mit denen des „Schweijks“ verglich. Stephan liebte unberechenbare Menschen, und Suzanne schien immer wieder für eine Überraschung gut zu sein. Sie war alles andere als langweilig. Bis zu jenem Punkt, wo es um persönliche Belange ging.
Wieder erlebte er dieselbe Szene wie am Quai in Paris. Suzannes Antworten wurden zusehends einsilbiger, sie verschloss sich und es machte sie sichtlich nervös, etwas von sich geben zu müssen. Da sie die oberflächlichen Informationen schon früher ausgetauscht hatten, konnten sie damit kaum ein zweites Treffen bestreiten, und er merkte, dass sie sich auf Themen, die sie ein wenig tiefer berührten, nur ungern einließ. So begannen sie, sich über Filme zu unterhalten, die sie beide gesehen hatten, über Bücher und Künstler. Sie fanden eine Ebene, die zwar intime Gefühle weitgehend ausklammerte, dennoch viel der eigenen Vorlieben vermittelte.
Sie verabredeten sich im Planetarium, der Kunsthalle und zahlreichen Parks, spazierten zusammen entlang des Elbe-Lübeck-Kanals und schlenderten durch den Sachsenwald. Immer wieder schlug Stephan vor, sich auch zu Hause zu treffen, doch stieß er damit bei Suzanne auf taube Ohren. Ohne ihm näher zu erklären warum, lehnte sie es entschieden ab, ihn in ihr Domizil zu lassen oder das seine zu betreten.
Er war es nicht gewohnt, sein Leben derart in der Öffentlichkeit zu verbringen. Noch weniger, gegen Ende des Monats fortwährend nachrechnen zu müssen, ob er sich ein Treffen mit einer Frau noch leisten könne. Aber er hatte sich in den Kopf gesetzt, Suzanne sei es wert, einen etwas längeren Atem zu behalten.
So dauerte es bis zum Herbst, bis Suzanne sich endlich darauf einließ, einen Fuß in seine Wohnung zu setzen. Er hatte ihr wiederholt erzählt, er lebe in der Nähe des Hafens und kenne sich in der Gegend recht gut aus. Jetzt erst fragte sie ihn, ob er nicht Lust habe, ihr ein paar der weniger touristisch erschlossenen Ecken zu zeigen.
Sie versprach, ihn von zu Hause abzuholen, um von dort aus mit ihm zur Elbe zu gehen. Er hatte vor, eine jener Routen zu nehmen, auf der er sich während seiner Studienzeit des Öfteren als Fremdenführer betätigt hatte und die er dementsprechend gut kannte.
Als sie kam, hatte sie einen Leinenbeutel mitgebracht, den sie ihm schon an der Tür überreichte. Ohne Stephan eines weiteren Blickes zu würdigen, ging sie an ihm vorbei in die Wohnung und schaute sich um.
„Nett hast du's hier. Ein bisschen viel Chaos vielleicht.“
Er ignorierte diese Anspielung auf seinen ungeordneten Junggesellenhaushalt und untersuchte stattdessen den Beutel. Zwei Fotoalben und eine Reihe von Fototaschen befanden sich darin.
„Sind die von dir?“
„Glaubst du, ich habe dir Filmfotos von Maria de Medeiros besorgt? In ihrer Rolle der Anaïs Nin?“
Er wollte einen der Umschläge aus dem Beutel nehmen, doch sie fuhr dazwischen.
„Ich dachte, wir wollen spazieren gehen.“
Geschickt nahm sie ihm den Beutel ab und legte ihn auf die Flurkommode. Dann griff sie seine Hand, zum ersten Mal überhaupt, und zog ihn zur Eingangstür.
„Darf ich mir vielleicht vorher was überziehen?“, fragte er.
Sie lachte fröhlich.
Schon an der Haustür, noch bevor sie die Elbe sahen, konnten sie das unverkennbare Gemisch aus Wasser und Öl riechen, das von der Begegnung mit unzähligen Städten und Ortschaften erzählte, vom Riesengebirge und der Tschechoslowakei, vor allem aber vom Meer, das bei Flut in einem orgiastischen Anfall sein Wasser bis hier hinauf stieß.
Die Straße abwärts warf die Sonne ihr warmes Licht gegen die Stufengiebel der alten Patrizierhäuser. Jenseits der Elbe erhob sich die Schiffswerft Blohm und Voss mit ihren roten Backsteinbauten. Unwillkürlich blieben sie stehen, um all das in sich aufzunehmen, bevor sie sich auf den Weg zum Fischmarkt machten.
Stephan kletterte auf ein Geländer, das die Betrunkenen am Kai davon abhalten sollte, in die Elbe zu fallen, und begann, gespielt unsicher wie ein Zirkusclown, darauf zu balancieren. Suzanne dachte nicht daran, ihm eine Hand zu reichen, sondern begnügte sich damit, das Schauspiel aus einiger Entfernung argwöhnisch zu betrachten.
„Bist du sicher, dass du gut genug schwimmen kannst?“, rief sie ihm zu.
Ein letztes Mal schwankte er mit weit ausgestreckten, rudernden Armen und sprang - machte seinen Abgang zur richtigen Seite, auf das Kopfsteinpflaster. Vielleicht hätte er in die Elbe springen sollen, dachte er.
„Komm!“
„Wohin?“, fragte sie.
„Ich will dir den Hafen zeigen.“
Sie gingen die Köhlbrandtreppe hinauf, eine pathetisch an den Elbhang gesetzte Backsteintreppe gegenüber der Einmündung des Köhlbrand in die Elbe, mit spielerisch verzierten schmiedeeisernen Geländern und ebensolchen Gaslampen, eine Treppe, die früher den Arbeitern als Heimweg diente.
Sie setzten sich auf eine Bank und beobachteten das Treiben auf der Elbe: Ein kleiner Hafenschlepper bugsierte ein Containerschiff in die tiefe Fahrrinne, eine vorwitzige Linienbarkasse hüpfte über die Wellen, daneben schaukelte ein kleines grünes Schnellboot des Zolls im Strom und eine leere Schute pflügte sich ihren Weg in eins der unzähligen Hafenbecken.
Das Licht brach sich in den nie zur Ruhe kommenden Wellen, die Elbe verwandelte die auftreffenden Sonnenstrahlen in Silberkaskaden und Stephan überkam eine unbändige Lust, Suzanne in den Arm zu nehmen. Sie ließ es mit sich geschehen, als habe sie schon lange damit gerechnet, und doch merkte er, es wäre ihr lieber gewesen, er hätte es nicht getan.
Er fuhr mit der Nase durch ihr Haar, sie drehte ihren Kopf weg.
„Du machst dir was vor“, sagte sie.
Er zuckte seufzend mit den Schultern. Eine Weile schwieg er, dann deutete er mit dem Zeigefinger den Hang hinunter zur „Großen Elbstraße“:
„Das da unten ist die berühmte 'Straße der Heringe', so hieß sie wenigstens früher, wegen der Fischmanufakturen. Hitler wollte hier eine Art Elb-Manhattan hochziehen, riesige Wolkenkratzer, Prunkbauten für seinen Partei- und Verwaltungsstab. Gott sei Dank hatte er im Krieg selbst nicht mehr die Mittel zur Verfügung, um den Plan durchzusetzen.
Dort drüben der dicke Flussarm; das ist der Köhlbrand. Die Brücke da gehörte Anfang der Siebziger zu den heißdiskutierten Bauprojekten der Stadt. Da hinten links, wo sie runterkommt, befand sich früher ein uriges Arbeiterviertel. Die Brücke wurde einfach in 52 Meter Höhe über die Wohnhäuser gebaut. Die Struktur des Viertels brach vollständig zusammen.“
Suzanne schaute ihn ernst an.
„Ich wollte, dass du mir ein paar schöne Ecken zeigst, nicht, dass du für mich den Fremdenführer spielst.“
Er schwieg überrascht. Eine Weile grollte sie vor sich hin, ganz in ihre eigenen Gedanken versunken, zu denen er keinen Zugang hatte.
Sie gingen weiter zum Donnerspark. Stephan hielt sich oft dort oben auf, wo er von einer kleinen Aussichtsplattform bei schönem Wetter bis zu den bewaldeten Höhen der Harburger Berge jenseits der Elbe sehen konnte. An jener Stelle des Höhenwegs waren Villen errichtet, großzügig geplante Gebäude mit breiten Fensterfronten in Richtung Wasser.
Manchmal betrachtete er sehnsüchtig das Mobiliar der Wohnungen durch die Scheiben und fragte sich, ob er wohl jemals in der Lage sein würde, eine derartige Einrichtung zu finanzieren. Bilder aus Filmen stiegen in ihm auf: Lofts, geräumige Atelierwohnungen, Zimmerfluchten. Er schämte sich ein wenig, noch immer nicht seinen Platz innerhalb der nur am Erfolg orientierten Gesellschaft gefunden zu haben.
Auf der anderen Seite am Fluss lagen die aus übereinandergeschichteten Containern bestehenden Wohnschiffe der Asylbewerber, die von den Häusern dort oben aus nicht zu sehen waren. Zu groß waren die Gärten, zu dicht bewachsen der Hang.
Ein paar kleine Kinder spielten vor dem Anleger Fangen.
Sie gingen durch den Rosengarten, der inzwischen fast verblüht war, hinunter nach Övelgönne, zum Museumshafen mit seinen alten Schiffen und weiter den Strandweg entlang zur „Kajüte“, einem kleinen Café, ein wenig über den Strand gebaut, von dem aus sie das Ufer mit seinen zahllosen Spaziergängern überblicken konnten. An einem der großen Fenster ließen sie sich nieder. Der Lärm des gegenüberliegenden Hafens und des Elbufers unter ihnen drang nur leise gedämpft durch die Scheiben. Es war warm und gemütlich.
„Woran denkst du?“, fragte er sie.
Sie schüttelte den Kopf. „An nichts. Und du?“
„An die Villen, an denen wir vorhin vorbeigekommen sind.“
„Was ist mit ihnen?“
„Manchmal sehne ich mich danach, in so einem Kasten zu wohnen und genug Geld zu haben, um all das tun zu können, worauf ich Lust habe. Kennst du das Gefühl?“
„Ich habe früher in so einem Haus gelebt. Das ist nicht immer lustig.“
Lange sahen sie dem Treiben am Strand zu, ohne zu reden, nur gelegentlich an Irish Coffee und Schokolade nippend, während draußen die Sonne tiefer sank.
Plötzlich fing Suzanne an zu zittern, zunächst ganz leicht, dann aber immer heftiger. Stephan setzte sich auf den Stuhl neben sie und legte seinen Arm auf ihre Schulter.
„Was hast du?“
Wieder schüttelte sie nur den Kopf.
„Halt mich einfach einen Moment fest, ja?“
So saßen sie eine Weile zusammen. Stephan hielt sie in seinen Armen, ohne zu wissen, was diesen Ausbruch ausgelöst haben mochte. Irgendwann schaute Suzanne auf ihre Armbanduhr. Es war spät geworden.
„Lass uns gehen“, meinte sie.
Der Weg an den alten Fischerhäusern entlang lag in leichtem Dämmerlicht. Nur wenige Leute waren jetzt unterwegs. Er brachte Suzanne zum Bus, der am Museumshafen hielt. Sie verabredeten sich für den Samstagabend bei ihm. Es war Suzanne, die diesen Vorschlag machte.
5
Er hatte seine Wohnung aufgeräumt, sämtliche Papierstapel, die zu sortieren er keine Zeit mehr gehabt, im Wäschekorb verstaut, mit einem neu erstandenen Mob die Staubflocken vom Holzfußboden in den Hinterhof befördert und dann in der Küche eine seiner im Freundeskreis berühmten Lasagnen gebacken. Beim Weinkontor am Spritzenplatz hatte er einen guten Rotwein besorgt. Das Bett war frisch bezogen. Der CD-Player spielte Tom Waits in Endlosschleife. So ziemlich alles war erledigt, was zur Vorbereitung eines gemütlichen Abends notwendig war.
Gegen zwanzig Uhr klingelte es an der Tür. Er war gerade damit beschäftigt, sich den Rest des Nudelteigs von den Fingern zu spülen, wischte kurzerhand seine Hände am Handtuch sauber und beförderte dieses, nachdem er es einen Moment nachdenklich begutachtet hatte, zu den Papieren in den Wäschekorb.
Suzanne trug ihr langes Haar offen, was dem Gesicht jegliche Strenge nahm. Ihm fiel nichts ein, was seine Überraschung adäquat hätte ausdrücken können.
Sie lächelte ihn an und überreichte ihm eine in Geschenkpapier eingewickelte Kassette. Stephan war überzeugt, sie habe sich bei der Auswahl ihres Mitbringsels von ihrem eigenen Musikgeschmack leiten lassen und mit diesem Geschenk gesichert, nicht den ganzen Abend Oldies hören zu müssen. Aber auch in diesem Punkt überraschte sie ihn: In dem Papier befand sich eine alte Aufnahme französischer Chansons.
„Weil du doch alles Vergangene liebst“, sagte Suzanne. Ihre Augen funkelten lustig.
Sie hatte Wein mitgebracht, einen Weißwein, der zwar nicht zum Essen passte, den er aber trotzdem wie ein Kenner kostete und für sein Bouquet lobte. Schon beim ersten Glas gestand sie ihm mit leicht gerötetem Gesicht, sie vertrage Wein eigentlich überhaupt nicht und er verstand spätestens, als sie auch dann noch mithielt, als die Flasche sich leerte.
Der Alkohol ließ sie gesprächig werden wie nie zuvor. Sie fing an, von ihrer Kindheit in Étampes zu berichten, einem kleinen Ort zwischen Paris und Orléans. Ihr Vater war Chef einer Konservenfabrik, während ihre Mutter für den Haushalt sorgte. Sie hatte eine vier Jahre jüngere Schwester. Als diese geboren wurde, störte es Suzanne, die Aufmerksamkeit der Eltern nun teilen zu müssen. Doch schnell gewöhnte sie sich daran. Ihr Vater kam abends erst spät nach Hause, sodass sie von ihm nicht viel mitbekam. Früh brachte ihre Mutter sie dazu, im Haus Verantwortung zu übernehmen und unter anderem auf ihre kleine Schwester aufzupassen.
Bald hatte sie gelernt, sich Freiräume zu schaffen, sodass ihre Mutter, die weitgehend allein für ihre Erziehung sorgen musste, häufig überfordert war. Aber Suzanne brauchte ein Gegengewicht zur verantwortungsgeladenen Enge ihres Zuhauses und schuf sich dieses.
„Erzähl mir von deiner ersten großen Liebe“, bat Stephan.
„Das war Claude. Ich war gerade 15. Er war süß. Ich lernte ihn auf einer Fete kennen, auf die ihn ein Freund mitgebracht hatte. Er wohnte in Maisse, etwa 17 km von uns entfernt. Wir trafen uns bald jeden Tag nach der Schule in einem Café. Zu Hause ging nicht, weil da Maman war - und Vanessa, meine Schwester.“
„Habt ihr miteinander geschlafen?“
„Nein, dafür fühlte ich mich noch zu jung. Irgendwie ist das in der Kleinstadt auch noch etwas anderes als in Paris. Außerdem war ich zu jener Zeit noch ziemlich religiös, lach' nicht. Meine Eltern nahmen mich schon früh mit zu einer kleinen evangelikalen Gemeinde in der Stadt. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dort das gefunden zu haben, wonach man sich eben sehnt, wenn man erwachsen wird. Ideale, Ideen, eine Gemeinschaft mit dem Gefühl, zusammen zu gehören. Gott wurde so eine Art Ersatzpapa für mich, der immer da war und mit dem ich sprechen konnte, wenn ich traurig war.
Ich habe dann gemerkt, dass es ein riesengroßer Unterschied war, von Gott zu reden oder zu versuchen, diese Ideale zu leben. Die meisten Gemeindeglieder haben mich diesbezüglich schnell enttäuscht. Aber ich konnte diese Vorstellung nicht aushalten, dass da plötzlich niemand mehr sein sollte. Vielleicht war es Angst vor dem Alleinsein, die mich lange hat dabei bleiben lassen. Gebrochen mit Gott habe ich eigentlich erst auf Korfu, als ... - Ich konnte nicht verstehen, warum Gott so etwas zuließ. Ich hatte ihn mir immer als übergroßen Schutzschild vorgestellt, als jemanden, der auf mich aufpasst und mich behütet. Damals habe ich begriffen, dass, wenn es einen Gott gibt, er ziemlich machtlos sein muss in dieser Welt.“
„Was passierte auf Korfu?“
Suzanne schüttelte den Kopf:
„Vielleicht später einmal ... Weißt du, man ist allein, sobald man eine Tür hinter sich zuschließt. Diese Angst, niemanden zu haben, die kommt schnell. Maman war zwar lieb, aber völlig unselbstständig. Was ich ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraute, wusste mein Vater schon am nächsten Morgen, oft auch andere Menschen, mit denen sie sich besprach, den Leuten aus der Gemeinde zum Beispiel. Deswegen war sie nie eine große Vertraute für mich.
Na ja, ich bin dann mit 19 auf die Uni gegangen. Mit Claude war da schon längst Schluss, irgendeine dumme Eifersuchtsgeschichte, die mir heute leidtut. Aber Claude war eine Jugendliebe, die sich sowieso nicht hätte in die Zukunft retten lassen. Es musste wohl irgendwann so kommen.
In Paris habe ich Sprachen studiert. Deutsch. Englisch. Spanisch. Ich wollte unbedingt die Welt kennenlernen und hatte die Vorstellung, so besser an die Menschen heranzukommen. Aus dem gleichen Grund habe ich es auch ein paar Semester lang mit Psychologie probiert.
Zuerst wohnte ich noch zu Hause und fuhr jeden Morgen mit der Bahn in die Stadt. Später nahm ich mir ein Zimmer zur Untermiete im fünften Arrondissement, bei einem Professor und dessen Freundin.“
„Einem Prof' von deinem Fachbereich?“
„Nein, das hätte nur Komplikationen gegeben. Ich mag mit den Leuten, von denen ich abhängig bin, nicht zu dicht zusammen leben.
Mit ein paar Kommilitonen brachten wir eine Fachbereichszeitung heraus. Wir waren sehr engagiert. Nicht, dass ich besonders politisch gewesen wäre zu jener Zeit, aber in mir gab es noch diese Ideale von Wahrheit, Rechtschaffenheit und fairem Verhalten, die ich auch am Fachbereich durchsetzen wollte. Und so waren wir bald die zentralen Personen, die jeder kannte, und zu denen jeder kam.
Es war eine schöne Zeit. Wir saßen bis tief in die Nacht zusammen und brüteten unsere Ideen aus, das Zimmer völlig in Zigarettenrauch gehüllt, neben uns die leeren Bierflaschen und auf dem Tisch die neuesten Entwürfe für die Zeitung, bald auch Reformvorschläge für den Fachbereich ...“