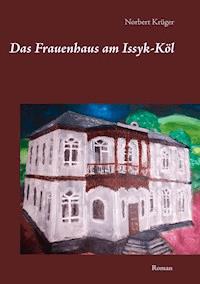
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elmira, die Kinderärztin, Mahabat, die Ärztin für innere Medizin und Ainura, die Betreiberin eines Jurtencamps für Touristen ziehen die Konsequenz aus ihren eigenen einschneidenden Erlebnissen und gründen ein Frauenhaus in der Stadt Karakol am Issyk-Köl-See im Hochland von Kirgisistan. Im Zusammentreffen von Samat, dem Pflegesohn Mahabats, mit den Bewohnerinnen des Hauses, spiegelt sich die Problematik zwischen kirgisischen Frauen und Männern im Spannungsfeld zwischen nomadischer Tradition, islamischer Religion, der noch nicht überwundenen sowjetischen Vergangenheit und der marktwirtschaftlichen Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Elmira, die Kinderärztin, Mahabat, die Ärztin und Ainura, die Betreiberin eines Jurtencamps für Touristen ziehen die Konsequenz aus ihren eigenen einschneidenden Erlebnissen und gründen ein Frauenhaus in der Stadt Karakol am Issyk-Köl-See im Hochland von Kirgisistan. Im Zusammentreffen von Samat, dem Pflegesohn Mahabats, mit den Bewohnerinnen des Hauses, spiegelt sich die Problematik zwischen kirgisischen Frauen und Männern im Spannungsfeld zwischen nomadischer Tradition, islamischer Religion, der noch nicht überwundenen sowjetischen Vergangenheit und der marktwirtschaftlichen Gegenwart.
Autor:
Norbert Krüger wurde im Jahre 1947 in Kitzingen, Deutschland geboren. Er lebt seit 1948 in Frankfurt am Main, studierte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt Wirtschaftspädagogik und arbeitete danach an einer Beruflichen Schule. Er verfasste zwei Lehrbücher zur Vermittlung von Wirtschaftsenglisch.
Norbert Krüger hielt sich über einen längeren Zeitraum in Kirgisistan auf. Er lebte in einer kirgisischen Familie, die ihm den Kontakt zu zahlreichen Menschen in der Umgebung ermöglichte. So entstand die Idee zu seinem vorliegenden Debut-Roman.
Für meine Ehefrau Erika und meine Tochter Miriam
Inhalt
Plan von Kirgisistan
Mahabat
Elmira
Ainura
Die Wölfin auf dem Fels
Ibrajevs Offerte
Korolkov Straße 45
Abgelehnt
Das Fest
Risiko
Bajtemir
Nach dem Umsturz
Gulsats Flucht
Der Junge
Banja
Die Wahrheit
Das offene Tor
Epilog: Aksana und Lenka erzählen eine Sage
Erklärung russischer und kirgisischer Begriffe
Personenregister
Mahabat
Damals in Bischkek, Mahabat stand bewegungslos an der Ampel der Naryn Straße, vor fast achtzehn Jahren. Damals schaute sie auf das grüne Licht der Fußgängerampel, blieb gedankenversunken stehen, versäumte es, die Straße zu überqueren. Sie nahm auch den jungen Mann kaum wahr, dessen Stimme immerhin schwach zu ihr gedrungen war, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt gehen könne. Wie aus einem unbekannten Raum blendete grelles Licht ins Innere ihres Kopfes, verhinderte die Erkenntnis, was zu tun sei, erlaubte stürmischen, ungeordneten Gedanken ihr Unwesen zu treiben.
Mahabat drehte sich um und bewegte sich langsam in die Richtung, aus der sie gekommen war.
Waren Minuten oder Stunden vergangen, seit sie am Bahnhof von Bischkek gestanden hatte? Sie hatte darauf gewartet, dass der Trolleybus Nummer vier halten würde, um sie aufzunehmen und sie dann, wie schon so oft, in der Sovjetskaya, vor dem kleinen Bazar, wo man Obst, Gemüse, Schinken und Hammelfleisch kaufen konnte, wieder auszuspucken. Von dort waren es nur ein paar Meter zu der zehnstöckigen, inzwischen heruntergekommenen Häuserkette von Plattenbauten, in der sie wohnte. Jetzt aber hielt sie das kleine Bündel in ihrem Arm fest umschlungen, aber doch in einigem Abstand von ihrem Körper. So als könne sie dadurch verhindern, dass das Baby, das in das Tuch gewickelt war und schlief, zu ihr gehört.
Eine junge Frau, etwa achtzehn Jahre alt, dem Aussehen nach Kirgisin, hatte sie gebeten, das Kind zu halten. Sie wolle sich am Straßenstand um die Ecke schnell ein paar Samsos kaufen, bevor der Bus kommt. Mahabat fühlte sich wohl mit dem warmen Kinderkörper im Arm. Es erinnerte sie an die Zeit, als sie ihre beiden eigenen Söhne auf diese Weise vor der beißenden Winterkälte geschützt hatte. Jetzt aber, da die Mutter des Kindes nicht zurückgekommen war, wurde die wunderbare Wärme abgelöst durch die Kälte der Ratlosigkeit. Mahabat hatte ein Kind im Arm, das nicht das ihre war, dessen Mutter sie nicht kannte, aber erkennen würde, wenn sie sie an der Stelle finden würde, wo diese ihr das Kind anvertraut hatte. Dort hatte sie ja lange genug gestanden, darauf gewartet, dass ihr die Frau das Kind wieder abnehmen würde, sich entschuldigen würde für ihre lange Abwesenheit, ihr Kind an sich nehmen und sich bedanken würde. Aber die Frau kam nicht.
Verschwommen nahmen Mahabats Augen wieder die Umrisse des Bahnhofs wahr, mit seinem riesigen, breiten Treppenaufgang. Sie musste einfach da sein, diese Frau, bestimmt hatte man sich nur irgendwie gegenseitig übersehen und nicht mehr gefunden. Mahabats Schritte beschleunigten sich ganz von alleine, bis sie wieder an der Haltestelle des Trolleybusses Nummer vier stand. Dort hoffte sie, die tränenüberströmte Mutter auf sich zulaufen zu sehen, überglücklich ihr Kind zurückzuerhalten, wütend darüber, dass sie, Mahabat, sich einfach vom Ort der Übergabe des Kindes entfernt hatte.
Nichts von alledem geschah. Nicht einmal die beißend kalte Winterluft konnte dem Taubheitsgefühl in Mahabat etwas anhaben, so lange bis ihr bewusst wurde, dass das Lebewesen in dem Tuchbündel durch die Kälte bedroht war, dass es beschützt werden musste, dass es Hunger haben musste. Reflexartig begann sie ein Wiegenlied zu summen, drückte das Tuch mit dem Kind jetzt fester an ihren Körper in die Nähe der Brust, wie sie es von ihren eigenen Kindern in Erinnerung hatte. Sie erschrak, als ein Bus der Linie vier mit lautem Quietschen an der Haltestelle hielt und sich die automatischen Türen krachend öffneten. Der Schreck wurde abgelöst von der Erleichterung, die es auslöste, das Kind in das von den Mitfahrenden gewärmte Innere des Busses bringen zu können. Mahabat setzte sich auf einen der harten Plastiksitzplätze, spürte jetzt zum ersten Mal, dass sich in dem Bündel etwas rührte, verbunden mit einem leisen Ton, der immer lauter wurde, der schließlich zu einem Kleinkindschreien anschwoll. Über Mahabat brach eine Flut von Fragen ungeordnet herein, an die sie bis dahin noch nicht gedacht hatte, die jetzt aber nach einer Beantwortung verlangten. Sie konnte spontan dem kleinen Wesen nichts bieten, was dessen Signale der Unzufriedenheit hätte stoppen können. Wen sollte sie in ihre Situation einweihen? Das Beste wäre, überlegte sie, zur Polizei zu gehen, den Vorfall zu melden. Dann aber wurde ihr klar, dass man Uniformierten und Beamten besser aus dem Wege geht, am besten jeden Anlass zur Erpressung von Geld vermeidet. Auf keinen Fall durfte man ihnen die Gelegenheit eröffnen, eine Schuld an der Situation zu konstruieren, von der man sich freikaufen müsse.
Dann sah sie wieder keine andere Möglichkeit, als das Kind ordnungsgemäß bei der Behörde zu melden. Es musste ja einen Namen bekommen, existent sein. Vielleicht hatte aber die Mutter das Kind auch schon als vermisst gemeldet, dann könnte man Mahabat den Vorwurf der Kindesentführung machen. Wie würde Talant darauf reagieren, wenn sie das Kind behielte? Gab es sonst noch jemanden, dem sie sich anvertrauen konnte?
Durch das Busfenster erkannte sie plötzlich das Gebäude des Bazars in der Sovjetskaya Straße. Hektisch sprang sie von ihrem Sitz auf, das immer noch schreiende Kind im Arm, verließ den Bus noch rechtzeitig, bevor die Menschen von außen hereindringen konnten und es ihr erschweren würden, auszusteigen. Sie kämpfte sich durch die an der Bushaltestelle wartenden Menschenmassen, strebte zügig in Richtung des Wohnkomplexes, in dem sich ihre Wohnung befand. Unversehens blieb sie stehen, schaute sich um, sah nirgendwo eine Apotheke, wo sie ein Milchfläschchen und Babynahrung hätte bekommen können. Dann eilte sie ein Stück die belebte Straße hinunter, wurde fündig.
Schließlich stand sie vor dem Aufzugsschacht im schmucklosen, allen anderen Häusern gleichenden Treppenhaus des Häuserblocks Nummer 18/2. Heute würde sie den gefährlich gebrechlichen Aufzug den Stufen in den siebten Stock vorziehen, um ihre durch eine Gitterwand zusätzlich gesicherte Wohnung zu erreichen. So hoffte sie, dass sie von niemandem, vom Klagen des Kindes aufmerksam gewordenem, gesehen würde. Auf ihren Knopfdruck hin, bewegte sich der Fahrkorb klappernd von oben nach unten, um sie abzuholen und dann wieder mit Mahabat und dem Kind in umgekehrte Richtung.
Im siebenten Stock angekommen, versuchte sie mit hastigen Bewegungen, den Schlüssel im Schloss des rostigen Sicherheitsgitters zu drehen, um dann endlich mit einem weiteren Schlüssel, den sie mit zittrigen Händen aus dem Bund herausfischte, die eigentliche Wohnungstür zu öffnen. Sie legte ihre Tasche auf den ausgebesserten Teppichboden im Eingangsbereich der Wohnung ab, versuchte aus dem Mantel zu schlüpfen, ohne das Kind zu heftig zu bewegen, ließ den Mantel fallen. Schließlich ging sie ins Schlafzimmer, legte das Bündel auf das noch von der Nacht ungeordnete Bett, öffnete das Tuch und konnte, nun zum ersten Mal, das schreiende, hilflose Wesen liegen und strampeln sehen. Sie schätzte das Alter des Jungen auf zwei Monate.
In der Küche bereitete sie eine Flasche, so wie sie es für ihre eigenen Kinder früher getan hatte, als die Milch ihrer Brust nicht mehr ausgereicht hatte. Dann begann sie das Kind zu füttern, merkte, wie Ruhe über sie kam, widmete ihre ganze Aufmerksamkeit diesem Vorgang, wiegte danach den Jungen sanft im Arm.
Wie groß musste die Not der Menschen sein in diesem Land, das sie so liebt. Was war der Grund der Mutter, ihr Kind einfach zu verlassen? Waren es nur Geldsorgen oder war es auch die gesellschaftliche Not, die so ein Kind mit sich bringen kann? In der Sowjetunion war es kein großes Problem alleinerziehende Mutter zu sein. In das islamische Verständnis der neuen kirgisischen Gesellschaft passte diese Rolle einer Frau nicht.
Mahabat begab sich nicht in den Gefahrenbereich korrupter Polizeibeamter. Sie entschied sich, das Kind in die Kleinkindabteilung des Krankenhauses einzuschmuggeln, in dem sie Ärztin war. Auf dem Weg zur Arbeit legte sie in einem unbeobachteten Moment das Kind in einer Tasche auf den Stufen eines Personaleingangs des Krankenhauses ab, wo es nicht zu kalt war. Sie hoffte, dass es bald von jemandem gefunden und ins Innere des Krankenhauses gebracht werden würde. Sie selbst würde unerkannt bleiben, wie gewohnt ihrer Arbeit in der internistischen Abteilung nachgehen, die der Kleinkindabteilung benachbart war. Ohne Verdacht zu erwecken, würde sie von hier den Gang der Dinge beobachten können.
Nach zwei Stunden ging sie zurück zum Ort, wo sie die Tasche, mit dem Kind darin, abgelegt hatte. Die Stufe war leer. Sie fand heraus, dass der Junge, wie erwartet, in der Kleinkindabteilung aufgenommen worden war. Um keinen Verdacht zu erregen und um als unbeteiligt zu gelten, erkundigte sie sich nicht, von wem das Kind gefunden worden war, wurde aber trotzdem von Elesa, einer Ärztin und Finderin der Tasche, eingeweiht.
Sie habe ihren Ohren nicht getraut, als sie auf der Treppe ein Winseln gehört habe, erzählte Elesa, habe das Kind unverzüglich hierher gebracht. Man wisse nicht, wer die Eltern sind. Der Oberarzt habe die Polizei benachrichtigt, die lasse das Kind hier, bis die Eltern ermittelt seien.
Das gab Mahabat Gelegenheit, das Schicksal des Jungen weiter zu verfolgen. Man übergab ihn einem Waisenhaus. Mahabat zog Erkundigungen über diese Einrichtung ein, war erschüttert über die untragbaren Zustände dort.
An einem Wochenende endlich, als sie zu Hause in Toru-Aigir war, sprach sie zum ersten Mal mit Talant über den Jungen. Sie wollte herausfinden, was er von einem adoptierten Kind halte. Talant reagierte abweisend. Er habe nichts gegen ein weiteres eigenes Kind, sagte er. Ein adoptiertes Kind könne er aber nicht als Familienmitglied akzeptieren, es würde ihm immer fremd bleiben.
So beschloss Mahabat, sich um den Jungen, der im Waisenhaus den Namen Samat erhalten hatte, zu kümmern. Sie suchte Samat häufig auf, um ihm Gelegenheit zu geben, sie als Bezugsperson zu akzeptieren. Man ließ sie als Pflegemutter gewähren. In ihrer Familie erwähnte sie Samat nicht mehr.
Das donnernde Klopfen an der Eingangstür lässt Mahabat aus ihrem Tagtraum hochschrecken. Sie schaut in die Richtung aus der das Klopfen kam, in der Gewissheit, dass einer der Söhne darauf reagieren und öffnen wird. Sie nimmt Stimmen wahr, kann sie zuerst nicht zuordnen, erkennt dann aber Seans unkirgisische Aussprache des Russischen. Mahabats ernstes breitwangiges Gesicht bleibt scheinbar unverändert, nur ein Blitzen in den zur Seite hin schlitzförmigen Mandelaugen, kaum erkennbar hinter den Gläsern der schlichten, unmodernen Brille, verrät ihre Freude.
>Sean!?< spricht sie den Namen halb fragend, halb fordernd mit lautstarker Stimme aus. Aus der eisernen, in die Platte des Kohleherdes eingelassenen Schüssel steigt ein Gemisch aus Rauch und Dampf auf, trägt den Geruch von angebratenem Reis und den Duft der für den Plov unerlässlichen Gewürze in die entlegensten Winkel des Küchengebäudes. Verfangen in der balkendurchzogenen Decke, ziehen die von Aromen geschwängerten Schwaden dann, einem Vorhang gleich, wieder nach unten, wo Mahabat die Zutatenmischung mit konzentrierter Miene unablässig rührt. Hier hat die Ehefrau von Talant Akajev und Mutter der beiden Söhne, Taschboo und Elim, ihren Rückzugsort und ihre Befehlszentrale, Verbindungsort zwischen Vorratsräumen, weiter hinten in demselben Gebäude, und dem Hof, der im Sommer als familiärer Aufenthaltsmittelpunkt dient. Am unteren Ende begrenzt das stählerne Eingangstor zur Straße hin das Gehöft, am oberen Ende der Durchgang zum Garten. Dazwischen eingebettet liegt die freie Fläche des Hofes zwischen mehreren ihn umgebenden Gebäuden.
Sean sucht, nur den Kopf um den Pfosten des Kücheneingangs in den dahinter liegenden Raum schiebend, mit einem breiten Grinsen Mahabats Gesicht. Unbeabsichtigt verursacht er damit, dass sie seinem Blick ausweicht.
>Du kommst rechtzeitig. Der Plov ist gleich fertig. Setz dich!< Sie spricht gewollt monoton, ohne jedoch einen gewissen Stolz auf ihr Produkt verbergen zu können.
Sean lässt sich auf einer der einfachen, ergrauten Naturholzbänke im Hof nieder. Auf dem farbresteüberzogenen Tisch, an dem Elim bereits sitzt und in seinem russischen Comic liest, stehen vier Teller und Löffel bereit. Mahabat kommt mit unverändert undurchsichtigem Gesichtsausdruck aus der Küche, rückt ihren Platok, das bunte, um den Kopf geschlungene Tuch, zurecht und geht mit schlurfendem, von den leichten, flachen Pantoffeln aufgezwungenem Schritt wieder in die Küche. Talant und Taschboo setzen sich ebenfalls.
>Hast Du die Stelle am Institut in Kant bekommen?< fragt Talant.
Sean nickt zustimmend. >Ich werde übermorgen einige meiner Sachen von hier mitnehmen. Ich habe in Kant ein Zimmer gemietet.<
>Aber du wirst doch wiederkommen, um uns zu besuchen?<
Sean nickt wieder, diesmal mit einem beruhigenden, fast tröstenden Ausdruck in den Augen. >Es ist ein guter Arbeitsplatz. Ich bin Dozent für Englisch, Umweltpolitik und Rechtslehre.<
Mahabat hat den Plov aus der Metallschale in einen anderen tönernen Topf umgefüllt und stellt diesen zusammen mit einem fünften Teller und Besteck für Sean auf den Tisch.
>Esst! Esst!< drängt sie auf Russisch mit gebieterischer Miene, die keinen Widerspruch zulässt und Elim dazu bewegt seinen Comic zur Seite auf die Sitzbank zu legen.
>Warum hast du hier deine Arbeit mit den Alten aufgegeben? Die haben sich gefreut, dass sich jemand um sie kümmert,< fragt Talant.
>Es ist effektiver, wenn diese Aufgabe von den Menschen in Toru übernommen wird,< erklärt Sean. >Die wissen besser was lebensnotwendig ist. Meine Arbeit war uneffektiv. Da war ich sehr unzufrieden.<
>Du hättest die Altentagesstätte aufbauen sollen,< sagt Talant. >Du hattest alles unter Dach und Fach. Da gibt man doch nicht auf.<
>Ich komme mit den Regeln der Finanzierung solcher Vorhaben hier in Kirgisistan nicht zurecht,< drückt Sean seine Ablehnung von Schmiergeldzahlungen vorsichtig aus. Er kennt die Einstellung der meisten Menschen hier zu diesem Problem sehr genau, will das Gastrecht nicht durch harsche Kritik verletzen.
Die erwartete Reaktion Talants folgt auf den Fuß.
>Die Bezahlung besonderer Leistungen gehört zu unserem Wirtschaftssystem. Wer kann, bessert sein Einkommen durch freiwillige Zuwendungen auf. Oder glaubst du Mahabat und ich weisen in den Krankenhäusern, in denen wir arbeiten, Geld zurück, das uns angeboten wird. Das gehört dazu. Damit musst du dich abfinden.<
Nach einer kurzen Pause fragt Taschboo: >Verdienst du jetzt gut?<
>Das Geld ist mir nicht so wichtig.<
Taschboo und Elim sehen Sean erstaunt an. >Ich würde schon gerne gut bezahlt werden,< sagt Taschboo.
>Du wirst bald ohne Bezahlung arbeiten, wenn du das Praktikum am Krankenhaus in Bischkek machst,< antwortet Sean.
>Anders kann ich kein Arzt werden. Danach wird es mir gut gehen, weil ich Geld habe,< erwidert Taschboo bestimmt und Elim nickt.
Talant unterstützt Taschboo. >Ohne Geld kommst du nicht weiter. Im Krankenhaus stellen sie dich nicht ein, wenn du kein Auto hast und keine Kleidung, in der du gepflegt aussiehst. Ohne Geld erreichst du nichts. Und Mahabat muss unsere andere Wohnung in Karakol bezahlen. Sonst könnte sie dort nicht arbeiten.< Mahabat ist anzusehen, dass es da keinen Zweifel gibt.
>Hilfst Du heute Abend, das Schaf schächten, für das Fest morgen?< wechselt Talant das Thema. >Taschboos bestandenes Examen an der Universität und der Geburtstag Elims sind Gründe genug für eine Feier.<
>Natürlich helfe ich! Habe mich schon darauf gefreut, nachdem du mir am Telefon davon erzählt hast. In Kant habe ich bis jetzt nur wenig Kontakt zu anderen Menschen. Da kommt das Fest gerade recht. Vielen Dank für eure Einladung,< schwärmt Sean. >Wird Samat auch kommen?<
Talant und Mahabat schauen verlegen in ihre Teller. Samat, der dritte, jüngste Sohn, der nicht der leibliche Sohn ist, war schon lange nicht mehr da. Mahabat hatte einmal gesagt, auch wenn er nicht da sei, gehöre er zur Familie. Jetzt ringt sie nach Worten, aber ihre Stimme lässt sie im Stich. Bei dem Gedanken an das, was Talant damals antwortete, was er so ernst und glaubhaft gesagt hatte, zieht Mahabat eine Änderung seiner Meinung nicht mehr in Betracht. Talant sagte damals, er sei froh, dass Samat nicht mehr in ihrem Haus wohne. Er könne ihn niemals als jüngsten Sohn akzeptieren. Er wolle sich nicht abhängig machen, von jemandem, der nicht zur Familie gehört. Und von der Altersversorgung seien Mahabat und Talant abhängig. Dafür könne und müsse ein leibliches Kind sorgen. >Er ist nicht unser Sohn,< hatte Talant gesagt.
Seitdem sprechen Mahabat und Talant nicht mehr über Samat.
Talant dankt Allah für das Essen, indem er mit den Händen über das Gesicht streicht und beendet so die Mahlzeit. Die anderen am Tisch Sitzenden tun es ihm gleich und stehen auf.
Mahabat nimmt die metallene Plovschale vom Tisch, schlurft in die Küche, geht zum Herd, nimmt einen Holzlöffel vom Haken an der Wand und beginnt zögerlich die Reste in der Plovschüssel in eine tönerne Schüssel zu füllen. Sie starrt an die Stelle, an der vorher der Löffel gehängt hatte, sieht Talant und sich selbst in Bischkek, wie sie 1985 zum ersten Mal in die Wohnung in der Sovjetskaya in Block 18/2 kamen. Die Dame von der Wohnungsverwaltung händigte ihnen den Schlüssel aus. Mahabat hatte Talant überglücklich umarmt. Sie konnte es kaum fassen, diesen Traum von einer Wohnung zugewiesen bekommen zu haben. Eine Wohnung mit fließendem Wasser, mit Badewanne und WC, mit einem Gasherd in der Küche und einem Blick in die Kronen der Bäume, bis hinunter in das pulsierende Leben der Sovjetskaya und des gegenüberliegenden Bazars. Die Wohnung stand ihnen zu, weil sie, die frisch gebackenen Ärzte, bald ein Kind haben würden. Talant hatte seine Zulassung als Chirurg gerade erhalten und sie, Mahabat, sie war Allgemeinmedizinerin, befand sich im Schwangerschaftsurlaub.
Schon damals in Bischkek war ihr klar, wie sehr Talant mit der kirgisischen Tradition verwachsen und verbunden war. Es fiel Talant schwer seinen Eltern zu widersprechen, die von ihm erwarteten, dass er und seine Familie nach Toru-Aigir zurück kommen sollten, dorthin zu kommen, wo Talant aufgewachsen war und wo seine Eltern wohnten. Er hatte ihr, Mahabat, erzählt, wie seine Familie im Winter, wenn der strenge Frost das Land und insbesondere das Gebirge überzog, vom Jailoo in den Bergen in die Stadt zog. Einen weiteren Aufenthalt in der Jurte hielt man dann nicht mehr aus, wenn von einem Tag auf den anderen der gefürchtete Wind einsetzte. Dann war das Leben in einem der Holzhäuser, wie sie von den Sowjets reihenweise gebaut wurden, schon erträglicher, zwar ohne den Luxus, den Talant und Mahabat in Bischkek hatten, aber schon geräumiger, als das, was eine Jurte bieten konnte. Oberhalb der Stadt auf dem Jailoo blieb man im Sommer, um den Bedürfnissen der Kühe und Schafe nach Futter zu entsprechen. In der Jurte hatte er sich immer wohler gefühlt als im Haus in der Stadt. Bedrückend eng standen all die Häuser, die sich zum Verwechseln ähnelten und sich nur durch die unterschiedlichen Vorstellungen des Gartenbaus ihrer Bewohner unterschieden.
>Wir arbeiten in Bischkek im Krankenhaus, da können wir nicht in Toru wohnen,< hatte Talant seinem Vater geantwortet, dem dann nichts weiter übrig blieb, als klein beizugeben.
Der wurde erst wieder fordernder, als Elim, der zweite Sohn, geboren wurde.
>Wir sind eine Familie, wir müssen füreinander da sein. Der jüngste Sohn hat in der Nähe des Elternhauses zu leben. Deine Mutter und ich, wir werden langsam alt,< argumentierte Talants Vater.
Damals sind sie dann nach Toru gezogen, Talant, Taschboo und Elim, weil Talant eine Stelle als Chirurg in Tscholpan-Ata fand. Das war 1991 kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Kirgisistans, in Folge des Zerfalls der Sowjetunion, sechs Monate nach der Geburt Elims. Mahabat blieb in Bischkek.
Der Vater war es auch, der Talant auf das Haus aufmerksam gemacht hatte, in dem sie jetzt wohnen und das damals zum Verkauf stand. Es war das Haus von Hermann Rosenbaum und seiner Familie. Die hatten schon ihr Hab’ und Gut zusammengepackt, waren bereit für die Abreise nach Deutschland, dem Heimatland ihrer Vorfahren, hatten die Ausreisegenehmigung aus Kirgisistan, hatten die Einreisegenehmigung für Deutschland, weil sie als Russlanddeutsche anerkannt waren und ihre Deutschkenntnisse nachgewiesen hatten. Zudem waren sie Juden, was ihre Einreise in Deutschland noch weiter erleichterte. Hermann Rosenbaum und Talant Akajev wurden sich über den Kaufpreis einig.
Mahabat blieb damals in Bischkek, um ihren Beruf weiter ausüben zu können, verdiente gutes Geld und konnte sich auch um Samat im Waisenhaus kümmern. Sie kam nur nach Toru, wenn sie ein paar freie Tage hintereinander hatte.
Im Jahre 2005 waren etwas mehr als vierzehn Jahre vergangen, seit der Zeit, in der Mahabat unfreiwillig zu Samats Pflegemutter geworden war. Während dieser Zeit hatte sich eine stabile Beziehung zwischen dem noch immer im Waisenhaus lebenden Samat und Mahabat entwickelt. Jetzt eröffnete man ihr im Krankenhaus, in dem Mahabat arbeitete, dass sie in einer Kurklinik in Suu-Kurort, einer Niederlassung des Bischkeker Krankenhauses, dringend benötigt würde. Sie selbst habe dadurch den Vorteil, viel näher bei ihrer Familie in Toru-Aigir zu sein. Das gebe ihr die Gelegenheit ein halbwegs normales Familienleben zu führen, anders als jetzt, da sie nur selten nach Hause komme.
Bei Mahabat schlug diese Anweisung wie ein Donnerschlag ein. Ihre leiblichen Kinder, Taschboo und Elim, waren ihr sehr wichtig, die Beziehung zu Talant war im Laufe der Jahre und wahrscheinlich auch auf Grund der raren Zeit des Zusammenlebens abgekühlt. Sie wollte aber auch Samat nicht verlassen und eine Adoption ohne Zustimmung ihres Mannes war nicht denkbar. Sie entschied sich für den Arbeitsplatz in Suu-Kurort bei Karakol, nahm es dann oft auf sich, den langen Weg nach Bischkek zurückzulegen, um Samat zu besuchen, wenn immer es ihre Zeit zuließ.
Als Samat fünfzehn Jahre alt war, weihte Mahabat ihre Familie über ihre mütterliche Beziehung zu ihm ein und drängte Talant zuzustimmen, dass Samat bei ihnen in Toru wohnen konnte. Bischkek sei ein gefährliches Pflaster, voller Halunken und Verbrechern. Der Junge sei dort nicht sicher und gerate womöglich auf die schiefe Bahn. Hier, in Toru, habe sie mehr Einfluss auf ihn, könne ihm auch einen Job bei Bahyt Kalistratow, einem Bauern in der Nähe, verschaffen. Talant stimmte schließlich zu, machte aber deutlich, dass er Samat niemals als jüngsten Sohn behandeln werde. Taschboo und Elim beugten sich dem Willen ihrer Eltern.
Es war eine schwere Zeit für Mahabat. Sie liebte Samat, wie einen ihrer Söhne, spürte aber die Abneigung die Talant, Taschboo und Elim ihm gegenüber empfanden. Und dann war Samat eines Morgens verschwunden, nicht einmal eine Nachricht hatte er hinterlassen. Mahabat versuchte ihre Trauer in ihrem Hause in Toru zu verbergen. So kam es, dass der Name Samats kaum mehr in der Familie Akajev genannt wurde.
Niemand hätte Samat in Verbindung mit dem bevorstehenden Fest erwähnt, hätte Sean nicht am Essenstisch das Gespräch auf Samat gebracht und damit die Stimmung erzeugt, die Mahabat jetzt, da sie am Herd steht und die leere Plovschüssel mit einem vom Putzen dunkel gewordenen Lappen auswischt, bedrückt.
Sean geht in Richtung Garten, vorbei an Elim, der sich am Waschbecken neben dem Banjahaus die Zähne putzt. Noch ehe er den Durchgang vom Hof erreicht, dringt ein temperamentvolles, winselndes Bellen seiner Hunde aus den vom Tisch aus unsichtbaren Schuppen hinter dem Wohngebäude. Mahabat schreckt vom Hundegebell hoch, folgt Sean zum Garten. Dort sieht sie, wie Sean die Hunde füttert, indem er den Fressnapf mit dem mitgebrachten Futter füllt. Nur mit Mühe kann er verhindern, dass ihm der Napf im Wirbel der Begrüßung von den Hunden, die an einem Pfahl festgebunden sind, aus der Hand gerissen wird. Sie beobachtet, wie Sean, als die Tiere durch das Fressen von ihm abgelenkt sind, sich im Garten umsieht, unter dem prall voll hängenden Aprikosenbaum hindurch zum Stall geht, die schwarzen Köpfe der Schafe streichelt, so als wolle er sich von ihnen verabschieden. Vor dem Hühnerstall stampft er schelmisch mit dem Fuß auf den Boden, um die Hühner hinter dem Zaun aufzuscheuchen. Dann geht er zur Zisterne, beginnt aus ihr mit Hilfe eines verblichenen Plastikeimers Wasser aus der Tiefe zu ziehen. Damit füllt er ein Behältnis oberhalb des einzigen Wasserhahns des Hauses und bringt eimerweise Wasser in das kleine Badehäuschen, in dem die Banja untergebracht ist. Am Abend wird ein Holzfeuer die Steine zum Glühen bringen, die das Wasser zum Sieden erhitzen und damit den notwendigen Dampf für das Saunabad erzeugen werden.
Sean geht zurück zum Hof, versucht zu vermeiden, auf das ausgebreitete Getreide zu treten, das Taschboo und Elim mit dem Mitsubishi und einem klapprigen, einachsigen Anhänger von einem Bauern in Toru geholt haben. Wenn das Korn getrocknet ist, werden es die beiden Söhne in Säcken zur Mühle am südlichen Rand der Stadt, ganz in der Nähe des Sees, bringen. Man wolle das Getreide beizeiten malen lassen, sagt Tashboo. Wenn das Wetter umschlage, sei es viel schwieriger in der Mühle einen Termin zu bekommen. Schließlich brauche man das Mehl im Winter, der ja sehr schnell da sein könne.
>Setz `dich noch einmal,< fordert Mahabat Sean auf, als der über einen Umweg am Tisch vor dem Küchenhaus angekommen ist. >Ich habe mit dir zu reden!<
>Choroscho! In Ordnung!< sagt Sean und lässt sich neben Mahabat nieder.
>Du wolltest damals diese - wie nennst du sie - Altentagesstätte hier in Toru gründen,< beginnt Mahabat. >Zwei Freundinnen und ich haben in Karakol jetzt ähnliche Pläne für ein Frauenhaus. Das wird dringend gebraucht, weil es Frauen in den Dörfern und Städten gibt, die sich den Traditionen nicht unterwerfen und von ihren Familien verstoßen werden. Für sie wollen wir eine neue Heimat gründen. Erzähl` mir etwas über deine Erfahrungen mit den Behörden.<
Mahabat steht auf, geht in die Küche, kommt mit zwei Tassen Tee zurück, lässt sich wieder neben Sean nieder. Sean setzt an zu einer langen Schilderung.
Elmira
Sergej zieht sanft, aber entschlossen die Bettdecke über Elmiras bloße Schulter. Er legt seinen Kopf auf das Kissen, wendet seinen Blick zu Elmira hin.
>Wirst du bei mir bleiben?< fragt Elmira.
Er schaut schweigend auf Elmiras Mund.
>Bleib’ bei mir!< flüstert Elmira erneut. >Ich möchte gemeinsam mit dir mein Leben verbringen. Ich möchte, dass du immer um mich bist!<.
Sergejs Blick verharrt auf Elmiras üppigen, wohlgeformten Mund.
>Hier in Karakol können wir ein schönes Leben führen,< bekräftigt sie.
Sergej fühlt sich unsicher, merkt, wie Ärger in ihm aufsteigt. Er versucht ja nichts anderes als die Startbedingungen für ein zukünftiges Zusammenleben mit Elmira zu verbessern, ist nicht bereit, ein Leben lang zuzusehen, wie andere in Saus und Braus leben und ihn dabei ausschließen. Ohne solides finanzielles Gerüst ist ein Zusammenleben nicht möglich. Er spürt, Elmiras Klagen und sein schlechtes Gewissen sind seinen Plänen im Wege.
Trotzdem hat er das Gefühl, dass er etwas verlieren würde, wenn die Beziehung zu Elmira zu Ende ginge. So schweigt er, versucht zu verhindern, dass die Mimik seine Gedanken verrät.
>Du verletzt mich, wenn du dazu schweigst.<
>Ich muss in Bischkek sein, um dort meinen Job zu tun.< Es platzt aus ihm heraus, er wird laut, ohne es zu wollen. >Ich muss in Bischkek schnell verfügbar sein, davon hängt es ab, ob ich Erfolg habe. Wie soll ich das machen, wenn ich mich hier, in Karakol, diesem Nest, aufhalte? Sechs Stunden von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ein schnelleres und zuverlässigeres Auto kann ich mir nicht leisten, dazu fehlt mir das Geld. Geld brauche ich aber, um in der Öffentlichkeit angemessen aufzutreten. Für Kleidung und so etwas. Versteh` mich doch!<
Sergej merkt, dass seine Stimme an Aggressivität zugenommen hat. Um sich zu bremsen, umfasst er Elmiras Schulter, gibt sich alle Mühe zärtlich zu sein, küsst ihren Hals, fühlt aber Elmiras Widerstand, verspürt, dass Weichheit und Hingabe fehlen.
>Jetzt bin ich ein Mensch zweiter Klasse. Du solltest sehen, wie meine amerikanischen Kollegen beim Peace Corps leben, auch ohne in einer Führungsposition zu sitzen.< Er versucht Ruhe in seinen Tonfall zu bringen. Trotzdem legt sich Zorn in die auf beiden Seiten in einer tiefen Falte endende Augenpartie, an die sich rechts eine nicht zu große, aber auffällige Narbe anschließt. Sein längliches braungebranntes Gesicht, dessen, an der Spitze leicht nach oben gebogene Nase ein unverwechselbares Profil erzeugt, kann den Ausdruck der Angespanntheit nicht verbergen.
>Du bist kein Mensch zweiter Klasse und hier in Karakol schon gar nicht. Du weist selbst, dass es hier viele Russen gibt,< kontert Elmira ebenso ernsthaft.
>Hier sind alle zweitklassig.< Sergej winkt ab. >Die Erfolgsstory spielt sich in Bischkek ab, Elmira. Dort sind nun mal die Menschen, die das Sagen haben und die mich weiter bringen können, nicht hier. Dort lohnt es sich, Kontakte zu pflegen. Oder glaubst du wirklich, in Karakol wäre ich zu einer leitenden Stelle in einer amerikanischen Organisation gekommen?<
>Und unser Zusammenleben bedeutet dir wohl gar nichts, das ist nicht wichtig?< reagiert Elmira jetzt deutlich verärgert. >Dass ich dich brauche, interessiert dich nicht!
Und nicht nur ich brauche dich. Die Herausforderungen sind grenzenlos hier in Karakol. Hier gibt es wahrhaftig genügend soziale Probleme, mit denen du dich profilieren kannst. Hier fehlen Menschen mit deinen Fähigkeiten; Menschen wie du, die den Mangel, die Armut, die überall herrscht, in den Griff bekommen und dafür sozialen Sachverstand mitbringen. Du hast das Know-how. Und da willst du weg gehen nach Bischkek und Karriere machen? Die Menschen hier brauchen dich. Das muss doch für ein Leben in Zufriedenheit reichen,< versucht Elmira Sergej umzustimmen. >Und ich brauche dich auch.< Elmira verleiht ihren Worten durch einen lang anhaltenden Blick in Sergejs Augen Gewicht, küsst ihn auf den Mund, ohne eine Erwiderung zu verspüren.
>Ich hatte so sehr gehofft, dass du an dem Aufbau des Frauenhauses mitarbeiten würdest, dass du mich, Ainura und Mahabat unterstützen würdest. Und mit der Stelle, die dir hier bei der Sozialbehörde angeboten wurde und meiner Arbeit als Kinderärztin hätten wir beide genug Einkommen, um gut zu leben.<
Sergej springt von dem aus Decken geformten Schlaflager auf. Sein schlanker, athletischer, von der Sonnenbank gebräunter Körper glänzt im Licht der noch tief stehenden Morgensonne. Durch die Scheiben der, von der Zeit gezeichneten, maroden Balkontür zeichnet sich eine rechteckige Lichtfläche, vom Türrahmen begrenzt, auf dem Boden ab. Seine Stimme füllt sich mit tiefer Überzeugung. >Ich gehöre nicht hierher. Es ist nicht mein Land. Was die Sowjets sich vor 80 Jahren genommen haben, kann ich heute nicht als mein Land bezeichnen. Aber wenn ich schon in Kirgisistan lebe, dann nicht in Armut oder Mittelmäßigkeit, in all dem Dreck, der hier herrscht.
In meiner Position in Bischkek komme ich bis an die Türen, hinter denen der Wohlstand auf uns wartet. Eine davon ist im Sozialministerium. Irgendwann werde ich auf der anderen Seite dieser Tür sitzen. Dann kommst du nach Bischkek und wir werden ein Leben führen, das unseren Fähigkeiten angemessen ist.<
Sergej bewegt sich durch den spärlich eingerichteten, mit Teppichen an Wänden und Fußboden ausgestatteten Raum. Der kleine, niedrige Holztisch neben dem Schlaflager zwingt ihn einen kleinen Umweg zu dem an der Wand, gegenüber dem Bett stehenden Waschtisch zu gehen. Er schaut in den blinden, zerbrochenen Spiegel, der über der beigen, mit einfachem Blumenmuster verzierten Wasserkanne und der daneben stehenden Schüssel hängt.
>Du wirst auch eine Zeit lang ohne mich auskommen. Ich überlasse dir die Wohnung. Ich zahle dafür weiter.< Im Spiegel kann er Elmira sehen, die im Bett aufrecht sitzt. Wärme steigt in ihm auf beim Anblick ihrer weichen Gesichtszüge, betont, durch die bräunliche, von roten Wangen charakterisierte Hautfarbe. Ihre Augen, außen zu den Winkeln hin schlitzförmig nach unten gezogen, zur Mitte hin mandelförmig, signalisieren eine Mischung aus Hilflosigkeit und Enttäuschung. Als fröstele ihr, zieht sie die Bettdecke höher, um ihren bis dahin bloßen Busen zu verhüllen.
>Ich brauche deine Wohnung nicht, wenn du nicht mehr da bist,< sagt sie schroff. >Es gibt sehr wohl einen anderen Weg. Den gehe ich. Ich werde in der Klinik in Suu-Kurort von den Poliopatienten genauso gebraucht, wie von der Heimleitung und den Kindern im Heim. Mit meiner Arbeit verzichte ich nicht auf meine Würde, denn ich helfe den Menschen Krankheiten zu überwinden oder mit ihnen umzugehen. Auf diese Arbeit will und kann ich nicht verzichten,< sagt sie mit Entschlossenheit.
Elmira schlägt die Bettdecke von sich weg, richtet sich auf, sodass Sergej für kurze Zeit ihren nackten, zierlichen Körper sehen kann. Sie greift nach dem Morgenmantel neben ihrem Bett, schlüpft zügig in die Ärmel, kommt zu Sergej und legt ihren Kopf auf seine Schulter. Beide sehen sich im Spiegel, in dessen Mitte die gesprungene Glasscheibe ihre beiden Köpfe voneinander trennt. Sergej spricht, als meinte er nur sein Spiegelbild. >Einfluss bekomme ich nur in Bischkek. Komm mit mir!<
Die Marschrutka erreicht den Dorfplatz von Suu-Kurort. Elmira steigt aus, holt aus dem Gepäckraum ihre wollene Umhängetasche. Sie geht zügig über den staubigen Fahrweg in Richtung des Tals, durch das der Fluss sich mit wild schäumendem Wasser seinen Weg aus der Enge der Schlucht bahnt. Das die Straße umgebende Grasland der dem Tien-Schan vorgelagerten Steppe öffnet dem hier stiller werdenden Gewässer Raum, um sich in der Ebene in vielen flachen Armen über ein weites Flussbett auszudehnen. Am Eingang zur Schlucht, dort wo sich das vorderste Waldgebiet des Gebirges ein Stück weit in die Ebene ausbreitet, nimmt Elmira Kurs in Richtung des Plattenbaus. Dessen graue, durch herabblätternden Putz gestörte Monotonie wird durch den beinahe arrogant wirkenden Hintergrund der in der Sommersonne beleuchteten Schneeberge zum skurrilen Machwerk degradiert. Elmira geht die provisorisch reparierten Stufen hinauf in den tristen, von zahllosen Stromkabeln, Wasser- und Gasrohren durchzogenen Flur, auf dessen einer Seite die Fensterfront durch milchige, teilweise zerbrochene Scheiben grelles Licht in den Gang fluten lässt. Auf der anderen Seite reihen sich die mit verrosteten Nummernschildern versehenen Zimmertüren auf.
Elmira öffnet eine Tür mit der Aufschrift „Biro“. Aina mustert sie. An ihrem Tisch, dem ein neuer Anstrich nicht schaden würde, macht sich Aina an einem Berg von kleinen weißen, offensichtlich frisch gewaschenen Tüchern zu schaffen.
Ob alles ruhig war, will Elmira wissen.
>Keine besonderen Vorkommnisse, was unsere Patienten angeht,< antwortet Aina, ohne zu Elmira aufzuschauen. >Bolot und Kanibek haben einen Wettlauf zum Badehaus gemacht. Ich glaube, es war ermutigend für sie, dass sie es mit dem, was von ihren Beinen übrig ist, bis zum Ziel geschafft haben. Die anderen haben sie angefeuert und haben ihnen dann auf den letzten Metern geholfen, das Ziel zu erreichen.< Sichtlich erfreut hebt Aina nun ihren Kopf. >Das ist eine gute Gruppe, die wir da haben. Das Schicksal schlägt die Besten immer am härtesten. Die haben die Polio nicht verdient, das ist sicher.<
Sie wollte, sie könne mehr für die Kinder tun, aber sie sei nun einmal Kinderärztin. Da wisse sie sich zu helfen, aber mehr auch nicht, sagt Elmira mit Bedauern in der Stimme, während sie sich an den Tisch setzt.
>Aber das andere ist nicht so erfreulich,< ergänzt Aina und setzt das Zusammenlegen der vor ihr liegenden Tücher fort.
Der Heißwasserleitung von den Quellen zum großen Badehaus sei wieder einmal die Verschalung gestohlen worden. Jetzt komme nur noch die Hälfte des Wassers im Badehaus an, was zu einer zusätzlichen Schicht der Betreuer geführt habe. Die Patienten hätten die langen Wartezeiten mit Fassung getragen. >Möchte wissen, wer so etwas macht und was die Kerle mit der Verschalung anstellen,< sagt Aina.
Wahrscheinlich könne man sie auf dem Basar an der Kropokov Straße wieder zurückkaufen, erwidert Elmira. Sie begibt sich mit unsicherem Schritt und unkonzentriert auf den Weg zur Visite der Patienten. Sergejs Worte zeigen jetzt erst ihre Wirkung.
Elmira verlässt das direkt neben dem Fluss liegende Gebäude, geht über die sich unmittelbar anschließende Holzbrücke und gelangt so zu einem weiteren, ebenso heruntergekommenen Unterkunftstrakt, in dem Patienten einquartiert sind, die zusätzlich zu Bewegungsstörungen unter Atemwegsproblemen leiden.
Aziza, eine siebzehnjährige Frau, wurde vor einigen Tagen zur Rehabilitation eingewiesen. Sie kommt sehr schnell außer Atem und ist deshalb wohl oder übel an einen Sitzplatz oder das Bett gebunden. Elmira kommt täglich zu ihr.
Gleich am Tag der Einweisung ihrer Patientin in die Klinik unternahm Elmira einen Spaziergang mit ihr. Auf diese Weise hoffte sie, mehr über den psychischen Zustand der jungen Frau zu erfahren und ihr den Weg in den Klinikaufenthalt zu erleichtern.
Elmira half Aziza in einen der abgenutzten Rollstühle, wollte sie ein wenig ins Freie bringen, schob sie durch den sich am Fluss entlang ziehenden Kurpark, abwartend, ob die Patientin ein Gespräch mit ihr beginnen würde. Aziza war zunächst sehr zurückhaltend, ja scheu. Elmira konnte nicht beurteilen, ob die Krankheit der Grund für ihr Schweigen war oder andere Hürden zu überwinden waren. Nur hie und da verriet ein kleines, kaum wahrnehmbares Lächeln Azizas, dass ihr Elmiras Gesellschaft angenehm war. Dann erhob Aziza ihre bis dahin unsicher nach unten blickenden Augen, wich aber Elmiras Beobachtung weiter aus. Sie schaute gerade vor sich hin, sodass Elmira mit einiger Mühe die schönen, rund wirkenden Züge ihres Gesichtes erkennen konnte, die sich hinter einer Fassade von grauer Blässe auf der dunklen Haut verbargen.
Erst nach dieser Zeit des schweigsamen Zusammenseins, in dem das Rauschen der riesigen Nadel- und Espenbäume die Atmosphäre beherrschte, vernahm Elmira ein beinahe geflüstertes, kaum hörbares >Ist das schön!< Elmira erwiderte Azizas Bemerkung mit einer ebenso knappen Zustimmung. Sie nutzte aber das begonnene Gespräch zu der Frage, ob Aziza schon jemanden kennengelernt habe, in ihrem neuen Zuhause. Azizas Kopfschütteln wurde begleitet von einem >Nur dich.<
>Ab übermorgen wirst du mit einem kleinen Kreis anderer Frauen zusammenkommen. Die sind sehr nett,< legte Elmira nach.
Lange gab Aziza keine Antwort. Schließlich schüttelte sie heftig mit dem Kopf. Hastig, geradezu atemlos, sagte sie, sie wolle das nicht.
Während der nächsten Spaziergänge versuchte Elmira vorsichtig den Sinn der bevorstehenden therapeutischen Treffen zu erklären und die Atmosphäre zu beschreiben. Sie versuchte Aziza deutlich zu machen, dass alle Teilnehmer der Gesprächsrunden eine ähnliche Situation durchmachten wie sie, Aziza, und dass es für sie hilfreich sein würde, zu erfahren, dass sie mit ihrem Problem nicht allein auf der Welt ist, sondern dass dann, wenn es ihr schlecht geht, jemand da ist, dem sie sich anvertrauen kann. Elmira, als Ärztin, versuche ihr auch zu helfen, könne ihr aber nicht die gleiche Hilfe geben, wie andere Patientinnen dazu in der Lage seien.
Elmira wurde dann gestern mitgeteilt, dass Aziza an keiner einzigen der bis dahin statt gefundenen Gesprächsrunden teilgenommen hatte, dass sie den Kontakt zu den anderen sieben Zimmerbewohnerinnen mied.
Am Abend traf sich Elmira mit der Ärztin Mahabat Akajeva, die, im Gegensatz zu ihr, in der Klinik ihren Hauptarbeitsplatz hat und somit mit den Abläufen besser vertraut ist, auch durch ihre umfangreichere Erfahrung mit den Patienten.
Sie und Mahabat haben sich angefreundet. Immer wenn Mahabat von ihrer Familie in Toru-Aigir, auf der anderen Seite des Issyk-Köl, zurück in die Klinik kommt, erzählt sie von ihrem Mann Talant, von ihren Söhnen Taschboo und Elim, auf die sie stolz ist; auf Taschboo, weil er in die Fußstapfen der Eltern tritt, Medizin studiert, auf Elim, weil er seinen Abschluss im Gymnasium erfreulich gut absolviert hat. Beide seien Prachtjungen, die sich ungemein verantwortungsbewusst um die gemeinsame Wohnung kümmerten. Sie erzählt von den Familienfesten und dass zu wenig Zeit bleibe für ein Leben in Zuneigung mit Talant. Der kümmere sich, neben seinem Arztberuf in Tscholpan-Ata, um die Männerarbeit und das Ansehen der Familie, so wie es von einem Familienoberhaupt zu erwarten sei.
Elmira hört Mahabat gerne zu, die Berichte erfüllen sie mit der Sehnsucht nach einem eigenen Familienleben einerseits. Andererseits hat sie nach der Auseinandersetzung mit Sergej die Vermutung: Nur als Single genießt sie die Freiheit zu entscheiden, wie stark sie sich im Berufsleben engagieren will. Trotzdem: Mahabat gibt Elmira die Hoffnung, dass Beruf und Familie miteinander vereinbar sind.
Die zwei Frauen haben ein offenes Geheimnis, einen Plan, der fest steht, der vom tiefen inneren Willen der beiden und einer dritten Frau, Ainura, getragen wird. Ainura lebt im Winter in Karakol. Im Sommer betreibt sie ein Feriencamp auf einem Jailoo in Barskoon.
Alle drei Freundinnen sind entschlossen, ein Frauenhaus zu gründen. Ein Haus für Frauen, die mit den nach dem Ende der Sowjetunion wieder aufkommenden Traditionen in Konflikt geraten sind. Oft steht ein familiäres System der Repression hinter den Betroffenen.
Aus dieser Gemeinsamkeit und freundschaftlichen Beziehung heraus war es für Elmira selbstverständlich, mit Mahabat die Situation ihrer Patientin Aziza zu besprechen. Sie erzählte Mahabat von ihren Beobachtungen, äußerte ihre Sorgen bezüglich der Verschlossenheit Azizas, darüber, dass sie das Gefühl hat, dass mehr dahinter steckt, als die Krankheit.
Mahabat konnte nicht mehr dazu sagen, als dass nur Geduld dazu führe, zu den Problemen vorzustoßen. Die Patientin müsse den Zeitpunkt ihrer Öffnung selbst bestimmen. Alles, was man machen könne, sei, einen günstigen Boden zu bereiten, damit Aziza überhaupt in der Lage sei, über sich zu reden, ihr also Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.
Sie habe ein schlechtes Gewissen Aziza gegenüber, sagte Elmira, habe eben nicht genug Zeit, sich auf sie wirklich einzulassen. Ihre Haupttätigkeit als Kinderärztin beanspruche sie sehr stark, damit verdiene sie nun mal in erster Linie ihren Lebensunterhalt.
Wie immer hilft Elmira Aziza in den Rollstuhl, schiebt das Gefährt über den, an einigen Stellen mit Beton ausgebesserten Kachelboden im Flur des Kurgebäudes, dessen russischer Baustil der Jahrhundertwende trotz des Verfalls noch erkennbar ist. Elmira lenkt den Rollstuhl vorsichtig über die Rampe hinter dem Ausgang hinunter auf die Straße, vorbei an einem unmöglich befahrbaren Engpass, der schon seit Beginn ihrer Tätigkeit in der Klinik darauf wartet, repariert zu werden. Dann steuert sie über den holprigen von Schlaglöchern zersetzten Beton, bis sie und Aziza die andere Seite des Flusses im Park erreicht haben. Dort bietet der unebene aber trockene Waldboden einen sanfteren Untergrund für den Rollstuhl und eine ruhigere Fahrt unter den schattigen Bäumen zwischen den aufstrebenden Bergen und dem Fluss.
>Ich habe eine Freundin. Sie heißt Ainura,< beginnt Elmira zu erzählen. >Sie ist eine starke Frau, leitet ein Feriencamp im Sommer, arbeitet in Karakol im Rest des Jahres, sie macht das allein ohne Mann. Das Schicksal hat es ihr schwer gemacht, war nahe daran, ihr alle Kraft zu rauben, als das mit der Brautentführung geschah. Sie legte den Jooluk nicht an, blieb standhaft gegen ihre Entführer, ließ sich auch nicht unterkriegen, als ihre Familie ihr die Unterstützung versagte. Sie verweigerte sich einer erzwungenen Heirat. Sie veränderte ihr Leben und ist jetzt eine geachtete Frau.<
Aziza hört Elmira zu. Elmiras Schilderung beeindruckt sie. Ihre Augen weiten sich, sehen die wiederholt aufschäumende Gischt des reißenden Flusses, nehmen wahr, dass diese Kraft sich in einem andauernden Prozess erneuert und den Gegensatz bildet zu der sanften Ruhe, die das Rauschen des Waldes auf der anderen Seite des Tales hinterlässt. Aziza fühlt, was Elmira ihr geben kann, es sind Kraft und Ruhe. Kraft und Ruhe werden ihr helfen, über das hinweg zu kommen, was sie, Aziza, ihrer Familie mit ihrer Krankheit angetan hat, werden ihr ermöglichen, die Verachtung zu ertragen, die sie gegen sich selbst empfindet. Sie fühlt sich wertlos, als Schande für ihre Familie. Sie will stark sein, dagegen ankämpfen.
>Du musst jetzt weiter im Bett bleiben. Du hast eine Lungenentzündung und Fieber. Damit muss man vorsichtig sein.< Die Wadenwickel zur Senkung des Fiebers sollten bei dem kleinen Tairbek regelmäßig ausgewechselt werden, solange bis das Antibiotikum wirke, erklärt Elmira dem Leiter des Kinderheims, Markian Kasapajev. Markian nickt respektvoll. Aus Erfahrung weiss er, dass die Kinderärztin Elmira Erketava bezüglich ihrer Diagnosen und Anweisungen eine verlässliche Mitarbeiterin ist. Er weiß, dass sie ebenso sorgsam mit den Kindern im Heim umgeht, wie mit den Wolfswelpen, die sie großgezogen hat und die mittlerweile ausgewachsene gesunde Wölfe sind. Auch jetzt noch, von Zeit zu Zeit, Markian hatte Elmira schon einmal begleitet, besucht Elmira ihre Findelkinder in einem Tierheim in Bosteri. Dort hat sie ein gutes Verhältnis zu Alexander, der das Tierheim in den Bergen betreibt.
Die drei Welpen wurden alleine in ihrer Wolfshöhle gefunden. Der Tschaban Sandscharbek Duschebajev hatte seine Schafe in der Nähe, oben in den Bergen, geweidet, hatte den Weideplatz gerade gewechselt, fand dort eine Blutspur, der er folgte und die ihn in die Höhle führte, die er nicht kannte. Vor der Höhle sah er etwas Graues liegen, erkannte sofort, dass es sich um einen Wolf handelte. Stellte dann fest, dass es eine Wölfin war, die durch eine Gewehrkugel getötet worden war. Er hörte in der Höhle leises Winseln, ging vorsichtig hinein, sah die Wolfsjungen dort liegen, höchstens zwei Wochen alt, zu jung, um selbst zu jagen, abhängig von den Zitzen der Mutter. Die kamen auf ihn zu, hatten Hunger, saugten an seinen Fingern. Sandscharbek Duschebajev schaute sich in der Umgebung um. Der Wolfsvater war nirgends zu sehen, hatte die Jungen vermutlich verlassen. So packte Sandscharbek die Welpen in ein Tuch, transportierte sie auf dem Pferd ins Tal, dachte erst daran die drei seinen Kindern mitzubringen, sodass die sie mit der Flasche hätten aufziehen können. Er verwarf dann den Gedanken, dachte an die Probleme, die entstehen würden, wenn die Wölfe älter geworden sein würden, dass die Kinder sich von den Wolfjungen würden trennen müssen und an den Schmerz, der damit verbunden sein würde.
Er entschloss sich, die Tiere direkt in andere Hände zu bringen, brachte die Wolfsjungen zu seiner Jurte, lud sie dort ins Auto und fuhr sie zum Tierheim in Bosteri.
Er habe sie gefunden, erklärte er, könne nichts mit ihnen anfangen, könne nicht verstehen, warum der Staat die Wölfe zum Abschuss freigebe, sich auf diese Weise der Probleme entledige, die die Wölfe erzeugten. Die wenigen Schafe, die von Wölfen gerissen würden, seien kein Grund, das natürliche Gleichgewicht und den Respekt vor der Kreatur zu zerstören.
Baltek, der Tierpfleger, der ihm zuhörte und durch Kopfnicken immer wieder zustimmte, informierte Elmira, die sich gerade hier aufhielt, um Alexander einen Besuch abzustatten. Sandscharbek Duschebajev knüpfte vor ihr das Tuch auf, in dem die Wolfsjungen zusammengekauert lagen. Wie schon bei Sanscharbek machten sich die Jungen über Elmiras Finger her, um Nahrung zu finden. Elmira nahm eines der Wolfsjungen auf den Arm, merkte wie es sich an sie schmiegte, um die Körperwärme zu spüren. Sie fühlte, dass sie bereit war, Mutter einer Wolfsfamilie zu werden und sich um die drei zu kümmern.
Alexander wies Elmira einen Käfig zu. Hier konnten die Welpen bleiben. Elmira zog sie mit der Milchflasche auf, vergaß zuweilen, dass sie nicht selbst die Wolfsmutter war.
Das altersschwache Taxi hält in der Gagarin Straße an, direkt vor dem Haus aus der Jahrhundertwende, das zur Zarenzeit eine repräsentative Villa gewesen sein musste. Nun wirken die Pracht vergangen, die Holzfassade verwittert, das kunstvoll geschwungene Geländer des Balkons brüchig und verrostet, die großen Fenster blind. Ganz anders als die schräg gegenüber liegende hölzerne orthodoxe Kirche, die in frischen Farben einen Kontrast zum rings umher fortschreitenden Verfall der Häuser bietet.
Elmira wirft dem Taxifahrer einen freundlichen Blick zu, reicht ihm das Geld für die Fahrt, passiert den kleinen, von bunten Zinnien geschmückten Vorgarten, öffnet die hölzerne Eingangstür. Sie geht die alte, knarrende Holztreppe hinauf in den ersten Stock, hält sich dabei an dem vibrierenden Geländer fest. Sie tritt in Sergejs Wohnung, setzt sich auf das noch ungemachte Bett. Sergej ist nicht da. Er muss schon abgereist sein, nach Bischkek.
Traurigkeit, eine Mischung aus Verachtung und Sehnsucht, kommt in ihr auf, macht es ihr unmöglich das Chaos im Kopf, den Wechsel zwischen Stillstand und Rasen der Gedanken, in den Griff zu bekommen.
Eine Weile verbringt Elmira liegend auf dem Bett. Sie kann nicht sagen, was in ihr vor sich geht, sie merkt nur, dass wieder Überlegungen bezüglich ihrer Zukunft einsetzen.
Es wird Zeit brauchen, bis sie diese Wohnung vergessen haben wird, diesen Raum, Inbegriff des Zusammenlebens zwischen Sergej und ihr, Liebesnest, das ihr Geheimnis war, das ihnen alleine gehörte, das Schutz bot vor dem Zynismus derer, die ihr Tun als unmoralisch, als völlig inakzeptabel deklariert hätten.
Elmiras Eltern hätten für eine Beziehung zwischen ihr und einem Russen von vorne herein kein Verständnis gehabt. Eine Kirgisin müsse einen Kirgisen heiraten. Dies ist die Einstellung ihres Vaters, der an und für sich modern denkt, für den die Vermischung der Volksgruppen während der Sowjetunion aber immer schon zu weit ging, auch wenn er überzeugter Anhänger der Kommunistischen Partei war. Und eine sexuelle Beziehung vor der Ehe verbot sich ohnehin von alleine.
Jetzt hat das Versteckspiel ein Ende, das Doppelleben zwischen der elterlichen Wohnung einerseits, wo Elmira, so wie es die Tradition verlangt, trotz ihrer dreißig Jahre, bis zu ihrer Hochzeit ihr zu Hause haben wird. Und andererseits Sergejs Wohnung, wo ihre Beziehung zu diesem Mann, den sie liebte, vielleicht noch immer liebt, der sie dazu brachte, gegen die Konventionen zu verstoßen, mehr oder weniger unbemerkt vonstatten gehen konnte. Das ist die gute Nachricht.
Und zur guten Nachricht gehört auch, dass Elmira bereit ist, ihre Einstellungen und Pläne weiter zu verfolgen, sie nicht, mir nichts, dir nichts, auf zu geben.
Aber den Schmerz kann sie nicht verleugnen, das Gefühl, vielleicht doch einen Fehler gemacht zu haben
Ainura
Ainura wechselt ein paar Worte mit Dinara, der Verkäuferin des Standes im Basar, an dem sie, immer wenn sie in die Stadt kommt, Obst und Gemüse einkauft. Dinara lacht. Die abgearbeiteten, faltigen Hände graben sich tief in die Kisten mit Aprikosen, Pflaumen, Zwiebeln und Möhren, füllen alles in eine schlecht bedruckte Plastiktüte, legen noch einen Salat dazu, übergeben die Tüte nun an Ainura. Die reicht Dinara einige Geldscheine und erhält andere Geldscheine zurück.
Ainura verlässt den Basar durch einen unverputzten Durchgang aus grobem Beton, in dem sich weitere Verkäufer drängen. Sie bieten Haushaltswaren aus Plastik an. Zwei Kinder, barfuß, freudig schreiend, einen im Spiel hochspringenden Hund verfolgend, kommen ihr entgegen. Ainura biegt hinter dem Durchgang nach rechts ab, passiert ein kleines schmuckloses Restaurant, vor dem zwei alt erscheinende Männer sitzen. Auf dem Kopf tragen sie den traditionellen Kalpak in würdiger Pose. Ainura gelangt durch den nächsten Hauseingang in einen Hinterhof. Von dort führt eine im Bau befindliche Treppe in den 1. Stock. Ein Plakat mit der Aufschrift „Kirgiz Turist Barskoon“ an der Eingangstür eines Raumes weist auf die Funktion als Touristenbüro hin. Ainura tritt ohne anzuklopfen ein. Sie wirft einen grüßenden Blick zu Jamira, die hier arbeitet und neben einem als Schreibtisch dienenden Esstisch steht. Jamira lächelt Ainura zu. Eine junge Frau sitzt auf einer mit Prospekten und Flugblättern überhäuften Couch. Ainura ist froh, endlich nach vier Tagen wieder einen Gast im Jurtencamp aufnehmen zu können.
>Ich bin Ainura. Willkommen in Barskoon.<
Die junge Europäerin schaut sie unsicher lächelnd an, grüßt sie kaum hörbar.
>Wir können gleich losfahren, dann kommen wir noch vor Dunkelheit auf dem Jailoo an,< sagt Ainura weiter in gebrochenem Englisch.
Ainura und die Reisende überqueren die staubige Straße in Richtung eines heruntergekommenen Betonkiosks. Davor sitzen ein Dutzend Männer mit lethargischen Gesichtern. Die beiden Frauen beeilen sich, um noch vor den drei Reitern und dem klapprigen Bus, die sich auf der Straße ein Wettrennen zu liefern scheinen, die gegenüber liegende Straßenseite zu erreichen.
Der Kofferraumdeckel schnellt nach oben, die Europäerin lässt ihren Rucksack in Ainuras Toyota verschwinden. Beide Frauen nehmen im Auto Platz. Die Fahrt führt ein Stück auf der Fernstraße zurück, auf der die Reisende mit dem Bus aus Balyktschi angekommen ist. Die Frauen fahren eine gute Strecke entlang dem Issyk-Köl, bis sie auf einem holprigen Weg, eine Staubfahne hinter sich herziehend, auf das gewaltige Massiv des Tien-Schan zusteuern.
>Woher kommst Du?< fragt Ainura.
>Is Germania. Aus Deutschland,< versucht sich die Reisende in Russisch.
>Warum reist Du ganz alleine?<
Die Europäerin zögert. >Ich habe hier in der Gegend beruflich zu tun, habe niemanden gefunden, der mit mir reisen wollte,< sagt sie jetzt auf Englisch. >Da bin ich eben allein unterwegs.<
>Was ist Dein Beruf?< will Ainura wissen.
Die Europäerin dreht den Kopf zum Fenster, antwortet nicht. Beide Frauen schweigen.
>Dort oben, wo du die drei weißen Punkte siehst, dort müssen wir hin, das sind die Jurten, in denen wir leben. Der weiße Punkt links, das ist deine Jurte.<
>Sieht aus, als wäre es sehr einsam gelegen,< sagt die Reisende.
>Ist es auch, aber wunderschön.<
Der klappernde Toyota meistert das Auf und Ab des kaum noch erkennbaren Fahrweges erstaunlich gelassen.
Aksana eilt aus einer der Jurten als das Auto hält und die beiden Frauen aussteigen.
>Salamdasuu. Willkommen,< sagt Aksana auf Kirgisisch. >Menja sobut Aksana, ich heiße Aksana,< setzt sie auf Russisch hinzu.
>Ya Karen,< ist die Antwort.
>Aksana ist meine Freundin und Köchin,< vervollständigt Ainura das Begrüßungszeremoniell. >Hier drüben ist also deine Jurte. Du hast sie für dich ganz allein.<
Ainura führt Karen den kleinen Trampelpfad zu ihrer Unterkunft hinauf, öffnet die kleine Holztür, rollt eine Bastjalousie hoch, schiebt einen Vorhang zur Seite, der eigentlich die Verlängerung eines der Schafsfelle ist, die die ganze Jurte bedecken, fordert Karen auf einzutreten. Karen staunt über die Größe des Innenraumes. Die mit bunten Teppichen verhängten Wände bringen Behaglichkeit in das Rund, an dessen Seite ein kleiner Holztisch steht, in dem an einer anderen Stelle ein Stapel Decken liegt und am Boden ein aus solchen Decken gefertigtes Nachtlager bereitet ist.
>Die Decken sind warm. Du wirst nicht frieren. Wasser findest du vor der Küche und am Badehaus.< Ainura deutet in die Richtung einer anderen Jurte über deren Dach aus einem Ofenrohr Qualm aufsteigt und vor der ein mobiles Waschbecken steht. Daneben eine Lehmhütte, umgeben von überdeckten, gegen das Wetter geschützten Brennholzstapeln.
>Komm herein,< sagt Ainura. >Setz’ dich. Das Essen ist fertig.<
Aksana war gegangen, um Karen zu holen, hatte an ihre Jurtenwand geklopft, hatte bedeutet, dass das Abendessen in der Küchenjurte bereit steht. Karen folgte Aksana den kleinen Trampelpfad hinunter, wo sie durch die offene Tür der Jurte Ainura erkennen konnte, wie sie etwas trägt und irgendwo abstellt.
Karen und Aksana treten ein. Aksana weist Karen einen Platz hinter dem kurzbeinigen Esstisch zu. Karen kniet sich auf eine Sitzdecke am Boden, sodass die Tischhöhe zum Essen wieder passt.
Ainura nimmt die Form mit dem frisch gebackenen Brot aus dem kleinen eisernen Backofen, dessen noch glimmende Glut eine angenehme Wärme im Innenraum der Jurte verbreitet und die Behaglichkeit der kräftigen Farben, eingewoben in zahlreiche Wand- und Bodenteppiche, noch verstärkt.
>Das frische Brot ist eine besondere Delikatesse, wenn man es zur Schurpa isst,< sagt Ainura, während sie Suppe aus einem großen Topf mit einer Kelle in die vor Karen stehende Tonschale schöpft. Sie lässt sich sichtbar geschmeidiger auf ihrer Sitzdecke nieder, als es Karen vorher gelungen ist. Karen hat mittlerweile die Beine unsicher zur Seite geschoben, kämpft mit der ungewohnten Sitzhaltung.





























