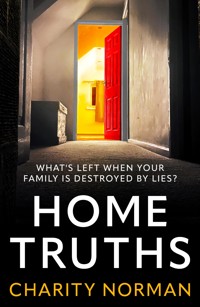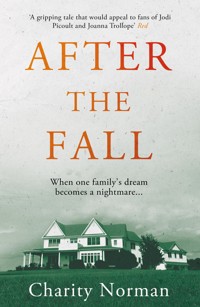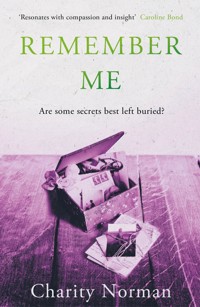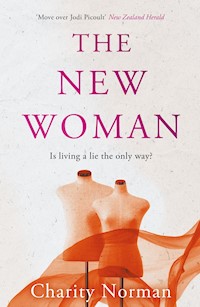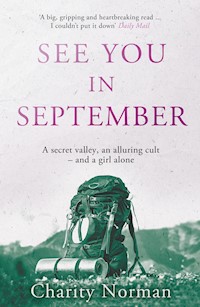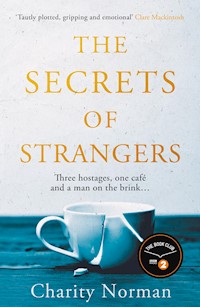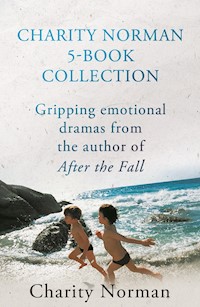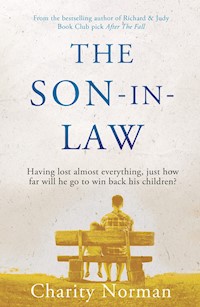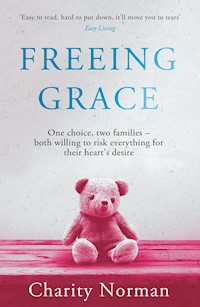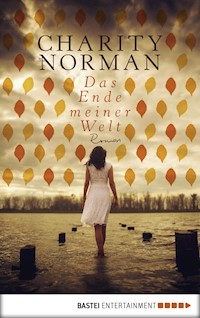
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim Backpacken in Neuseeland steigt die Studentin Cassy in ein Auto voller lächelnder Fremder - und landet im Paradies: in Gethsemane, einer Selbstversorger-Gemeinschaft am idyllischen Lake Tarawera. Hier führen die Leute ein nachhaltiges Leben, und alle sind zutiefst glücklich. Cassy lässt sich immer mehr auf die Gemeinschaft ein und entfernt sich dabei Stück für Stück von ihrem alten Leben. Als ihre Familie bemerkt, dass sie Cassy an eine zerstörerische Sekte zu verlieren droht, ist es bereits zu spät ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
PROLOG
EINS
Das Handbuch des Sektenführers
ZWEI
Das Handbuch des Sektenführers
DREI
VIER
Das Handbuch des Sektenführers
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
Das Handbuch des Sektenführers
ZEHN
ELF
Das Handbuch des Sektenführers
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
Das Handbuch des Sektenführers
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
Das Handbuch des Sektenführers
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
Das Handbuch des Sektenführers
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
Das Handbuch des Sektenführers
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
EINUNDFÜNFZIG
ZWEIUNDFÜNFZIG
DREIUNDFÜNFZIG
VIERUNDFÜNFZIG
FÜNFUNDFÜNFZIG
SECHSUNDFÜNFZIG
SIEBENUNDFÜNFZIG
DANKSAGUNG
Über das Buch
Es sollte nur eine kurze Auszeit in Neuseeland sein. Doch dann entdeckt die Studentin Cassy das Paradies auf Erden: ein idyllisches Tal am Lake Tarawera, weitab jeder Zivilisation. Hier führen die Menschen ein friedliches und nachhaltiges Leben, und alle sind zutiefst glücklich. Cassy lässt sich immer mehr auf die Gemeinschaft ein und entfernt sich dabei Stück für Stück von ihrer Vergangenheit. Als ihre Familie bemerkt, dass sie Cassy an eine zerstörerische Sekte zu verlieren droht, ist es bereits zu spät …
Über die Autorin
Charity Norman wurde in Uganda geboren und ist in England aufgewachsen. Nach mehrjährigen Reisen wurde sie Anwältin mit den Spezialgebieten Straf- und Familienrecht. 2002 zog sie sich aus dem Berufsleben zurück, um mehr Zeit für ihre drei Kinder zu haben. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie in Neuseeland und schreibt mit großem Erfolg Romane.
CHARITY NORMAN
Das Ende meiner Welt
Roman
Aus dem Englischen von Sylvia Strasser
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Charity NormanTitel der britischen und australischen Originalausgabe: »See You in September«Originalverlag: Allen & Unwin
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnTitelillustration: © Trevillion Images/Jake Olson; © FinePic/shutterstockUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5008-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für George, Sam und Cora Meredith –in Liebe
Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von jenen, welche die Musik nicht hören konnten.
Friedrich Nietzsche zugeschrieben
PROLOG
Diana
März 2016
Wie der Schauplatz eines tödlichen Vorfalls sieht das hier nicht aus. Eher wie das Paradies. Holzhütten liegen verträumt im herbstlichen Sonnenschein, Ziegen weiden am Ufer eines plätschernden Sees. Sogar die mit einem üppigen grünen Pelz bedeckten Hügel wirken friedlich. Nicht ein einziger von Menschen gemachter Laut ist zu hören: nur das ferne Glucksen eines Flusses, das Trillern und Pfeifen von Vögeln. Der bläuliche Dunst idyllischen Friedens liegt über dem Tal.
Ein Paradies.
Oder auch nicht. Glänzendes buntes Plastik flattert sacht zwischen Büscheln von Neuseelandflachs. Absperrband der Polizei – das muntere, schrille Souvenir einer Tragödie. Wer genau hinsieht, entdeckt weitere Hinweise. Leere Gebäude, Markierungspflöcke am Strand. Sie weiß, dass die Polizei hier wochenlang campiert hat. Tauchereinheiten suchten den See ab, Hundestaffeln durchkämmten die schattigen, dicht bewachsenen Falten des Buschlandes. Sogar eine Drohne für Luftaufnahmen wurde eingesetzt. Sie stellt sich vor, wie die Beamten, völlig deplatziert in ihren schweren Stiefeln, herumstapfen und versuchen, Menschen, die nichts anderes als vergessen wollen, mit schmeichelnden Worten oder Drohungen zu Aussagen zu bewegen.
Bis vor ein paar Jahren hatte Diana noch nie von Justin Calvin gehört. Sie hätte nicht mal im Traum daran gedacht, dass Ereignisse in einem Tal am anderen Ende der Welt derart dramatische Auswirkungen auf ihre Familie haben könnten. Sie und Mike waren damals ein ganz normales Ehepaar, länger verheiratet als der landesweite Durchschnitt, nicht reich, aber auch nicht arm. Sie hatten seine Zeit bei der Armee unbeschadet hinter sich gebracht, und sie besaßen eine aus rotem Backstein erbaute, stuckverzierte Doppelhaushälfte in South London. Fast alle ihre Sorgen und Hoffnungen drehten sich um ihre beiden Töchter, den Mittelpunkt ihres Lebens. Aber keine von beiden bereitete ihnen ernsthaft Kummer. Taras Schulverweis wegen Rauchens hinter der Turnhalle war kaum als ernst zu nehmende Sorge zu bezeichnen.
Nichts, absolut nichts hatte auf die kommenden Ereignisse hingedeutet.
Von den Hütten dringen plötzlich Klänge herüber, klar und kraftvoll und gänzlich unerwartet. Jemand spielt Klavier, rieselnde komplizierte Triolen, in die eine eindringliche Melodie eingeflochten ist. Zwei Fächerschwänze flattern um Dianas Kopf herum, auf und nieder, als ließen sie sich von den Klängen tragen. Nach dem schweren Verlust scheint die Musik an diesem eigenartigen, wunderschönen Ort Ausdruck einer abgrundtiefen Traurigkeit zu sein. Sie rührt Diana zu Tränen.
Sie hat ein Foto von Cassy, das kurz vor ihrem Abflug von Heathrow aufgenommen wurde. Ein letztes Foto. Ein letztes Lächeln. Ein Schmetterling im Glaskasten. Viel Spaß!, haben sie alle geschrien, als auf den Auslöser gedrückt wurde. Nimm dich vor den Killer-Kiwis in Acht! Diana verwendet das Bild als Bildschirmschoner. Ihrer ältesten Tochter gilt ihr erster Gruß am Morgen und ihr letzter am Abend, und dazwischen sagt sie ihr noch hundert Mal Hallo.
Sie liebt die junge Frau, die ihr vom Computerbildschirm entgegenlächelt, sie ist ihr vertraut und … na ja, sie ist eben Cassy. Sinnlich, langbeinig, schnell errötend. Ein dicker Zopf hängt ihr über die eine Schulter, der Riemen einer Flugtasche liegt über der anderen. Ihre Nase ist ein kleines bisschen krumm, seit sie ihr von einem verirrten Hockeyball gebrochen wurde. Aber die dunkelblauen Augen und die geschwungenen Wimpern haben etwas Faszinierendes. Ihre Augenwinkel zeigen leicht nach unten, ihr Gesichtsausdruck hatte immer schon etwas Wehmütiges, so, als wüsste sie etwas, was andere nicht wissen.
Mein Gott. Haben wir wirklich Witze über Killer-Kiwis gemacht?, denkt Diana. Wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt, hätte ich sie angefleht, nicht in dieses Flugzeug zu steigen!
Der Vulkan auf der anderen Seite des Sees ist ein schlafender Riese. Die friedliche Atmosphäre übt eine geradezu hypnotische Wirkung aus. Die Seele kommt zur Ruhe, die Atmung verlangsamt sich unwillkürlich. Kein Wunder, dass die Medien regelrecht besessen sind von dieser grandiosen Wildnis. Kein Wunder, dass die Polizei sich schwertat mit ihren Ermittlungen. Kein Wunder, dass die Nation immer noch wie gelähmt ist und die Frage nach dem Schuldigen sie immer noch beschäftigt.
Diana hat sich die gleiche Frage oft selbst gestellt. Im Lauf der Jahre ertappte sie sich immer wieder dabei, wie sie innehielt. Einfach mittendrin innehielt. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit oder will die Katze füttern. Stattdessen ist sie weit weg, ihre Arme hängen schlaff herunter, ihr Blick richtet sich in die Vergangenheit.
Als ob man dabei zusieht, wie eine Milchflasche herunterfällt. Sie rollt über die Tischplatte und über die Kante und fällt wie in einer albtraumhaften Zeitlupe, und dennoch kann man nur machtlos dabei zuschauen. Es gab einmal eine Zeit, da war die Familie heil, und dann kam der Absturz, der harte Aufprall. Milch und Glasscherben überall auf den Fliesen. Und dazwischen ein Augenblick, wo sie sie hätte auffangen können.
EINS
Diana
Juli 2010
Die letzten Minuten in Cassys Zimmer waren eine so kostbare Erinnerung. Nicht mehr lange, dann würden sie sie zum Flughafen fahren. Aber es herrschte keine gedrückte Stimmung, schließlich fuhr sie nur in die Ferien. Sie würde zurück sein, ehe sie es sich versahen.
Diana hörte Gelächter und steckte den Kopf durch die Tür. Da waren sie, ihre beiden Töchter, die eine einundzwanzig, die andere fünfzehn, beide größer als ihre Mutter. Cassy hatte alles, was sie mitnehmen wollte, auf den Fußboden geworfen und versuchte jetzt, das ganze Zeug in ihren Rucksack zu stopfen. Tara lag auf dem Bett, die dunklen Haare wie ein Fächer auf dem Kissen ausgebreitet, und hörte Musik aus ihrem Smartphone. Für Diana hörte es sich blechern und sinnfrei an, aber über Geschmack ließ sich bekanntlich nicht streiten.
»Mum«, rief Tara, »sag ihr um Himmels willen, dass sie viel zu viele Socken mitnimmt!«
Diana setzte sich auf die Bettkante und warf einen flüchtigen Blick auf ihr Spiegelbild, das ihr ein gerötetes Gesicht und einen grauen Haaransatz zeigte. Ungepflegt, dachte sie ohne Bedauern. Man kann es nicht anders nennen. Egal. Wenn es sein musste, konnte sie sich immer noch aufbrezeln.
Tara setzte sich auf und tat so, als hielte sie mit beiden Händen einen Kochlöffel und rühre in einem Kessel um. »Wann werden wir drei uns wiedersehen?«, krächzte sie mit Hexenstimme. »Bei Donner, Blitz …«
»Am 3. September«, fiel Cassy ihr ins Wort. Sie bückte sich und zog drei Paar Socken aus ihrem Rucksack. »Der Flieger landet vierundzwanzig Stunden vor Imogens Trauung.«
»Ich finde, das ist ganz schön knapp«, bemerkte Diana.
»Ja, das sagt Imogen auch. Sie ist ganz besessen von dieser Hochzeit. Von dem armen Jack redet sie überhaupt nicht. Als ob er bloß eine Randfigur wäre.«
»So schlimm ist es bestimmt nicht.«
Cassy zog eine Schnute. »Sie sagt, ich darf auf keinen Fall schön braun werden.«
»Das ist nicht dein Ernst!« Tara schnappte nach Luft. »Dieses Brautmonster!«
»Du sagst es. Sie will keine sonnengebräunte Göttin als Brautjungfer neben sich haben, weil sie sonst so käsig aussieht.«
»Sag ihr, sie soll so tun, als ob. Sich irgendwas ins Gesicht schmieren. Sie wird ihr ganzes Eheleben lang so tun als ob.« Tara zog vielsagend die Brauen hoch.
Diana gab sich schockiert, aber ihre Töchter machten sich über sie lustig. »Wir haben 2010, Mum, nicht 1810!« Wenn die beiden sich verbündeten, waren sie ein fantastisches Team.
»Hab ich dir die Kleider der Brautjungfern schon gezeigt?«, fragte Cassy. »Grauenvoll! Warte mal.« Sie griff zu ihrem Handy und wischte durch die Fotos, bis sie das richtige gefunden hatte: Das Kleid war ein grelllila Albtraum mit Puffärmeln.
»Nicht gut«, stöhnte Tara und schirmte ihre Augen ab. »Gar nicht gut! Oje, oje, oje!«
Cassy starrte bestürzt auf das Foto. »Becca ist blass und klapperdürr, für sie sind das Kleid und die Farbe ideal. Ich werde darin aussehen wie Barney, der Dinosaurier.«
»Zahl es ihr doch heim«, schlug Diana vor. »Heirate Hamish, und lass Imogen einen orangeroten Overall tragen.«
»Eine geniale Idee! Aber ans Heiraten möchte ich noch nicht denken, Mum. Wir sind viel zu jung dafür.«
»Stimmt«, pflichtete Tara ihr bei. »Andererseits, ein Spatz in der Hand … Hamish sieht nicht übel aus, er hat Geld wie Heu, und – ganz großes Plus – Dad mag ihn.«
Diana lauschte aufmerksam. Sie traute sich nur selten, Cassy auf ihr Privatleben anzusprechen, aber Tara konnte sich das anscheinend erlauben.
Cassy ging in die Hocke und stopfte einen Waschbeutel mit beiden Händen in den Rucksack. »Ich glaube, manchmal geh ich ihm auf die Nerven. Unsere Interessen sind einfach zu unterschiedlich.«
»Du meinst, er ist kein Ökofreak wie du und Grandma Joyce«, spottete Tara. »Ich meine – Gott bewahre! –, am Ende trinkt er noch Kaffee, der nicht von einer Kooperative einbeiniger Frauen in Kolumbien angebaut wurde! Was für ein elender Mistkerl!« Sie gähnte und streckte ihre knochigen Arme. »Wir können nicht alle so gefühlsduselig sein wie du, Cass. Oh mein Gott, das ist richtig unheimlich! Deine Tür geht von ganz allein auf!«
Cassy und ihre Mutter drehten sich Richtung Tür, die sich gerade so weit öffnete, dass der Kater hindurchpasste.
»Pesky!« Cassy hob ihn hoch und gab ihm einen Kuss auf den Kopf. »Schleich dich doch nicht so an!«
»Er wird allmählich ganz schön pummelig«, sagte Diana.
Cassy hielt dem Kater die Ohren zu. »Mecker nicht dauernd an seinem Körper rum! Willst du, dass er eine Essstörung entwickelt?«
Als sie mit ihrer Freundin Becca in einer stürmischen Nacht von einer Party nach Hause gegangen war, hatte sie ein klägliches Miauen gehört, das aus einem Altkleidercontainer kam. Als sie den Deckel zurückschob, entdeckte sie ein schwarz-weißes Fellbündel, das jemand zwischen die Säcke mit gebrauchten Sachen geworfen hatte. Sie stemmte sich am Rand des Containers hoch. Becca hielt sie an den Beinen fest, während sie sich kopfüber hinuntergelassen hatte. Dann hatte sie das halb verhungerte Kätzchen in ihren Pullover gewickelt und mitgenommen. Drei Jahre später wäre niemand auf die Idee gekommen, dass der gepflegte König des Hauses nur mit knapper Not dem Hungertod entronnen war.
»Dad hält gar nichts von dieser Reise«, sagte sie, als Pesky sich aus ihrem Griff gewunden hatte. »Heute Morgen hat er wieder davon angefangen. Ich solle lieber ein Praktikum machen, anstatt in der Weltgeschichte herumzugondeln.«
Tara schnaubte. »So ein Spießer!«
Diana pflichtete ihr insgeheim bei, wenngleich sie das nie zugeben würde. Mikes im Vorjahr verstorbener Vater hatte alle seine Enkel in seinem Testament mit einer hübschen Summe bedacht. Cassy sparte das meiste, aber für diese Reise hatte sie keine Kosten gescheut – schließlich, so hatte sie traurig festgestellt, sei es ihr letztes Abenteuer, bevor sie in der gefürchteten Tretmühle der Arbeit landen würde. Sie und Hamish würden vierzehn Tage als Freiwillige in einer Wildtierstation in Thailand arbeiten, sich danach ein paar Tage am Strand entspannen und dann zu einer Tour durch Neuseeland aufbrechen.
»Ich bin startklar.« Cassy richtete sich auf und hüpfte ein paarmal auf und ab, um das Gewicht des geschulterten Rucksacks zu testen.
»Reisepass?«, fragte Diana.
»Hab ich.« Cassy stieß ihr Handgepäck mit dem Fuß an.
»Kreditkarte? Insektenschutzmittel? Handy?«
»Hab ich, hab ich, hab ich.«
»Kondome?«, fragte Tara.
Diana unterdrückte ein Schmunzeln. Cassy lief knallrot an und seufzte, ihre Schwester sei wirklich oberpeinlich.
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt verspürte Diana ein leises Unbehagen – ein flüchtiges, undefinierbares, sofort unterdrücktes Gefühl. Es gab keinen Grund zur Sorge. Nicht den geringsten. Schließlich zog es Tausende Studenten, ihren Lonely-Planet-Reiseführer im Rucksack, jedes Jahr als Backpacker in die Ferne.
»Na dann.« Sie stand auf. »Noch eine schnelle Tasse Tee, bevor wir starten?«
Die ganze Familie einschließlich Dianas Mutter Joyce, die in einem nahe gelegenen Seniorenheim wohnte und immer für einen Ausflug zu haben war, brachte Cassy zum Flughafen London Heathrow. Alle waren gut gelaunt, als Mike auf die Autobahn einbog. Die Mädchen sangen die Songs im Radio mit. Joyce war eingenickt.
Cassy, die auf der Rückbank saß, flocht sich ihre kastanienbraunen Haare zu einem Zopf. Ein paar Strähnen ließen sich allerdings nicht bändigen. Sie trug Jeans und ein graues T-Shirt und hatte sich einen Pulli um die Taille gebunden.
Dann machte Tara, die zwischen ihrer Schwester und ihrer schlafenden Großmutter saß, den Mund auf, und der Ärger fing an. Sie hatte es nicht absichtlich getan. Es war reine Gedankenlosigkeit.
»Hey, Cass«, sagte sie, »ich hab gehört, du willst dein Jurastudium an den Nagel hängen.«
»Blödsinn!«, entgegnete Cassy schnell und scharf, aber Tara verstand den Wink nicht.
»Komisch, Tillys Bruder hat nämlich erzählt, du hättest schon mit deinen Studienleitern gesprochen und so.«
Mike schaltete das Radio aus. Schluss mit der Musik und dem Gesinge. Diana wappnete sich innerlich.
»Was sagst du da?«, fragte er.
»Hör nicht auf sie«, erwiderte Cassy. »Das ist dummes Zeug. Ehrlich. Tillys Bruder ist ein Idiot.«
»So? Hört sich aber nicht so an.«
»Sch«, murmelte Diana und drückte seinen Arm. »Komm schon, Mike. Nicht jetzt. Nicht heute.«
Aber er ließ nicht locker. »Cassy?« Seine Stimme war zu laut.
Diana drehte leicht den Kopf nach hinten. Cassy kaute an ihrem Daumennagel wie eine Sechsjährige. Tara verzog gequält das Gesicht und formte mit den Lippen lautlos sorry!
»Ich habe nur über Alternativen nachgedacht«, sagte Cassy.
»Und warum, zum Teufel?« Mike hob beide Hände und ließ sie aufs Lenkrad heruntersausen, dass es knallte. »Ich glaub das einfach nicht! Du hast nur noch ein Jahr, bis du fertig bist. Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass du alles hinschmeißen willst!«
»Ich hab nur gedacht, dass es vielleicht ein Fehler war, Jura zu studieren. Dass ich mir vielleicht etwas anderes hätte aussuchen sollen. Ich bin mir nicht sicher, dass ich wirklich Anwältin werden will.«
»Das ist doch nicht zu fassen!« Mike schnaubte und schüttelte den Kopf. »Eine hervorragende Studentin wie du!«
»Lass es gut sein«, sagte Diana warnend. Wieder drückte sie seinen Arm, fester dieses Mal, aber es nützte nichts.
»Welche Kurse hast du dir für September noch mal ausgesucht? Unternehmensrecht, Immaterialgüterrecht …«
Cassy seufzte. »Arbeitsrecht. Wettbewerbsrecht.«
»Richtig.« Mike sah seine Tochter im Innenspiegel an. »Nächstes Jahr um diese Zeit könntest du den Vertrag für ein Praktikum bei einem großen Unternehmen in der Tasche haben. Du könntest für den Rest deines Lebens ausgesorgt haben.«
»Genau das ist es, was mir Sorge macht«, erwiderte Cassy trocken. »Dieses Lebenslängliche.«
»Was sagt denn Hamish dazu?«
»Er hält mich für verrückt.«
»Dann hat er mehr Verstand als du. Wir sind keine Millionäre, deine Mutter und ich.«
»Das weiß ich.«
»Wir können dich nicht ewig unterstützen, so gern wir das auch täten. Aber das geht einfach nicht.«
»Das erwarte ich auch nicht.«
Mike nörgelte den ganzen Weg bis nach Heathrow. Diana bemühte sich vergeblich, ihn zu besänftigen. »Es gibt so viele Unsicherheiten … Man kann nicht von Luft leben … Ich bin nicht Soldat geworden, weil ich die Army so liebe, sondern weil es ein sicherer Beruf mit einer anständigen Pension war …« So ging es in einem fort.
»Willst du als Hamburger-und-Fritten-Verkäuferin enden?«, herrschte er seine Tochter an.
»Nein.«
»Na also! Das Leben ist ein Kampf. Fressen oder gefressen werden! Du wirst nicht weit kommen, wenn du deine Ellenbogen nicht gebrauchst. Millionen Uni-Absolventen stehen ohne Job auf der Straße.«
»Lass sie doch in Ruhe, Himmel noch mal!«, mischte sich Tara ein. »Es ist ihr Leben. Wen interessiert es, ob sie bei McDonald’s Hamburger verkauft?«
»Du hältst dich da raus, Tara!«
»Ich hab mich nur wegen eines Studienwechsels erkundigt«, sagte Cassy weinerlich. »Ich hab mich nur erkundigt. Aber es geht nicht. Ausgeschlossen, haben sie gemeint. Ich müsste mich exmatrikulieren und dann neu einschreiben, das Studiendarlehen neu beantragen, alles. Und das werde ich ganz bestimmt nicht tun, du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.«
Sie näherten sich dem Flughafenzubringer und bogen schließlich ab. Mike fuhr sich mit einer Hand durchs Haar und sah Cassy im Innenspiegel an.
»Das heißt also, du bleibst bei Jura?«
Ja, das heiße es, erwiderte Cassy, woraufhin Mike sagte, wunderbar, er habe auch nicht erwartet, dass sie alles hinwerfe. Manche Leute würden sich wegen nichts und wieder nichts ins Hemd machen, bemerkte Tara, was Diana, die sich dazu verpflichtet fühlte, zu dem Tadel veranlasste, sie solle nicht so frech zu ihrem Vater sein. Glücklicherweise wachte Joyce genau in diesem Moment auf.
»Hab ich was verpasst?«
»Nein, Mum«, antwortete Diana.
»Hm, merkwürdig. Hier herrscht so dicke Luft, dass man sie mit dem Buttermesser schneiden könnte.«
Sie hatte recht. Der Tag, der so fröhlich begonnen hatte, war ruiniert, und Diana hätte Mike erwürgen können. Sie versuchte, zu retten, was zu retten war, und eine belanglose Unterhaltung über das Wetter, den Flug, den Verkehr in Gang zu bringen. Keiner kam ihr zu Hilfe. Als Mike den Wagen parkte, traf eine SMS auf Cassys Handy ein.
»Hamish. Er verspätet sich. Der Zug hatte eine Panne.«
»Könnte das problematisch werden?«, fragte Diana.
»Nein. Der Zug fährt schon wieder. Hamish hat online eingecheckt. Wir werden uns an der Sicherheitsschleuse treffen.«
Die nächste halbe Stunde brachten sie in der Schlange vor dem Check-in-Schalter zu, sodass keine Gelegenheit für Familienstreitigkeiten war. Nachdem Cassy ihr Gepäck aufgegeben hatte, bot Mike an, dazubleiben und nach Hamish Ausschau zu halten, während die anderen schon zur Sicherheitskontrolle gingen. Diana und die beiden Mädchen steuerten Joyce mit ihrem Rollator durch das Gedränge zum Lift und fuhren nach oben.
»Nimm es dir nicht zu Herzen, was Dad gesagt hat«, flüsterte Diana, kaum dass sie außer Hörweite waren. »Er macht sich manchmal zu viele Gedanken.«
Cassy zuckte mit den Schultern.
»Er liebt dich eben«, fuhr Diana fort. »Er will nur dein Bestes, deshalb wünscht er sich eine sichere Zukunft für dich.«
»Wenn er doch nur …« Cassy brach achselzuckend ab. »Vergiss es.«
Als sie an der Sicherheitskontrollstelle angelangt waren, kam eine junge Frau in zerrissenen Jeans und Strohhut angerannt, so schnell, dass sie Mühe hatte abzubremsen. Sie schlang Cassy einen Arm um die Taille, noch bevor sie richtig zum Stehen kam.
»Becca! Du hast gar nicht gesagt, dass du zum Flughafen kommst!«
»Bin früher von der Arbeit weggekommen. Ich hatte schon Angst, ich würde es nicht rechtzeitig schaffen. Auf der Piccadilly Line war die Hölle los.« Sie strahlte, als ihr Blick auf Joyce fiel, die sich auf ihren Rollator gesetzt hatte. »Hi, Joyce! Das ist aber schön, dass ich Sie mal wiedersehe!«
»Ja, freut mich auch, Kindchen!« Von der zierlichen alten Dame war nichts mehr zu sehen, als die junge Frau sie umarmte.
Diana lächelte dankbar. Nach der spannungsgeladenen Atmosphäre im Auto tat die Gegenwart der fröhlichen Becca richtig gut. Sie war die zweite Brautjungfer, die blasse Klapperdürre, die alles tragen konnte und dabei auch noch gut aussah. Ihr Leben und das von Cassy verliefen mehr oder weniger parallel, außer dass Becca Psychologie studierte.
»Sei bloß rechtzeitig wieder da für die Hochzeit des Jahrhunderts«, sagte sie, während sie den Arm ausstreckte und ein Selfie von sich, Cassy und Tara machte. »Ich hab keine Lust, der einzige Trottel in einem lila Baiser zu sein.«
»Keine Bange, ich werde da sein. Versprochen.«
»Möchte bloß wissen, was Imogen sich dabei denkt! Sich mit einundzwanzig lebenslänglich zu binden!«
Joyce lachte in sich hinein. »Ich habe genau das Gleiche gemacht. Und bin mit einundfünfzig ausgebrochen. Nicht einmal für Mord bekommt man dreißig Jahre.«
Die drei Mädchen fanden das komisch. Diana nicht.
Kurz darauf gesellten Mike und Hamish sich zu ihnen. Der junge Mann mit dem modischen Dreitagebart trug eine sportliche Fleecejacke. Cassy schimpfte mit ihm, weil er sich verspätet hatte, und zog ihn zum Spaß am Ohr. Hamish hatte es eilig, die Sicherheitskontrollen waren anscheinend verschärft worden und dauerten doppelt so lange wie sonst.
Mike schüttelte missbilligend den Kopf. »Wieder eine Terrorwarnung.«
Becca ernannte sich zur Teamfotografin.
Ihr Handy in der einen Hand, gab sie mit der anderen Anweisungen zur Aufstellung. »Okay, Leute, ein letztes Foto fürs Verbrecheralbum! Nun macht schon! Rückt näher zusammen! Sie auch, Mike.«
»Dass das Bild aber nicht in den sozialen Medien auftaucht!«, sagte Hamish warnend.
Becca achtete nicht auf ihn. »Okay, alle mal lächeln – ja, Sie auch, Mike!«
Alle sechs rückten zusammen, grinsten – sogar Mike – und wurden für die Ewigkeit festgehalten.
Hamish trieb zur Eile an. Er schüttelte Mike die Hand, verabschiedete sich hastig von den anderen und eilte dann hinter den Wandschirm. Cassy zögerte. Sie hatte jedem einen Abschiedskuss gegeben, ihre Großmutter zärtlich umarmt und ihren Vater sehr kurz. »Tut mir leid, Dad.« Mike hatte ihr übers Haar gestrichen und gemurmelt: »Pass auf dich auf.« Ihr Flugzeug wartete nicht. Dennoch drehte sie sich noch einmal um.
In diesem Moment machte Becca noch ein Foto. »Viel Spaß!«, hatten alle gerufen. »Nimm dich vor den Killer-Kiwis in Acht!«
Cassy lächelte, warf ihnen eine Kusshand zu.
»Dann bis September«, sagte sie und winkte ein letztes Mal.
Achtlos dahingeworfene Worte einer jungen Frau, die ihr Flugzeug erwischen musste.
Und dann war sie fort.
Das Handbuch des Sektenführers: In acht Schritten zur Bewusstseinskontrolle
Cameron Allsop
Schritt 1: Erkenne dein potenzielles neues Mitglied
Er oder sie muss nicht besonders jung, labil oder naiv sein. Im Gegenteil, es ist sinnvoller, reife Menschen mit nützlichen Fähigkeiten anzuwerben. Die Aussichten auf Erfolg sind größer, wenn sie sich in einer schwierigen Lage befinden: Trauer, eine Beziehungskrise, Sucht, Einsamkeit, Depressionen und Arbeitslosigkeit – all das kann zu einer zeitweiligen psychisch instabilen Verfassung führen.
Sieh dich nach jemandem um, der seine Wohlfühlzone verlassen hat, und biete ihm das, was er braucht.
ZWEI
Cassy
August 2010
Ein Auto. Und noch eins. Und noch ein verdammtes Auto. Sie knipste ihr Lächeln an und wieder aus. Und unterdessen wirbelte ihr Leben herum, ziellos, planlos, auf den Kopf gestellt.
In der letzten Stunde hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt. Sie standen an einer Tankstelle am Stadtrand von Auckland und wollten per Anhalter weiter. Cassy hielt das Stück Pappe mit den ungelenk darauf gemalten Buchstaben TAUPO hoch und strahlte übers ganze Gesicht, sooft sich ein Auto näherte. Sie hatte sich extra Jeansshorts und ein eng anliegendes T-Shirt angezogen – das, was beängstigend war, mit jedem Tag knapper saß –, aber bisher hatten ihre langen Beine keinen Autofahrer zum Anhalten bewogen.
Es spielte keine Rolle, ob sie nach Taupo kamen. Egal, wie weit sie rannte – es gab kein Entkommen. Sie waren noch in Thailand, als die Probleme anfingen. Zuerst war es nur ein leiser Verdacht gewesen, der sich zu nagender Furcht entwickelte und jetzt in eine ausgewachsene Panik umgeschlagen war. Heute Morgen hatte sie sich schon wieder übergeben müssen. Schweißgebadet war sie aus dem Schlaf hochgefahren und von ihrem Bett im Hostel nach unten in den Gemeinschaftswaschraum getorkelt. Als sie aus der Kabine kam, hatte eine Australierin aus ihrem Schlafsaal (Kylie? Keren?) an einem der Waschbecken gestanden und sich die Zähne geputzt.
»Magen-Darm-Infekt«, murmelte Cassy.
»Kriegst du scheinbar jeden Morgen«, nuschelte Kylie oder Keren mit der Zahnbürste im Mund.
»Ich komm gerade aus Thailand. Muss was im Wasser gewesen sein.«
Kylie/Keren spuckte aus.
»Ja … Ich hatte so was auch mal. Das lässt sich beheben, keine Bange. Aber schieb’s nicht auf die lange Bank.«
Cassy lehnte sich mit zitternden Knien an die geflieste Wand. Sie brauchte unbedingt eine Freundin, jemanden, dem sie sich anvertrauen konnte. »Hast du es beheben lassen?«
»Ja, hab ich.«
»Ist es sehr schlimm?«
»Es geht. Jedenfalls immer noch besser als die Alternative.«
Cassy mochte sich die Alternative gar nicht vorstellen. »Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde.«
»Das denken alle.«
»Ich war nicht unvorsichtig. Ich nehme die Pille.«
Kylie/Keren zog den Reißverschluss ihres Waschbeutels zu. »Hast du’s ihm gesagt?«
»Ich hoffe immer noch, dass es … ich meine, es könnte ja tatsächlich ein Magen-Darm-Infekt sein.« Cassy machte die Augen zu. »Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert!«
»Ich finde, du solltest es ihm sagen«, meinte Kylie/Keren, bevor sie den Waschraum verließ. »Er hat ein Recht darauf, es zu erfahren.«
Hamish war nicht aufgefallen, dass etwas nicht stimmte, aber vielleicht war er mit seinen Gedanken ganz woanders. Auf der Wildtierstation in Thailand hatte es ihm überhaupt nicht gefallen. Also waren sie früher abgereist als geplant und hatten sich einen Platz am Strand gesucht. Jetzt saß Hamish an seinen Rucksack gelehnt auf dem Grasstreifen an der Straße und pflegte seinen Kater. Er hatte die halbe Nacht mit ein paar englischen Backpackerinnen, die aus einer Comedyserie hätten stammen können, Billard gespielt, wilde Geschichten über die Londoner Immobilienpreise erzählt und damit geprahlt, dass er spätestens mit dreißig seine erste Million verdient haben würde.
»Ich dachte, in diesem Land würde anständiges Wetter herrschen«, nörgelte er und schirmte die Zigarette, die er sich anzünden wollte, mit beiden Händen gegen den Wind ab.
»Es ist Winter.«
Ihr wurde schlecht, als sie den Zigarettenrauch roch. Hamish faltete die Zeitung, die er am Morgen in einem Café mitgenommen hatte, auseinander und strich sie auf seinen Knien glatt, damit sie nicht davongeweht wurde. Auf der Titelseite war ein Held mit kantigem Kinn im Trikot der All Blacks abgebildet – als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe als die Oberschenkelverletzung eines Rugbyspielers.
Cassy wusste es besser. Sie war zwölf gewesen, als das World Trade Center einstürzte. Der Unterricht war ausgefallen, alle drängten sich um den nächstbesten Fernseher und kreischten entsetzt, als das zweite Flugzeug wie aus dem Nichts auftauchte. Sie würde niemals vergessen, wie die beiden Wolkenkratzer in sich zusammenfielen wie Türme aus Spielzeugklötzen. Sie würde niemals vergessen, wie Menschen – richtige, reale Menschen – in den Tod gesprungen waren.
Ihre Lehrerin hatte schockiert die Hand vor den Mund geschlagen und gemurmelt: »Die Welt wird nie wieder so sein, wie sie war.« Die Mädchen begriffen damals nicht, was sie damit meinte, aber heute war es Cassy klar. Von dem Tag an traf eine schlechte Nachricht nach der anderen ein. Afghanistan. Irak. Völkermord im Sudan. Ein mörderischer Tsunami an Weihnachten, Wirbelstürme, Terrorangriffe. Anfang dieses Jahres hatte ein schweres Erdbeben Haiti erschüttert und zweihundertfünfzigtausend Menschen das Leben gekostet. Zweihundertfünfzigtausend! Das bloße Ausmaß einer solchen Katastrophe sprengte jedes Vorstellungsvermögen. Und jetzt gerade rissen Überschwemmungen in Pakistan ganze Familien in den Tod.
»Ich könnte noch einen Kaffee vertragen«, sagte Hamish gähnend. Er blätterte zum Sportteil, wo das Neueste von der Fußball-WM stand. Fußball war ein harmloses, ungefährliches Thema. Das Leben ist zum Leben da, lautete sein neues Motto. Nimm’s leicht, Cass.
Ein Auto. Nur der Fahrer saß drin. Cassy schwenkte fröhlich ihr Schild und versuchte, glücklich und gesund dreinzublicken – wie ein Mädchen eben, das jeder Mann gern neben sich auf dem Beifahrersitz hätte. Er raste vorbei.
Mistkerl! Ihre Hände färbten sich schon bläulich vor Kälte.
»Vielleicht sehen wir wie Serienmörder aus«, sagte sie. »Oder sie wollen uns nicht im Auto haben, weil sie uns für langweilig halten.«
»Das gibt’s«, grunzte Hamish und blätterte um.
»Was, dass die Leute langweilig sind?«
»Nein, mordende Anhalter. War auf Facebook. Irgend so ein Typ hat Leute, die ihn mitgenommen haben, gekocht und gegessen.«
»Das ist doch bloß ein modernes Märchen. Kursiert schon seit Urzeiten.«
Es begann so plötzlich und so heftig zu regnen, als ob jemand im Himmel die Schleusen aufgedreht hätte. Hamish hielt sich seine Zeitung schützend über den Kopf.
»Ich schlage vor, wir geben auf und steigen morgen in den Bus«, meinte Cassy.
»Geht nicht. Wir müssen heute noch nach Taupo.«
»Ist doch egal, ob wir heute hinkommen oder morgen.«
»Nein, es ist verdammt noch mal nicht egal. Ich hab für morgen früh meinen Fallschirmsprung gebucht.«
Sie kramte ihre Regenjacke aus ihrem Rucksack und zog sie über den Kopf. Fallschirmsprung? Wen interessierte das? Sie jedenfalls nicht – und er würde in wenigen Augenblicken garantiert auch nicht mehr daran denken.
Sie holte tief Luft und atmete erst nach ein paar Sekunden wieder aus. Er hat ein Recht darauf, es zu erfahren.
»Hör mal, ich mach mir Sorgen.«
Er sah sie ganz gelassen an. Er ahnte nicht, was auf ihn zukam.
»Weißt du noch, als ich diese Lebensmittelvergiftung hatte und fast eine Woche lang nichts bei mir behalten konnte? Das war nach den Prüfungen, so Ende Mai, Anfang Juni.«
»Ich hab dir gleich gesagt, dass dieser Kebab nicht astrein war.«
»Jaja, ich weiß. Du erinnerst dich also.« Sie rieb sich nervös die Hände. »Äh … tja, also, wie gesagt, da konnte ich auch absolut nichts bei mir behalten. Jetzt geht es mir ganz ähnlich. Aber diesmal stecken wir in ernsthaften Schwierigkeiten, fürchte ich.«
Es dauerte ungefähr fünf Sekunden, dann begriff er. Sie konnte es ihm ansehen. Es traf ihn wie eine Gewehrkugel genau zwischen die Augen.
»Hast du einen Test gemacht?«
»Noch nicht. Ich schieb’s die ganze Zeit vor mir her.«
»Dann mach einen Test, Himmel noch mal! Das ist bestimmt falscher Alarm.«
»Ich muss mich seit Tagen morgens übergeben. Ich bin so müde, dass ich mich kaum auf den Beinen halten kann – ich will nur noch schlafen. Und … da sind noch ein paar andere Dinge.«
»Mach einen Test, okay? Ich wette mit dir, dass er negativ ausfällt.« Er nagte an seiner Oberlippe. »Und wenn nicht, musst du schnell handeln. Ich werde dir helfen.«
»Helfen? Heißt das, du willst dich aktiv als Vater einbringen?«
Er machte ein Gesicht, als hätte sie ihm einen Skorpion in seine Boxershorts gesteckt. Sie hätte über seinen Gesichtsausdruck gelacht, wenn die Situation nicht so todernst gewesen wäre.
»Ich bitte dich, Cass! Wir sind noch viel zu jung für so was. Wir haben unser ganzes Leben noch vor uns! Es gibt nur eine logische Lösung, und das weißt du auch.« Er zog sein Blackberry hervor. »Mal sehen, ob ich hier ins Internet kann … Scheiße, geht nicht. Aber ich bin sicher, dass du das hier machen lassen kannst. Wir schauen im nächsten Internetcafé nach. Wir finden bestimmt eine Adresse.«
Cassy wusste bereits, was bei seinen Recherchen herauskommen würde. Sie hatte sich am Computer im Hostel in Auckland selbst schon schlaugemacht. Gutes altes Google, dachte sie bitter. Buch deinen Fallschirmsprung, bestell deine Peperonipizza und organisiere den Mord an deinem kleinen Problem. Und das alles ganz bequem vom Sessel aus.
»Das wird keine große Sache sein«, sagte Hamish.
»Für mich schon.«
»Selbst wenn es kein falscher Alarm ist – und ich wette, es ist einer –, ist das bis jetzt doch nur ein Zellklumpen. Wahrscheinlich musst du nur eine Pille schlucken. Im Grunde ist es Empfängnisverhütung.«
Sie rieb sich das Gesicht mit beiden Händen. »Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll.«
»Du hast gar keine Wahl.« Er blickte die Straße hinunter. »Ich darf gar nicht daran denken, verdammte Scheiße. Stell dir bloß mal Mikes Reaktion vor!«
Das war allerdings ein Argument. Ihr Vater durfte niemals, unter gar keinen Umständen, davon erfahren. Er würde die Wände hochgehen. Er wäre über alle Maßen enttäuscht von ihr, er würde sie für unfähig und leichtsinnig und dumm halten, und das würde sie nicht ertragen. Sie hatte einen Fehler gemacht, der so alt war wie die Menschheit: Sie hatte Mist gebaut, und jetzt war sie möglicherweise schwanger.
Hamish schien ihr Schweigen als Zustimmung zu werten.
»Dann sind wir uns also einig? Wir können es uns nicht leisten, einen auf glückliche Familie zu machen, du nicht und ich auch nicht. Ich jedenfalls habe nicht die geringste Lust dazu, selbst wenn ich es mir leisten könnte.«
Es wurde bereits dunkel, obwohl es noch früher Nachmittag war. Die Autos hatten die Scheinwerfer eingeschaltet. Ein Pferdetransporter. Ein Lastwagen. Ein herzloses Auto nach dem anderen raste vorbei und spritzte ihre nackten Beine nass. Obwohl sie mittlerweile vor Kälte zitterte, knipste sie tapfer ihr Lächeln an. Kein Mensch würde eine heulende Anhalterin mit roter Nase mitnehmen.
»Außerdem hast du mir gestern Abend nicht den Eindruck gemacht, als ob es dir so furchtbar schlecht ginge«, fuhr Hamish fort. »So, wie du geflirtet hast.«
»Ich? Geflirtet?«
»Ja, mit diesem Schweden.«
Sie überlegte stirnrunzelnd. »Du meinst diesen Finnen? Der Typ, der mir einen Tee gemacht hat, während du Charlotte und Topsy zugetextet hast?«
»Finne, Schwede. Ist doch alles das Gleiche.«
»Keineswegs. Finnland liegt …«
»Wen interessiert das«, entgegnete er genervt.
»Wenn hier einer geflirtet hat, dann ja wohl du. Ich hab gesehen, wie ihr eure Telefonnummern ausgetauscht habt, du und diese stinkvornehme Charlotte.«
»Charlottes Vater ist zufällig einer der Vollpartner bei Bannermans.« Hamish hatte eine Miene gekränkter Würde aufgesetzt. »Vielleicht kann sie mir zu einer Praktikantenstelle verhelfen. Ich würde alles tun, um dort einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich meine, alles.«
Cassy blieb buchstäblich die Spucke weg. Diese Bemerkung war sogar für seine Verhältnisse unglaublich niveaulos.
»Du bist echt ein Arsch«, stellte sie fest.
Falls er es gehört hatte, ließ er sich nichts anmerken. Eine Gruppe Radler sauste vorbei, große, in Lycra gekleidete Insekten mit sehnigen Schenkeln und bebrillten Augen. Cassy dachte an ihren Vater, einen leidenschaftlichen Radsportler, der genauso aussah wie diese hier. Die Reifen zischten auf dem nassen Asphalt. Der Tag verwandelte sich allmählich in einen Albtraum. Vielleicht würden sie nie nach Taupo kommen. Vielleicht waren sie dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit auf diesem Grasstreifen auszuharren und sich mit jeder Stunde, die verging, mehr zu hassen.
»Sollen wir uns trennen?«
»Was?« Hamish klappte der Unterkiefer herunter. »Wo kommt das denn jetzt her?«
Sie breitete ihre Arme aus. »Sieh uns doch an, Hamish! Sehen wir etwa aus wie ein glückliches Paar? Ich hasse es, wenn eine Beziehung in den letzten Zügen liegt. Es wäre vielleicht barmherziger, ihr eins über den Schädel zu hauen und sie zu erlösen.«
Sie hoffte, dass er immer noch etwas für sie empfand, dass er ihr energisch widersprechen, aufspringen und sie in seine Arme nehmen würde. Immerhin waren sie seit fast zwei Jahren zusammen und einmal bis über beide Ohren ineinander verliebt gewesen.
Aber er rührte sich nicht. Er widersprach ihr auch nicht. Er machte sogar einen erleichterten Eindruck, auch wenn er es zu verbergen versuchte. Sie kannte ihn zu gut und sah es an seiner Körpersprache – hängende Schultern, ausdruckslose Miene, schräg gelegter Kopf.
»Das musst du wissen«, sagte er bloß.
Sie werde sich in der Tankstelle einen Kaffee holen, murmelte sie, drückte ihm das TAUPO-Pappschild in die Hand und ging schnell weg, damit er sie nicht weinen sah. Es war alles zu viel. Sie fror und war müde und hatte Angst. Sie hatte sich noch nie im Leben so einsam gefühlt.
Als sie mit schleppenden Schritten am Straßenrand entlangging und sich dabei die Tränen mit den Handflächen wegwischte, fuhr ein weißer Kleinbus an eine der Tanksäulen. In der klapprigen Rostlaube saßen eine Menge Leute, die lauthals sangen. Die Fahrertür schwang auf. Ein etwa dreißigjähriger Mann stieg aus. Breite Schultern, volles helles Haar, das seitlich und hinten kürzer geschnitten war. Ein heißer Typ, wenn man auf das Raue, Herbe stand – so wie sie, wie sie gerade feststellte. Er grinste sie an.
»Alles in Ordnung mit dir?« Es klang ernsthaft besorgt.
»Ja, alles bestens. Aber – brrr – ganz schön kalt.«
Er schraubte den Tankdeckel ab. »Wollt ihr nach Süden?«
»Ja, nach Taupo.«
»Wir fahren bis Rotorua. Von da wär’s nicht mehr ganz so weit.«
Die Seitentür wurde aufgeschoben, Köpfe herausgestreckt.
»Die beiden da wollen nach Taupo«, rief der Fahrer über die Schulter. »Haben wir da hinten noch Platz für zwei mehr?«
»Aber immer doch!«, kam es von drinnen. »Jede Menge Platz sogar!« Zwei Mädchen sprangen heraus, das eine hatte einen kleinen Jungen auf dem Arm. Beide trugen dunkelblaue Kleider und blaue Strickjacken und Schnürstiefel und hatten kurz geschnittene Haare. Sie lächelten Cassy zu. Schulmädchen? Nein, dafür waren sie eine Spur zu alt. Vielleicht gehörten sie einem Chor an, waren irgendwo aufgetreten und befanden sich jetzt auf dem Nachhauseweg.
»Dir ist doch bestimmt kalt«, sagte die mit dem Kleinkind. Die beiden mussten verwandt sein: Beide hatten olivfarbene Haut und dunkle, fast schwarze Haare. »Wir können dich doch nicht da draußen im Regen lassen.«
Das andere Mädchen, ein gertenschlanker Rotschopf, winkte mit einer Thermosflasche. »Wir haben Tee!«
Cassy empfand eine geradezu mitleiderregende Dankbarkeit. »Ich kann euch gar nicht sagen, wie wundervoll sich das anhört! Einen Moment, ich bin gleich wieder da, ich will nur meinem Begleiter Bescheid sagen.«
Sie lief zu Hamish zurück, der sich nicht vom Fleck gerührt hatte.
»Stell dir vor, sie nehmen uns mit!«, sagte sie aufgeregt und schnappte ihren Rucksack. »Wir können bis nach Rotorua mitfahren!«
»In dieser Kiste? Auf keinen Fall! Die Karre ist doch nicht verkehrssicher.«
»Ich glaube nicht, dass wir große Ansprüche stellen können.«
»Ich hab keine Lust, in Rotorua festzusitzen.«
Cassy schaute zu dem Van. Sein attraktiver Fahrer hatte getankt und ging weg, um zu bezahlen, wobei er zu ihr hinsah und gut gelaunt seinen Daumen hochreckte. Die beiden Mädchen kamen auf sie zu.
»Hi!«, rief die Rothaarige. »Ich bin Paris. Das ist Bali und das hier« – sie gab dem kleinen Jungen einen sanften Klaps auf den Kopf – »ist Monty. Sollen wir euch beim Tragen helfen?«, fragte sie. Sie hatte einen schottischen Akzent und einen Kurzhaarschnitt, wie nur rassige Rothaarige ihn tragen können, und sie strahlte Hamish an, was ihn jedoch völlig kaltzulassen schien.
»Nein, danke«, erwiderte er knapp.
»Du benimmst dich wie ein echtes Arschloch«, zischte Cassy. »Wir müssen froh sein um jeden, der uns in die richtige Richtung mitnimmt!«
»Nicht, wenn das Fahrzeug ein Schrotthaufen ist.«
Das war der Augenblick. Der entscheidende Moment. In dieser Sekunde traf sie die Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte.
»Wie du meinst«, fauchte sie. »Mach’s gut. Vielleicht sehen wir uns ja in Taupo.«
Sie folgte den Mädchen zu dem Bus, wo sie mit fröhlichen Jubelrufen empfangen wurde. »Hi!« und »Willkommen an Bord!« tönte es von allen Seiten. Sie behandelten sie wie einen Promi. Ein Junge nahm ihr eilfertig ihren Rucksack ab, ein anderer bot ihr seinen Platz an. Die Tür schloss sich mit einem ächzenden Rums.
»Ahh«, seufzte Cassy und rieb sich ihre nackten Beine, um die Blutzirkulation anzuregen. »Herrlich warm habt ihr’s hier drin.«
»Wir werden die Heizung noch ein bisschen höherdrehen, bis du trocken bist«, sagte Bali, die den kleinen Monty im Kindersitz festschnallte.
Der Fahrer kletterte hinters Lenkrad, schlug die Tür zu und ließ den Motor an, der dröhnend und rumpelnd zum Leben erwachte.
Endlich hatte Hamish sich hochgerappelt. Cassy sah, wie er halbherzig einen Schritt auf den Van zu machte. Es wäre ein Leichtes für ihn gewesen, angelaufen zukommen und die Tür aufzureißen, wenn er es wirklich gewollt hätte.
Der Wagen rollte weg von den Zapfsäulen. Als sie an Hamish vorbeifuhren, trafen sich ihre Blicke. Er breitete die Hände aus, und Cassy konnte ihm von den Lippen ablesen, was er sagte: »Was soll denn das, verdammte Scheiße?«
Der Kleinbus beschleunigte. Zwanzig Sekunden später waren Hamish und die Tankstelle hinter einer Kurve verschwunden.
Das Handbuch des Sektenführers:In acht Schritten zur Bewusstseinskontrolle
Cameron Allsop
Schritt 2: Überzeuge die neu Angeworbenen davon, ins Netzwerk einzutreten
Stell es als etwas Harmloses dar: ein Einführungswochenende, einen Kurs, eine Party, ein Bett für die Nacht, Freundschaft, Eheberatung, eine Kirchenversammlung oder sogar eine Geschäftsidee. Es ist egal, wie du es nennst, aber sorge dafür, dass die Leute mitkommen.
DREI
Cassy
»Schade, dass dein Freund nicht mitkommen wollte«, sagte Paris.
»Sein Pech«, entgegnete Cassy. Es hatte leichthin klingen sollen, aber der Schock saß so tief, dass ihre Stimme brüchig war.
Es war aus. Das war eine Tatsache. Heute Morgen beim Aufwachen waren sie noch ein Paar gewesen und an den Tagen davor auch. Zweimal dreihundertfünfundsechzig Tage lang. Aber jetzt war es aus und vorbei. Da – endlich gestand sie es sich ein. Fünf Tage hintereinander hatte sie sich morgens übergeben, und jetzt war sie ganz auf sich allein gestellt.
Die Leute in dem Van kümmerten sich rührend um ihre Anhalterin. Jemand drückte ihr einen Apfel in die Hand. Der Fahrer drehte die Heizung hoch. Ein anderer gab ihr ein Handtuch, damit sie sich ihre tropfnassen Haare trocken rubbeln konnte. Paris schenkte ihr einen Becher Schwarztee aus der Thermosflasche ein.
»Da ist Honig drin«, sagte sie, als Cassy einen Schluck probierte.
»Das tut gut«, seufzte Cassy. »Ich war total durchgefroren.«
Ihre Retter stellten sich vor. In den hinteren beiden Reihen saßen ein etwa siebzigjähriges Paar aus der Schweiz, Otto und Monika, und ihre beiden Enkel im Teenageralter. Otto hatte buschige Brauen und Hängebacken und lächelte oft. Monika war eine winzige Frau mit schütterem grauem Haar. Anscheinend war sie Ärztin und praktizierte noch immer. Hießen ihre Enkel tatsächlich Washington und Riad, oder hatte sie das bei dem Motorenlärm nicht richtig verstanden? Jedenfalls spielten die beiden friedlich eine Partie I Spy miteinander.
Cassy staunte über die beiden Jugendlichen. Wieso zanken sie sich nicht?, dachte sie. Tara und ich haben uns bei jeder längeren Autofahrt so in die Wolle gekriegt, dass alles zu spät war.
Unmittelbar hinter ihr saß Balis Partner Sydney, ein stiller junger Mann, dessen Augen hinter den runden Brillengläsern Cassy freundlich anblinzelten. Er sei in Kapstadt aufgewachsen, erzählte er, habe aber in Südafrika keine Zukunft für sich gesehen und sei deshalb nach dem Studium nach Neuseeland gegangen.
»Da habe ich Bali kennengelernt … und dann kam dieser kleine Bursche da.« Er strich Monty über den Kopf. »Und so bin ich immer noch hier.«
Monty starrte ganz fasziniert auf Cassys Haare. Sie beugte den Oberkörper zurück, damit er mit den schweren, langen Strähnen spielen konnte.
»Nicht dran ziehen!«, ermahnte Bali ihn überflüssigerweise. Er war ganz vorsichtig.
»Und du?« Cassy wandte sich dem Jungen zu, der ihr seinen Platz angeboten hatte und jetzt auf dem Boden neben einer Apfelkiste hockte. Er war ein Schlaks in der Pubertät und schien nur aus langen, sehnigen Armen und Beinen zu bestehen. Er grinste. Seine Zähne standen ein wenig schief. Kein Handy, kein Tablet, keine Kapuzenjacke, kein mürrisches Schweigen. Er reichte Cassy die Hand.
»Ich bin Rom. Freut mich sehr, dich kennenzulernen.«
Cassy war verwirrt. »Ich möchte nicht unhöflich sein, aber … ist das Zufall, dass ihr alle geografische Namen habt? Sydney, Rom, Paris, Bali … und ihr zwei heißt Washington und Riad, oder? Sind das Spitznamen?«
Alle lachten. »Nein, das sind unsere richtigen Namen – ein ganzer Planet in einem einzigen Fahrzeug!«, rief Rom.
Auf dem Beifahrersitz saß ein Mädchen. Als die Kleine sich umdrehte, sah Cassy, dass sie ein sommersprossiges Gesicht hatte. Sie trug eine ziemlich hässliche Strickmütze.
»Das ist Suva«, sagte Bali. »Nächste Woche wird sie elf. Und unser Fahrer ist ihr Dad. Aden.«
Seltsam, dachte Cassy. Ich hätte ihn nicht für einen verheirateten Mann gehalten.
Er wirkte belustigt, als sich ihre Blicke im Rückspiegel trafen. »Zu viele bescheuerte Namen, hm? Macht nichts, wenn du sie dir nicht merken kannst.«
Cassy war auf der knapp dreistündigen Fahrt nach Rotorua so entspannt wie seit Tagen nicht mehr. Sie fand, dass sie ein richtiger Glückspilz war, weil sie so nette Leute kennengelernt hatte. Während der ganzen Fahrt fiel nicht ein einziges böses Wort. Es herrschte keinerlei Spannung, keiner verdrehte genervt die Augen. Alle machten einen rundherum glücklichen, zufriedenen Eindruck und schienen sich aufrichtig für sie zu interessieren. Für Cassy war das eine völlig neue Erfahrung: Die meisten ihrer Freunde hörten ungefähr drei Sekunden lang zu und lenkten die Unterhaltung dann geschickt auf sich selbst zurück. Die Leute hier stellten ihr dagegen Fragen und hörten ihren Antworten aufmerksam zu, sie lachten über ihre Scherze und staunten, als sie erwähnte, dass sie Jura im letzten Jahr studierte.
»Du bist bestimmt sehr klug«, bemerkte Suva.
»Ach was. Jurastudenten gibt’s heutzutage wie Sand am Meer. Manchmal wünschte ich, ich hätte mich für etwas anderes entschieden.«
»Zum Beispiel?« Otto, der Schweizer, hatte sich interessiert vorgebeugt.
»Na ja … wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vermutlich Lehrerin werden. Mir gefällt es, wie Kinder denken.«
Otto breitete die Hände aus. »Was hält dich davon ab? Es ist noch nicht zu spät! Es ist nie zu spät!«
»Das stimmt allerdings.«
»Warum studierst du gerade Jura?«
Sie verzog das Gesicht. »Schien mir damals eine gute Idee zu sein. Mein Dad hat mir dazu geraten.«
»Ist er Anwalt?«
»Nein, nein. Er war über zwanzig Jahre bei der Army. Er ist pensionierter Major und arbeitet jetzt für eine Sicherheitsfirma. Die prüfen das Risiko vor Ort und stellen speziell ausgebildete frühere Armeeangehörige als Leibwächter zur Verfügung, wenn jemand ein Geschäft in einer unsicheren Region abwickeln will. Und bei einer politischen Krise bringen sie dich schnell außer Landes.«
»Wow! Das ist ja ein cooler Beruf!«
»Na ja, so cool auch wieder nicht. Meistens eher langweilig. Bin mir außerdem nicht sicher, ob das ethisch ist, diesen Großunternehmen bei der Ausbeutung von Menschen zu helfen. Aber jetzt genug von mir! Erzählt mir von euch. Wer seid ihr? Was macht ihr?«
»Okay.« Paris schlug die Hände zusammen und ließ sie einen Augenblick so. »Okay. Halt uns bitte nicht für verrückt, Cassy, aber wir leben alle auf einer Farm am Lake Tarawera. Wir bauen unter anderem unser eigenes Gemüse an.«
Cassy stellte sich Gewächshäuser und vielleicht einen Verkaufsstand an der Straße vor. »Das muss aber ein großes Haus sein, wenn ihr alle da wohnt!«
»Wir wohnen nicht alle im selben Haus. Nur im selben … Dorf. Es ist ein landwirtschaftliches Kollektiv, könnte man sagen.«
»Seid ihr Obstpflücker? Saisonarbeiter?«
»Nein, wir sind da zu Hause. Wir besitzen ungefähr fünfhundert Hektar, nicht nur landwirtschaftlich genutzte Fläche, sondern auch Wald und Brachland. Wir betreiben eine nachhaltige Landwirtschaft, wir geben dem Boden mehr zurück, als wir ihm entnehmen. Wir haben unsere eigene Wasser- und Stromversorgung, unser eigenes Klärwerk. Wir führen ein autarkes Leben, und wir leben wirklich gut.«
Die Stimmung im Kleinbus hatte sich beinah unmerklich verändert. Cassys neue Freunde schienen auf der Hut, als warteten sie darauf, dass sie sie auslachen würde.
»Ja, du hast richtig geraten: Wir sind ein Haufen Hippies«, sagte Otto mit seinem starken Schweizer Akzent todernst und zwinkerte ihr dann zu. Cassy lächelte. Wie Hippies kamen sie ihr nicht vor, dafür schienen sie zu adrett, gesund und aufgeweckt.
»Aber ihr braucht doch Benzin für dieses Auto«, wandte sie ein.
»Es fährt mit Ethanol aus eigener Herstellung. Wir konnten bloß nicht so viel mitnehmen, wie wir für den Weg nach Auckland und zurück brauchen, deshalb mussten wir tanken.«
»Und warum wart ihr in Auckland?«
»Wir mussten ein paar Dinge erledigen. Besorgungen machen.«
»Ich bin jedes Mal heilfroh, wenn wir wieder zu Hause sind«, seufzte Bali. »Gethsemane ist der schönste Ort, den du dir vorstellen kannst. Der See, die Hügel, die Wildnis – so etwas findest du sonst nirgendwo auf der Welt.«
»Klingt traumhaft. Scheint ein Paradies zu sein.«
»Es ist ein Paradies. Ich wünschte, du könntest es mit eigenen Augen sehen.«
Als sie hinter einem Schulbus halten mussten, drehte Aden sich um.
»Hey, Cassy, warum kommst du nicht einfach mit zu uns und schaust dir an, was wir machen?«
»Das würde ich wahnsinnig gern.« Cassy dachte kurz nach, schüttelte dann aber den Kopf. »Geht nicht. Ich werde lieber in Rotorua aussteigen. Und gleich morgen früh nach Taupo weiterfahren. Und Hamish suchen.«
»Ist das der Bursche, mit dem du unterwegs warst?«
»Ja.«
»Dein Freund?«
»Weiß nicht so genau.«
Aden lächelte. Er hatte Grübchen in beiden Wangen.
»In letzter Zeit verstehen wir uns nicht mehr so gut«, fuhr Cassy fort. »Gut möglich, dass es aus ist.«
Die anderen machten ein mitfühlendes Gesicht, und jemand drückte ihr sanft die Schulter. Der Regen hatte sich inzwischen zu einem Wolkenbruch entwickelt. Große Tropfen zerplatzten hüpfend auf dem Asphalt; die Scheibenwischer hatten Mühe, die Wassermassen zu bewältigen. Durch die beschlagenen Scheiben und den strömenden Regen konnte man einen Wegweiser erkennen: Rotorua 5 km.
»Jetzt sind wir bald da, nicht wahr?«
»Ja, dauert nicht mehr lange«, erwiderte Aden. Der Blick seiner lächelnden Augen und Cassys trafen sich im Rückspiegel.
Sie ertappte sich dabei, wie sie unwillkürlich zurücklächelte. Hör auf damit!, schimpfte sie im Geist mit sich. Reiß dich gefälligst zusammen.
»Falls du dich wunderst, was das für ein Geruch ist«, sagte Bali naserümpfend, »das liegt an den geothermischen Aktivitäten hier in der Gegend. Rotorua ist bekannt für diesen Geruch!«
Cassy schnupperte. Es roch tatsächlich nach Schwefel. Der Geruch erinnerte sie an die Stinkbombe, die einmal jemand in der Aula ihrer Schule geworfen hatte.
»Nach ein paar Stunden hat man sich daran gewöhnt«, sagte Rom.
Als sie bald danach den Randbezirk der Stadt erreichten und an Läden und Imbissstuben vorbeikamen, kniete Suva sich auf ihren Sitz und flüsterte ihrem Vater etwas ins Ohr. Das Mädchen war klein und schmächtig und hatte dunkel umschattete Augen.
»Warum fragst du sie nicht selbst?«, flüsterte Aden hörbar zurück.
»Kannst du das nicht tun?«
Er stupste sie sanft in die Rippen. »Nein, mach du das.«
Suva drehte sich zu Cassy um. »Bleibst du heute Nacht bei uns? Bei Dad und mir? Bitte, bitte, bitte! Wir haben ein Gästezimmer. Es wird dir bestimmt gefallen bei uns. Morgen früh bringen wir dich hierher zurück.«
»Oh, das ist furchtbar lieb von dir, aber das geht nicht.«
»Warum denn nicht?«
Ja, warum eigentlich nicht?, fragte sich Cassy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute gefährlich sind. Laut sagte sie: »Das möchte ich deinem Dad nicht zumuten, weißt du.«
»Das macht ihm überhaupt nichts aus! Nicht wahr, Dad? Es macht dir doch nichts aus?«
»Nicht das Geringste.« Aden sah Cassy im Rückspiegel an. »Und ich weigere mich ganz entschieden, dich bei diesem Wetter hier abzusetzen.«
Suva hatte flehentlich die Hände gefaltet. Cassy kannte zwar nicht viele zehnjährige Mädchen, aber dieses hier schien etwas Besonderes zu sein. Wenn sie nur an Tara dachte, die in dem Alter eine fürchterliche Nervensäge gewesen war. Suva hatte so etwas In-sich-Gekehrtes, Wachsames, als hütete sie ihr Glück sorgfältig.
»Da vorn müssen wir abbiegen«, sagte Aden. »Also? Kommst du mit?«
Bali sah sie verschmitzt an. »Ich habe ein Wildragout auf dem Herd.«
»Ach, komm schon, sag Ja!« … »Du bist so herzerfrischend!« … »Bali ist berühmt für ihr Wildragout!«, ertönte es von allen Seiten.
In den folgenden Jahren würde sich die Szene immer und immer wieder vor Cassys innerem Auge abspielen, und sie würde sich fragen, was genau sie bewogen hatte, in diesem Van sitzen zu bleiben und mit unbekannten Menschen an einen ihr unbekannten Ort zu fahren.
Damals war ihr die Entscheidung nicht sonderlich schwergefallen. Sie konnte sich im strömenden Regen in einer fremden Stadt auf die Suche nach einem Hostel machen. Sie konnte in einer schmuddeligen Gemeinschaftsküche zum x-ten Mal ein Nudelfertiggericht hinunterwürgen. (Ein selbstgefälliges skandinavisches Paar in Designerpullis würde kochen, irgendetwas mit Gemüse und einem Wok. Das war in jedem Hostel so.) Sie konnte sich im Schlafsaal in ihr knarrendes Feldbett legen, kein Auge zutun und darauf warten, dass diese grauenvolle Morgenübelkeit wieder einsetzte. Sie konnte alles ganz allein durchstehen.
Oder aber sie konnte mit diesen freundlichen, liebenswürdigen Menschen gehen, die Nacht in einem warmen Haus verbringen, sich ein selbst gemachtes Ragout schmecken lassen. Sie konnte ein Gast sein, der willkommen war, der umsorgt, verwöhnt, gemocht wurde. Was für eine verlockende Aussicht!
»Na ja, wenn ihr meint«, sagte sie.
Jubel brandete auf. Aden setzte den Blinker und bog nach links ab.
Die Landschaft hatte sich verändert. Die Hügel waren steiler geworden, die Vegetation üppiger. Riesige Baumfarne streiften das Wagendach. Der Regen lief in Schlieren an den Scheiben herunter. Aden musste ab und zu einem Tierkadaver ausweichen. Das seien Possums, Beuteltiere, erklärte Rom. Cassy, die den Tag in Auckland mit seinem Sky Tower, seinen Cafés und seinem Verkehr begonnen hatte, kam sich vor wie auf einem anderen Planeten.
Allmählich klarte es auf. Aden schaltete herunter, damit der Kleinbus die Steigung bewältigen konnte. Dann, hinter einer lang gezogenen Kurve, erhob sich vor ihnen in der Ferne ein Berg, ein zerklüfteter Riese, vor einem strahlend sauberen Himmel.
»Tarawera«, rief Bali freudig aus. »Der Vulkan. Jetzt sind wir bald daheim.«
Unter ihnen erstreckte sich ein See im Dunst. Cassy musste bei seinem Anblick an flüssiges Quecksilber denken, das träge und glänzend die Narben der Erde füllte.
»Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier einen See gibt«, sagte sie.
»Komisch, bei mir ist es genau andersrum«, erwiderte Paris. »Ich wundere mich jedes Mal wieder, dass es eine Welt jenseits dieses Fleckchens gibt.«
Die Straße führte bergab und dann am See entlang. Anfangs kamen sie noch an einigen Häusern vorbei, Ferienhäuser, wie sie erfuhr. Bald gab es ringsum nur noch Wildnis. Die Straße wurde schmaler, ihr Zustand schlechter. Dann hörte sie ganz auf.
Suva stieg aus, öffnete ein Gatter und schloss es hinter ihnen wieder. Ihr Vater steuerte den Wagen eine steile Böschung hinunter auf einen unbefestigten Weg voller Schlaglöcher. Der Van holperte durch dichten Wald. Cassy konnte nirgendwo eine menschliche Behausung oder irgendein anderes Anzeichen von Zivilisation entdecken. Sie war diesen fremden Menschen schutzlos ausgeliefert. Wenn sie nun – wie ihre Mutter sagen würde – eine Bande mordlüsterner Irrer waren?
Schließlich erreichten sie eine Lichtung. Aden schaltete den Motor aus.
»Endstation«, sagte er in die plötzliche Stille hinein.
Cassy schaute sich verwundert um und dachte: Hier ist doch gar nichts.
Nachdem sie nacheinander ausgestiegen waren, luden sie Kisten aus dem Wagen aus. Cassy sprang auf den weichen, morastigen Waldboden und spürte, wie die nach Farn und Moos riechende Feuchtigkeit ihre Kleidung durchdrang. Irgendwo im Unterholz plätscherte Wasser.
»Gut.« Aden schloss das Fahrzeug ab und drehte sich um. »Gib mir deinen Rucksack, Cassy, damit wir ihn verstauen können.«
»Verstauen? Wo denn?«
Aden nickte mit dem Kinn Richtung See. Da erst sah sie, dass die anderen über einen wackligen Steg gingen, an dem ein Holzschiff vertäut war.
»Das ist nicht dein Ernst!«, rief sie halb ängstlich, halb entzückt aus. »Ihr könnt euer Zuhause nur per Boot erreichen?«
Es sah aus wie eine Filmrequisite: sehr viel größer als ein normales Ruderboot, mit Brettern zum Daraufsitzen und sechs Rudern. Rom, Paris, Sydney und die Enkelsöhne der beiden Schweizer sprangen hinein und ergriffen die Ruder. Bali hatte bereits im Heck Platz genommen. Monty saß an sie geschmiegt auf ihrem Schoß und summte eine Melodie vor sich hin.
»Das war einmal ein Walfänger«, erklärte Aden. »Aber es fährt jetzt schon seit über hundert Jahren auf diesem See.«
Cassy bewunderte die Wölbung des Rumpfs, das dunkle Holz, das sich im Lauf vieler Jahre ausgedehnt und wieder zusammengezogen und jeder Witterung getrotzt hatte. Sie stellte sich vor, wie mit Harpunen bewaffnete Männer am Bug gestanden hatten.
»Setz dich doch mit Suva zu Bali«, schlug Aden vor, während er das Tau vom Steg löste. »Ich werde rudern. Deinen Rucksack stellen wir am besten in die Mitte. So … rein mit dir!«
Augenblicke später tauchten die Ruder ins Wasser ein, das Boot glitt über den See. Wasserhühner stoben empört kreischend nach allen Seiten davon. Cassy spürte den flutenden Druck des Wassers gegen den Rumpf. Sie beugte sich über den Bootsrand. Der See war klar und anscheinend jetzt schon sehr tief. Das Seegras, das sie sehen konnte, war beunruhigend weit unten. Sie blickte sich verstohlen um, konnte aber weder Schwimmwesten noch Rettungsringe entdecken.
»Wie tief ist der See eigentlich?«
»Stellenweise sehr tief«, antwortete Bali. »So still und harmlos, wie er sich heute zeigt, ist er nicht immer.«
Jenseits des Sees ragte der Mount Tarawera empor. Der Vulkan war nicht besonders hoch, aber sehr kompakt. Man konnte mehrere Krater erkennen. Die kahle, narbige Trostlosigkeit erinnerte Cassy an die letzte Episode der TV-Serie Dinosaurier – Im Reich der Giganten, als gegen Ende der Kreidezeit die enorme vulkanische Aktivität und ein gewaltiger Meteoriteneinschlag praktisch alles Leben auf der Erde ausgelöscht hatten.
»Zu Lebzeiten meiner Ururgroßmutter ist der Tarawera mal ausgebrochen«, erzählte Bali. »Die Eruption war so stark, dass der Grund des Lake Rotomahana auf der anderen Seite des Bergsporns dort regelrecht weggesprengt wurde. Etliche Millionen Tonnen Asche regneten über der Gegend nieder und begruben sie unter sich. Es gab viele Todesopfer.«
Es war kalt auf dem Wasser, viel zu kalt, wenn man eine halbe Stunde nur bewegungslos dasaß. Cassy zitterte schon am ganzen Körper, als sie sich endlich einer kleinen Insel näherten. Alle Köpfe drehten sich zu ihr hin, so als würden sie von einer unsichtbaren Kraft gelenkt. Rauch kräuselte sich zwischen den Bäumen empor, und auf dem Strand lag ein blaues Ruderboot.
»Ist die Insel bewohnt?«, fragte Cassy.
Gemurmel erhob sich ringsum, fröhlicher noch als Gelächter.
»Allerdings. Von einem ganz besonderen Menschen«, erwiderte Rom.
Noch während sie diese Einsiedelei im Schatten eines Vulkans neugierig betrachtete, trat eine Gestalt zwischen den Bäumen hervor. Es war ein groß gewachsener, langgliedriger Mann. Er schlenderte zum Wasser hinunter. Er trug keine Schuhe, nur ein helles Hemd und eine helle Hose. Ein Hund begleitete ihn, ein wunderschönes, wolfsähnliches Tier mit einem dichten Fell und Stehohren.
Rom war aufgesprungen, er winkte und schrie: »Justin! Justin!« Die anderen Kinder und Jugendlichen taten es ihm nach, und das alte Boot schwankte.
»Vorsicht, Kinder!«, ermahnte Otto sie. »Wir sind noch nicht da. Wenn ihr so weitermacht, werden wir noch alle im Wasser landen!«
Bis auf Rom, der noch einmal winken musste, setzten sich alle sofort wieder hin und ergriffen die Ruder.
Der Mann stand jetzt direkt am Wasser. Er hatte hagere Züge, und der Wind spielte mit seinen hellen Haaren. Er sah Cassy direkt an. Dann lächelte er und hob die Hand.
Cassy konnte keinen Blick von ihm wenden. Selbst, als das Boot in eine geschützte, von einem grauen Strand gesäumte Bucht glitt, starrte sie immer noch an die Stelle, wo er gestanden hatte.
»Wer war das?«
»Das war Justin«, antwortete Bali.
»Wer ist Justin?«
»Er ist der wunderbarste Mensch, dem du jemals begegnen wirst.«
Ein merkwürdiges Gefühl erfasste Cassy. Obwohl sie nicht die Einzige auf diesem Boot war und mindestens die Hälfte der anderen diesem Mann zugewinkt hatte, hatte seine grüßende Geste ihr allein gegolten. Je länger sie darüber nachdachte, desto sicherer war sie sich.
Warum ich?, dachte sie. Ich bin nur eine Anhalterin. Er hat nicht mal gewusst, dass ich kommen würde.
Doch dann fiel ihr noch etwas auf. Er hatte sich nicht benommen, als ob sie eine Fremde wäre, sondern als ob er sie bereits kennen würde.
VIER
Cassy
Kinder rannten zu einem Bootssteg. Ihre freudigen Stimmen trugen weit in der Stille. »Sie sind wieder da! Juhu!«