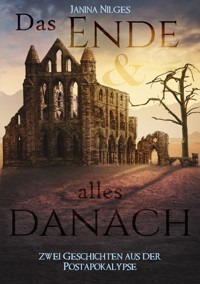
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Du bist Rebellin, oder?«, fragte er mich. Ich nickte stumm. »Warum?« »Weil ich blind war.« Arianna Travino ist Rebellin - eine von hunderten, tausenden im neuen Deutschland. Eine von denen, die glaubte, etwas verändern zu können. Fünf Jahre nach ihrem Beitritt bei der staatsfeindlichen Organisation hat sie alles verloren: Freundschaften. Familie. Den Sinn ihres Lebens. Die Mission im Wüstengefängnis sollte ihre letzte sein, doch dann trifft sie auf ihn: Den Jungen ohne Namen. Sie trifft eine folgenschwere Entscheidung - und bringt damit den Staat endgültig gegen sich auf. Larissay Cardinale hat eine andere Art der Rebellion gewählt. Die Anführerin der Charity-Organisation Tender Freedom setzt da an, wo es am nötigsten ist: Bei den Menschen. Als eine Art dystopischer Robin Hood stiehlt sie von den Reichen und hilft den Ärmsten - durch eine glückliche Fügung fliegt die Organisation unter dem Radar des Staats. Doch dann treten drei neue Mitglieder bei - und die erschüttern das friedliche Leben der Tender Freedom ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Ein Blick in die Zukunft – hundert, fünfzig, vielleicht nur zwanzig Jahre nach heute. Die Welt stand in Flammen, jetzt regiert die Asche. Die Politik: überfordert, verlogen, ungerecht. Die Menschen: arm, verzweifelt, tot. Die Umwelt: Verwüstet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rebellen versprechen Hoffnung, Änderung, Besserung, doch innerhalb ihrer Reihen herrscht dieselbe Grausamkeit wie im Parlament. Gibt es noch eine Chance auf eine bessere Welt – oder ist der einzige Ausweg aus dem Leiden der Tod?
~~~
Von der Autorin bereits bei Books on Demand erschienen:
Dark Deadly Lies – Fatale Spiele (Thriller)
Rebel School – Gefährliches Geheimnis (Urban Fantasy, ab 12)
Rebel School – Wanted Dead Or Alive (Urban Fantasy, ab 12)
Rebel School – Was Jetzt Noch Bleibt (Urban Fantasy, ab 12)
Tungldraumur (High Fantasy, ab 12)
Für alle, die sich bemühen, die Apokalypse zu verhindern.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Six Feet Under
Deserted
Anhang
Anmerkung:
Eine Figur in der Geschichte Deserted identifiziert sich als nichtbinär und nutzt dey/demm-Pronomen. Eine Erklärung zu diesen Pronomen sowie eine Liste der queeren Identitäten im Buch findet sich im Anhang.
Inhaltswarnung:
Im Buch werden Themen behandelt, die auf manche Menschen triggernd wirken oder Unwohlsein auslösen können. Dazu zählen: Waffengewalt, Tod/Mord, Monster/ Mutationen, suizidale Gedanken, Lebensmüdigkeit, Manipulation/Gaslighting, Drogen-/Alkoholkonsum.
Einführung
Die Apokalypse liegt hinter uns. Ein Atomkrieg konnte gerade noch abgewendet werden; stattdessen haben Sandstürme Mitteleuropa verwüstet – gelegentlich entsteht auch heute noch einer und hinterlässt Zerstörung und Chaos.
Bewohnbares Land ist knapp geworden, nur hier und da gibt es fruchtbare Oasen in der Wüste – und eben die Städte. Großstädte, verbunden durch ein paar wenige Autobahnen zum Gütertransport – Großstädte, vor deren Mauern sich Dörfer und Slums den Stürmen stellen oder untergehen. Und innerhalb der Mauern leben diejenigen, die es sich leisten können.
In diesem Buch lernst du unterschiedliche Persönlichkeiten kennen, ihre unterschiedlichen Wege, in der Postapokalypse zu leben, und eine ganze Menge Möglichkeiten, wie unsere Zukunft aussehen könnte, wenn wir die Apokalypse nicht aufhalten.
Six Feet Under
Playlist
Living At The End Of The World – a-ha
Desert Song – My Chemical Romance
Desert Rose – Sting
THE LONELIEST – Maneskin
Viva la Gloria? (Little Girl) – Green Day
Selfmachine Blame – Coco
ilomilo – Billie Eilish
The Judge – Twenty One Pilots
Neon Gravestones – Twenty One Pilots
Six Feet Under – Billie Eilish
Six Feet Under: Das Ende
01 – Der Überfall
Die Apokalypse hatte die Form der Augen eines Zehnjährigen. Bis zu diesem Tag hatte ich geglaubt, es wären die üblichen Dinge gewesen – der Krieg, die Sandstürme, die Zerstörung und natürlich die Regierung mit ihren Lügen und falschen Versprechungen. Aber diese Dinge waren vor meiner Geburt schon da gewesen – sie hatten mich höchstens geprägt, aber nicht verändert. Deshalb hatte meine ganz persönliche Apokalypse die Form der Augen eines Zehnjährigen.
Der Junge stand bloß dort wie zur Salzsäule erstarrt, als ich vom Heulen der Sirenen begleitet und mit der Pistole im Anschlag durch die Gänge des Gefängnisses schlich. Er stand bloß dort, und er war kein Teil meiner Mission.
Ich konnte die Worte meiner Mitstreiter förmlich hören. Lass ihn, Arianna. Der macht uns bloß Probleme. Kleine Jungs aufnehmen sendet keine Signale an Faherty und ihre Regierung. Und vielleicht hatten sie Recht – er war rein zufällig zusammen mit allen anderen befreit worden, als meine Leute in der Zentrale die Generalverriegelungen aller Zellen geöffnet hatten. Die Präsidentin interessierte nicht, ob jemand diesen Jungen aufnahm, sondern es interessierte sie, dass die Rebellen das Gefängnis in Schutt und Asche gelegt und sämtliche einst verhafteten Gleichgesinnten zurück in ihre Reihen geholt hatten.
Ich nahm den Jungen an die Hand und führte ihn in den Innenhof des Gefängnisses. Man mochte mir nachsagen, was man wollte. Rebellin. Mörderin. Verräterin. Monster. Damit konnte ich leben. Aber ich würde ganz sicher nicht die Person sein, die ein Kind in den Händen der Regierung ließ.
Es war Mittag, als wir in den Innenhof traten – schutzlos unter der gnadenlosen Wüstensonne. Das Heulen der Sirenen war hier allerdings erträglicher als in den Fluren. Leise genug, dass man ein kurzes Gespräch führen konnte.
Ich führte den Jungen vorbei an aus Beton Kübeln, in denen vor fünfzig Jahren vielleicht mal Blumen gewachsen waren. Der blaue Himmel über mir war nur ein kleines Rechteck; die Mauern des Gefängnisses waren so hoch, dass sie beinahe auf mich hinunterzukippen schienen. Einige Fenster waren zerbrochen und auf dem Boden lagen Scherben – meine Einheit hatte es wohl mal wieder übertrieben und Teile des Gebäudes gesprengt. War das wirklich nötig gewesen?
»Wie heißt du?«, fragte ich den Jungen, nachdem ich ihm bedeutet hatte, sich auf eine ebenfalls aus Beton gegossene Bank zu setzen.
Er hatte bislang kein Wort gesprochen. Weder, als ich ihn an der Hand genommen hatte, noch, als ich ihn durch die Flure geführt hatte. Vermutlich hatte er einfach Angst vor mir – mit einer Größe von einem Meter dreiundachtzig, meiner Uniform und dem Helm, der mein Gesicht verdeckte, war ich nicht gerade der Typ von Mensch, dem man bedingungslos vertraute.
Jetzt öffnete er den Mund, zögerlich. »Ich weiß es nicht.«
»Du weißt deinen Namen nicht?«
»Ich kann mich an nichts erinnern.«
Verdammter Staat. Was hatten sie ihm angetan? Ich kniete mich vor ihm hin und legte meine Hände auf seine schmalen Schultern. »Hör zu, Junge ohne Namen. Ich hole dich hier raus, aber dafür musst du dich noch ein paar Minuten gedulden. Bleib im Innenhof, bis ich wieder da bin. Hock dich am besten unter die Bank, falls nochmal jemand oben randaliert.« Ich zeigte auf die Scherben am Boden. »Alles wird gut, okay? Keiner wird dir etwas antun.« Weil keiner mehr übrig ist. »Ich bin in fünfzehn Minuten wieder da. Spätestens.«
Er sah mich aus großen blauen Augen an und nickte.
In all den Jahren, die ich bei den Rebellen verbracht hatte, hatte ich mich noch nie so schlecht gefühlt wie in diesem Moment, als ich den Jungen zurücklassen musste. Aber ich war nicht bloß irgendwer, ich war eine von drei Sergeants auf dieser Mission und ich hatte die Verantwortung dafür, dass meine Leute und die Leute aus dem Knast es sicher in die Fahrzeuge schafften.
Es war eigentlich bis auf wenige Ausnahmen nur noch ein Kontrollgang. Die meisten der Gefangenen hatten den Weg zum Ausgang schon gefunden oder waren hingebracht worden – nur wenige waren zu alt oder zu verletzt und brauchten meine Hilfe. Diejenigen, die ich von früher kannte, gehörten leider zumeist der letzteren Kategorie an. Ein schmerzhafter Anblick.
Und trotzdem: Lag die Zukunft unseres Landes nicht eher in den Kindern als in den Alten, die wir zum Ausgang schleppten? Klar, niemand sollte im Knast versauern, aber ich wusste genau, dass jeder einzelne von ihnen den Jungen hierlassen würde, und das erfüllte mich mit einer lebendigen Wut, die ich lange nicht mehr gespürt hatte.
Meinen Ruf hatte ich mir damit nicht verdient. Sergeant Arianna Travino war keine hektische, wütende Rebellin, sondern eine bedachte, geduldige. Eine, die sich Zeit für jede einzelne Person nahm und selbst im Angesicht des Todes immer ruhig und kontrolliert blieb. Ich war selbst in der Planung des Überfalls auf das Gefängnis beteiligt gewesen. Wir setzen ein Zeichen, indem wir unsere Leute befreien. Wir sind Rebellen. Wir halten zusammen. Wir lassen niemanden sterben.
Es war verdammt scheinheilig, so wie alles, was wir taten.
Nach nur fünfzehn Minuten, die sich wie Stunden zogen, kehrte ich in den Innenhof zurück.
»Hey, Junge ohne Namen, ich bin wieder da!« Ich zwang mich, ein gewisses Maß an Fröhlichkeit vorzuspielen.
Der Junge kroch unter der Bank hervor. Er hatte sich Dreck ins Gesicht und in die Haare geschmiert, um sich in der tristen Umgebung zu tarnen. »Du bist zurückgekommen.« Er klang überrascht und irgendwie abweisend.
»Natürlich«, bestätigte ich. In Gedanken war ich schon einen Schritt weiter: Wie würde ich ihn ins Hauptquartier bekommen? Die Tragelast der Helikopter und Wüstenvans war genaustens beschränkt und man würde ihm stets die Erwachsenen vorziehen. Es geht um das Zeichen. Wir haben genug Nachwuchs. Ich konnte die Worte bereits förmlich hören. Da ist es ein Junge mehr oder weniger nicht wert, unseren Plan über den Haufen zu werfen.
»Komm mit«, sagte ich. »Wir müssen hier raus.«
Er machte vorsichtig einen Schritt auf mich zu, dann einen weiteren, in stummem Einverständnis.
Über unseren Köpfen lärmten die abhebenden Helikopter und ich zählte stumm mit, als sie vorbeiflogen. Zwölf. Wenn alles nach Plan gelaufen war, waren zeitgleich auch sechzehn Minivans auf ihren Weg durch die Wüste aufgebrochen. Ich hätte in einem davon sitzen sollen, aber da ich nicht um Punkt eins am Treffpunkt gewesen war, hatten sie wohl vermutet, ich wäre tot.
Beinahe hätte ich gelacht bei dem Gedanken. So einfach konnte mich keiner töten, nicht mit der Vorbereitung, die ich in all den Jahren bekommen hatte. Und nicht mit der kugelsicheren Weste und dem Helm. Es gab letztendlich nur eine Person in der Welt, die die Macht dazu hatte, aber wer das war, daran wollte ich in diesem Moment nicht denken.
Der Junge und ich machten uns auf den Weg durch die Flure. Ich warf immer wieder einen Blick nach hinten. Man wusste nie, wo sich noch jemand versteckt haben konnte, der uns jetzt hinterrücks erschießen wollte. Es war ein Gefühl, das ich seit Beginn unserer Mission kein einziges Mal verspürt hatte: Angst.
»Bleib immer vor mir, ja?«, wies ich den Jungen an. Wenn jemand vor uns auftauchen würde, konnte ich schnell eingreifen. Wenn wir von hinten angegriffen würden, war der Junge schutzlos.
Er nickte stumm.
Ich blickte erneut über meine Schulter zurück. Ein Schatten huschte hinter die nächste Wand, aber ich hatte ihn gerade so noch gesehen. Bloß der Lauf seiner Waffe lugte noch um die Ecke, und im nächsten Moment knallte auch schon der Schuss.
Ich warf mich zu Boden und riss den Jungen mit. Ein dumpfer Schmerz breitete sich an meiner rechten Seite aus – das würde auf jeden Fall einen blauen Fleck geben, aber immerhin steckte keine Kugel zwischen meinen Rippen.
Der Soldat des Staats stand mir jetzt offen gegenüber und natürlich trug auch er schusssichere Kleidung, aber letztendlich waren er und ich gleichermaßen trainiert worden. Wir kannten die Schwachstellen des jeweils anderen.
Der Junge gab ein Wimmern von sich, aber ich ließ mich nicht ablenken. Waffe ziehen, zielen, schießen, bevor der andere es tat.
Blut spritzte gegen die Wand hinter dem Soldaten, als er am Boden zusammensackte. Ich wandte mich hastig ab, rappelte mich auf und zog den Jungen hoch. »Komm, weiter, schnell!«
Wir hasteten nach draußen und standen endlich im Sand vor dem Gefängnis. Hinter uns die Ruinen, vor uns unendliche Weiten der Wüste.
Es war heiß, viel zu heiß. Kurz wägte ich ab, wie wahrscheinlich es war, dass sich jetzt noch lebendige Soldaten im Gefängnis befanden, dann entledigte ich mich meines Helmes und der schusssicheren Weste. Das Tuch, das ich wie eine Art Sturmmaske unter dem Helm getragen hatte, war schweißnass und ich zog es ebenso aus, sodass meine langen dunkelblauen Haare jetzt offen über meine Schultern fielen. Es gab mir ein Gefühl von Freiheit und von Rebellion – dass ich unter den beigen Camouflage-Klamotten noch eine eigene Identität hatte.
Der Junge beobachtete mich mit einer undefinierbaren Neugierde im Blick, und mit einem Mal fiel mir ein, dass ich mich gar nicht vorgestellt hatte. »Ich bin übrigens Arianna. Sergeant Arianna Travino, wenn du es ganz genau haben willst.«
»Hi«, erwiderte er etwas unschlüssig. »Wie gesagt, ich weiß meinen Namen nicht.« Stille. »Du bist Rebellin, oder?«
Ich nickte.
»Warum?«
Wow, das kam unerwartet. Ich zögerte, dann winkte ich ab. »Erzähle ich dir später, ja? Wir sollten zusehen, dass wir von hier wegkommen, bevor die Verstärkung des Staats anrückt.« Ich gab ihm meine Weste und ließ den Helm achtlos in den Sand fallen. »Zieh die an, die schützt dich etwas vor der Sonne.«
Er gehorchte und streifte die Weste über, die ihm natürlich viel zu groß war und ihn noch kleiner und zerbrechlicher wirken ließ als er sowieso schon war.
»Also …« Ich redete, um mich selbst zu beruhigen. »Wir gehen jetzt dort rüber in den Anbau und überprüfen die Ressourcen, die wir haben, und dann schauen wir, wie wir von hier wegkommen, okay?«
Er nickte stumm und folgte mir in einigem Abstand zu dem besagten Anbau, der nichts weiter als ein kleinerer Betonklotz neben dem Gefängnis war. Laut dem Plan, den wir uns vor dem Angriff auf den Knast besorgt hatten, wurden hier diverse Dinge gelagert, die uns bei der Flucht hilfreich sein konnten: Wüstentaugliche Motorräder, haltbare Nahrung, Ausrüstung für Reisen.
Aber die Halle war leer.
Ich wusste nicht, ob meine Leute oder die fliehenden Soldaten die Motorräder genommen hatten – es war aber auch egal. Wir saßen fest.
»Und jetzt?«, fragte der Junge beinahe tonlos.
»Wir müssen laufen.« Ich marschierte quer durch die Halle zu einer Werkbank, auf der noch ein paar vereinzelte Dinge verstreut lagen, und sah mich um. Das Erste-Hilfe-Set wanderte sofort in meinen Rucksack, dann füllte ich meine halb leere Wasserflasche am Wasserhahn in der Ecke auf. Ich bezweifelte, dass das reichen würde, aber wir hatten keine andere Chance. Es gab weder Essen noch Flaschen hier, also mussten wir uns auf eine anstrengende Reise gefasst machen.
Nach kurzem Überlegen kramte ich zwei frische Schutztücher aus meinem Rucksack, befeuchtete sie am Wasserhahn und reichte eins dem Jungen. »Wickel das um deinen Kopf, es schützt deine Haut und kühlt dich ab.« Ich machte es ihm vor und er machte es nach, und dann standen wir wieder an der Tür der Halle.
»Wir schaffen das, okay?« Ich wusste nicht, ob ich ihn oder mich selbst zu beruhigen versuchte.
»Okay«, erwiderte er, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sein Einverständnis weniger in Vertrauen als in etwas anderem begründet war, das ich nicht greifen konnte.
02 – In der Wüste
Die Wüste lag brennend heiß vor uns, als wir die Halle wieder verließen. Sand, Sand, Sand, wohin ich auch blickte. Ich hasste die Apokalypse so abgrundtief – noch vor wenigen Jahrzehnten war hier vielleicht mal ein Wald gewesen, eine Wiese, ein Feld. Dann waren die Sandstürme gekommen und hatten alles Lebendige niedergemacht.
Andererseits: Wenn die Sandstürme nicht gewesen wären, wären die Kriege eskaliert. Vielleicht wäre dann hier nukleares Sperrgebiet. So oder so, beide Katastrophen waren menschengemacht. Wir trugen Schuld an allem, was passiert war. Und Präsidentin Faherty machte keine Anstalten, irgendetwas zu verbessern. Sie hatte gut reden, in ihrer befestigten und gesicherten Stadt, im Luxus.
»Kennst du den Weg?«, fragte der Junge leise und unterbrach so meine Gedanken.
Ich hatte keine zufriedenstellende Antwort für ihn.
Wohin, war die Frage.
Zurück zu den Rebellen, natürlich, war meine erste instinktive Antwort. Und die einzig richtige. Trotz allem.
Und wie?
Gute Frage.
Ich kannte zwar das ganze Gefängnis auswendig, aber nicht den Weg dorthin beziehungsweise zurück. Wir normalen Rebellen kannten den Standort des Hauptquartiers nicht – bloß die, die einen Helikopter oder Transporter steuerten, bewahrten dieses gefährliche Wissen. Die Rebelleneinheit hatte ein sehr komplexes Sicherheitssystem.
Andererseits war ständig irgendwer von uns in den Städten unterwegs, um neue Mitglieder anzuwerben. Wir würden sie finden, irgendwie. Wir mussten.
»Wohin gehen wir?«, wiederholte der Junge nachdrücklich.
»In die Wüste«, sagte ich. Ich musste irgendwas sagen und das war das Einzige, das mir einfiel. Natürlich stellte die Antwort ihn nicht zufrieden, aber er schien sich nicht zu trauen, nochmal nachzuhaken – und die Wahrheit würde ihn ebenso wenig zufriedenstellen. Der Weg in die Zivilisation war höllisch weit. Man hatte den Standort des Gefängnisses nicht einfach irgendwie ausgewählt.
Ich blickte zum Himmel und wählte eine vage Richtung. Jemand hatte mal erwähnt, dass unser Hauptquartier westlich des Knasts lag, und wenn jetzt Mittag war, stand die Sonne im Süden, oder? Und wenn der Staat Soldaten zum Knast schicken würde, dann sicherlich aus der Hauptstadt Forlin. Wenn wir jetzt nach Westen gingen, hatten wir Forlin im Rücken und liefen weniger Risiko, von den Helikoptern gesehen zu werden.
Irrsinnig war die Aktion natürlich trotzdem, aber es gab keinen anderen Weg. Zurück zu den Rebellen oder in den Händen des Staats landen – es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Do or die-Situation.
Wir liefen im totalen Schweigen durch den Sand. Der Junge folgte mir in einigem Abstand, als traute er sich nicht, auf einer Höhe mit mir zu sein, und ich hing meinen Gedanken nach.
Meine Eltern hatten noch die Zeit mitbekommen, die allgemein als das »Früher« bezeichnet wurde. »Früher war alles anders«, pflegten diese Generationen zu sagen. Als ich noch ein Kind gewesen war – als die Apokalypse noch fünf, zehn Jahre her war und man noch Hoffnung auf einen Neuanfang gehabt hatte, hatten sie mir vom »Früher« erzählt. Von einer Zeit, in der man die Apokalypse hätte verhindern können – und es hatte immer Leute gegeben, die dafür gekämpft hatten. Für Demokratie, für die Umwelt, für Menschlichkeit. Von allem hatten wir jetzt viel zu wenig.
Hey, liebe Bevölkerung, ihr dürft doch wählen, beschwert euch nicht. Klar – wählen durfte, wer sich ausweisen konnte und einen festen Wohnsitz hatte. Sprich: Die Leute innerhalb der Metropolen. Die, denen es sowieso gut ging. Alle anderen – die Mehrheit der Bevölkerung –, die in Dörfern und Slums außerhalb der Städte lebten, die vielleicht sämtliche legalen Dokumente in der Apokalypse verloren hatten oder deren Barackendorf nicht als Wohnort anerkannt wurde, hatten keine Stimme.
Und, mal ehrlich: Die Optionen an Parteien waren alle beschissen. Die einen waren mehr und die anderen weniger schlimm, aber sie bewegten sich alle auf einer Skala von Wir kümmern uns gar nicht um Mensch und Umwelt bis Wir tun so, als würden wir uns kümmern.
Was brachte eine intakte Wirtschaft – so intakt sie eben sein konnte, in einer Welt wie dieser –, wenn die Bevölkerung nichts davon hatte? Wenn die Armen immer ärmer und die Reichen immer ärmer wurden?
Wenn Kinder so verzweifelt waren, dass sie zu den Rebellen überliefen?
Bist du Rebellin? Ja. Warum?
Weil ich blind war.
Als wir an einer groben Steinformation vorbeikamen – die Überreste einer Stadt, die jetzt unter einer dicken Sandschicht begraben war – holte der Junge mich wieder ein.
»So eins hat mich am Kopf getroffen«, erklärte er. »Laut den Leuten im Knast zumindest.«
»Dir sind solche Trümmer auf den Kopf gefallen?«
»Yep. Die Leute vom Staat haben mir überhaupt nichts gesagt, aber die Leute in meiner Zelle haben es mir so erklärt, sie haben wohl Gespräche der Wärter belauscht. Sie haben gesagt, unser Haus wäre in einem der Sandstürme zusammengebrochen. Der Staat hat aufgeräumt.«
Das passt, dachte ich bitter. Der Wohltäter Staat: Natürlich tun wir etwas für die Armen. Wir helfen ihnen, nachdem die Katastrophe, die wir hätten verhindern können, eingetreten ist.
»Meine Eltern sind tot«, fuhr der Junge leiser fort. »Aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht an sie. Angeblich hatte ich auch mal eine Schwester. Die ist schon vor Ewigkeiten zu den Rebellen übergelaufen, meinten sie. Sie glauben, dass ich deshalb in den Knast gekommen bin. Der Staat wollte sie erpressen, dass sie ihr Leben im Tausch für meins gibt. Aber sie ist nicht gekommen, um mich zu retten.« Er schüttelte den Kopf. »Sie interessiert sich nicht für mich. So wie alle Erwachsenen.«
»Was – wie meinst du das?«
»Ich möchte nicht darauf antworten.« Er hob das Kinn, aber seine Augen wanderten unruhig hin und her.
Ich zögerte. »Was haben dir die Leute im Gefängnis sonst noch erzählt?«
»Nichts.« Er seufzte. »Ich habe eine Art Ame- Ane- Vergesslichkeit, meinte eine der Frauen, die mit mir gefangen waren.«
»Amnesie?«
»Genau. Ich weiß noch ein paar Dinge, die ich mal gelernt habe, aber ich erinnere mich fast gar nicht an Gesichter oder Orte oder Namen. Nicht mal meinen eigenen. Der Staat muss ihn ja kennen, vielleicht haben sie in den Trümmern das Klingelschild gefunden oder meinen Ausweis. Aber sie haben ihn mir nie gesagt und … und es hat mich auch nie besonders interessiert. Es gibt nichts in meiner Vergangenheit, das mich wirklich interessiert.«
Und das ist es, was der Staat unseren Kindern antut.
»Welchen Namen willst du?«, fragte ich den Jungen.
»Was …?«
»Ich kann dich nicht einfach Junge ohne Namen nennen.«
»Das haben sie im Gefängnis auch getan. Junge. Bursche. Oder kleiner Bastard.«
»Wer hat das gesagt?!« Ich blieb abrupt stehen, um ihn anzuschauen.
»Alle. Die Wächter. Die Erwachsenen in meiner Zelle. Die … waren wie du. Rebellen, meine ich.«
Meine Einheit. Eine leichte Übelkeit stieg in mir auf. Leider überraschte es mich nicht. Ich kannte zu viele Leute, die so mit Schwächeren umgingen.
»Ich möchte dich aber nicht Junge nennen«, erwiderte ich. »Willst du dir nicht einen neuen Namen aussuchen?«
»Ich denk mal drüber nach.« Zum ersten Mal spielte sich ein Lächeln auf seine Lippen.
03 – Unterkunft
»Wie lange noch?«, fragte der Junge mich irgendwann, als sich die Sonne langsam dem Horizont näherte und den Himmel und die Wüste in ein feuriges Orange tauchte. Er hatte die Frage in den letzten sechs Stunden immer wieder gestellt und ich hatte bloß immer »Noch ein paar Stunden« geantwortet, aber jetzt schien es mir endlich Zeit für die unbeschönigte Wahrheit.
»Wir kommen langsamer voran als gedacht. Bei der nächsten Gelegenheit suchen wir uns ein Nachtlager und laufen morgen weiter.«
»Hm«, machte er.
»Hast du einen Einwand?«
Er schaute zu mir hoch. »Würdest du denn einen Einwand von mir hören wollen?«
»Warum nicht? Ich bin nicht unfehlbar. Es kann aber sein, dass ich andere Argumente habe.« Ich hatte inzwischen gemerkt, dass er mir beinahe mit Angst oder zumindest einem sehr ungesunden Respekt gegenübertrat, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen sollte.
»Also … wäre es nicht sinnvoller, nachts zu laufen? Wenn es kalt ist? Dann können wir tagsüber rasten. Der Sand ist so heiß … ich schaffe das morgen nicht nochmal, glaube ich.«
Er hatte Recht, unser Weg war unglaublich anstrengend – und das für mich, die ja als Rebellin ein regelmäßiges ausgiebiges Sporttraining absolviert hatte. Wie sehr er litt, wollte ich mir gar nicht vorstellen. Bei jedem Schritt sanken wir tief im Sand ein; man stolperte mehr, als dass man lief. Ab und zu hatten wir natürlich Pausen gemacht, aber das Sitzen im Sand wurde schnell zu heiß und wir waren weitergelaufen.
»Keine üble Idee«, erwiderte ich. »Aber ich glaube, wir haben beide jetzt eine Pause nötig. Da vorne am Horizont ist ein Dorf, das nicht ganz untergegangen ist, vielleicht können wir dort in einem Haus schlafen. Das Glück haben wir vielleicht nicht, wenn wir tagsüber schlafen wollen, und dann müssen wir unter der offenen Sonne schlafen. Das überleben wir nicht.«
»Also ich könnte noch ein Stück laufen«, versuchte er es vorsichtig.
»Wenn es nur das Laufen wäre, schon. Aber –«
»Oh«, unterbrach er mich. »Nein, ist schon gut, du hast Recht.«
»Was?«
»Biomasse.«
»Genau.« Ich lächelte erleichtert. »Biomasse.« Es war der Begriff für alles, was in dieser Wüste lebte und nachts an die Oberfläche kam – gewöhnlich wilde Tiere, aber auch Mutationen, die bei den Stürmen aus Genlaboren befreit worden waren. Monster, die wahnsinnige Wissenschaftler gezüchtet hatten, um die Apokalypse noch schlimmer zu machen. Und natürlich: Menschen.
»Laufen ist die eine Sache«, erklärte ich ihm trotzdem nochmal, »aber Kämpfen ist eine ganz andere. Auch ich habe nur begrenzt Kraft.«
»Ist schon gut«, nickte er. »Dann suchen wir eine Unterkunft?«
Ich nickte.
»Arianna …«
»Ja?«
»Warum tust du das?«
»Was?«
»Warum hast du mich mitgenommen? Warum rennst du mit mir durch die Wüste, statt einfach irgendwen anzurufen, der dich abholt?«
Ich musste lachen. Abholt? Nein, niemals. Niemand würde auf die irrsinnige Idee kommen, einen Helikopter rauszuschicken, um eine einzige Rebellin abzuholen. Es war viel zu riskant. »Das erkläre ich dir, wenn wir in Sicherheit sind, ja?«
Stille. Dann, leiser: »Willst du mich ausnutzen? Soll ich für dich arbeiten? Rekrutierst du mich für die Rebellen?«
»Himmel, nein!« Es tat weh, ihn so reden zu hören. Ein Kind. »Ganz im Gegenteil. Ich bringe dich zwar erstmal zu meiner Einheit, aber es steht dir völlig frei, ob du bei ihnen bleiben willst.«
»Wie du meinst.« Er schien wieder unzufrieden, fragte aber nicht nach.
Das war es also, das ihn zu stummem Gehorsam getrieben hatte. Angst. Angst, ich würde ihn so behandeln wie die Leute im Gefängnis.
Keiner der Erwachsenen interessiert sich für mich.
Die Silhouette am Horizont, die ich gesehen hatte, war kein ganzes Dorf. Es war bloß ein Turm, dessen Spitze aus dem Sand ragte. Ein Kirchturm, vermutlich. Der Rest der Stadt war im Sand begraben, aber ich meinte, den Dachgiebel der Kirche unter meinem Füßen zu spüren.
»Wir können durchs Fenster klettern«, schlug ich vor. »Dann verbringen wir die Nacht hier und laufen in den frühen Morgenstunden weiter.«
Der Junge schwieg, folgte mir aber zur Kirche.
Das Fenster war höher, als es von weiter weg ausgesehen hatte, aber zumindest gab es keine Glasscheibe, die wir hätten zerstören müssen. Es sah aus, als wären wir dort drinnen sicher vor der Biomasse.
Ich ließ den Jungen auf meine Schultern klettern und hob ihn auf die Fensterbank. Selten zuvor war ich so froh um das Militärtraining gewesen, zu dem ich Tag für Tag gezwungen wurde.
Nachdem der Junge in den Glockenraum geklettert war, lief ich zwei Schritte an der Wand hoch und zog mich ebenfalls nach drinnen. Es war dunkel und staubig und der Raum war groß und leer – die Glocke, die hier einst geläutet hatte, war wohl längst gestohlen und verkauft worden.
Ich zückte meine Stabtaschenlampe und ließ den Lichtkegel über den Boden wandern, bis ich bei einer Falltür hängenblieb.
»Cool«, sagte der Junge leise. »Wir sind in Sicherheit. Und jetzt gehen wir runter in die Kirche?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich muss nach draußen sehen können, falls wir angegriffen werden. Sie suchen noch immer nach uns, weißt du?«
»Sie?«
»Der Staat. Meine Einheit hat den Knast überfallen – natürlich will man überprüfen, ob noch jemand von uns hier unterwegs ist. Die nutzen wahrscheinlich sogar Wärmebildkameras bei Ruinen wie diesen. Und dann sind da noch unsere Spuren im Sand …« Es schien mir immer wahrscheinlicher, dass wir heute Nacht unliebsamen Besuch haben würden.
»Dann wären wir doch unten sicherer …?«
»Unten gibt es keinen Fluchtweg.«
»Wenn die durch ein Fenster hier reinklettern, kommen wir unmöglich schnell genug durch ein anderes nach draußen. Die haben Waffen.«
Er hatte Recht, natürlich, ich hatte denselben Gedanken auch gehabt, aber ich wollte es nicht akzeptieren. Ich wollte nicht in einen Raum gehen, der unter einer Sandschicht begraben war und dessen Mauern ungefähr siebenhundert Jahre alt und damit total instabil waren. Und in dem wir definitiv in der Falle saßen.
Ich seufzte und trat näher an die Falltür. »Dann lass uns mal sehen, ob wir die aufkriegen.« Ich zog an dem Eisenring, der wohl einen Griff darstellen sollte, aber das Holz hier war wohl keine siebenhundert Jahre alt – jedenfalls war es kein bisschen porös, bewegte sich aber auch keinen Zentimeter. Wir konnten also hier oben bleiben.
Dann sah ich in die Augen des Jungen, verängstigt und zweifelnd, und ich verstand. Er hatte Angst. Und es war meine Verantwortung, ihm diese Angst zu nehmen.
Ich wühlte in meinem Rucksack, zückte das schwere Brecheisen, das mich auf dem Weg schon die ganze Zeit in den Rücken geschlagen hatte, und nutzte es als Hebel. Das Holz zerbarst.
»Ich geh vor«, sagte ich und schnappte mir meinen Rucksack, eine Hand an der Waffe. »Und wenn ich dich rufe, kannst du nachkommen.«
»Okay.«
Den Rucksack auf dem Rücken und die Pistole in der Hand kletterte ich Stück für Stück die Leiter hinab, die in Form von Eisensprossen in die Wand eingelassen war. Für die Stabtaschenlampe hatte ich keine Hand mehr frei, deshalb war es bloß der dünne Lichtstrahl der in die Pistole integrierten Lampe, in deren Licht ich den Abstieg fortsetzte. Da unten konnte alles und jeder lauern. Kreaturen – oder schlimmer: Menschen. Soldaten.
Aber ich war allein. Meine Füße berührten den sicheren Boden; ich schaltete die starke Taschenlampe wieder dazu. Das Kirchenschiff war leer, die alten Bänke teils verwittert, teils umgekippt, der Altar mit Graffiti und Dreck beschmiert. Die Buntglasfenster lagen in Scherben am Boden und gaben den Blick auf die dichten Sandschichten draußen frei.
Die christliche Gemeinde, die hier einst gefeiert hatte, war entweder sehr arm gewesen oder die Kirche war schon mehrmals überfallen worden. In diesen Zeiten war beides eine glaubhafte Möglichkeit.
»Wir sind sicher«, rief ich halblaut und hörte sofort das Rascheln von Stoff, als der Junge hinter mir die Leiter runterkletterte.
Auch er sah sich kurz um. »Wo sollen wir schlafen?«
»Hinter dem Altar«, entschied ich. »Wir können die langen Sitzkissen von den Bänken nehmen, um darauf zu liegen. Ich will nur halbwegs versteckt sein – bringt uns zwar nicht viel, wenn sie uns einmal im Visier haben, aber trotzdem … Ich brauche die Sicherheit.«
Er nickte und wir machten uns auf den Weg quer durch die Kirche zu unserem neuen Schlafplatz, die Sitzkissen unterm Arm. Schließlich saßen wir uns gegenüber auf den Kissen und ich reichte ihm die Wasserflasche und einen Proteinriegel aus meinem Rucksack.
»Arianna – kann ich dich Ria nennen?«
»Klar.«
»Ria.« Er nahm einen Schluck aus der Flasche. »Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Warum du Rebellin bist und … das hier tust.«
04 – Nacht
»Warum ich Rebellin bin …« Ich seufzte. »Weil ich damals dachte, dass ich etwas in der Welt verändern könnte.«
»Du dachtest? Jetzt nicht mehr?«
»Ich habe sie immer sehr glorifiziert. Also – verherrlicht«, wählte ich ein anderes Wort. »Sie waren immer eine Art unberührbare Helden. Und als ich ihnen dann mit vierzehn Jahren zum ersten Mal in echt begegnet bin … hat sich das Bild nur gestärkt. Es war Nacht, ich war ausnahmsweise in einer Stadt unterwegs, weil ich etwas dort kaufen musste, was es bei uns im Dorf nicht gab, und die beiden Rebellinnen haben mich beschützt, als ich beinahe von zwei übergriffigen Staatssoldaten überfallen worden wäre.«
Der Junge wirkte unbeeindruckt. Vielleicht hatte er im Gefängnis viel brutalere Geschichten gehört.
»Die beiden hatten eine faszinierende Aura, fast wie ein Geheimbund. Sie nahmen mich mit in eine ihrer verruchten Kneipen und erklärten mir, wer sie waren. Rückblickend – natürlich war es Absicht. Natürlich haben sie gehofft, in mir ein neues Mitglied zu finden. Und es hat funktioniert. Ich habe sie noch stärker idealisiert und habe auf den Tag gewartet, endlich alt genug zu sein, um ihnen beizutreten und an ihrer Seite für Veränderung zu kämpfen. Ich habe trainiert, was ich trainieren konnte, und mit siebzehn bin ich endlich von daheim weggelaufen.«
»Die Leute, die ich im Knast getroffen habe, waren ganz anders«, widersprach der Junge vorsichtig. »Sie waren böse. Haben gestritten ohne Ende. Daran war nichts faszinierend.«
»Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt.« Ich zögerte. »Die jungen Frauen von damals – ich habe bei meinem Beitritt nach ihnen gefragt, in derselben Kneipe. Der Typ an der Theke hat nur gelacht und gesagt, die beiden seien seit Monaten tot. Es hätte mich sicherlich abschrecken sollen, aber stattdessen hat es mich noch mehr fasziniert. Dass die Leute tatsächlich bereit waren, ihr Leben für Verbesserung zu geben. Ich glaubte, die Rebellen wären mein Schicksal, meine Bestimmung, aber es war eine völlig bescheuerte Entscheidung.«
Er nickte bloß.
»Und, wie du sagst: Die Rebellen sind kein Ideal. Sie sind bloß … Monster. Ich hatte keine Freunde. Bekannte, Kollegen, ja, aber nie Verbündete in der Art, wie ich es mir erträumt hatte. Keine geheimen Verschwörer, mit denen ich durch irgendwelche Tunnel in irgendwelche Regierungsanstalten klettern konnte, sondern bloß brutale Bestien. Sprengen, schießen, töten, Chaos und Zerstörung anrichten. Als ich Sergeant wurde, habe ich versucht, meine Einheit menschlicher zu machen. Im Englischen gibt es ein Sprichwort: Practise what you preach. Das bedeutet: Handle so, wie du es anderen predigst. Und das ist das Hauptproblem der Rebellen. Sie predigen Menschlichkeit, aber ihre Soldaten sind ersetzbare Marionetten. Ich bin Sergeant, aber sie würden sich nicht die Mühe machen, mich oder uns hier abzuholen, wenn ich sie jetzt anrufen würde.«
Der Junge schwieg lange, dann hob er den Kopf. »Also hast du mich gerettet, um ihnen zu zeigen, dass für dich jeder Mensch wichtig ist?«
»Nein.« Ich hielt seinem Blick stand. »Nicht, um es ihnen zu zeigen. Ich habe dich gerettet, weil für mich jeder Mensch wichtig ist. Ich predige nicht, ich handle nur. Wenn du verstehst …?«
Er nickte, aber ich war mir nicht sicher, ob er es wirklich verstanden hatte. Andererseits begriff er für einen Zehnjährigen wirklich tiefsinnige Dinge. Dinge, die jemand in seinem Alter noch nicht verstehen sollte. Ich wollte gar nicht wissen, wer oder was ihn dazu gezwungen hatte, so schnell erwachsen zu werden.
»Und außerdem könnte ich wirklich gut einen Freund gebrauchen.« Ich vermied es, ihm in die Augen zu sehen, während ich meinen Rucksack nach einer dünnen Decke durchwühlte, die ich schließlich fand und ihm reichte. »Schlaf gut.«
»Du hast keine Decke.«
»Ich hab meinen Mantel, das muss reichen.« Klare Lüge, natürlich.
»Sicher?«
»Sicher.« Ich legte mich auf die Kissen, den Rücken gegen den kalten Stein des Altars gelehnt. So konnte ich wenigstens sichergehen, dass mich niemand von hinten überfallen würde. Der Junge legte sich in einigem Abstand auf seine Kissen und ich löschte das Licht meiner Taschenlampe.
Stille, dann raschelte seine Decke.
»Milo«, sagte er. »Ich will Milo heißen.«
Ich musste lächeln. »Dann gute Nacht, Milo.«
05 – Unter Monstern
Der Helikopter landete in den frühen Morgenstunden.
Ich hatte ihn nicht gehört – diese modernen Kriegshelikopter waren zu leise. Alles, was ich hörte, waren die Schritte im Turm über uns und das laute, dreckige Lachen der Soldaten. Sie machten sich nicht mal die Mühe, sich anzuschleichen – warum auch? Für sie waren Milo und ich leichte Beute.
Ich hatte schon eine Weile wachgelegen, bevor ich sie wahrgenommen hatte, und so war ich sofort auf den Beinen und weckte Milo so leise wie möglich.
»Sie kommen«, flüsterte ich.
»Der Staat?« Er blinzelte kaum. »Dann sind wir verloren.«
»Nein, verdammt!« Ich zog ihn hoch. »Wir sind so weit gekommen, da geben wir jetzt nicht einfach auf! Jetzt komm schon!«
Ich hatte nicht mal gemerkt, dass ich wieder in meinen militärischen Tonfall gerutscht war, bis ich in seine angsterfüllten Augen sah. Aber es war jetzt keine Zeit für Trost – erstmal mussten wir das hier überleben.
Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn Richtung Sakristei, die ich gestern Abend noch als einzige Versteckmöglichkeit auserkoren hatte. Das Quietschen der metallenen Leitersprossen erklang; die ersten Soldaten kamen. Und auch die Tür zur Sakristei quietschte. Fuck! Ich schob sie trotzdem hinter uns wieder zu, das würde uns vielleicht einige wertvolle Sekunden geben.
Ich sah mich im Raum um. Die Tür nach draußen konnten wir vergessen, die würde unter all dem Sand nicht mal einen Spalt aufgehen. Dann blieb nur –
»Da, der Schrank«, flüsterte ich Milo zu und wir huschten in einen hohen Wandschrank, zwischen all die bodenlangen, muffigen Messgewänder. Ich zog die Tür hinter uns zu – sie klemmte und ließ einen Spaltbreit Licht hinein.
Im Kirchenraum lachten und lästerten die Soldaten weiterhin.
Türen knallten – wahrscheinlich der Beichtstuhl. Gut, dass ich den direkt als Versteck ausgeschlossen hatte.
»Aber sie waren definitiv hier«, hallte die Stimme eines Manns dumpf von den Wänden. »Hier liegt massenweise Zeug hinterm Altar – ein Mantel, eine Decke, ein Rucksack!«
»Und einzelne Haare auf dem Kissen hier«, rief eine Frau. »Blaue Haare! Meint ihr, das ist Sergeant Travino?«
Ein bitteres Lächeln schlich auf meine Lippen. Noch heute Morgen hätte es mich nicht gekümmert, wenn sie mich an meiner Haarfarbe erkannt hätten, aber im Moment wollte ich gar nicht so genau darüber nachdenken, was mein ursprünglicher Plan nach der Gefängnisstürmung gewesen war. Mein Ausweg aus den Reihen dieser grausamen sogenannten Rebellion.
»Wenn, dann müssen wir sie schnell finden, bevor sie sich selbst erschießt. Diese dummen Rebellen tun doch alles, um ihre Geheimnisse zu wahren!«
»Das wirst du tun?«, wisperte Milo erschrocken.
»Nein, keine Sorge. Ich müsste, unseren Regeln nach«, gab ich zurück. »Aber das ist Unsinn, niemand tut es. Niemandem ist es das wert. Die Rebellion … an sich ist eigentlich Schwachsinn. Wenn die Rebellen an die Macht kämen, würde sich im Land nicht viel ändern. Sie haben keine Ahnung vom Regieren. Und davon mal abgesehen ist die Struktur unserer Einheit so aufgebaut, dass niemand so viel weiß, dass es Schaden anrichten kann. Wir sind als Einzelne auf eine gewisse Art ersetzbar.«
»Ersetzbar?«
»In unserer Rebelleneinheit ist jeder nur ein Kämpfer, nur ein Soldat, und es ist kein Problem, einen von uns für einen übergeordneten Zweck zu opfern.« Es klang bescheuert, das wusste ich. Vielleicht war es das auch. Aber wenn es das ist, was es braucht, um Präsidentin Melena Faherty und ihr verfluchtes Parlament zu stürzen? Nein. Faherty interessierte sich nicht für uns, wenn es nicht darum ging, uns hinzurichten. Verdammte Todesstrafe.
»Das klingt schlimmer als das Gefängnis«, setzte Milo an, aber ich hob bloß den Finger an die Lippen, als die Schritte draußen lauter wurden. »Leise jetzt! Sie kommen!«
Milo zuckte zusammen und drückte sich gegen die Rückwand des Schranks. Im nächsten Moment klammerten sich seine kleinen Hände an meine Uniform.
»Hilfe«, wisperte er und ich griff reflexartig nach seinen Armen. Die Schrankwand hatte nachgegeben und war zur Seite geschwungen. Dahinter tat sich ein dunkler Abgrund auf.
»Du bist genial«, flüsterte ich und richtete meine Stabtaschenlampe auf den Abgrund – eine Treppe nach unten, die Wände gemauert. »Ein Geheimgang!«
Ich drückte Milo die Lampe in die Hand. »Mach dir Licht und geh vor, ich komm gleich nach.« Sobald ich sichergestellt habe, dass wir nicht da unten in der Falle sitzen.
Er nickte zögerlich und verschwand mitsamt dem Licht irgendwo im Gewölbe der Kirche. Im selben Moment ging die Tür zur Sakristei auf und drei Personen in der typischen staatlichen Uniform kamen rein. Blauer Camouflage-Print. Musste man sich erstmal vorstellen – sie hatten es selbst in einer Wüste nicht nötig, sich zu verstecken. Ich hingegen wünschte mir auf dieser Flucht zum ersten Mal in meinem Leben eine ganz normale, vollkommen unindividuelle Haarfarbe.
»Sie müssen hier irgendwo sein«, murmelte ein Mann. »Durch die Tür können sie unmöglich geflohen sein!«
»Na ja, viele Möglichkeiten gibt es für Travino ja nicht. Die ist doch viel zu groß für die meisten Verstecke!«
Die Frau, die das gesagt hatte, drehte sich einmal um ihre eigene Achse und lief dann zielstrebig auf den Schrank zu, in dem ich stand. Scheiße – wenn die anderen beiden ebenfalls im Raum waren, konnte ich sie nicht einfach erschießen. Sie waren in der Überzahl und damit die schnelleren Schützen.
Ich huschte ebenfalls ein Stück die Treppe runter und schob dann die eben zur Seite geschwungene Tür in der Schrankwand wieder zu. Hoffentlich reichte das als Tarnung.





























