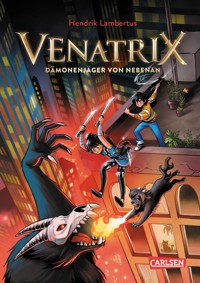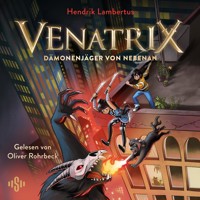9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Familie. Die Chronik einer Stadt. Das Bild einer Epoche. Bremen im 18. Jahrhundert: Die Altendiecks sind eine der angesehensten Handwerksfamilien der Stadt. In ihrer Werkstatt entstehen kunstvolle Uhren für Ratsherren, Kaufleute und Seekapitäne. Doch nicht einmal Uhrmacher können den Lauf der Zeit aufhalten – oder die Katastrophen, die sie mit sich bringt. Johann Altendieck wird die Familie beinahe in den Abgrund stürzen, seine Tochter Gesche wird grausame Entscheidungen treffen müssen, sein Enkel Nicolaus wird einen Krieg erleben, der den ganzen Kontinent zerreißt. In diesen dunklen Zeiten können sie nur eins tun: sich an dem festhalten, was bleibt. Liebe. Hoffnung. Und die Familie. Ein beeindruckender historischer Roman, der fast hundert Jahre Geschichte einer norddeutschen Uhrmacher-Dynastie erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hendrik Lambertus
Das Erbe der Altendiecks
Eine Uhrmacher-Saga
Historischer Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte einer Familie.
Die Chronik einer Stadt.
Das Bild einer Epoche.
Bremen im 18. Jahrhundert: Die Altendiecks sind eine der angesehensten Handwerksfamilien der Stadt. In ihrer Werkstatt entstehen kunstvolle Uhren für Ratsherren, Kaufleute und Seekapitäne. Doch nicht einmal Uhrmacher können den Lauf der Zeit aufhalten – oder die Katastrophen, die sie mit sich bringt. Johann Altendieck wird die Familie beinahe in den Abgrund stürzen, seine Tochter Gesche wird grausame Entscheidungen treffen müssen, sein Enkel Nicolaus wird einen Krieg erleben, der den ganzen Kontinent zerreißt. In diesen dunklen Zeiten können sie nur eins tun: sich an dem festhalten, was bleibt. Liebe. Hoffnung. Und die Familie.
Ein beeindruckender historischer Roman, der fast hundert Jahre Geschichte einer norddeutschen Uhrmacher-Dynastie erzählt.
Vita
Hendrik Lambertus legt mit «Das Erbe der Altendiecks» seinen ersten historischen Roman vor. Als promovierter Mediävist hat er für diese Geschichte ausführlich recherchiert. Zudem ist er dem norddeutschen Setting des Romans sehr verbunden: Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bremen. Neben seinen Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten betreibt er freiberuflich eine Schreibwerkstatt.
Mehr Informationen sind auf seiner Homepage zu finden: www.hendrik-lambertus.de
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Seite 500 f.: Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen, Gedicht von Gottfried August Bürger, entstanden 1773. Zitiert aus: Gottfried August Bürger: Werke in einem Band. Herausgegeben von den nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Bibliothek Deutscher Klassiker. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 3. Auflage 1965.
Seite 519 und 539: Zitiert aus: Mary Wollstonecraft: Rettung der Rechte des Weibes mit Bemerkungen über politische und moralische Gegenstände. Aus dem Englischen übersetzt. Mit einigen Anmerkungen und einer Vorrede von Christian Gotthilf Salzmann. Erster Band. Schnepfenthal 1793. (Übersetzer: Georg Friedrich Christian Weissenborn)
Seite 546: Das Lied von der Glocke, Gedicht von Friedrich Schiller, entstanden 1799. Zitiert aus: Reinhard Buchwald/K. F. Reinking (Hrsg.): Schillers Werke. Band 1. Die Gedichte. Nach Schillers letzter Auswahl und Anordnung. Mit einer Nachlese. Hamburg o. J.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung privat; Lithographie im Besitz des Focke-Museums, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Der Bremer Marktplatz. Lithographie von F.A. Borchel nach Gemälde von Hermann Aßmann)
ISBN 978-3-644-40585-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Heidi
Erster Teil
1766
Erstes Kapitel
Hora fugit.
Die Inschrift unter dem Ziffernblatt der Standuhr war mit geschwungenen Lettern auf Messing graviert. Sie schimmerte in dem gedämpften Licht, das durch Buntglasscheiben in die Diele hereinfiel und den Tanz unzähliger Staubkörnchen beleuchtete.
Auch das dunkle, polierte Holz des Uhrenkastens glänzte. Hier verbarg sich das Pendel der Uhr hinter einer Tür, die als hoher Rundbogen gearbeitet war. Vornehm sah das aus, ein bisschen wie ein Kirchenportal und ein bisschen wie die bauchigen Leiber der Violen und Gamben, wenn die Stadtmusiker auf dem Balkon des Rathauses aufspielten.
Gesche mochte vornehme Dinge.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser zur Standuhr hinaufschauen zu können, wie sie es schon so oft getan hatte. Ganz oben, in mehr als sechs Fuß Höhe, war eine runde Öffnung eingelassen. Ein Schiffchen aus Zinn mit weißen Segeln tanzte dahinter auf gemalten Wellen. Mit jedem Pendelschlag bewegte es sich ein wenig, vor und wieder zurück, als wäre es in einem ewigen Sturm gefangen und würde niemals einen Hafen erreichen.
Besucher pflegten das mechanische Schiff besonders ausgiebig zu bestaunen, und das hatte auch Gesche einst getan, als sie noch ganz klein gewesen war. Inzwischen konnte sie darüber nur lächeln, denn ihr war längst klargeworden, dass die Uhr viel interessantere Geheimnisse in sich barg.
Darauf verwies schon die Signatur, die sich rings um die Fassung des Schiffchens zog: «N. Altendieck. Bremen 1735».
N. Altendieck, das wusste Gesche genau, war ihr Großvater Nicolaus. Er hatte die Uhr gebaut, lange bevor die Werkstatt von Vater übernommen worden war. Doch er hatte nicht etwa den Uhrenkasten zusammengefügt oder die windrosenförmige Intarsie am Sockel angebracht. Nicolaus Altendieck hatte etwas ungleich Spannenderes getan: Er hatte das Uhrwerk konstruiert und der Uhr so Leben eingehaucht. Eine Seele.
Hora fugit.
Hora. So nannte Gesche die Uhr bei sich, seit ihr der Großvater zum ersten Mal die Inschrift unter dem Ziffernblatt vorgelesen hatte. Hora war die unbestrittene Königin der Diele, das erste, was ein Besucher sah, wenn er von der Straße hereinkam. Natürlich hatte Großvater ihr auch die Bedeutung der Inschrift erklärt: Die Stunde eilt dahin.
Doch die Zeiger der Uhr bewegten sich bedächtig über das Ziffernblatt aus Messing, so langsam, dass man es fast nicht bemerkte. Schon manche kostbare Minute hatte Gesche damit zugebracht, einfach nur auf der Diele zu stehen und Hora, die Familienuhr, zu betrachten. Dann eilten ihre Stunden nicht, sondern kamen zu ehrfurchtsvoller Ruhe.
Bis man sie wieder zu einer ihrer Hauspflichten rief. Gesche ließ sich nicht gerne rufen. Die anderen wussten das, missbilligten es – und hatten sich in den zehn Jahren, die Gesche nun schon auf dieser Welt weilte, fast daran gewöhnt. Jene verhassten Stunden, in denen sie Lisa in der Küche helfen musste, vergingen besonders langsam. Von Eilen konnte dabei keine Rede sein – ganz egal, was dort oben auf Messing geschrieben stand.
Konzentriert betrachtete Gesche die Zeiger. Wenn man genau darauf achtete, bewegten sie sich doch, glitten von einer der auf Zinn geprägten römischen Ziffern zur nächsten.
Eine Ahnung vom Verrinnen der Zeit bekam sie in jenen herrlichen Stunden, die sie bei Großvater in seiner Kammer verbrachte und ihm aus seinen Büchern vorlas, so wie er Gesche früher die Inschrift vorgelesen hatte. Eine Stunde bei Großvater war genauso lang wie eine Stunde in der Küche, so lang wie Gesches kleiner Finger, der exakt in die Lücke zwischen zwei der Ziffern passte. Und doch waren es in der Küche zermürbende Ewigkeiten und in Großvaters Kammer flüchtige Momente, ehe man sie wieder zu irgendeiner Pflicht rief. Wer in einem Uhrmacher-Haus aufwuchs, entwickelte schon früh ein Gespür für die veränderliche Qualität der Zeit.
Und wer die Enkeltochter von Nicolaus Altendieck war, wurde zudem in ihre Mysterien eingeweiht. Schon oft hatte Großvater die Abdeckung geöffnet und Gesche hochgehoben, damit sie einen Blick hineinwerfen konnte: auf das Uhrwerk, das schlagende Herz von Hora, dessen Komplexität erst die schlichte Eleganz der wandernden Zeiger ermöglichte.
Während Gesche das Geflecht der Räder bestaunte, hatte Großvater dazu Erklärungen geflüstert: von den Gewichten, in denen auf geheimnisvolle Weise die Kraft der Uhr gespeichert war, die sie durch ihr allmähliches Absinken auf das Walzenrad übertrugen. Vom Minutenrad, das davon angetrieben wurde. Vom Stundenrad, das über das Wechselrad damit verbunden war. Vom Pendel, das die Zeit in gleichmäßige Scheiben zerteilte wie eine feine Klinge. Und vom Rechenschlagwerk, das dafür sorgte, dass die vollen Stunden als metallische Glockentöne durch das Haus hallten, gefolgt von den ersten Noten von Nun danket alle Gott, als sei ein leibhaftiger Musiker im hohen Uhrenkasten eingesperrt. Das war Großvaters besonderer Stolz.
Räder und Werke, Kräfte und Übertragungen – für Gesche klang das alles wie Zauberformeln, über die ihr Großvater gebot. Ihre Macht hatte Hora zum Leben erweckt, deren gleichmäßiges Ticken durch die Diele hallte und der Herzschlag des Hauses war.
Gesche schaute so gebannt zu den Zeigern hinauf, dass sie darüber beinahe den anderen Grund vergessen hätte, warum sie heute in der Diele stand. Aber nur beinahe.
Vater hatte einen Gast. Es musste ein ungewöhnlicher und wichtiger Gast sein, denn Vater hatte schon am Morgen Lisa angewiesen, den Kachelofen in der guten Stube anzuheizen. Das tat er sonst nie – man traf sich in der Wohnküche, der Diele oder, wenn es um die Arbeit ging, in der Werkstatt.
Als der Gast dann erschienen war, hatte sich Gesches Vermutung bestätigt. Sie hatte seine Ankunft vom Geländer der Treppe aus beobachtet, die zum Hängeboden der Diele hinaufführte. Es war ein alter Mann mit silbernen Knöpfen am Justaucorps-Rock, dessen Perücke weiß gepudert war. Nur wichtige Leute trugen gepuderte Perücken. Leute, die im Rathaus aus und ein gingen oder im Schütting, dem Haus der Kaufmannschaft.
Vater hatte sich mit dem gepuderten Gast in die gute Stube zurückgezogen, und Gesche hatte ihren Lieblingsplatz vor der Standuhr eingenommen, um den Gang der Zeiger zu beobachten – und um die Gesprächsfetzen zu belauschen, die hinter der grün bemalten Stubentür hervorkamen.
Leider war nur ärgerlich wenig von dem zu verstehen, was gesprochen wurde. Schon bald stand Gesche nur noch hier, weil sie unbedingt wissen wollte, was Vater mit dem Besucher zu bereden hatte – und nicht, weil sie wirklich darauf hoffen konnte, es zu erfahren. Wenn Gesche etwas wollte, reichte bloße Unmöglichkeit nicht aus, um sie davon abzubringen.
Sie lauschte angestrengt, trat immer näher an die Stubentür heran, geradezu unverschämt nah, bis die Standuhr mit ihren Zeigern nicht viel mehr als ein fadenscheiniger Vorwand war. Was hatte die fremde Stimme da gesagt? Ratsuhrmacher?
Plötzlich klapperte eine Tür.
«Gesche!» Clara, ihre große Schwester, rauschte mit der Unaufhaltsamkeit einer Sturmflut herein. «Dreimal hat Lisa dich jetzt gerufen! Und du stehst auf der Diele und starrst Löcher in die Uhr …» Und handfest, wie sie war, packte Clara Gesche am Zopf und zog sie mit sich in die Küche.
«Aua», beschwerte sich Gesche, während sie hinter ihrer Schwester herstolperte. «Lass mich los! Ich glaube, ich habe eben gehört …»
Ihre Schwester beachtete ihren Protest nicht. Es ging fort von der Stubentür, fort von Vaters Gast und fort von Hora, der Familienuhr. Unbeteiligt hallte ihr Ticken durch die Diele. Dann schlug sie schwer und unabwendbar die Stunde.
Zweites Kapitel
«Was wollte denn nun der Ratsdiener, Vater?»
Sein Sohn Friedrich sah ihn nicht an, als er diese Frage stellte. Stattdessen ordnete er Kornzangen, Schraubenzieher und andere Werkzeuge auf dem Arbeitstisch, an dem Johann Christian Altendieck saß. Das war nicht wirklich nötig, denn die Werkstatt im hinteren Teil des Altendieck’schen Hauses nahe der Ansgarii-Kirche zu Bremen war stets in guter Ordnung. Doch Friedrichs Finger kannten keine Ruhe und brauchten immer eine Beschäftigung.
Die Werkstatt war ein kleiner Raum, dessen Sprossenfenster auf den Hinterhof schauten. Hier gab es einen winzigen Garten, in dem vor allem Braunkohl gezogen wurde. Das heimliche Gemach stand gleich daneben – der Holzschuppen, der als Abort diente.
In den großen Arbeitstisch unter dem Fenster waren zahllose schmale Schubladen eingelassen, an der Wand darüber hingen Werkzeuge bereit. Johann betrachtete sie nachdenklich und ließ sich mit der Antwort Zeit. Er wusste, dass seinem Sohn die Neuigkeit gefallen würde. Und ebendas bereitete ihm Sorge.
«Es ging um einen Auftrag», sagte er schließlich vage.
Friedrich ließ die Räumerei sein und wandte sich ihm ganz zu. Er war kräftig, stämmig und strohblond, mit den typischen rauchgrauen Altendieck-Augen. Johann erkannte sich in ihm wieder, eine breitschultrige Version seiner selbst – wenn da nicht diese Spannung in Friedrichs Körper gewesen wäre, wie eine aufgezogene Spiralfeder, die ungeduldig darauf wartete, ihre Kraft freizusetzen. Ein Erbe Magdalenas, seiner lebensvollen Mutter.
Man hätte leicht daran zweifeln können, dass Friedrich mit dieser Spannung die Ruhe eines guten Uhrmachers aufbrachte. Doch der Zweifel verflog, wenn man Johanns Sohn arbeiten sah. Er beherrschte die Kunst, seinen Tatendrang in kleine, präzise Bewegungen umzuwandeln, die frei waren von jedem Ungestüm.
«Ein Auftrag vom Rat?», hakte er nach und spielte mit einer Zange.
«Nein, nicht ganz», gab Johann zurück. «Nur die Aussicht auf einen Auftrag. Wir sind nicht die einzigen, mit denen die Ratsdiener sprechen. Es wäre vermessen, darauf zu hoffen.»
Friedrich ging zwei kurze, ärgerliche Schritte auf und ab. Die Werkstatt war nicht groß, doch für Johann war sie immer ausreichend gewesen. Friedrichs Gebärden hingegen schienen stets mehr Raum zu brauchen, als das kleine Zimmer bieten konnte.
«Worum geht es denn jetzt genau? Was für ein Auftrag, Vater?» Er bemühte sich vergeblich, nicht zu trotzig zu klingen. So liefen ihre Gespräche oft ab. Friedrich preschte unbeirrt voran, und Johann war die Hemmung, die verhinderte, dass die Kraft seiner Feder ungebremst freigesetzt wurde. Gegen seinen Willen stahl sich ein müdes Lächeln auf seine Lippen. Johanns Lächeln war immer müde, seit seine Frau Magdalena nicht mehr da war.
«Sie wollen eine neue Uhr», sagte er langsam. «Für die obere Rathaushalle, wo die hohen Herren tagen. Eine Uhr, die dem Ansehen unserer ehrwürdigen freien Reichsstadt angemessen ist, hat der Ratsdiener gesagt. Du kannst dir denken, dass sie keine nette, kleine Kaminuhr meinen … Mit etwas anderem als einem Meisterwerk gibt sich der Rat nicht zufrieden. Darum haben sie auch 425 Taler dafür ausgelobt.»
«425 Taler?», wiederholte Friedrich, und seine grauen Augen blitzten. Dann fixierte er Johann misstrauisch. «Aber irgendetwas verschweigst du doch, Vater!»
Johann seufzte. Friedrich konnte manchmal so zielsicher nachbohren wie Magdalena. Wenn auch nicht ganz so unnachgiebig wie die kleine Gesche …
«Es geht nicht nur um das Geld, das der Rat für die neue Uhr ausgeschrieben hat», erklärte Johann. «Als wenn das nicht schon für sich ein schöner Lohn wäre … Sie verbinden auch den Posten des Ratsuhrmachers damit! Seit der alte Fidelius im letzten Winter gestorben ist, wurde die Stelle noch nicht wieder besetzt. Nun geben sie den Posten demjenigen, der ihnen ihre Wunderuhr baut.»
«Ratsuhrmacher!» Friedrich rief das Wort wie einen Schlachtruf. «Das ist doch großartig, Vater! Du würdest alle Uhren des Rates pflegen und warten – Aufträge, die praktisch von selbst kommen. Und denk nur mal an die Kaufmannsfrauen, die es gewiss besonders vornehm finden, wenn ihre Stubenuhr direkt vom Ratsuhrmacher der freien Reichsstadt Bremen stammt! Wahrscheinlich müssten wir noch einen Gesellen ins Haus nehmen …»
«Friedrich», sagte Johann streng und lächelte nicht mehr. «Nun werd’ nicht gleich hoffärtig. Noch hat uns niemand zum Ratsuhrmacher gemacht. Wir sind nicht die einzigen, denen sie den Bau ihrer Uhr antragen. Wahrscheinlich wird einer der alteingesessenen Meister den Auftrag bekommen, vielleicht sogar der Greven. Ich werde jedenfalls ablehnen.»
Friedrichs Zange fiel klappernd auf den Arbeitstisch. Seine innere Feder hatte all ihre Spannung auf einmal verloren.
«Du wirst was?», fragte er ungläubig.
«Ablehnen», erwiderte Johann, in dem langsam Ärger aufstieg. «Du weißt doch, dass manch andere Uhrmacher die Altendiecks immer noch als Kleinschmiede sehen, die zu hoch hinauswollen. Da werde ich uns nicht den Spott ins Haus holen, indem ich mich um eine Stellung beim Rat bemühe.»
«Aber was könnten wir denn verlieren?», fragte Friedrich ehrlich verständnislos.
Johann atmete tief durch. Sein Sohn war nicht ungehorsam. In seinem Tatendrang verstand Friedrich wirklich nicht, dass man nicht jede sich bietende Gelegenheit bedenkenlos ergriff.
«Stell dir mal vor, dass wir durch Gottes Fügung den Auftrag des Rates wirklich bekämen», erklärte er um Geduld bemüht. «Es dauert mindestens zwei Jahre, so eine Uhr zu bauen, eher drei. Wir müssten andere Aufträge ablehnen, hätten nur noch Raum für diese eine, große Arbeit. Unser ganzer Ruf hinge davon ab, ob die hohen Herren damit zufrieden sind. Der Deibel hat schon mehr als einem närrischen Spieler das Genick gebrochen, der Haus und Hof auf einen Würfelwurf gesetzt hat.»
«Aber Vater …»
«Friedrich!» Es kam nicht oft vor, dass Johann in diesem Tonfall sprach. Sein Sohn verstummte sofort – mehr aus Überraschung denn aus Respekt. Johann rieb sich die Schläfen. Er hasste es, laut zu werden. Die Menschen schrien ihre Überzeugungen dann am lautesten heraus, wenn sie innerlich am unsichersten waren.
Für einen Moment herrschte peinliches Schweigen in der Werkstatt. Es wurde von einer leisen, kratzigen Stimme durchbrochen: «Kairos. Denk an Kairos.»
Johann vergaß zuweilen, dass sein Vater Nicolaus da war. Der alte Mann konnte stundenlang stillsitzen und vor sich hin brüten, wie ein Möbelstück. Und es war praktisch nicht zu erkennen, ob er darüber eingeschlafen oder hellwach war. Andere Greise wärmten ihre Knochen auf der Bank hinter dem Ofen. Nicolaus Altendieck zog es jedoch vor, unbequem in einer Ecke jener Werkstatt zu hocken, die er einst aufgebaut hatte, bevor seine Finger zu steif für die Arbeit mit den feinen Rädchen geworden waren.
«Kairos?», fragte Friedrich mit gerunzelter Stirn. «Was meinst du damit, Großvater?»
Nicolaus räusperte sich geräuschvoll. «Hat dein Vater dich nicht in die Sögestraße zur Lateinschule geschickt, damit man sich um deine Bildung kümmert, Junge?», fragte er, und ein schiefes Lächeln teilte sein faltiges Gesicht. «Kairos nannten die alten Griechen die günstige Gelegenheit! Er war ein Knabe mit einem dicken Haarschopf auf der Stirn und am Hinterkopf noch kahler als meine Glatze.» Er kicherte. «Wer Kairos fangen wollte, musste ihn vorne am Schopf packen, solange er noch angerannt kam. Zögerte man zu lange, lief er vorbei, und hinten gab es nichts mehr, um ihn festzuhalten. Dann konnte man ihm höchstens hinterherwinken, ehe man sich wieder um sein täglich Mühsal kümmern musste.»
Johann verlagerte unbehaglich sein Gewicht auf dem Stuhl. Solche Geschichten standen in den Büchern, die sein Vater sich von Gesche vorlesen ließ, seit seine Augen verschleiert waren.
«Kairos …», murmelte Friedrich und schaute Johann bedeutungsvoll an. Dieser schwieg ungnädig.
Nicolaus Altendieck hatte damals zugepackt und den rennenden Knaben am Haar erwischt, auf seinen Reisen, zu einer anderen Zeit in einem fremden Land. Sonst wären die Altendiecks heute keine Uhrmacher in einer der stolzesten Städte des Nordens. Johann hingegen …
Plötzlich tauchte Gesche wie aus dem Nichts auf. Sie trug ihr beigefarbenes Schürzenkleid, ihre Haube war nachlässig verrutscht. «Und? Wirst du es tun, Vater? Wirst du, Vater? Wirst …»
Sie zog am Ärmel seines Hemdes, während sie ihn mit überschlagender Stimme bedrängte. Johann fiel einmal mehr auf, wie groß sie inzwischen war und wie ähnlich sie ihrer Mutter mit dem hageren Körperbau und dem dunkelblonden Haar sah.
Friedrich und Nicolaus wirkten genauso überrascht wie er. Keiner von ihnen hatte bemerkt, wie das Mädchen in die Werkstatt gekommen war. Da sah Johann, dass die Tür zur Diele einen Spaltbreit offen stand. Dahinter war eine Gestalt im Halbdunkel zu erkennen. Clara, seine große, vernünftige Clara. Sie schaute ziemlich betreten drein, als sie nun zögerlich die Tür öffnete. Offenbar hatte sie sich nicht verkneifen können, zusammen mit ihrer kleinen Schwester zu lauschen.
«Nun komm halt auch noch rein», brummte er ihr zu. Johann zweifelte keinen Moment daran, dass das Lauschen Gesches Idee gewesen war. Und es überraschte ihn nicht, dass sie schließlich hereingestürmt war, um ihre Meinung kundzutun. Ihr Wille war schon immer stärker ausgeprägt gewesen als ihre guten Manieren. Sie war nun mal die Tochter ihrer Mutter. Auch wenn sie Magdalena in den zwei kurzen Jahren, die sie gemeinsam verbringen durften, kaum kennengelernt hatte. Clara hingegen schlug mehr nach ihm.
«Wirst du es nun tun?», drängelte Gesche weiter, während Clara sich stumm neben Friedrich stellte.
«Werde ich was tun?», erwiderte Johann in dem matten Versuch, hausväterliche Strenge in seiner Stimme anklingen zu lassen. Er war nie besonders gut darin gewesen – und Gesche ein denkbar undankbares Gegenüber für solche Exerzitien.
«Na, aufs Rathaus gehen!», insistierte Gesche. «Und Bescheid sagen, dass du Ratsuhrmacher werden willst! Es ist bestimmt nicht schlimm, dass du nicht gleich zugesagt hast …» Ihre großen, grauen Augen schauten eher fordernd als flehend.
Johann straffte sich. «Gesche, dieses Gespräch war nicht für deine Ohren bestimmt, aber wenn du schon lauscht, dann hör auch zu. Ich habe deinem Bruder bereits gesagt, dass ich ablehne. Und dabei bleibt es. Ich werde …»
«Was hätte Lenchen gewollt?»
Johann stockte der Atem. Nicolaus hatte die Frage leise, fast flüsternd gestellt. Und doch hallte sie wie der Stundenschlag einer Uhr in der Werkstatt wider. Niemand sagte etwas. Johann schaute auf seine Kinder, die vor ihm am Arbeitstisch standen, aufgereiht wie die Orgelpfeifen von St. Ansgarii. Drei Paar rauchgrauer Augen. Dreimal Züge, in denen er mehr als nur eine Spur von Magdalena erkennen konnte.
Johann wusste die Antwort auf die Frage seines Vaters, ohne nachzudenken. Er musste nur Friedrich, Clara und Gesche anschauen.
«Clara», seufzte er schließlich. «Geh doch zu Lisa und sag ihr, sie soll meinen guten Dreispitz abstauben.»
Gesche stieß einen ungebührlichen Jubelruf aus, den Clara sofort mit einem Stoß in ihre Seite beantwortete, ehe sie sich auf den Weg machte. Auf Friedrichs Lippen hatte sich ein erleichtertes Grinsen gestohlen. Es machte seine Züge ungewöhnlich weich. Johann fiel plötzlich auf, dass er seinen Sohn nur selten lächeln sah. Und Nicolaus? Der saß wieder in seiner Ecke und rührte sich nicht, wie eine Kleidertruhe. Eine Kleidertruhe, die überaus zufrieden mit sich aussah.
«Ich weiß, dass du noch wach bist, Vater», brummte Johann beim Aufstehen. «Und ich weiß, dass ich deinetwegen heute vermutlich eine große Dummheit begehen werde. Nein, nicht deinetwegen.» Er hielt kurz inne, rief sich das Gesicht seiner Frau vor Augen. «Meinetwegen.»
Und er zog los, einen griechischen Knaben zu fangen.
Bremen war eine geschäftige Stadt. Sobald Johann aus dem Haus trat, umfing ihn das Treiben auf den Gassen zwischen den hohen Stufengiebeln. Bürger eilten in ehrbarer, dunkler Tracht ihren Pflichten entgegen; Fuhrwerke rumpelten hochbeladen über das Pflaster; eine Schweineherde wurde durch die Straßen getrieben, und der Gestank der Tiere mischte sich in die ohnehin schon schweren Gerüche der Gassen.
Allerorts hallten die Ausrufe der Händler durch die kalte Frühjahrsluft, die mit Körben, Handkarren und Kiepen durch die Viertel zogen und alles an den Haustüren verkauften, was die Bremer zum Leben brauchten.
«Appel un Beern!», rief es hier, «Zuppenkrut un Peterzilljen?» dort. «Riesbess! Heidquäst!», krakeelten die Heidebauern, die in die Stadt gekommen waren, um ihre Besen aus Reisig und Heidekraut anzubieten. «Torf! Goden Backtorf nödig?», fragte der Torfhändler.
Am lautesten waren die Fischweiber, die ihre hohen Körbe auf dem Kopf balancierten und sich wie mächtige Schiffe unter vollem Segel ihren Weg durch die Straßen bahnten:
«Gröne Heringe!»
«Stinte! Frische Stinte!»
«Willt dschi mal gode Matjesheringe eeten?»
Jeder Händler rief in seinem ganz eigenen Rhythmus, je nachdem, welche Waren er anbot, wobei sich sein Ruf beständig und ohne Variation wiederholte. Magdalena hatte daran stets erkannt, wer sich ihrem Haus näherte, lange bevor einzelne Wörter zu unterscheiden waren. Sie war dann gleich zur Tür geeilt, wenn die Familie etwas brauchte.
Für Johann, der diese Kunst nicht beherrschte, verbanden sich die Ausrufe der Händler und der übrige Lärm der Straßen zu einer misstönenden Kakophonie, die wie eine dunkle Woge über ihn hereinbrach. Er war am zufriedensten, wenn er sich in seiner Werkstatt in Ruhe der Arbeit widmen konnte.
Doch heute hatte er ein Ziel. Entschlossen eilte er die Obernstraße entlang, dem klobigen Nordturm des Doms entgegen, der über den Giebeln der Stadthäuser aufragte. Von seinem Zwilling, dem Südturm, war nur noch ein Stumpf übrig. Eines schrecklichen Tages vor über hundert Jahren war er in sich zusammengestürzt und hatte zwei Häuser unter sich begraben. Die Leute erzählten noch heute davon.
Tauben flogen in den grauen Himmel auf, als Johann eilig auf den gepflasterten Marktplatz einbog, vorbei am Pranger neben der Marktwache. Auf der einen Seite lag hier das Rathaus mit seinen drei reich verzierten gotischen Giebeln und dem hohen, grünen Dach. Auf der anderen Seite erhob sich der Schütting, das nicht minder prächtige Haus der Kaufmannschaft, bekrönt von einem stolzen Segelschiff. Fast schien es, als hätte Bremen zwei Rathäuser, die sich misstrauisch über den Platz hinweg musterten und mit ihrem Reichtum zu übertreffen versuchten.
Johann war diese Konkurrenz schon immer befremdlich vorgekommen. Schließlich stellten die Kaufleute auch den größten Teil der Ratsherren, viele ihrer Elterleute saßen im Rat und gingen ganz selbstverständlich in beiden Gebäuden ein und aus. Da erschien ihm dieser doppelte Prunk wie eitle Verschwendung.
Nicolaus erzählte gerne davon, dass in alter Zeit, als der Dom noch zwei Türme gehabt hatte, sich die Handwerker und einfachen Leute einst gegen die hohen Herren aufgelehnt und ihnen sogar den Schütting weggenommen hatten. Doch sie hatten ihren Übermut mit Blut bezahlt, und schon bald war alles wieder zur alten Ordnung zurückgekehrt.
Vielleicht lag es an solchen Geschichten, dass sich Johann im Bannkreis der Macht zwischen Marktplatz und Domshof noch nie besonders wohl gefühlt hatte. Vielleicht merkte er aber auch einfach nur allzu deutlich, dass er eigentlich nicht hierhergehörte. Sein abgetragener Justaucorps-Rock wirkte unscheinbar gegen die Brokatwesten und rüschenbesetzten Hemden der Herren, die in der Begleitung ihrer Dienstboten über den Platz schritten, umhüllt von einer unsichtbaren Dunstglocke aus Wichtigkeit. Ganz zu schweigen davon, dass er weder Perücke noch Gehstock trug und man seinem Dreispitz vermutlich ansah, dass er die meisten seiner Tage in einer Kleidertruhe in der Gesellschaft von Motten verbrachte.
Johann hielt auf das Rathaus zu und versuchte unwillkürlich, würdevoll zu schreiten. Doch er kam sich dabei wie einer der Störche auf der Bürgerweide draußen vor den Wallanlagen vor und gab es nach ein paar Schritten wieder auf.
Unter den Rundbogen-Arkaden des Rathauses standen Grüppchen von Kaufleuten beieinander, gleich neben dem Roland, dem steinernen Hüter der Stadt. Fetzen fremder Sprachen wehten zu Johann herüber. Er hörte Englisch und Niederländisch heraus und verstand sogar einige Worte. Dafür hatte Nicolaus gesorgt.
«Ah, der werte Herr Altendieck!»
Johann zuckte zusammen, als eine tiefe Stimme seinen Namen über den Platz schmetterte. Eigentlich hatte er vorgehabt, wie ein Schatten ins Rathaus zu huschen, sein Anliegen vorzubringen und ungesehen wieder zu verschwinden. Nun fühlte er sich, als würde man ihm in dunkler Nacht plötzlich mit einer Laterne ins Gesicht leuchten. Wie aus dem Nichts trat Albert Greven auf ihn zu, stattlich, verbindlich und raumeinnehmend. Er war einige Jahre alter als Johann und hatte schon fast komplett ergrautes Haar. Die Knöpfe an seinem Rock glänzten stolz, den Dreispitz zierte eine Goldborte. Auch seine Augen blitzten lebhaft, während er Johann vom Kopf bis zu den Füßen musterte und dabei ein breites Lächeln zur Schau stellte. War es leutselig oder herablassend?
«Herr Greven», murmelte Johann und verbeugte sich überrumpelt. «Ihr kommt wohl gerade aus dem Rathaus?»
Damit stellte er nur das Offensichtliche fest, aber Johann war noch nie gut darin gewesen, spontane Höflichkeiten zu drechseln.
«In der Tat», dröhnte Greven zufrieden. «Man hat so seine Geschäfte, nicht wahr? Und was führt Euch hierher, mein Freund? Ich hätte nicht erwartet, Euch anderswo als in Eurer kleinen Werkstatt anzutreffen.»
Johann zwang sich zu einem verkrampften Lächeln. Albert Greven war einer der erfolgreichsten Uhrmacher der Stadt und zeigte das überaus gern, nicht nur durch seine Garderobe. Die Grevens hatten schon Uhren für Kaufleute und Ratsherren gebaut, als die Altendiecks noch als einfache Kleinschmiede Werkzeuge hergestellt hatten. Bevor die große Reise des Nicolaus Altendieck alles verändert hatte.
«Auch mich führen Geschäfte her», sagte Johann schließlich vage in der Hoffnung, einem verfänglichen Gespräch zu entkommen.
Doch Greven ließ nicht locker. «Geschäfte, gewiss», erwiderte er. «Mein Ältester, Carl, sagte mir, dass man heute Morgen den Ratsdiener in Eurer Gasse gesehen hat. War er wohl zufällig auf dem Weg zu Euch?»
Neuigkeiten sprachen sich schnell herum zwischen Bremens Mauern.
«Ja, das war er», gab Johann leicht entnervt zurück. Greven wollte offensichtlich eine Bestätigung für das, was er ohnehin schon wusste. «Wir sprachen über die neue Uhr, die der Rat für den oberen Saal in Auftrag geben wird», sagte er. «Ihr habt vielleicht davon gehört.»
«Aber natürlich», lächelte Greven. «Ich habe schon mit den Konstruktionsskizzen begonnen, und zur Stunde arbeitet mein Carl daran.»
«Ihr seid gewiss stolz auf ihn», entgegnete Johann lustlos. Genau so etwas hatte er befürchtet. «Auch ich habe mir inzwischen einige Gedanken über diese Uhr gemacht …» Das hatte er in der Tat. Auf dem Weg hierher. Es gab da ein paar Dinge, die er schon seit langem an einer großen Uhr ausprobieren wollte.
«Ihr strebt also den Posten des Ratsuhrmachers an, Altendieck?», fragte Greven und zog beide Augenbrauen bis zum Dreispitz hoch. «Soso.»
Mehr sagte er nicht. Keine Spitzen, keine Beleidigungen, kein Verweis auf die Herkunft der Altendiecks und die alte Uhrmacher-Tradition der Grevens. Es war auch nicht nötig. In seinem Tonfall lag genug Herablassung, um den Frachtraum eines großen Lastenseglers damit zu füllen.
«Dann interessiert es Euch bestimmt», fuhr Greven jovial fort, «dass ich heute Nachmittag mit dem gestrengen Ratsherrn Abraham Hemeling verabredet bin, der den Auftrag für den Rat vergeben wird. Sobald er zum Rathaus zurückgekehrt ist, werden wir miteinander reden. Wenn ich erst einmal mit dem Bau der Uhr beginne, habe ich wohl keine Zeit mehr für Kleinaufträge. Dann werde ich an Euch denken, Altendieck. Bis dahin empfehle ich Euch, Eure Zeit nicht weiter zu verschwenden.» Er musterte Johann abschätzend, ehe er fortfuhr. «Vielleicht solltet Ihr Euch damit beschäftigen, eine anständige Frau Meisterin in Euren Haushalt zu holen? Mit jedem Jahr, das vergeht, reden die Leute mehr, mein Bester.»
«Manchem Haushalt fehlt eine anständige Frau Meisterin – und anderem ein anständiger Meister», erwiderte Johann leise. Mit Genugtuung beobachtete er, wie Greven sich an dem verschluckte, was er eigentlich noch hinzufügen wollte.
Grußlos stolzierte der ältere Mann quer über den Marktplatz davon, die Tauben stoben wie die Bugwelle eines Schiffes zu allen Seiten von ihm fort. Johann schaute ihm missmutig nach. Wenn Albert Greven die Stellung als Ratsuhrmacher wollte, konnte er es eigentlich auch gleich bleibenlassen. Genau deswegen hatte er nicht gehen wollen, bevor Nicolaus mit seiner albernen Geschichte von Kairos angefangen hatte. In Bremen liefen eben keine stirnlockigen Griechen herum …
Doch langsam kroch Ärger über den aufgeblasenen Greven in ihm hoch. Die Spitze mit der Frau Meisterin hätte er sich wirklich sparen können. Jeder, der Johann kannte, wusste, dass er sich nicht neu verheiraten wollte. Zunächst waren noch Zunftgenossen an ihn herangetreten und hatten damit angefangen, dass sie da eine Tochter hätten, die bald in dem Alter sei … Doch Johann wollte nicht. Auch heute noch trauerte er, und er mochte es keiner guten Seele zumuten, mit dem Geist seiner toten Frau zu konkurrieren. Inzwischen fragte niemand mehr.
Schlecht gelaunt wandte Johann sich ab, um wieder nach Hause zu gehen, dem Kirchturm von St. Ansgarii entgegen, der noch höher aufragte als der Dom. Plötzlich setzte der Klang seiner Glocken zum Mittagsgeläut ein, erst zögerlich, dann immer machtvoller. Die anderen Kirchen stimmten leicht versetzt mit ein. Das Läuten tänzelte über die Dächer und schien den grauen Himmel aufzuhellen.
Glocken hatte Johann auch in die neue Rathausuhr einbauen wollen. Ein Glockenspiel von nie gekannter Kunstfertigkeit, ein Schmuckstück für den Rat und die Stadt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Albert Greven etwas Vergleichbares für das Rathaus plante. Er arbeitete präzise, als wäre er selbst ein mechanischer Automat, aber er war völlig phantasielos. Wenn Johann die Gelegenheit bekäme, seine Pläne darzulegen …
Er schüttelte den Kopf über sich. Gesche hatte ihn mit ihrem großäugigen Optimismus angesteckt. Das brachte doch alles nichts – Greven würde vor ihm mit Hemeling sprechen, und er war sehr überzeugend. Er gab sich stolz wie ein Kaufmann, sprach ihre Sprache.
Sobald er zum Rathaus zurückgekehrt ist … Grevens Worte hallten in Johanns Gedanken wider. Wo mochte der Ratsherr dann wohl jetzt sein? Im Schütting? Oder er war für irgendwelche Geschäfte unterwegs. Oder aber er hielt sich über Mittag in seinem Haus auf, aß mit seiner jungen Frau und schaute auf die Geschäfte seines Kontors, ehe er sich wieder zum Rathaus aufmachte. Das erschien Johann am wahrscheinlichsten.
Er wusste, dass das Hemeling’sche Haus beim alten Katharinenkloster nahe am Herdentor lag, gar nicht weit entfernt. Wenn er direkt dorthin ginge und bei Hemeling vorstellig würde, konnte er noch vor Albert Greven mit ihm sprechen.
Ihm behagte die Vorstellung gar nicht, als einfacher Handwerker an die Tür eines Fernkaufmanns und Ratsherren zu klopfen und um ein Gespräch zu bitten, mit dem mottenzerfressenen Dreispitz in der Hand und ohne Einladung. Vermutlich würden ihn die Hausknechte davonjagen wie einen Hausierer. Doch was hatte er zu verlieren? Greven fand offenbar allein die Vorstellung schon lächerlich, dass Johann sich als Ratsuhrmacher bewerben könnte – und lächerlicher als lächerlich konnte er sich wohl kaum machen.
Mit grimmiger Entschlossenheit änderte er seinen Weg und bog in Richtung der Katharinenstraße ab. Die Straßenhändler wichen seinen festen, weit ausladenden Schritten aus. Johann Christian Altendieck hatte es eilig, auf ihn warteten Geschäfte.
Drittes Kapitel
Neptun hielt seinen Dreizack fest umschlossen und schaute unbeirrt in die Ferne. Die Statue wachte über dem Portal des Hemeling’schen Kaufmannshauses. Links und rechts wurde der Meeresgott von zwei weiteren Figuren flankiert: einem dunkelhäutigen Bewohner Afrikas und einem Speerträger mit Federkrone aus der Neuen Welt. Die Statuen waren erst vor kurzem hinzugefügt worden. Seit der unselige Krieg vorbei war, den der Preußenkönig Friedrich gegen die Erzherzogin Maria Theresia geführt hatte, war es mit dem Handel in Bremen bergauf gegangen, und Neptuns Gefährten verkündeten stolz, dass die bremischen Handelssegler immer weiter auf den Weltmeeren herumkamen. Man beschränkte sich nicht mehr darauf, Stockfisch aus Bergen oder Wolle aus London einzuhandeln. Waren aus der ganzen bekannten Welt lagerten auf den Speicherböden der Packhäuser.
Johann trat einen Schritt zurück, um seinen Blick über die Fassade schweifen zu lassen – teils aus Neugier und teils, um sich noch etwas Zeit zu verschaffen. Irgendwo hinter den kostbaren Glasfenstern des Erkers, der im ersten Stock vorsprang, hielt sich jetzt vermutlich Abraham Hemeling auf. Weiter oben folgten mehrere Reihen kleiner Fenster dicht übereinander, die die niedrigen Zwischenstockwerke der Lagerräume beleuchteten. Zuoberst öffnete sich eine Verladepforte mit Seilwinde direkt unter dem Giebel. Dieser war stufenförmig gestaltet, mit üppigen Rankenwerk-Verzierungen an jeder Stufe, und erinnerte irgendwie an eine Miniatur-Version des Rathauses.
«Drei», murmelte Johann vor sich hin. Abraham Hemeling hatte sogar drei Prachtgebäude, in denen er täglich ein und aus ging. Kopfschüttelnd trat Johann an die Flügeltür heran und betätigte den Türklopfer. Schon nach kurzer Zeit tat ihm ein alter Hausdiener auf. Er warf ihm einen prüfenden Blick zu und geleitete den Gast dann wortlos in die Diele.
Hier befand sich Hemelings Kontor. Ledergebundene Rechnungsbücher thronten würdevoll auf einem Wandregal. Darunter stand eine bauchige Truhe, die vermutlich nur einen Bruchteil des Vermögens in Silber enthielt, das die Bücher in Tinte verwahrten. Ein herrlicher, turmhoher Ofen mit bunt bemalten Kacheln bollerte in der Ecke, die Wand zierte eine goldgerahmte Karte des bekannten Erdenkreises. Ein Durchgang öffnete sich zu einem Hinterraum, wo dicke Ballen von Tabak lagerten und eine Luke zu den oberen Speicherböden hinaufführte. Von weiter hinten drangen Küchengerüche nach vorn. Auch in einem Kaufmannshaus spielte sich alles Leben und Arbeiten unter einem Dach ab.
Mit Interesse entdeckte Johann neben dem Durchgang eine kostbare englische Standuhr. Doch ihm blieb keine Zeit, sie sich näher anzuschauen. Er musste sich den beiden Kontorschreibern zuwenden, die in der Mitte des Raumes hinter einem Tisch mit abgeschrägter Schreibfläche und eingelassenen Tintenfässern residierten. Der jüngere von ihnen blickte gar nicht auf und reihte mit der Feder konzentriert einen kunstvoll geschwungenen Buchstaben an den anderen. Der ältere Schreiber jedoch schaute Johann mit gerunzelter Stirn entgegen. Er war eine hohlwangige Erscheinung mit spitzer Nase und enganliegender Perücke.
«Ihr wünscht …?», fragte er ungnädig, als Johann kurz zögerte.
«Ähm … Johann Christian Altendieck, Uhrmachermeister», stellte er sich mit einer Verbeugung vor, den Dreispitz an die Brust gepresst. «Ich wünsche, den ehrenwerten Ratsherrn Abraham Hemeling in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen. Kann Er mich wohl zu ihm geleiten?»
«Ein Uhrmachermeister», echote der Kontorschreiber, ohne sich seinerseits vorzustellen. Seine Augen wanderten kurz über den Schreibtisch. «Ich habe keinen Vermerk, dass der Herr einen solchen rufen ließ. Aber ich werde das prüfen. Wartet doch so lange auf der Ofenbank.»
«Nein, nein», beeilte sich Johann einzuwenden. Insgeheim freute er sich. Er hatte recht mit seiner Vermutung, Hemeling war wirklich zu Hause! «Ich bin nicht eingeladen. Doch mein Anliegen ist dringlich.»
Das ohnehin schon spitze Gesicht des Kontoristen wurde noch ein wenig spitzer.
«Keine Einladung», sagte er ungerührt. «Und wer hat Euch geschickt?»
Offenbar fand unter seiner engen Perücke die Vorstellung keinen Platz, dass Johann wirklich aus eigenem Antrieb seinen Herrn zu sprechen verlangte.
«Kairos!», erwiderte Johann spontan. «Sage Er dem Herrn, dass ich im Auftrag des Kairos komme.» Das hatte er eigentlich nicht so geplant. Aber es war die Essenz seines Unterfangens. Johann Christian Altendieck war hier, um eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Das durften ruhig alle wissen!
Der Kontorschreiber machte sich mit unbewegtem Gesicht eine Notiz. «Kairos … Scheint ein ausländischer Herr zu sein», murmelte er.
«Grieche von Geburt», erwiderte Johann und verkniff sich ein Schmunzeln.
«Nun gut.» Der Schreiber übergab dem Hausdiener seine Notiz, der sich sogleich auf den Weg machte, die Treppe zum ersten Stock hinauf.
Johann wartete mit dem Dreispitz in der Hand, während die Kontoristen sich wieder ihren Schriftstücken zuwandten. Er war zu angespannt, um sich zu setzen, und musste sich zusammennehmen, um den Hut nicht beständig in seinen Händen zu drehen. Ob solche innere Unruhe auch in Friedrich wirkte? Wie hielt er das dauerhaft aus? Doch Johann spürte auch etwas anderes: eine merkwürdige Kraft, die daraus erwuchs. Wie eine Feder, die ihre Spannung abgab, um Räder zu bewegen.
Schließlich kam der alte Hausdiener wieder herunter. Er wechselte einige Worte mit dem Schreiber und trat dann direkt auf Johann zu.
«Der Herr wird Ihn sogleich empfangen», sprach er respektvoll. «Er bittet Ihn, in der Wunderkammer zu warten, bis er seine Geschäfte erledigt hat.»
«Das … ist gut!», rief Johann überrascht und fragte sich, was wohl eine Wunderkammer sein mochte. «Habt Dank!»
Und dann folgte er dem Hausdiener die Treppe hinauf, während der Schreiber ihm noch einen abschätzigen Seitenblick zuwarf. Johann ignorierte ihn. Dass er damit wirklich durchkam …!
Im ersten Stock lagen die Wohnräume des Handelsherrn. Sie waren großzügig angelegt, was ein deutlicheres Zeichen von Reichtum war als Gold und Seide. Freier Platz war in der Stadt mehr als rar, niemand konnte es sich leisten, ihn zu verschwenden.
Der Hausdiener führte Johann in eine Kammer, wo hohe Glasfenster nach vorne auf die Straße schauten, und bat ihn, in einem Sessel Platz zu nehmen, der Herr würde bald erscheinen. Dann zog er sich zurück.
Staunend blickte Johann sich um. Die Kammer war nicht groß, doch angefüllt mit absonderlichen Dingen. Eine ausgestopfte Raubkatze mit getupftem Fell fauchte Johann von einer Anrichte aus an. Daneben standen ein bauchiges Straußenei in einer Silberfassung und eine Schale mit verschiedenen Bergkristallen, die jeweils mit einem Papierbändchen beschriftet waren. Zwei mächtige Globen auf bronzeglänzenden Ständern gaben Aufschluss über die Gestalt des Erdenkreises und den Aufbau des Sternenhimmels. Über dem Fenster hing lang und spiralartig gedreht der Stoßzahn eines Narwals, den man in älterer Zeit wohl für den Kopfputz eines Einhorns gehalten hätte. Eine Schnitzerei aus schwarzem Edelholz zeigte ein Wesen mit riesigem Kopf und starrenden Kugelaugen, das Geschöpf irgendeines fernen Erdteils. Daneben thronte stolz ein Trinkpokal, der aus einer Art riesigem, alabasterweißem Schneckenhaus auf einem goldenen Fuß bestand. An der Wand hing ein üppiges Gemälde im niederländischen Stil, eine Seeschlacht mit brennenden Schiffen, die von ungnädigen Wogen herumgeworfen wurden. Darunter war ein Meerestier mit grotesken Fangarmen in Alkohol eingelegt.
Fasziniert beugte Johann sich vor, als er eine vergoldete Taschenuhr in einem mit Samt ausgeschlagenen Kästchen entdeckte. Das Innere des aufgeklappten Uhrendeckels war mit einer Miniatur bemalt, die vornehme Damen unter den Bäumen eines Parks zeigte.
«Gefällt Euch die Wunderkammer?», fragte eine belustigte Frauenstimme.
Johann fuhr schuldbewusst zusammen. Er hatte sich so konzentriert über die Uhr gebeugt, dass er das Hereinkommen der Hausherrin gar nicht bemerkt hatte.
Agathe Hemeling war einige Jahre jünger als Johann und hatte nussbraune Korkenzieherlocken, die vorwitzig unter einer Seidenhaube mit Schleife hervorlugten. Sie trug ein gelbes Kleid mit weißem Besatz, dessen ausladender Rock die Hüften betonte. Ihr Lächeln war fein, und ihre grünen Augen blitzten schalkhaft.
Johann sprang auf und verbeugte sich rasch. «Verzeiht … Ich war für einen Moment abgelenkt …»
«Das habe ich bemerkt», schmunzelte Agathe und stellte ein Tablett auf dem ovalen Tischchen in der Mitte der Kammer ab. Es trug Porzellantassen mit Kaffee und einen Silberteller, auf dem sich Trockenfrüchte und Biskuits türmten. «Aber Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet, Herr Altendieck.»
«Wie meinen?», fragte Johann irritiert.
«Ob Euch die Wunderkammer gefällt? Dass Ihr Eure Aufmerksamkeit bei all diesen Kuriositäten auf eine winzige Uhr konzentriert, lässt mich befürchten, dass Ihr Eurer Arbeit genauso verfallen seid wie mein Mann, der Euch übrigens noch um etwas Geduld bittet. Die Geschäfte, Ihr kennt das gewiss …»
«Oh, die Kammer gefällt mir schon», sagte Johann, während sie beide Platz nahmen und Agathe ihm eine Tasse Kaffee reichte.
«Was erscheint Euch am wundersamsten?», hakte Agathe nach. «Und ich verbiete Euch, jetzt die Uhr zu nennen!»
«Am wundersamsten erscheint mir …» Johann überlegte. «… dass jemand in einer Welt, die voller Wunder ist, eine eigene Kammer dafür anlegt, um sich zu wundern!», sagte er schließlich.
Agathe lachte. Es klang leicht und ehrlich. Ein schöner Klang, fand Johann.
«Die Kammer dient wohl eher dazu, fremde Kaufleute und andere Gäste zu beeindrucken», erwiderte sie. «Das ist jedenfalls der Grund dafür, dass mein Mann das viele Geld für all diese Dinge aufgebracht hat. Sonst hätte er den Plunder, wie er es nennt, kaum gekauft. Ich finde die Sachen hingegen schön. Sie sind wie ein Fenster, durch das man in die Welt außerhalb unserer Mauern schauen kann.»
Johann ertappte sich dabei, dass er nickte.
«Ihr seht selbst wohl viel von der Welt?», plauderte Agathe weiter und trank von ihrem Kaffee. «Zumindest entnehme ich das dem Umstand, dass Ihr in den Diensten eines griechischen Herrn steht.»
Etwas betreten senkte Johann den Blick auf seine Finger.
«Kairos», fuhr Agathe fort. «Mir scheint, dass Euer Herr eher einen Perückenmacher benötigt als einen Uhrmacher. Oder ist das Haar am Hinterkopf jenes Gottes, der für die günstige Gelegenheit steht, inzwischen nachgewachsen?»
Johann schaute ertappt auf. Agathe betrachtete ihn amüsiert.
«Nun, in gewisser Weise bin ich tatsächlich in Kairos’ Diensten unterwegs», sagte er mit einer Überzeugung, die ihn selber überraschte. «Denn ohne die Hoffnung, seinen Schopf zu ergreifen, hätte ich es nie gewagt, heute dieses Haus aufzusuchen … Es geht um die neue Uhr im Rathaus.»
«Macht Euch wegen Eures abenteuerlichen Dienstherrn keine Sorgen», beruhigte Agathe ihn. «Ich finde Euch jetzt schon interessanter als die üblichen Gäste meines Mannes, die nichts als Frachtbriefe und Warenpreise im Kopf haben. Ich werde Eure kleine List nicht verraten. Und mein Mann ist nicht sehr belesen in den Klassikern.» Agathes Lächeln verblasste, doch schon im nächsten Moment war sie wieder ganz die verbindliche Gastgeberin. «Ihr wollt also die neue Uhr für das Rathaus bauen, Herr Altendieck?»
«Ja», erwiderte Johann. «Ich habe da zum Beispiel ein großes Glockenspiel im Sinn, das verschiedene Melodien im Tagesverlauf erklingen lässt.»
«Ich mag Glocken», erwiderte Agathe mit leuchtenden Augen. «Wenn die Kirchen läuten, habe ich gerne die Fenster offen.»
Johann musste daran denken, wie ihr Klang den Lärm der Gasse übertönte, und nickte zustimmend.
«Bitte erzählt mir mehr», fuhr Agathe fort. «Was vermag Eure Uhr noch alles?»
«Sie ist ja noch nicht einmal entworfen, geschweige denn gebaut», schränkte Johann rasch ein. «Aber ich denke, sie sollte auch …»
Er wurde vom Geräusch schwerer Schritte unterbrochen, die sich von draußen näherten. Dann betrat auch schon der gestrenge Ratsherr Abraham Hemeling die Wunderkammer seines Hauses.
Das Größte an ihm war auf den ersten Blick seine Perücke. Sie war in dicke Locken gelegt und fiel lang über seine Schultern, wie auf einem alten Fürstenporträt. Eigentlich trug das heutzutage kaum noch jemand so, doch Hemeling schien sich mit wallender Haarpracht zu gefallen.
Alles andere an ihm war deutlich schlichter: Sein Justaucorps-Rock war ebenso dunkel wie die Weste, die einen Kontrast zu den weißen Rüschen seines Hemdes bildete.
Seine Absätze konnten nicht kaschieren, dass Hemeling nicht besonders groß war, dafür jedoch von handfester Stämmigkeit. Das faltige Gesicht mit den kleinen, stechenden Augen über schweren Tränensäcken kündete von einer stattlichen Anzahl an Lebensjahren. Seine Stirn war in tiefe Runzeln gelegt, so als machte er sich über zu viele Dinge auf einmal Sorgen.
Johann begrüßte den Ratsherrn respektvoll, der das ungeduldig über sich ergehen ließ, ehe er sich zu seiner Frau setzte. Sofort reichte sie ihm eine Tasse Kaffee an.
«Nun, Herr Altendieck», sagte Hemeling schließlich geradeheraus und streifte einige falsche Locken zur Seite, «was verschafft mir die Ehre Eures Besuchs? Die Notiz meines Kontoristen war nicht ganz eindeutig. Etwas mit einem griechischen Uhrmacher?»
«Das ist ein Missverständnis», erwiderte Johann verlegen.
Agathe kicherte. «Der alte Kontorist Stoever muss sich etwas falsch notiert haben», warf sie ein.
«Ich bin Uhrmachermeister, doch kein Grieche», fuhr Johann dankbar fort. «Heute Morgen trug mir der Ratsdiener zu, dass eine neue Uhr für den oberen Rathaussaal geplant ist. Man sagte mir, dass der Herr Ratsherr diesen Auftrag vergeben würde.»
Hemeling rieb sich unwillig das Kinn. «Das ist richtig», brummte er. «Ich bat den Diener, sich bei den erfahreneren Uhrmachern der Stadt umzuhören. Nachher werde ich mit Meister Greven in dieser Sache sprechen. Er erschien nicht abgeneigt und hat hervorragende Referenzen.»
«Gewiss zu Recht», erwiderte Johann. «Doch auch ich habe einige Vorschläge für die Uhr zu unterbreiten.» Er holte tief Luft. «Ich denke, für das Ansehen des Rates und der Stadt ist es unabdingbar, dass die Uhr ein Schmuckstück wird – nicht durch Gold und teure Edelhölzer, sondern als Verkörperung unserer neuen, aufgeklärten Zeit. Unser Wissen über die verborgene Mechanik, die die Welt in Bahnen hält, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Dieses Wissen sollte in den Bau der Uhr einfließen und in jeder ihrer Funktionen erkennbar sein!»
Agathe nickte ihm aufmunternd zu. Hemeling hingegen wischte sich unbeeindruckt ein Staubkorn vom Rockärmel. Johann redete hastig weiter, ehe der Ratsherr auf die Idee kommen konnte, gelangweilt abzuwinken.
«Es geht nicht nur um Minuten und Stunden – auch den Gang der Sekunden muss die Uhr anzeigen, den Wochentag, den Monat und die Phasen des Mondes. Ihr Ziffernblatt soll ein Abbild des großen Räderwerks sein, das sich hinter dem Sternenschleier in der Tiefe der Schöpfung dreht.» Hemelings Gesicht blieb undurchsichtig. Johann entschied sich, direkt seinen Trumpf auszuspielen.
«Und der Gang der Zeit muss selbstverständlich mit angemessener Würde verkündet werden! Darum sollte die Uhr ein Glockenspiel für den Stundenschlag enthalten. Verschiedene Melodien im Laufe des Tages, erlesene Musikstücke.»
«Menuette?», schlug Agathe lächelnd vor.
«Gewiss, warum nicht auch galante Menuette …»
Hemelings gravitätisches Räuspern unterbrach ihn. «Herr Altendieck», sprach der Ratsherr, «meiner Auffassung nach hat eine Uhr im Wesentlichen eine Aufgabe: die rechte Stunde anzuzeigen – nicht etwa Menuette nach dem Räderwerk der Welt zu tanzen. Und natürlich das Rathaus in würdiger Weise zu schmücken und den Gästen und Gesandten von der Macht und dem Reichtum unserer Stadt zu künden. Doch das fällt wohl eher in die Zuständigkeit des Tischlermeisters, der einen prunkvollen Uhrenkasten bauen wird.»
Agathe stellte ihre Kaffeetasse etwas zu heftig ab, sodass das Porzellan unschön klirrte. «Aber ein Glockenspiel hätte doch genau diesen Effekt!», sagte sie. «Silberne Klänge können mehr beeindrucken als goldene Beschläge! Vor allem, wenn die besagten Gesandten so etwas noch nie zuvor gehört ha…»
«Agathe, mein Kaffee ist kalt», knurrte Hemeling. «Sei doch so gut und brüh eine neue Tasse auf.»
Die Angesprochene stand wortlos auf und rauschte aus dem Raum. Johann sah ihr betreten nach.
«Nun, Meister Altendieck», sprach der Ratsherr, «habt Ihr mir in dieser Angelegenheit noch etwas zu sagen? Meine Zeit ist knapp bemessen, und auch Ihr habt gewiss genug zu tun.»
«Ich kann eine Uhr bauen, die zur größten Zufriedenheit des Rates ausfallen und als Zierde der Stadt gelten wird», beharrte Johann matt. «Wenn der geneigte Ratsherr mir einige Tage Zeit für eine Konstruktionsskizze zu geben geruht, könnte ich konkrete …»
Es klopfte, und der alte Hausdiener kam herein. Er flüsterte Abraham Hemeling einige Worte zu, der daraufhin sofort aufsprang.
«Was? Er ist schon in der Stadt?» Er rückte seine üppige Perücke zurück. «Gero, den guten Gehstock mit dem Silberknauf!» Hemeling stürmte zur Tür, wobei er den Diener vor sich herscheuchte.
«Auf bald, Herr Altendieck», nuschelte der Ratsherr mit einer halben Verbeugung über die Schulter. Und schon war er verschwunden. Johann blieb allein in der Wunderkammer zurück.
Unbehaglich rutschte er auf seinem Sessel herum. Vor ihm stand noch eine halbvolle Tasse Kaffee, doch das Treffen war zu einem abrupten Ende gekommen. Er erwog kurz, aufzustehen und ebenfalls zu gehen, entschied sich dann aber dagegen. Wahrscheinlich würde gleich wieder der Hausdiener erscheinen und ihn hinausgeleiten. So war es in vornehmen Häusern üblich. Am Ende sagte man ihm sonst noch nach, er hätte sich mit irgendeiner Kostbarkeit davongestohlen.
Johann leerte schlürfend seine Tasse. Der bittere Kaffee schmeckte ihm eigentlich nicht. Aber er hätte es unpassend und verschwenderisch gefunden, die Tasse nicht auszutrinken. Dann faltete er die Hände und wartete. Nichts geschah. Die Tür, die aus der Kammer führte, blieb geschlossen.
Unruhig ließ Johann seinen Blick über die Exponate schweifen. Das eingelegte Meerestier glotzte ihn aus dummen Augen an. Die Raubkatze schien spöttisch zu grinsen, das eingefasste Straußenei darauf zu warten, von einem kochlöffelgroßen Silberlöffelchen sanft aufgeklopft zu werden. Nichts rührte sich. Selbst die Zeiger der kostbaren Taschenuhr nicht. Sie war nicht aufgezogen, als wäre sie zusammen mit der Zeit erstarrt.
Draußen klapperte ein schweres Fuhrwerk vorbei. Zwei Fischfrauen stritten sich lautstark in einer nahen Gasse. Eine Fliege krabbelte über den Narwal-Zahn.
Johann überlegte, ob er nun einfach gehen oder zumindest auf sich aufmerksam machen sollte. Doch er wollte auf keinen Fall im Hemeling’schen Haus unangenehm auffallen …
Plötzlich schwang die Tür auf, und Agathe kam herein. Sie stutzte, als sie Johann entdeckte: «Ihr seid noch da?»
«Ja … Bitte entschuldigt, ich wusste nicht …», stammelte Johann.
«Ich dachte, Gero hätte Euch hinausgeleitet, als mein Mann zum Schütting geeilt ist», sagte Agathe. «Irgendein ungemein wichtiger und zweifellos schwerreicher Handelspartner aus Holland ist eher als erwartet eingetroffen.»
«Nein, der Hausdiener hat Euren Mann begleitet.»
«Ich verstehe …», überlegte sie. «Er wird gedacht haben, dass ich Euch zur Tür bringe. Es scheint so, als hätten wir Euch vergessen, Herr Altendieck.»
«Das ist überhaupt nicht schlimm», sagte Johann und sprang rasch auf. «Ich war im Begriff zu gehen und möchte keine Umstände machen …»
«Die macht Ihr nicht», entgegnete Agathe und schloss die Tür hinter sich. Johann schaute sie irritiert an.
«Bevor Ihr geht, würde ich Euch gerne noch etwas fragen», erklärte sie und setzte sich auf einen der Sessel am Kaffeetisch. Johann vermeinte, eine leichte Unsicherheit in ihrer Stimme zu hören. Auch er nahm wieder Platz.
«Als Ihr vorhin von der Uhr geredet habt, die Ihr bauen wollt … Da spracht Ihr auch von dem verborgenen Getriebe des Kosmos. Dem Räderwerk hinter den Dingen.» Sie schwieg kurz, dann raffte sie sich auf. «Glaubt Ihr, dass die Welt eine große Maschine ist?»
«In gewisser Weise schon», erwiderte Johann vorsichtig. «Wenn wir auch ihre Funktionsweise noch nicht komplett verstehen. Ihre Mechanismen sind viel feiner als die Räder, die wir Menschen formen können.»
«Erschreckt Euch diese Vorstellung nicht?», hakte Agathe weiter nach. «In einer Welt zu leben, die nur ein großer Mechanismus ist, eingeschlossen in ein Gehäuse aus Sternen?» Sie schielte zu der Taschenuhr auf ihrem samtenen Bett.
«Ich finde es eher tröstlich, ein Rad in einem großen Getriebe zu sein», erwiderte Johann. «Denn das Ganze funktioniert nur durch das harmonische Zusammenspiel seiner Teile. Wer Uhren baut, lernt Respekt vor kleinen Rädchen.»
Agathe nickte, sodass ihre Locken unter der Haube wippten. «Das ist ein schöner Gedanke. Wenn die Rädchen doch nur erkennen könnten, welchen Zweck der Konstrukteur mit seinem Werk verfolgt, so es diesen Zweck überhaupt gibt …» Plötzlich hielt sie inne. «Verzeiht, dass ich Euch mit meinen Gedanken belästige», sagte sie leise. «Ich … ich habe nur selten Gelegenheit, mich über solche Dinge auszutauschen.»
«Das tut mir sehr leid», erwiderte Johann ehrlich. «Auch bei mir ist es lange her, seit ich …» Er stockte, als ihm bewusst wurde, wie lange es tatsächlich zurücklag, dass er sich angeregt mit jemandem unterhalten hatte. Die Stille seiner Werkstatt war sein Zufluchtsort geworden, und er hatte sich während der letzten Jahre allzu sehr vor der Welt zurückgezogen. «Darf ich Euch ebenfalls eine Frage stellen?», bat er kühn.
Agathe lächelte. «Nur zu gerne.»
«Welches Stück in dieser Kammer findet Ihr am wundersamsten? Ich musste Euch schon Rede und Antwort stehen. Nun seid Ihr dran.»
Agathe schaute ihn prüfend an, ohne sich in der Kammer umzublicken. Sie schien nicht über ihre Antwort nachdenken zu müssen. Eher darüber, ob sie sie aussprechen sollte … Dann sagte sie es schließlich: «Die Leopardenkatze!»
Johann betrachtete das ausgestopfte Raubtier, das ihn von der Anrichte aus mit aufgerissenem Maul anfauchte. «Wegen ihrer Schönheit?», fragte er.
«Nein», erwiderte Agathe, die seinem Blick folgte. «Wegen ihres Schicksals. Man hat sie gefangen, zur ewigen Bewegungslosigkeit verdammt und in dieses Haus gebracht, in das sie niemals gehörte. Ihr Fell glänzt wie Gold, wenn die Sonne durchs Fenster scheint, aber darunter steckt nur Holz. Sie ist im Inneren tot. Und doch …» Ihr Blick wanderte von der Katze zu Johann. «Und doch hat sie etwas von ihrer Würde bewahrt. Man sieht ihr ihre Kraft noch an, ihre verlorene Freiheit. Ihre Leidenschaft – und ihre Krallen! Manchmal erwarte ich fast, dass sie sich bewegt. Dass ich eines Tages mit meinem Kaffeetablett in die Wunderkammer komme, um meinen Mann und einen seiner Handelspartner zu bedienen, und nur noch blutige Körper auf dem Boden vorfinde, während die Leopardin von der Anrichte verschwunden ist …» Sie brach ab. Ihre grünen Augen fixierten Johann und schauten doch durch ihn hindurch.
Plötzlich legte sie ihre kühlen Finger auf seine Hand. In ihrem Tasten lag eine ängstliche Frage. Als Antwort umschloss er ihre Hand mit der seinen. Mehr tat er nicht. Er hielt nur ihre Hand. Eine simple Geste. Und doch so viel mehr. Ein Meeresgeschöpf in Alkohol, eine Kreatur aus schwarzem Holz und eine zur Reglosigkeit verdammte Leopardin beobachteten Johann und Agathe mit leerem Blick, als sie sich am Kaffeetischchen, umgeben von Wundern, ganz dem Augenblick hingaben. Johann konnte nicht sagen, wer sich zuerst bewegte. Ihre Köpfe näherten sich einander, bis sie den Atem des anderen auf ihren Lippen spüren konnten. Und das Getriebe des Kosmos, das Räderwerk der Welt hielt für einen Moment an.
Viertes Kapitel
«Gesche, min Deern», sagte ihr Großvater. «Lies doch noch mal aus dem Buch vom alten Huygens.»
Gesche griff zum kleinen Bücherregal neben Großvaters Bett und zog einen rotbraunen Lederband heraus. Christiaan Huygens – Traité de la lumière stand auf der Titelseite. Abhandlung über das Licht. Gesche war stolz darauf, dass sie dank Großvater immer besser Englisch und Französisch verstand, inzwischen sogar ein wenig Latein.
Sie saß auf einem kleinen Hocker in der Dachkammer, die Nicolaus Altendieck als Altenteiler bewohnte. Hierher zog er sich grummelnd zurück, wenn es ihm unten, in der Werkstatt, zu unbequem geworden war und seine Knochen Ruhe brauchten.
«Ist das der Huygens, der die Pendeluhr erfunden hat?», fragte Gesche, obwohl sie es eigentlich schon wusste.
«Ja, das hat er getan», antwortete Großvater lächelnd. «Und er hat sie nicht nur erfunden, sondern auch gebaut. Ohne ihn könnte unsere gute Hora unten in der Diele nicht so schön den Takt schlagen.»
«Und dein Meister Visbagh in Holland war ein Schüler von Christiaan Huygens?», bohrte Gesche nach. Sie mochte es, ihrem Großvater vorzulesen. Aber noch schöner war es, wenn er ins Erzählen geriet.
«Mehr oder weniger», erklärte Nicolaus. «Meister Visbagh war der Nachfolger von Meister Coster, der damals in Den Haag die ersten Pendeluhren für Huygens gebaut hat. Er war der Handwerker, Huygens das Genie. Unsere Altendieck’schen Uhren sind in gewisser Weise Huygens’ Enkel.»
«Warst du bei Meister Visbagh, nachdem du den Straßenräubern entkommen bist?»
«Das mit den Straßenräubern war in Frankreich, in den Bergwäldern der Ardennen», sagte Großvater und schaute versonnen an Gesche vorbei. «Es waren Deserteure, im Grunde arme Kerle, die die Angst vor den Kugeln des Feindes gegen die Angst vorm Galgen eingetauscht hatten …»
Gesche lächelte in sich hinein. Sie hatte es wieder einmal geschafft. Großvater erzählte von seinen Reisen nach England, Frankreich und in die Niederlande. Wie er als junger Kleinschmied aus Bremen aufgebrochen war, um bei anderen Meistern zu lernen. Und wie er immer weitergewandert war, bis er in ferne Länder gekommen war. Wie er dort staunend die Wunder mechanischer Uhren für sich entdeckt und schließlich nach Meistern gesucht hatte, die ihn die Kunst des Uhrenbaus lehren konnten. Er hatte sie gefunden und so dafür gesorgt, dass die Altendiecks von Kleinschmieden zu Uhrmachern geworden waren.
«Und was genau macht der Anker dabei?», hakte Gesche nach, als Nicolaus gerade von einem Uhrwerk des Meisters Charlton erzählte, bei dem er in London in der Fleet Street gelernt hatte. Früher hatte sie stets nur nachgefragt, um bunte Details über fremde Städte und ihre Bewohner, über Reisen und Segelschiffe zu erfahren. Doch seit neuestem interessierte sie sich immer mehr für die Funktion der Wunderwerke, von denen Großvater verträumter zu schwärmen pflegte als von den Weinen Frankreichs.
«Also, das Pendel einer Uhr gewährt durch seinen gleichmäßigen Schwung ihren regelmäßigen Gang», begann Großvater. «Es gibt ihr gewissermaßen den Takt vor. Über eine Pendelführung ist es mit dem Anker verbunden, der in das Hemmrad greift und verhindert …» Er bemerkte Gesches konzentrierten, aber etwas ratlosen Blick. «Das muss man vor sich sehen, dann ist es ganz einfach», brummte er, ließ sich eines seiner Bücher geben und schlug eine Doppelseite mit mechanischen Skizzen auf.
Mit großen Augen saugte Gesche die Erklärungen auf, die Großvater ihr dazu gab.
Mitten im schönsten Erzählen über die Konstruktionen des großen Uhrmachers George Graham schaute er Gesche plötzlich direkt an. «Du hast einen klugen Kopf, min Deern», sagte er. «Du weißt genau, was du willst, wie deine Mutter. Und wenn ich mir deine Hände so anschaue, sehe ich Johanns geschickte Finger.»
Gesche erwiderte nichts. Ihr kam es vor, als stünde ihr Großvater kurz vor einer wichtigen Entscheidung. Mit klopfendem Herzen blickte sie in das faltige Gesicht des alten Mannes, hinter dessen Stirn es zu arbeiten schien.
«Ich hab’ da so eine Idee», sagte Nicolaus schließlich. «Komm doch morgen, wenn du bei Lisa in der Küche fertig bist, zu mir nach hinten in die Werkstatt. Dein Vater und Friedrich sind dann im Ohlandt’schen Haus in der Hutfilterstraße und richten die reparierte Wanduhr wieder ein. Da kann ich dir ein bisschen was von dem in natura zeigen, was diese Skizzen nur unvollständig wiedergeben.»
Gesche nickte eifrig und sagte immer noch nichts. Sie hatte Sorge, dass ein falsches Wort den Zauber dieses Augenblicks verderben könnte.
Großvater brummte zufrieden. «Und nun lies mir endlich aus dem Buch von Huygens vor. Darum habe ich dich schon vor einer halben Stunde gebeten.»
«Ja, Großvater», erwiderte Gesche und öffnete rasch den französischen Band. Langsam und konzentriert las sie über die geheimen Gesetze des Lichtes vor, das in Wahrheit aus Wellen bestand wie die graue Nordsee. Großvater hörte versonnen zu, die Augen auf die Deckenbalken gerichtet, und verbesserte gelegentlich ihre Aussprache. Nach einiger Zeit hob er die Hand. Gesche hielt inne.
«Ist eigentlich dein Vater schon wieder vom Rathaus zurück?», fragte er.
Gesche schüttelte den Kopf. «Nein, Großvater.»
Sie hätte sonst gewiss das Klappen der Haustür und seine Schritte unten auf der Diele gehört. Schließlich lauschte sie schon seit dem Mittag mit einem Ohr darauf. Sie wollte wissen, was aus der Sache mit der neuen Uhr im Rathaus und dem Posten des Ratsuhrmachers wurde!
«Er ist schon ziemlich lange unterwegs», sagte sie. «Was mag das zu bedeuten haben?»
«Verlaufen hat er sich bestimmt nicht», erwiderte Großvater schmunzelnd.
Gesche überlegte. «Vielleicht sind ja die hohen Herren auf dem Rathaus so angetan von seinen Ideen, dass er alles gleich ganz genau erklären muss?»
«Wer weiß», murmelte Großvater. «Lass uns hoffen, dass das etwas Gutes verheißt.»
Fünftes Kapitel
Regentropfen trommelten an die Scheiben der Werkstatt. Das Licht war so grau, dass Johann trotz der frühen Tageszeit eine Lampe entzündet hatte. Die Metallschale, die an seinem Arbeitstisch hing, war mit Tran gefüllt, der beim Verbrennen ölig roch. Damit musste man wohl oder übel leben. Immerhin war Tran in Bremen ein günstiger Brennstoff, kehrten doch die Walfangschiffe der Grönland-Compagnie stets mit reichem Fang aus den Eismeeren des Nordens heim.
Johann versuchte, sich auf die letzten Handgriffe an der Wanduhr zu konzentrieren, die er nachher wieder im Haus des Hutmachers Ohlandt platzieren würde. Für ihr Alter war sie eigentlich noch gut beieinander – bis sie so ungünstig von der Wand gefallen war, dass Teile ihrer Werke komplett ersetzt werden mussten. Der stattliche Melchior Ohlandt hatte sich darüber bedeckt gehalten, wie es zu diesem merkwürdigen Sturz gekommen war. Seine Nachbarin jedoch, die olle Gevatterin Schmidtke, hatte Johann und Friedrich auf der Straße nur zu bereitwillig erzählt, dass Ohlandt eines Abends mit zu viel Branntwein im Balg der Hausmagd nachgestellt hatte und dabei gegen seine gute Uhr gestolpert war.