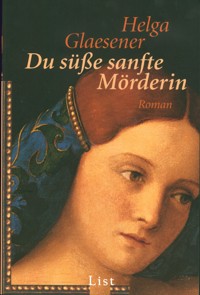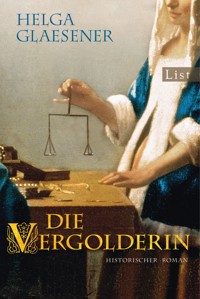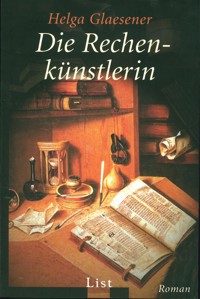10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Legende lebt.
Die junge Freya wird Zeuge, wie ihre von dänischen Wikingern entführte Mutter ermordet wird. Anschließend flieht sie gen Süden, getrieben von der Sehnsucht nach ihrem Großvater Gerold. Bald findet sie heraus, dass Gerold inzwischen in Rom lebt, als Schutzherr des Papstes. Verkleidet schafft Freya es, im Jahr 858 in die Heilige Stadt zu gelangen. Doch dort muss sie mitansehen, wie Gerold während einer Prozession ermordet wird – und mit ihm der Papst, der in Wahrheit eine Frau ist: die kluge Heilerin Johanna. Freya beschließt, herauszufinden, wer hinter dem Mord an der Päpstin steckt, auch wenn sie damit übermächtige Feinde auf den Plan ruft ...
Inspiriert vom Weltbestseller „Die Päpstin“ erzählt Helga Glaesener eine große, sehr eigenständige Geschichte – wie das Mädchen Freya sich aufmacht, das Erbe Johannas zu verteidigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Die Legende lebt
Die junge Freya wird Zeuge, wie ihre von dänischen Wikingern entführte Mutter ermordet wird. Anschließend flieht sie gen Süden, getrieben von der Sehnsucht nach ihrem Großvater Gerold. Bald findet sie heraus, dass Gerold inzwischen in Rom lebt, als Schutzherr des Papstes. Verkleidet schafft Freya es, im Jahr 858 in die Heilige Stadt zu gelangen. Doch dort muss sie mitansehen, wie Gerold während einer Prozession ermordet wird – und mit ihm der Papst, der in Wahrheit eine Frau ist: die kluge Heilerin Johanna. Freya beschließt, herauszufinden, wer hinter dem Mord an der Päpstin steckt, auch wenn sie damit übermächtige Feinde auf den Plan ruft.
Inspiriert vom Weltbestseller »Die Päpstin« erzählt Helga Glaesener eine große, sehr eigenständige Geschichte – wie das Mädchen Freya sich aufmacht, das Erbe Johannas zu verteidigen.
Über Helga Glaesener
Helga Glaesener hat ursprünglich Mathematik und Informatik studiert, bevor sie sich entschloss, freie Autorin zu werden. Gleich ihr erster Roman »Die Safranhändlerin« wurde ein Besteller. Sie lebt heute in Oldenburg. Zuletzt erschien von ihr: »Das Seehospital«.
Helga Glaesener
Das Erbe der Päpstin
Roman
Inspiriert von dem Roman »Die Päpstin« von Donna W. Cross
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapteil
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Fünfzehn Jahre später
Epilog
Impressum
Prolog
Dorstadts Küste, im Sommer 837
Vom Wind zerrupfte Wolken. Möwen, die über ein blau-rot gestreiftes Segel gleiten. Dazwischen der Schrei: »Giiiislaaa!« Vater brüllt ihren Namen.
Die Ruderer greifen nach den Riemen. Das Boot ruckelt sich in Bewegung, bald schießt es durch die See. Am Bug hebt und senkt sich der Drachenkopf, Gischt spritzt auf ihren Körper. Alles ist Schmerz. Spitze, rote Zähne haben sich in ihren Unterleib verbissen und wüten darin.
»Giiiislaaa!«
Sie muss ihm antworten und ruft seinen Namen. Oder denkt sie nur, dass sie es tut? Ein Mann mit einem eisernen Helm beugt sich über sie. Seine Augen funkeln durch die Löcher über dem Nasenschutz. »Heb mit an, Afdrif!« Er grinst. Seine Zähne sind rot bemalt, er sieht aus wie ein Hund, der ein Huhn gerissen hat. Gisla wird gepackt, und zwei Männer heben sie johlend in die Höhe, so dass ihr Gesicht zum nahen Ufer weist.
»Giiiislaaa …« Vaters Stimme klingt jetzt voller Qual. Die Männer lachen und lassen sie wieder auf die Planken fallen. Neben ihr bewegen sich die Ruderer rhythmisch vor und zurück. Ihre Kleider sind von Blut durchtränkt. Sie kann kaum atmen vor Schmerz.
Irgendwann beginnt es zu regnen. Es ist Nacht. Dann Morgen. Die Sonne scheint so grell, dass sie die Augen schließen muss. Sie schreit. Und wieder Dunkelheit. Und wieder Sonne.
***
Benommen schreckt sie hoch, als ein Ruck durch das Boot geht. Haben sie angelegt? Ja, Gelächter, Hundegebell und ausgelassene Rufe tönen ihnen vom Ufer entgegen. Der Mann mit den roten Zähnen reißt sie auf die Füße und zwingt sie, über die Bootswand auf einen Steg zu klettern. Gisla stolpert, er zieht sie wieder auf die Beine. Sie sieht, dass ihr goldenes Kleid in Höhe der Scham einen dunklen Fleck aufweist, und beginnt zu weinen. Wo ist Vater?
Der Mann mit den roten Zähnen schüttelt sie und stößt sie zu einer Frau, die sie weiterzerrt. Das Weib beschimpft sie in einer fremden Sprache. Es geht durch einen Wald. Wie seltsam unbeschwert die Vögel Gottes Lob verkündeten. Als schwebten sie mit ihm über aller irdischer Not.
Dann tauchen Häuser auf. Die Wände sind aus Holz, die tiefgezogenen Dächer aus erdfarbenem Schilf. Bohlenwege verbinden die krummen Gebäude. Hinter einem Zaun strecken sich Wiesen, dazwischen Felder, auf denen Getreide wogt. Die Frau stößt sie in einen Raum. Sie hat blonde Haare und ein strenges, hageres Gesicht mit einer kleinen Wunde unter der Nase. Grob weist sie auf einen mit Wasser gefüllten Bottich in der Mitte des Raums und reicht ihr einen Lappen.
Als Gisla sich nicht rührt, öffnet sie das goldene Kleid und zieht es ihr vom Körper. Sie sagt etwas. Es klingt freundlicher, und Gisla bemüht sich um ein Lächeln, das ihr aber sofort wieder aus den Mundwinkeln rutscht. Die Frau legt das Kleid auf einen Schemel. Es ist kostbar. Sicher soll es später gewaschen werden. Sie deutet auf den Bottich, und Gisla begreift, dass sie sich säubern soll. Unsicher taucht sie den Lappen in den Bottich. Als sie das kalte Wasser auf der Haut spürt, wird ihr Kopf klarer. Und plötzlich kehrt die Erinnerung zurück. Die Kathedrale in Dorstadt. Der Bischof, der das Kreuz gegen die feindlichen Angreifer schwingt. Dann der Fremde über ihr, die Pein, die Scham … Ja, Wasser ist nötig, sie braucht es dringender als alles andere. Heftig reibt sie über die Haut, scheuert die weiche Stelle zwischen ihren Oberschenkeln – und kann damit erst aufhören, als die Frau ihr eine Ohrfeige gibt und ihr den Lappen mit Gewalt entreißt.
Sie soll ein Kleid aus grober, ungefärbter Wolle überziehen. Gisla gehorcht. »Elva«, sagt die Frau und deutet auf die eigene Brust. Gisla überlegt, ob sie ihren eigenen Namen nennen soll. Und entscheidet sich dagegen. Sie wird ja nicht hier bleiben. Vater wird ihr folgen und in kurzer Zeit hier sein. Er ist stark und klug. Er wird sie heim nach Dorstadt bringen. Daran besteht kein Zweifel.
Vater wird mich holen…
1. Kapitel
Dänemark Siebzehn Jahre später
Die Dämmerung zog heran und verwandelte den Wald. Eben noch hatte die Sonne den Horizont zum Leuchten gebracht, hatte Buchen, Berberitzen und Seidelbast in rotgoldenes Abendlicht getaucht – nun langte plötzlich die Nacht wie ein Dieb mit schwarzen Fingern in die Baumkronen.
Freya war alarmiert. Wenn es dunkel war, holte Elva ihre Sklavinnen in die Halle, wo die Hausarbeit auf sie wartete. Wolle musste gekämmt, Kleider ausgebessert, Schnürsenkel geflochten, Leder gegerbt, Kessel geschrubbt werden … Im Trubel des Tages, wenn sich die Arbeit über Gärten, Felder und Ställe verteilte, war es den Sklaven manchmal möglich, sich davonzustehlen, aber nicht in der Nacht, wenn Elva mit scharfem Blick darüber wachte, dass keiner ihrer Leute auf der faulen Haut lag. Müßiggang duldete sie nicht.
Also auf halbem Weg umkehren, ohne in die Falle geschaut zu haben, die sie vor wenigen Tagen bei einem ihrer verbotenen Ausflüge in den Waldboden gegraben hatte? Freya biss sich auf die Lippe. Wie lange war es her, dass sie, ihre Mutter Gisla und ihre Schwester Asta den Magen vollbekommen hatten? Zwei Wochen? Drei? Gestern hatte sie sich erbrochen, weil sie verdorbenes Fleisch in sich hineingestopft hatte. Nein, sie würde weitergehen und darauf hoffen, dass ihr Verschwinden nicht auffiel. Falls sie erwischt würde, müsste sie eben eine Ausrede parat haben.
Und wenn Elva ihr nicht glaubte? Ach was, Schlimmeres als Prügel drohte nicht. Es gab nur sieben Sklavinnen in dem kleinen Dorf, das ihrer Herrschaft gehörte. Elva konnte auf keine davon verzichten. Und schon gar nicht auf das gerade erst zu voller Kraft herangewachsene Mädchen, das ihr noch viele Jahre im Haushalt und auf dem Feld zu Diensten sein sollte.
Freyas Rock blieb an einem Dornenzweig hängen und riss ein. Sie strich über den ausgefransten Stoff. Das würde sie flicken müssen, bevor Elva es bemerkte. Warum verflucht, hatte sie die Falle nur so tief im Wald gegraben? Sie eilte weiter und merkte, wie sich mit Einbruch der Nacht auch die Geräusche änderten. Die Amseln verstummten, stattdessen füllte das unheimliche Buhoo eines Uhus und das Kreischen von Schleiereulen die Luft. Laute, die sie nicht zuordnen konnten, mischten sich in das düstere Konzert der Vögel. Zweige, die unter den Pfoten und Hufen unsichtbarer Tiere brachen, Rascheln, Schnauben …
Unvermutet begann ihr Herz zu klopfen. War im Langhaus nicht von einem Bären die Rede gewesen, der draußen an der Küste mehrere Lämmer gerissen hatte? Ihr wurde bewusst, dass sich hinter jedem Busch eine Gefahr verbergen konnte. Geächtete retteten sich in die Wälder, wilde Hunde durchstreiften sie, Luchse … Im letzten Winter hatte ein Rudel Wölfe den kleinen Torfin erwischt. Das Bild seines Körpers, aus dem die Tiere faustgroße Fleischstücke gerissen hatten, war ihr ins Gedächtnis gebrannt. Sie merkte, wie ihre Augen im Bemühen, die Dunkelheit zu durchdringen, zu schmerzen begannen.
Aufhören!, rief sie sich zur Ordnung. Das fehlte noch, dass sie in Panik verfiel. Die einzige echte Gefahr, die drohte, bestand darin, dass sie wegen der Dunkelheit an ihrer sorgfältig präparierten Falle vorbeirannte. Sie würde sich das Tier holen, das hoffentlich von der Maus, die sie als Köder ausgelegt hatte, angelockt worden war, und heimkehren und … Immer eine Sache nach der anderen.
Freya zog den Kopf ein, um unter einem schräg stehenden Baum hindurch zu schlüpfen. Sie stolperte und rappelte sich wieder auf. Endlich erreichte sie die vom Blitz gefällte Eiche, die ihr als Markierung diente, und bog in ein noch dichter bewachsenes Stück Wald ein. Ein weiteres Dutzend Schritte quer durch die Büsche, und sie hatte die Falle erreicht. Als sie vor der Grube auf die Knie ging, hörte sie es darin rascheln – ihr Herz schwoll an vor Glück. Sie hatte etwas gefangen. Hastig schob sie die Reste des Reisigs beiseite, durch das ihre Beute gestürzt war. Sie legte sich auf den Boden, tastete in das trichterförmige Loch und bekam weiches Fell zwischen die Finger. Ein ängstliches Bellen, dann ein Biss. Sie hatte einen Fuchs erwischt!
Freya zog ihn am Nacken zu sich herauf und griff mit der freien Hand nach dem Messer, das sie aus der Küche gestohlen hatte. Kurz bemitleidete sie das Tier, das ihr verzweifelt zu entkommen suchte. Dann zog sie ihm das Messer durch die Kehle.
***
Wenig später, als sie wieder den Waldrand erreichte, kehrte ihre Angst mit einem Schlag zurück. Das Dorf auf der anderen Seite der Wiese hatte zu leuchten begonnen, es schwirrte vor Lebendigkeit. Im Licht der Fackeln, die die Häuser und Bohlenwege säumten, küssten Männer überschwänglich ihre Frauen, sie schwenkten kleine Kinder durch die Luft und drückten ihre vor Rührung weinenden Großmütter. Freya sah Dammo, der Gepäckstücke vom Rücken eines Esels hievte, und den hinkenden Isenbard, der Säcke voller Beutegut in Björn Ragnarssons Langhaus schleppte. Björn war also mit seinen Leuten vom Beutezug heimgekommen! Aber warum heute?, fragte sie sich verzweifelt. Warum nur gerade heute? Sicher hatte Elva die Sklaven bereits zusammengetrommelt, damit gekocht wurde, Aber vielleicht hat sie meine Abwesenheit in dem Trubel gar nicht bemerkt? Unmöglich war das ja nicht.
Geduckt rannte Freya über die Wiese, schwang sich über einen der hinteren Zäune und mischte sich unauffällig zwischen die Dörfler. Niemand achtete auf sie oder den löchrigen Sack unter ihrem Arm, in dem sie ihre Beute versteckt hatte. Nur der kleine Orm, der Sohn eines Bauern, streckte ihr mit hoffnungsvollem Blick die Hand entgegen. Sie legte ein paar Brombeeren hinein, die sie im Laufen von einem Busch gerissen hatte, und er lachte sie an und rannte davon, um seinen Schatz heimlich zu verdrücken. Kinder waren die besseren Menschen. Sie verschenkten ihre Zuneigung ohne Hintergedanken. Heimtücke und Verstellung kamen erst, wenn der Mensch älter wurde.
»Freya …«
Rief da jemand ihren Namen? Oh, das war Mutter. Gisla brauchte nicht zu wissen, was sie getan hatte, es würde sie nur aufregen. Freya tat, als hätte sie nichts gehört, und rannte um die nächste Ecke zu dem abseits gelegenen Gebäude, in dem sie und die anderen Sklavinnen hausten. Gehetzt sprang sie die Holzstufen hinab in die halb ins Erdreich gebaute Hütte. Hier unten war es stockdunkel. Sie bückte sich unter dem Dachbalken hindurch, der das Gebäude in der Mitte stützte, und verbarg ihre kostbare Beute im Stroh der Bettstatt, die Asta, Mutter und ihr zum Schlafen diente. Dann hastete sie wieder ins Freie – und hätte fast ihre Schwester umgestoßen.
»Wo steckst du denn?«, zischte Asta. »Elva fragt die ganze Zeit nach dir. Wir sollen Heringe ausnehmen.«
»Was? Die wollen doch nicht im Ernst schon heute Nacht feiern.« Freya war noch nie in einem der Boote gefahren, aber sie wusste, dass der Kampf mit den Wellen enorme Kraft erforderte. Auch der Weg von der Küste zu ihrer kleinen Siedlung, bei dem die Männer ihr Boot in einem ausgehöhlten Baumstamm hinter sich herzogen, war kein Spaziergang. Sie hatte fest damit gerechnet, dass die Kämpfer in ihren Häusern verschwinden, dort irgendwas in sich hineinstopfen und dann schlafen würden.
»Das Fest kommt natürlich erst morgen, gebratenen Fisch wollen sie aber jetzt schon.« Asta klang wie immer herablassend, was daran liegen mochte, dass sie ein Jahr älter als Freya war, schon beinahe fünfzehn. Vielleicht hatte es auch mit ihrer vornehm weißen Haut, den prallen Lippen und den Locken zu tun, die sich wie flüssiges Gold über ihre Schultern ergossen. Ob Herren oder Sklaven – die Blicke der Männer folgten ihr, und Freya wusste, dass sie die Bewunderung genoss. »Nun mach schon, bevor es Ärger gibt. Und den kriegen wir beide – und Mutter auch, vergiss das nicht.« Asta boxte sie, um ihr Beine zu machen.
***
Das Haus, in dem Björn mit seiner Familie lebte, stand in der Mitte des Dorfs. Ein langgestrecktes Gebäude, das die anderen Häuser um Mannshöhe überragte, weshalb es auch ein zweites, halbes Stockwerk besaß, in dem Björn mit seiner Frau die Nächte verbrachte. Auf dem Dach und im Flechtwerk wucherte Moos, aus dem Abzugsloch über der Feuerstelle wälzte sich eine Rauchfahne.
Als Freya die Tür öffnete, schlugen ihr Gelächter und lärmende Ausgelassenheit entgegen. Aber der Schein täuschte. Als sie in die Gesichter der Heimkehrer blickte, sah sie, dass sich die meisten vor Erschöpfung kaum auf den Beinen halten konnten. Viele waren auf die Lager an den Seitenwänden der Halle gesackt, streckten die Füße Richtung Feuer und ließen sich Trinkhörner voller Met reichen, die sie in einem Zug leerten. Sie wollten feiern, sich versichern lassen, was für Helden sie waren, einige vielleicht auch die Gräueltaten vergessen, die sie begangen hatten. Was sie jedoch in Wirklichkeit brauchten, war Schlaf.
»Willst du Wurzeln schlagen?«, zischte Asta in ihren Nacken und schob sie weiter.
Verstohlen warf Freya im Vorübergehen ihrem Herrn, der es sich auf einem der mit Fellen gepolsterten Betten bequem gemacht hatte, einen Blick zu. Björn war ein muskelbepackter Mann mit blondem Haar und einem geflochtenen Bart, in den sich die ersten grauen Strähnen mischten. Seine älteste Tochter – Elva hatte ihm zu seinem Verdruss keine Söhne geschenkt – kniete mit einer Schüssel vor ihm, weil sie ihm den Bart entflechten und stutzen wollte. Die Normannen waren eitel und unnatürlich reinlich, wie Mutter gern rügte. Sie badeten jede Woche und wechselten ebenso oft ihre Kleider. Björn ließ seine Tochter – sie hieß Gafna – gewähren, obwohl auch ihm fast die Augen zufielen. Als ihre Klinge eine kaum verheilte Wunde auf seiner Wange berührte, fluchte er kurz, aber er schlug sie nicht – sie war ja auch kein Sklavenbalg.
»Nun mach schon.« Ein weiterer Stoß von Asta. »Sie guckt!«
Tatsächlich. Elva deutete ungeduldig auf einen Holzeimer mit Heringen, der neben dem Tisch hinter dem Feuer stand. Die Mädchen zogen sich Schemel heran, und Freya begann, die Fische zu schuppen. Durch die schmalen Ritzen in den Wänden, die tagsüber das Licht ins Haus ließen, pfiff der Wind. In dem abgetrennten Stall unter dem Schlafgeschoss käuten Schafe und Ziegen ihre Mahlzeit wieder. Es stank nach Rauch und der schwitzenden, salzbedeckten Haut der Heimkehrer. Aus den Augenwinkeln sah Freya, wie Björn und seine Männer sich erhoben und träge ihre Kleider abwarfen. Offenbar wollten sie rüber ins Badehaus. Das war gut, es verschaffte den Frauen Zeit beim Kochen.
Während Freyas Messer unter die Schuppen glitt, köpfte Asta die Heringe und nahm sie aus. Sie arbeiteten mit fliegenden Fingern. Nur keinen Ärger bekommen. Nicht an einem Tag wie diesem, an dem alle wegen der Rückkehr der Krieger fast durchdrehten. Verstohlen musterte Freya den wachsenden Haufen Fischköpfe. Normalerweise durften die Sklaven sie mitnehmen, um daraus eine Suppe zu kochen. Hoffentlich auch heute. Gebratener Fuchs und Fischsuppe – das wäre ein Festmahl! Obwohl – besser, sie sparten sich einen Teil des Essens für …
»Na endlich!«, schnauzte Elva.
Freya zuckte zusammen. Gisla hatte die Halle betreten, auf dem Buckel ein schweres Fass mit Met, das sie fast in die Knie zwang. Freya sah, dass ihre Mutter vor Anstrengung zitterte und ihr Kopf rot angelaufen war, doch sie wagte keine Bemerkung. Elva war seltsam, was ihre älteste Sklavin anging. Sie schlug Gisla bei jeder Gelegenheit und oft auch ohne Anlass. Weil sie eifersüchtig ist, hatte Mutter einmal erklärt, ohne das Gesicht zu verziehen. Björn hatte sie vor Jahren, als er sie von seinem Beutezug mitbrachte, zu seiner Bettsklavin gemacht, und das konnte Elva ihr bis heute nicht verzeihen, obwohl ihr Mann die Rivalin schon lange nicht mehr unter seine Felle zog. Gisla war vor der Zeit gealtert und sah inzwischen wie eine Greisin aus.
»Zu viel! Du schneidest zu viel fort.« Elva eilte um den Tisch herum, griff in Astas blondes Haar und riss so hart daran, dass dem Mädchen die Tränen in die Augen schossen.
»Und? Was hältst du Maulaffen feil?« Diese Worte galten wieder Gisla. »Beeil dich, krumme Hexe! Wenn du was verschüttest, kriegst du die Peitsche zu spüren!«
Gisla versuchte, das schwere Fass auf ein Brett zu hieven, was ihr nach mehreren Versuchen auch gelang. Nur wenige Augenblicke verstrichen, dann begann Elva erneut zu keifen. »Ungeschicktes Luder, du zermanscht ja alles! Wer soll das noch braten? Und die Hälfte hast du drin stecken lassen …« Ihre Hand klatschte in Astas Gesicht, die nun in lautes Geheul ausbrach. »Schaff sie fort, Gisla. Los, bring deine tollpatschige Göre in die Milchhütte. Sie soll Butter stampfen. Und zwar die ganze Nacht durch, ohne Pause, bis morgen früh! Sie stampft Butter, bis die Sonne in die Hütte scheint! Keinen Atemzug weniger, sonst wird sie den Tag verfluchen, an dem sie geboren wurde.«
Das war hart, es war … unmenschlich, falls Elva ihre Drohung wirklich ernst meinte. In der Milchhütte war es eiskalt, und das Stampfen der Butter erforderte enorme Kraft. Die Kombination reichte, einen Menschen ums Leben zu bringen. Was war nur in die Herrin gefahren? Sie hatte Gisla gepiesackt, aber zu deren Töchtern war sie bisher nicht grober als zu den anderen Sklavinnen gewesen.
Freya wurde das Herz schwer, während sie ihrer Schwester nachblickte. Sie senkte den Kopf, als Elva sie herausfordernd anblickte. Der Rest des Abends floss an ihr vorbei, ohne dass sie viel aufnahm.
***
Etliche Stunden später lag sie neben ihrer Mutter in der Hütte der weiblichen Sklaven. Es war eiskalt hier, obwohl sie doch gerade erst Oktober hatten. Freya zog ihre Mutter zu sich heran und umschlang den mageren Körper mit den Armen, um sie zu wärmen. Die Hühner, die Elva ihnen zugestanden hatte, raschelten im Stroh, der Wind pfiff um den oberen Teil der Holzwände, der aus der Erde ragte, sonst war es still. Die anderen Sklavinnen waren offenbar von den zurückgekehrten Männern geholt worden, oder sie hatten sich in die Hütte der männlichen Sklaven geschlichen, die auf der anderen Seite des Dorfs lag, vielleicht auch in die irgendeines Bauern.
Gisla tastete nach Freyas Hand. »Ich wollte Asta ablösen, damit sie ein paar Stunden schlafen kann, aber die Hexe hat es nicht erlaubt«, flüsterte sie.
Sofort fühlte Freya sich schlecht. Sie hatte ebenfalls daran gedacht, ihrer Schwester zu helfen, und sie hätte sich vielleicht wirklich unbemerkt in die Milchhütte schleichen können. Eigentlich hatte sie das auch gewollt, doch dann war sie einfach zu erschöpft gewesen – und hatte ihr Gewissen damit beruhigt, dass Elva die Nacht sicher an Björns Seite verbrachte und Asta sich deshalb während des Stampfens Ruhepausen gönnen konnte. »Ich werde ihr morgen die schweren Arbeiten abnehmen«, versprach sie. Ihre Zähne klapperten. Die Decke war zu dünn. Aber Holz für ein Feuer zu verbrauchen – dazu brauchten sie die Erlaubnis von Elva, und die bekämen sie bei diesem Wetter noch nicht.
Gisla drehte sich zur ihr auf die Seite. »Gott möge …« Die Worte verebbten. Die Stille schreckte Freya auf.
»Was möge Gott?«
Gisla bebte in ihren Armen. Sie murmelte etwas, verstummte, dann begann sie zu weinen, murmelte wieder … Und plötzlich floss es aus ihr heraus, erst stockend, im nächsten Moment sich überschlagend, als wäre ein Damm gebrochen: »Gott möge sie zerquetschen, die dänischen Teufel, in seiner Hand zermalmen … zerreißen wie Wolle … Weißt du, wie es gewesen war? Wie es wirklich war, am Tag, als sie mich …« Es quoll aus ihrem Mund, was sie bis zu diesem Augenblick nie hatte preisgeben wollen. Der Tag ihrer Entführung. Wie ihre Freundin Johanna heiraten wollte … oder sollte, aber was spielte das noch für eine Rolle. Die Hochzeit im Dom. Der Bischof, der heilige, lateinische Worte sprach. »Und dann flogen die Türen auf.« Der Schlachtruf der Dänen besudelte den heiligen Ort … Schwerter … Blut … Schreie der Qual … in Stücke gehauene Kinderleiber … »Kinder, Freya, Kinder! Und schon waren sie über mir.«
Ein Seufzer, so tief, dass er kaum zu ertragen war.
»Sie schleppten mich raus … warfen mich in ihr Boot … Aber plötzlich tauchte mein Vater auf, Gerold, dein Großvater. Ein guter und starker Mann. Ich hab ihn nach mir rufen hören. Er wollte mich …«
»… retten«, ergänzte Freya, als ihre Mutter erneut zu schluchzen begann.
»Ich weiß, dass er sein Leben für mich gegeben hätte. Nur waren die Dänen stärker.«
Das war die bittere Wahrheit.
»Und doch«, flüsterte Gisla und grub ihre Hände in Freyas Hemd, »wir mögen Sklaven sein, aber wir dienen dem wahren Gott der Liebe. Dieser Gott wird uns, wenn die Zeit gekommen ist, aus der Hand der verfluchten Bastarde befreien – darauf musst du vertrauen, Tochter!«
Freya nickte, nicht aus Überzeugung – sie glaubte an keine Rettung –, sondern weil es den zitternden Körper in ihren Armen so sehr danach verlangte.
»Weißt du noch, wie du dich an der Fackel verbrannt hast?«
Natürlich. Ein Ungeschick, als sie stolperte. Die Narbe zog sich vom Handknöchel bis zum Ellbogen.
»Genau so wird es sein, wenn unser aller Leben endet. Gott wird die Dänen in die Hölle senden. Und dort wird er sie im Fegefeuer martern lassen. Ihr Schmerz wird wie deiner sein – nur hundertmal, tausendmal beißender. Und er wird niemals enden. Unser Gott wird die Dänen bis in alle Ewigkeit büßen lassen, ohne die Möglichkeit der Vergebung, die er allein dem reuigen Sünder gewährt. Aber sie sind ja nicht reuig …«
Still vor Mitleid strich Freya über die welke Haut ihrer Mutter. Und wehrte sich doch gegen ihre Worte. Nicht, dass sie Björn keine Qualen gönnte. Anders als die meisten Dänen schlug er nicht, um ein Vergehen zu bestrafen, sondern aus Lust an der Angst seiner Opfer. Sie las es in seinen Augen und hörte es in seiner Stimme. Es gab keinen Menschen, dem sie mit größerer Inbrunst den Tod wünschte. Was sie störte, war der Widerspruch in dem, was ihre Mutter behauptete. Wie ließ sich ein Gott, der die reine Liebe war, mit einem Wesen vereinbaren, das sich an Marter und Folter ergötzte? Leise fragte sie ihre Mutter.
Sie hatte erwartet, dass Gisla ihr über den Mund fahren und ihr die Ketzerei, wie sie es nannte, verbieten würde, aber erstaunlicherweise schwieg sie – und murmelte dann: »Ich bin nicht klug, Freya, ich bilde es mir auch nicht ein. Aber der klügste Mensch, den ich kannte, hat fest an diesen Gott der Liebe und der Rache geglaubt.«
Sie sprach von Johanna, das wusste Freya. Und sie ahnte auch, was nun folgen würde. Johanna war in der erinnerungsmilden Vergangenheit ihrer Mutter eine Lichtgestalt voller Klugheit, Mut und Freundlichkeit gewesen – der Gegensatz zu der Verderbtheit und Grausamkeit der Dänen. Wenn Johanna behauptet hatte, dass sich Liebe und Rache in einem einzigen Wesen vereinigen konnten …
Doch ihre Mutter wechselte überraschend das Thema. »Deine Schwester wird älter.«
»Natürlich.«
»Genau wie du. Aber sie ist hübscher, sie ist eine Schönheit.«
Warum sagte sie das? Kurz war Freya gekränkt. Sie wusste selbst, dass sie mit ihrem dürren, knabenhaften Körper, an dem die Brüste nicht größer als Walnüsse waren, unscheinbar aussah, wenn nicht hässlich. Ihr Haar war rot und struppig. Keiner der Männer hatte einen Blick für sie. Das hatte natürlich auch Vorteile. So ging sie Schwierigkeiten aus dem Weg, die sie nicht haben wollte. Trotzdem traf sie die Bemerkung ihrer Mutter.
Gisla war wieder in Schweigen versunken, und Freya begann, an die Arbeit von morgen zu denken, daran, dass sie sich wirklich anstrengen wollte, Asta zu entlasten. Bei Wotan und Jesus und wie die Götter alle hießen – es war verächtlich und dumm, ihre einzige natürliche Verbündete zu verprellen. Außerdem tat Asta ihr wirklich leid. Gut, ein oder zwei Stunden Schlaf würde sie sich gönnen, nur so lange, bis ihr die Glieder nicht mehr weh taten, dann würde sie … Ein kalter Luftzug, der von der Tür zu ihr hinüberwehte, unterbrach ihre Gedanken. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass jemand die Tür geöffnet hatte. Vor dem hellen Viereck stand eine dunkle Gestalt.
Björn.
Seine wollige Mähne hob sich wie ein heller Kranz gegen die Nacht ab. Er war betrunken, der Schein der Fackel, die er trug, führte an der Decke und der Wand einen unsicheren Tanz auf. Wortlos stieg er die kleine Treppe hinab. Als er den Boden der Hütte erreicht hatte, ließ er das Licht durch den Raum schweifen, bis es Gisla und Freya erreichte, die sich unwillkürlich enger aneinander schmiegten. Er musterte sie kurz und stieß einen Laut der Enttäuschung aus. »Wo steckt sie?«
Was?
Mutter murmelte: »Die Kleine … sie ist doch noch ein Kind, bitte nicht, Herr.« Sie versuchte sich aufzurappeln. »Ich komme schon, ich werde Euch glücklich …«
Björn brach in meckerndes Gelächter aus. »Hör ich das richtig? Du willst mein Bett beflecken?« Er trat sie aufs Bett zurück. »Weißt du nicht, wie hässlich du geworden bist, Runzelhexe? Da würde ich’s lieber mit einer toten Katze treiben.« Er riss die Decke fort und starrte zu Freya, die in sich zusammenschrumpfte. Björn war unachtsam – etwas Pech tropfte auf ihren Hals, aber sie traute sich trotz des Schmerzes nicht, es fortzuwischen. »Ein Skelett«, mäkelte er und versetzte ihr ebenfalls einen Tritt. »Hoch mit dir. Hol deine Schwester!«
Erst da begriff Freya. Björn suchte eine neue Bettsklavin. Und natürlich wollte er Asta, wen auch sonst? Niemand konnte es an Schönheit mit ihr aufnehmen. Ihr fiel es wie Schuppen von den Augen. Elva musste gespürt haben, was kommen würde, sie war eifersüchtig. Deshalb die überzogene Strafe im Milchhaus. Störte es Björn gar nicht, dass Asta seine Tochter war?
Hilfesuchend blickte Freya zu ihrer Mutter – aber die lag da wie gelähmt. Sie waren machtlos. Selbst zu zweit, selbst wenn die Furcht sie nicht lähmen würde, wären sie nicht stark genug, um ihrem betrunkenen Herrn entgegenzutreten. Schwerfällig erhob sie sich und erklomm die Stufen. Die Tür stand immer noch offen, und ein kalter Wind wehte ihr ins Gesicht. Gerade als sie ins Freie treten wollte, ertönte in ihrem Rücken ein entsetzlicher Laut – kaum menschlich zu nennen, von Qual halb erstickt. Sie fuhr herum.
Gisla war aufgesprungen und hatte ihre Hände um Björns Hals gelegt. Ihr Gesicht war zu einer Fratze verzerrt. Wie eine Puppe hing sie an dem Riesen, drückte ihre Finger in den muskulösen Hals, den sie kaum umfassen konnte, trat, brüllte … Und war Björn doch nicht gewachsen. Mühelos lockerte er ihre Hände und schleuderte sie gegen die Bohlenwand. Er bückte sich zornentbrannt nach der Fackel, die ihm bei Gislas Attacke aus der Hand gefallen war, und rammte den Stil in den erdigen Boden. Freya konnte nur seinen Rücken sehen, aber sie merkte, dass er vor Zorn bebte. Er warf sich auf Gisla, die weinend auf dem Lager kauerte. Noch einmal erhob er sich kurz, um ihr Hemd auseinanderzureißen – dann drückte er ihren armen Leib mit seinem massigen Körper ins Stroh. Gisla begann zu wimmern.
Wie betäubt stieg Freya die Stufen wieder hinab. Sie schlich sich ans Fußende des armseligen Betts und begann im Stroh nach dem Messer zu tasten, mit dem sie den Fuchs getötet hatte. Björns Füße bewegten sich, sein Körper schien Gisla zu zermalmen. Wo war das verfluchte Ding? Da endlich, ihre Finger berührten den Griff aus Horn. Freya zog die Waffe heraus. Sie erhob sich, dann tat sie ohne Zögern dasselbe wie Stunden zuvor bei ihrer Jagdbeute: Sie packte in Björns Haar und zog dem überraschten Mann mit einem kräftigen Schnitt die Klinge durch die Kehle.
Nur starb er nicht.
Björn kam mit einem Röcheln auf die Knie und entriss ihr das Messer, um es ihr in den Leib zu rammen. Aber er schaffte es nicht. Während Freya zurückwich, umklammerte Gisla seine Beine. Zornig fuhr er herum und jagte ihr die Klinge ins Gesicht, direkt hinein in eines der Augen. Gisla erschlaffte, ihr blieb nicht einmal mehr Zeit für einen Schrei.
Björns Atem rasselte, aus seinem Hals sprudelte das Blut wie Wasser aus einem löchrigen Eimer. Freya stürmte die Treppe hinauf, aber ein dumpfes Geräusch ließ sie erneut herumfahren. Ihr Peiniger lag am Boden, das Gesicht auf der dunklen Erde. Seine Hand zuckte noch einige Male nach dem Messer, das ihm entfallen war, dann rührte auch er sich nicht mehr.
Freya schluckte. Alles drängte sie ins Freie – aber eine planlose Flucht wäre töricht, vielleicht sogar ihr Tod. Sie huschte die Stufen wieder hinab, beäugte misstrauisch die leblose Gestalt und raffte das Messer an sich. Und jetzt fort? Noch einmal zögerte sie. Dann drehte sie den Toten auf die Seite und zog ihm seinen dicken Umhang mit dem Marderfellkragen vom Leib. Mehrere Male musste sie würgen – so viel Blut. Aber das Kleidungsstück würde sie nicht nur wärmen, sondern vielleicht auch zufällige Beobachter täuschen. Als sie es endlich unter dem schlaffen Körper hervorgezerrt und übergeworfen hatte, löschte sie die Fackel im Sand und stolperte ins Freie.
Auch hier war es nicht völlig dunkel. Der Mond warf bleiche Linien auf den Bohlenweg und die Dächer der Häuser. Lautlos huschte Freya an einer Bank vorbei, dann an einem Stall und mehreren Hütten. Hörte sie Stimmen? Nein. Die Müdigkeit hatte die Krieger übermannt, die Freude, sie wieder wohlbehalten zurückbekommen zu haben, hielt die Frauen neben ihnen auf den Fellen. Nur eine Katze strich um eine Ecke und maunzte böse. Freyas Blick ging immer wieder über die Schulter. Aber da war nichts.
Endlich erreichte sie das Milchhaus, das genau wie die Schlafhütten der Sklaven halb in die Erde hinein gebaut worden war. Sie öffnete die Tür. Der Mond warf sein Licht auf ihre Schwester. Asta hockte vor den Steinstufen auf dem Boden, in sich zusammengesunken, den Butterstößel zwischen den Knien. Ihr Haar floss über ihr Gesicht. Sie war wirklich schön. Eine Prinzessin mit güldenem Haar, der Stößel war ihr Zepter, ihr Lumpenkleid schimmerte wie weichgezeichnete Seide. Freya stieß sie erst vorsichtig, dann kräftiger an. Als sie aufschreckte, legte sie ihr die Hand auf den Mund. »Wir müssen fort.«
2. Kapitel
Sie flohen in die zugewachsenen Areale des Waldes, dort wo Buschwerk und hohes Unkraut den Waldboden überwuchert hatten, und mieden die Wege, die sie rasch vorangebracht hätten, aber todsicher auch von den Dänen abgesucht werden würden, sobald man Björns Leiche gefunden hatte.
War das vielleicht schon geschehen? Spätestens wenn die Sklavinnen zurückkehrten, mussten sie die Toten entdecken. Björn lag ja mitten im Gang zwischen den Strohlagern. Freya kamen die Tränen, als sie an ihre Mutter dachte. Sicher würde man ihre Leiche den Hunden vorwerfen oder ähnlich Scheußliches machen, um sie noch nach ihrem Tod zu bestrafen. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Nicht daran denken, nicht jetzt!
Ihr Weg war von Löchern und Baumwurzeln durchzogen. Aus dem Dunkeln schlugen ihnen Zweige wie Peitschen ins Gesicht. Die Angst trieb sie voran. Das Rennen durchs Dickicht erforderte jedoch Aufmerksamkeit, und die brachte Asta leider nicht auf. Es war zum Verrücktwerden mit ihr. Ständig kreischte sie auf, jammerte, rief um Hilfe. Sie schien mehr am Boden zu liegen als zu rennen.
»Ich kriege keine Luft mehr.«
Rasend vor Unruhe kehrte Freya um. Sie brauchte einen Moment, um zwischen den Büschen den Buckel zu entdeckten, der ihre Schwester war. Grob riss sie Asta auf die Füße. »Komm schon.«
»Nein, ich … ich kann nicht mehr.« Asta klammerte sich an Freyas Oberarme. »Ist Mutter wirklich tot?«
»Wenn ich’s doch sage.«
»Aber …«
»Sie ist tot. Wir können es nicht ändern.« Das hätte man auch zärtlicher ausdrücken, doch die Angst vor den Verfolgern macht sie fast wahnsinnig.
»Aber wo wollen wir denn hin?«
»Zu unserer Familie.« Die Antwort kam wie geschossen, obwohl sie Freya gerade erst eingefallen war.
»Wir haben doch gar keine Familie. Wir haben … wir hatten nur Mutter.«
»In Dorstadt lebt unser Großvater«, erklärte Freya mit so ruhiger Stimme wie möglich. Drangen Geräusche durch die Bäume? Pferdewiehern? Nein, Einbildung. »Schau, Asta, Mutter war eine Adlige. Das hat sie uns doch immer erzählt. Sie war eine reiche Frau. Die Markgräfin zu Villaris. Dann muss es auch einen Markgrafen geben, und der ist vielleicht immer noch am Leben und wird …«
»… auf uns spucken. Wir sind die Töchter von dem Mann, der sein Weib geschwängert hat. Er wird uns hassen. Das werden sie alle in Dorstadt. Sie werden uns davonjagen. Wenn sie uns nicht gleich umbringen.«
Freya starrte ihre Schwester an. Sie hatte Asta bisher immer für ein bisschen einfältig gehalten. Woher kam plötzlich diese kalte Einschätzung?
»Außerdem schaffen wir es gar nicht bis dorthin. Hasteinn wird uns vorher erwischen.«
Sie sprach von Björns älterem Bruder, der in einem der Nachbardörfer lebte. Hasteinn war das Haupt der Sippe der Ragnarssons – der Erbe des väterlichen Besitzes, ein wilder Mann, brutal, herrschsüchtig. Die Brüder hatten einander nicht sonderlich gemocht, wie Freya wusste, aber Hasteinn würde trotzdem versuchen, Björn zu rächen. Es war eine Frage der Ehre – und der Klugheit. Hielt er still, so würde das von den Nachbarn als Schwäche angesehen werden. Und wer schwach war, wurde angegriffen.
»Er erwischt uns nicht. Wenn wir uns in den Wälder verstecken …«
»Warum hat Mutter Björn nicht einfach gewähren lassen?«
»Was?«
»Es ging uns doch gut«, sagte Asta störrisch.
Freya schloss die Augen. Björn hatte sie beide gezeugt. Wie konnte Asta bedauern, dass Mutter sie davor gerettet hatte, von ihrem eigenen Vater vergewaltigt zu werden? Wie konnte sie nur … so wenig Würde besitzen? Sie dachte daran, wie sie Eier und Äpfel gestohlen hatte, während Asta sich abmühte, Elva gefällig zu sein. Sie selbst war in den Wald ausgerissen, wo sie Beeren und Pilze in sich hineinstopfte, Asta lernte im Langhaus mit vor Eifer geröteten Wangen, wie man Wolle kämmte und Tonschüsseln gefällig verzierte. Sie waren Schwestern, die aber nichts verband.
»Komm mit oder bleib hier«, stieß sie schroff hervor.
Asta gab nach und folgte ihr, aber sie kamen nur noch langsam voran, als hätte der Streit ihnen die Kraft ausgesaugt. Bis jetzt waren sie planlos immer tiefer in den Wald hineingerannt, nun wandte Freya den Blick zum Himmel – die Gestirne waren ihre Wegweiser. Sie musste die Angst niederkämpfen und überlegen, welche Richtung sie einschlagen sollten. Die Friesen, das Volk ihrer Mutter, wohnten im Süden. Man konnte ihr Land übers Meer erreichen – so war Mutter ja auch geraubt worden –, aber sie besaßen kein Boot, und wenn es anders gewesen wäre, hätte sie es nicht rudern und steuern können. Also mussten sie übers Land fliehen. Undeutlich grub sich ein Wort in ihren Kopf: Danewerk. Das war ein Wehrbau, den die Dänen errichtet hatten, um ihre südlichen Feinde fernzuhalten. Diesen Ort mussten sie finden. Hinter dem Danewerk waren sie in Sicherheit.
***
Bei Anbruch des Tages verbargen sie sich in einer schmalen Höhle, einem Loch voller Tierkot und Nestern, das mehrere Schritte in die Erde hineinführte, bevor es sich so verengte, dass nur noch eine Maus hätte weiterkrabbeln können. Asta schlief sofort ein, erstaunlicherweise, aber Freya bekam kein Auge zu. Mutter, die unter Björns Gewicht wimmerte, die klaffende Kehle ihres Peinigers … Als sie doch kurz wegnickte, schrak sie fast sofort wieder hoch, weil sie sich einbildete, einen Schatten am Höhlenausgang entdeckt zu haben. Sie stand auf, spähte vorsichtig hinaus und suchte nach Spuren, fand aber keine. Nur die eines Hirsches, der vielleicht beim Höhleneingang geäst hatte.
Müde kehrte sie in ihr Versteck zurück, doch ihre Schläfrigkeit war verschwunden. Sie starrte gegen die von Wurzeln durchzogenen Erdwände, bis es dunkel wurde. Dann machten sie sich erneut auf den Weg. Dass sie nach Süden wollten, war nun klar, aber Freya war so erschöpft, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich an der matten Kugel, die immer wieder durch die Äste schimmerte, zu orientieren. Liefen sie im Kreis? Oder gar in die Richtung, aus der sie gekommen waren?
Bei Tagesanbruch stießen sie auf eine Quelle, und sie schlief, die Hand im Wasser, einfach ein. Als Asta sie in die Rippen stieß, war sie zuerst wütend – und dann bestürzt. Kaum einen Steinwurf entfernt pflügte sich ein Weg durch den Wald. Wie hatte sie ihn übersehen können! Wie leichtsinnig, wie gefährlich! Es war die verfluchte Müdigkeit! Wenn sie sich nicht zusammenriss, würde ihre Unaufmerksamkeit sie ins Verderben reißen.
Als sie wenig später eine verlassene, zwischen zwei Hügeln eingeklemmte Köhlerhütte entdeckte, nahm Freya sie, verfroren, hungrig und schwindlig, in Besitz und beschloss, einen Tag oder zwei auszuruhen. Das kärgliche Mobiliar in dem höhlenartigen, nach modernden Pflanzen riechenden Raum war zerbrochen, als hätte hier ein Kampf stattgefunden, aber das musste lange her sein, denn eine dicke Schicht Staub überzog das zersplitterte Holz. Es brauchte sie also nicht zu kümmern. Im Gegenteil, sie konnten den Staub als Beweis nehmen, dass niemand sie behelligen würde. Die Hütte besaß eine Tür, die sie mit Hilfe eines zerbrochenen Schemels von innen verschloss, dann legten Asta und sie sich auf die Erde und bedeckten sich mit Björns Umhang, in dem das Blut zu steifen Schlieren getrocknet war.
Eine Weile versuchte Freya die Wärme, die die Wolle ausströmte, zu genießen, aber es gelang ihr nicht, und sie rollte sich verstohlen zur Seite. Lieber frieren, als etwas auf der Haut zu spüren, das ihr vor Hass Übelkeit verursachte.
Ihr Blick fiel auf die Tür, die aus mehreren grob zurechtgestutzten Baumstämmchen zusammengebunden und -genagelt worden war, und plötzlich kam ihr Snorri in den Sinn, der Sohn des Schmieds, der sie manchmal mit in den Wald genommen hatte. Er hatte ihr seine fabelhafte Geschicklichkeit beim Stockfechten zeigen wollen, und sie hatte sich ebenfalls einen Stock gegriffen und seine Bewegungen nachgeahmt. Zuerst war sie ungeschickt gewesen, aber bald wechselte das Holz in atemberaubender Geschwindigkeit von ihrer linken Hand in die rechte, es wirbelte um ihre Hüfte, glitt an die Seite, dann kam ein Ausfallschritt … Stoß … Am Ende schaffte sie es sogar, Snorri die Waffe vor Brust und Unterleib zu stoßen. Im Ernstfall hätte er Hiebe einstecken müssen. »Du kämpfst wie ein Kerl«, hatte er lachend gesagt. Wie alt war sie damals gewesen? Neun? Zehn? Inzwischen war Snorri zum Mann geworden und arbeitete in der Schmiede seines Vaters. Würde er verstehen, was sie Björn angetan hatte?
Freya drehte sich auf die Seite. Nichts wird er verstehen, dachte sie. Am Ende halten wir alle zu unseren eigenen Leuten.
***
Ihr neuer Rückzugsort war kalt und zugig, und auch das Feuer, das sie irgendwann entzündeten, half dagegen wenig. Noch schlimmer als die Kälte quälte sie jedoch der Hunger. Als die Sonne verblasste, stahl Freya sich hinaus, um Waldfrüchte und Pilze zu sammeln. Da sie sich beeilen musste, suchte sie in dem kleinen Waldstück direkt beim Haus. Die Pilze wuchsen in diesem Herbst spärlich, warum auch immer. Und sie waren leider oft genug von goldenem und rotem Herbstlaub bedeckt. Freya kroch unter Büsche und in Senken und fegte das Laub beiseite. Sie hatte einen Korb aus der Hütte mitgenommen, in dem sie ihre Beute sammelte. Als sie ihn, halb verrenkt im Bemühen, einen Champion zu erreichen, hinter sich herzog, berührten ihre Knie plötzlich etwas Weiches.
Sie hielt inne. Ein totes Tier, es musste sich um ein totes Tier handeln – allerdings um ein sehr großes. Als sie vor sich auf den Boden blickte, sah sie dort etwas krabbeln. Schwarzgoldene Aaskäfer. Sie rutschte zurück. Aus dem Laub ragte etwas, das wie ein grau gefärbter Handrücken aussah. Sie zwang sich, ein wenig Laub beiseitezuschaufeln. Unter den Blättern lag ein nachlässig mit Erde überhäufter menschlicher Leichnam. Das Fleisch faulte, an einigen Stellen waren Knochen sichtbar. Der Köhler? Vermutlich. Und sein gespaltener Schädel verriet, woran er gestorben war. Hastig warf sie das Laub zurück über die arme Kreatur und nahm sich vor, Asta nichts von ihrem Fund zu erzählen.
Aber der Appetit war ihr vergangen. Was bereits im Korb lag, musste als Mahlzeit reichen.
Und doch war es zu wenig. Sie brieten die Pilze an einem Stock, aber ihre Mägen knurrten immer noch, als sie das karge Mahl verzehrt hatten.
»Mir ist kalt«, flüsterte Asta über die Flammen hinweg, die die Hütte erleuchten und wärmen sollten, aber kraftlos wie Geister schienen.
»Ich weiß.«
»Wir werden verhungern.«
»Das werden wir nicht. Morgen Abend machen wir uns wieder auf den Weg. Wir schlagen uns nach Süden durch und kehren in das Land unserer Mutter zurück!«
»Sie werden uns dort hassen.«
»Aber wir werden keine Sklaven mehr sein.«
»Was war denn so schlimm daran, für Elva …«
»Nun halt schon den Mund«, schnitt Freya ihrer Schwester gereizt das Wort ab. Sie wollte ein paar Holzscheite nachlegen, die der Köhler in einer Ecke gestapelt hatte. Da endlich zeigte sich das Schicksal einmal von seiner gnädigen Seite. Ihre Hand ertastete, als sie einen der Scheite hervorzog, den Rand einer Kiste. Überrascht stieß sie einen Pfiff aus. Glück und Unglück wachsen im selben Garten, hatte Mutter oft gesagt. Wie recht sie hatte! Sie zerrte ihren Fund unter dem Holz hervor und beugte sich mit Asta darüber. Der Streit war vergessen.
Als sie die Kiste öffneten, kam Kleidung zum Vorschein: eine Leinenhose, mehrere Schnüre und Lederschnallen, mit denen sich die Hose in eine Pluderhose verwandeln ließ, außerdem ein rot gefärbter, etwas schmuddeliger Rock, Wollstrümpfe und sogar ein Wehrgehänge, bestehend aus Hüft- und Schultergürtel, um Messer und ein Schwert unterzubringen. »Das ist alles Männerkleidung«, stöhnte Asta enttäuscht.
»Sehe ich auch«, sagte Freya. Sie zog ihr besudeltes Kleid aus und streifte die Sachen des Köhlers über ihren kalten Körper. Vorsichtig bewegte sie die Beine. Es war seltsam, Männerkleider zu tragen. Besonders unterhalb der Taille. Ihre Beine waren in Stoff gehüllt, eigentlich gefangen, und doch fühlte sie sich plötzlich auf eine schwer zu beschreibende Weise frei. Sie stellte ihren linken Fuß auf einen Holzklotz und stützte sich mit dem Unterarm lässig auf den Oberschenkel. Asta lachte.
Ja, sie war frei – und zwar deshalb, weil sie nicht mehr nackt wie unter dem Rock war. Selbst ihre Scham wurde von Stoff bedeckt. Als sie einige Schritte tat, war sie bezaubert davon, dass es auch keinen Saum mehr gab, über den sie stolpern könnte. Nichts begrenzte die Länge ihrer Schritte, kein Stoff musste umständlich angehoben werden, wenn es über ein Hindernis ging. Snorri hätte am Boden gelegen, wenn ich den Stock in Hosen hätte schwingen können. Sie lachte und begann sich im Kreis zu drehen.
»Willst du das etwa anbehalten?«, fragte Asta.
»Ja, was denn sonst?«
***
Der Rausch verflog leider schon am nächsten Tag mit ihrem Aufbruch. Freya hatte beschlossen, von nun an im Hellen zu marschieren. Sie waren ein gutes Stück von den Dörfern der Ragnarssons entfernt, Schnelligkeit war wichtiger als Vorsicht. Aber die Wälder streckten sich endlos, irgendwann begann es zu regnen, das Laub verwandelte sich in schmierigen Matsch. Sie liefen, sie schliefen, sie froren, sie hungerten. Von den Erlen, Buchen und Walnussbäumen regnete das letzte Laub, von den Kastanien die Früchte. Einmal taumelten sogar einige Schneeflocken durch die Luft wie eine Drohung, was ihnen noch bevorstand.
»Natürlich kommen wir nach Dorstadt«, wiederholte Freya stumpf, jedes Mal, wenn Asta zu klagen begann. Glaubte sie selbst daran? Glauben half nicht weiter. Mutter hatte ihr Leben für sie gegeben, sie schuldeten ihr die Stärke zu kämpfen.
Und dann – zwei Wochen mochten verstrichen sein, vielleicht auch drei, und es dunkelte bereits – schob sich plötzlich ein gigantisches Hindernis vor den roten Horizont. Sie hatten gerade ein Wäldchen verlassen und stritten, ob sie umkehren und sich dort einen geschützten Platz für die Nacht suchen oder weitergehen sollten, als sie es erblickten. Es handelte sich um einen steilen, viele Meter hohen Wall, der rechts und links in der Ewigkeit zu verschwinden schien. Seine Kuppe wurde von einer riesigen Mauer gekrönt, in seiner Mitte befand sich ein Steinkoloss, etwas wie eine kleine Burg, aus dessen schmalen Fenstern gelbschimmerndes Fackellicht drang.
»Was ist das?«, fragte Asta verblüfft.
»Das Danewerk.«
Sie hatten es geschafft. Sie hatten die Grenze erreicht, hinter der die Freiheit auf sie wartete.
***
Ihre Freude verflog jedoch rasch. Je näher sie dem Bauwerk kamen, umso deutlicher wurde, dass sie auf ein monumentales Hindernis zuwanderten. Der Wall schien auf ihrer Seite mit Gras bewachsen, genau konnte man das nicht erkennen, aber so würde es wohl sein. Dort könnten sie sich vielleicht hochhangeln. Finger in die Erde … Stück für Stück. Aber dann stünden sie vor der Mauer. Und die war … gigantisch.
Freya wischte sich das Haar aus der Stirn und warf einen besorgten Blick zu einer Straße, die parallel zum Wald verlief, bei den letzten Bäumen abbog und geradewegs auf die kleine Festung im Wall zusteuerte. Es war eine breite Straße, die zweifellos häufig benutzt wurde. Bisher waren sie auf ihrer Flucht nur gelegentlich Hirten oder Bauern begegnet, die sie kaum beachtet hatten, doch von nun an mussten sie wieder vorsichtig wie Mäuse sein, vor deren Loch die Katze lauerte. Hasteinn Ragnarsson mochte sie aus den Augen verloren haben, aber er hatte seine Suche gewiss noch nicht aufgegeben. Es war nicht schwer zu erraten, wohin die beiden Sklavinnen sich wenden würden, und da er als kluger Stratege galt, würde ihm auch klar sein, wo das Netz lag, mit dem er sie fangen könnte. Gut, der Wall war lang, er schien die komplette dänische Grenze abzuriegeln, aber vielleicht ließ er ihn von Reitern bewachen, die Tag und Nacht an der Befestigung entlangritten? Vielleicht saßen in jeder Burg, die den Wall nach Süden hin schützten, seine Männer?
Wie dumm sie gewesen war, wie wenig sie nachgedacht hatte! Freya hatte die metbenebelte Prahlerei über das Glanzstück der dänischen Verteidigung nie ernst genommen. Aufschneiderei, hatte sie gedacht. Und doch war es eine Tatsache, dass ihr Dorf niemals von den Friesen oder anderen südlichen Stämmen überfallen worden war. Die Dänen hatten es tatsächlich geschafft, ihr Land abzuriegeln. Nun saßen sie beide dahinter gefangen.
Asta stieß sie an. »Was machen wir denn jetzt?«
Freya starrte weiter zur Mauer. Sie bräuchten eine Leiter, sehr hoch, sehr stabil. Aber die besaßen sie nicht. Außerdem: Wenn die Grenzbefestigung wie das legendäre Haithabu geschützt wurde, befand sich hinter dem Wall ein breiter, mit Wasser gefüllter Graben, in den die Dänen womöglich auch noch Speere gerammt hatten, mit den Spitzen nach oben. Sie waren so verschlagen wie Loki, der Lügengott.
»Ich bin müde. Lass uns einen Platz zum Schlafen suchen«, murmelte Asta. Freya nickte und wollte ihr schon in den Schutz des Waldes zurückfolgen, als sie auf der Straße eine Bewegung bemerkte. Sie riss Asta zu sich hinab und rollte mit ihr in eine natürliche Furche zwischen zwei Büschen.
»Was …?«
Sie presste die Hand auf Astas Mund, dann drehten beide die Köpfe. Ein Dutzend Männer waren hinter einer Waldzunge aufgetaucht, müde Gestalten, die auf ebenso erschöpften Pferden hintereinanderher ritten und sich auf das Wachgebäude zubewegten. Ihre Köpfe waren gesenkt, sie gönnten der Umgebung keinen einzigen Blick. Hasteinns Leute? Oder harmlose Reisende?
Als die Männer die kleine Festung erreichten, sammelten sie sich und begannen zu rufen. Die Entfernung war zu groß, um Worte verstehen zu können, aber das Tor schwang auf, und sie wurden herzlich begrüßt. Mitsamt ihren kostbaren Pferden verschwanden sie im Innern des Gebäudes.
»Das sind bestimmt keine von Hasteinns oder Björns Leuten …«
»Warum nicht?«, fragte Freya.
»Und wenn, dann würden sie uns nichts antun.«
»Weil wir ihnen so vorbildlich die Heringe gebraten und die Hütten gefegt haben?«
»Wir werden uns vor ihnen auf den Boden werfen und sie um Gnade an …«
»Scheißdreck, dann wird ihnen das Dreinhauen nur umso leichter fallen!« Freya schlug sich mit der Hand auf den Mund. Sie durfte sich mit ihrer Schwester nicht zerstreiten, wen hatten sie denn schon, außer einander? Sie wandten die Köpfe und starrten zum Wachgebäude.
»Sicher sind es Fremde, die nur zufällig …«
»Und wenn nicht?«
»Wir haben ihnen doch nie etwas getan.«
»Außer ihren Häuptling ermordet.«
Asta wollte lospoltern. Das bist du gewesen, nicht ich! Wohl etwas in dieser Art. Aber sie biss sich auf die Zunge. Wieder verstrich Zeit. Dann flog plötzlich eines der Fenster auf. Stimmen drangen in die Nacht, durchsetzt von Gelächter.
»Sie sind betrunken«, flüsterte Asta.
Das war anzunehmen, niemand soff so zuverlässig wie die Dänen, sie waren berüchtigt dafür und stolz drauf. Wenn es stimmte, was sie behaupteten, tranken sie sogar vor ihren Überfällen – und rammten die Feinde trotzdem in Grund und Boden. Jemand begann mit lallender Stimme zu singen.
»Geht eine Tür in die Burg hinein und auf der anderen Seite eine andere wieder raus?«, fragte Asta.
»Was sonst?«
»Und die rausgeht, wird wohl durch einen Riegel verschlossen sein?«
»Bestimmt durch mehrere. Das Tor muss ja einem Rammbock standhalten – einem ganzen Reiteransturm. Warum fragst du?«
»Aber man kann es von innen öffnen?«
»Natürlich.«
Unvermittelt sprang Asta auf die Füße. Sie rannte los, quer über die Wiese, direkt auf das Gemäuer mit den gelben Fenstern zu. Freya brauchte einen Moment, um zu reagieren. Dann folgte sie ihr. Aber ihre Schwester schien plötzlich wie von unsichtbaren Flügeln getragen, uneinholbar. Sie erreichte eine kleine Tür, die sich direkt neben dem großen Tor befand, und hämmerte mit beiden Fäusten dagegen. Entsetzt blieb Freya stehen. Was für ein Wahnsinn!
»Bitte, gute Leute, lasst uns ein. Wir haben uns verlaufen.« Astas glockenreine Stimme hallte durch die Nacht.
Freya nahm die Verfolgung wieder auf, doch es war zu spät. Die Tür öffnete sich einen Spalt weit, und ein Wächter, der misstrauisch seinen Helm übergestreift hatte, spähte hinaus. Nur ein Weib? Er schien beruhigt und sogar ein wenig amüsiert zu sein – bis er Freya entdeckte. »Was verflucht …?«
»Oh … das ist nur mein Bruder. Bitte, Herr, wir haben uns verlaufen, und es ist so furchtbar kalt. Bei Odin, fass an. Hier, meine Hände. Merkst du? Die sind wie Eis. Habt ihr Feuer drin? Ich riech das doch. Ooooh, sei gnädig. Ich könnte dich für ein Fünkchen Wärme umarmen, ich …« Asta plapperte, und in ihrer Stimme bebte eine Verheißung, die Freya kaum ertrug. Nach kurzem Zögern zog der Mann sie ins Innere der Festung. Sein Blick richtete sich auf Freya – und plötzlich hielt er ein Schwert in seiner Hand. Er musterte sie. Was sah er? Einen schmächtigen Jungen, dem die Angst durch die zerschlissenen Kleider starrte? »Also gut, rein mit dir!«, blaffte er sie an.
Was blieb ihr, als den beiden zu folgen?
Hinter der Tür lag ein breiter Flur, von dem seitlich ein Pferdestall abging. Der Widerling nötigte sie in den Raum gegenüber. Die Luft, die ihnen entgegenschlug, war stickig, was vor allem an dem von Asta so gepriesenen Feuer lag, das an der Seite des Raums in einem riesigen Kamin flackerte. In den Geruch des Rauchs mischte sich der von Bier, Met und einer würzigen Pilzsuppe. Männer schliefen mit den Köpfen auf den verschränkten Armen an einem Tisch, andere hatten sich aufs gehäufelte Stroh geworfen, wieder andere saßen in den Ecken und soffen oder löffelten einen dünnen Brei in sich hinein. Das waren wohl die Spätankömmlinge. Aber – Jesus sei Dank! – nirgends fand sich ein bekanntes Gesicht.
Freya fragte sich, wo die Männer sein mochten, die Wachdienst schoben. Oder gab’s die im Moment gar nicht? Das mochte sein, ein Angriff war um diese widrige Jahreszeit kaum zu erwarten. Wahrscheinlich hatte bereits der Schlendrian des Winters Einzug gehalten, und die Wächter betranken sich gemeinsam mit ihren Gästen.
Und nun?
Freya ging zu Asta – los weg, sie könnten sich drüben im Stall verkriechen, bis die lüsternen Schweine sich in die Bewusstlosigkeit gesoffen hatten. Aber ihre Schwester schlüpfte an ihr vorbei und ließ sich stattdessen von einem Dänen auf eine Bank ziehen. Wie ein Kätzchen schmiegte sie sich an die halbnackte Brust des Mannes und begann Zärtlichkeiten zu murmeln. Freya starrte sie mit offenem Mund an.
»Hier, Junge!« Der Mann, der sie eingelassen hatte, wollte ihr einen schäumenden Holzbecher in die Hand drücken. Als sie den Kopf schüttelte, lachte er. »Bist ein ganz braver, was? Missfällt dir deine ungezogene Schwester? Lass gut sein, Junge, das Leben ist, wie es ist.« Er schüttete den Met selbst herunter, rülpste, wischte mit dem Ärmel über den Mund und stellte sich hinter Asta. Seine behaarten Finger langten über ihre Schultern und verschwanden unter ihrem Hemd. Asta lachte und räkelte sich in seine Pranken hinein. Der zweite Mann, der auf der Bank, schob eine Hand unter ihren Rock.
Freya ballte die Fäuste. Hingehen und reinschlagen? Und dann Prügel beziehen und zuschauen müssen, wie das … das Unfassbare dennoch seinen Fortgang nahm? Asta bog den Hals nach hinten und kraulte dem Mann in ihrem Rücken das Kinn. Als hätte sie es schon immer getan. Männer kirre gemacht. Als hätte … Und wenn das die Wahrheit war? Ich musste noch fegen… eine Kuh hat sich verletzt… Hatten sie und Mutter nicht oft im Schlafhaus auf Asta gewartet?
Freya sank kraftlos auf eine hölzerne Wendeltreppe, die in eine runde Mauer eingelassen war und ins Obergeschoss führte. Stumpf ließ sie ihren Blick schweifen. Von dem Zimmer, in dem sie sich befand, ging ein kleinerer Raum ab, eine Art Vorzimmer, an das sich wiederum ein weiterer Raum anschloss. Lag irgendwo hinter diesem Labyrinth das südliche Tor? Es wäre logisch. Wer von Friesland aus das Haupttor erstürmte, musste mehrere Räume mit engen Türen passieren, bevor er auf die nördliche Seite gelangte. Und an jeder Schwelle würden sich ihm kampferprobte Verteidiger entgegenstellen.
Sie dachte an das nördliche Tor. Es war verschlossen geblieben, als Asta Einlass begehrte. Stattdessen hatte der Wächter sie durch die kleinere Tür eingelassen. Sicher gab es auch für die Südseite einen schmalen Zugang für Fußgänger? Aber wo mochte der stecken?
Asta begann zu singen, und einer der Kerle, die sie wie einen lebenden Beutel voller Geschenke abtasteten, leckte sich über die Lippen. Die anderen Männer glotzten oder schliefen. Niemand schenkte Freya Beachtung. Sie nutzte den Moment und huschte die Wendeltreppe hinauf.
Die Stufen endeten in einem mit Brettern ausgelegten Raum, der halb so groß wie das Zimmer darunter war und völlig leer. An einer der Wände lehnte lediglich eine Leiter. Aber es gab eine weitere Tür, der Treppe gegenüber. Sie war klein und wuchtig – ein Zwilling des Eingangs, durch den sie von Norden her den Wehrbau betreten hatten. Nur dass diese Tür ein vergittertes Guckloch besaß. Freya spähte hinaus und blickte auf mondbeschienene Wiesen hinab, die sich in einem Waldessaum verloren. Es gab einen zweiten Unterschied: Dieser Zugang zur Festung befand sich in schwindelnder Höhe – er wäre im Fall eines Angriffs leicht zu verteidigen. Wer über eine Leiter hinaufkam, konnte von der Plattform aus niedergestochen oder hinabgestoßen werden.
Sie horchte ins Erdgeschoss hinab, aber niemand schien ihr Verschwinden bemerkt zu haben. Entschlossen schob sie die Riegel zurück, die auch diese Tür sicherten, und beugte sich ins Freie. Unter ihr lag ein silbern glänzender Abgrund – der Graben, den sie dort ja auch vermutet hatte. Um den Zugang zur Tür für willkommene Besucher zu ermöglichen, war eine schmale Brücke über das Wasser gebaut worden. Dahinter begann ein Weg, der sich rasch zwischen den Wiesen verlor. Kurz packte Freya dasselbe Hochgefühl wie damals, als sie Snorri ihren Stock vor die Brust gerammt hatte. Die Hosen, in denen sie steckte, hatten sich niemals perfekter angefühlt. Da unten lag die Freiheit! Aber noch war sie nicht draußen. Außerdem musste sie sich um Asta kümmern …
Freya lehnte sich gegen den Balken, der die Tür stützte, und starrte ins Leere. Sie konnte ihre Schwester nicht einfach holen. Noch gab es dort unten Männer, die Waffen führen konnten. Die Überlegung war richtig, fühlte sich aber bitter an. Zahlte Asta gerade den wahren Preis für ihr Entkommen? Sie biss auf ihre Lippe.
Der Wind blies gegen ihren Mantel, ein Nachtvogel schiss auf das Brückengeländer, Zeit verstrich. Im Erdgeschoss wurde es kurz laut, als einer der Betrunkenen zu johlen begann, und dann wieder stiller. Irgendwann war es völlig ruhig. Freya wollte sich umdrehen und zur Treppe gehen, als sie plötzlich Astas Stimme hörte – verängstigt, protestierend. Ihre Hand ging zum Messer, sie hastete die Stufen hinab. Ein erster Blick zeigte ihr, dass fast alle Männer schliefen. Aber einer, der ihr zuvor gar nicht aufgefallen war, ein eher schmächtiger Mann mit einer Tätowierung auf der Wange, beugte sich über ihre Schwester. Was er tat, war nicht zu erkennen, da er ihr den Rücken zukehrte. Dann rutschte er seltsamerweise unter die Tischplatte, die Hölle mochte wissen, was er vorhatte. Asta hatte ihre Schwester entdeckt und blickte sie panisch an. Im nächsten Moment wurden ihre Augen groß, sie erstarrte.
Freya nahm die letzten Stufen, sie packte das Messer fester und bückte sich. Unter dem Tisch war es dunkel, aber sie hörte den Mann stoßweise atmen. Asta begann zu weinen. Dann handelte Freya genau wie bei dem Fuchs, wie bei Björn. Der Schnitt durch die Kehle war dieses Mal schwieriger, weil ihr der Bart des Mannes in die Quere kam, aber das Messer war scharf, und sie handelte entschlossen. Ihr Opfer begann mit den Armen zu rudern, soweit die Enge unter dem Tisch es zuließ, dann sackte es in sich zusammen.
Freya bekam einen Tritt von Astas zappelnden Füßen ab. Sie kroch unter dem Tisch hervor – und sah ihre Schwester fliehen. Nur in die falsche Richtung, zum Nordtor. Hastig zerrte sie sie zurück. »Dort rauf!« Asta wollte gehorchen, als ihr Blick auf die Blutlache fiel, die unter dem Tisch hervorsickerte.
»Komm schon!«
Jede Farbe wich aus Astas Gesicht. Wie betäubt folgte sie ihr hinauf in den abgeschiedenen Raum. Freya schob die Leiter durch die Pforte, wenig später standen sie auf der Brücke und dann, endlich, auf dem Weg, der dahinter begann. Der Geruch der Wiesen war wie eine Fanfare, das Mondlicht glich einem Kuss, das feuchte Blatt, das der Wind Freya ins Gesicht blies, einem zärtlichen Scherz. Überglücklich wollte sie ihre Schwester umarmen – und hielt mitten in der Bewegung inne. Astas weiches, immer noch blasses Gesicht war gezeichnet von Erschöpfung, Verwirrung und Schmerz. Aber da war noch etwas anderes. Freya brauchte einen Moment, um dem, was sie sah, einen Namen zu geben. Kälte. Astas Augen waren blau, aber nicht strahlend blau, so dass man ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt hätte – sie ähnelten eher dem Himmel an einem Nebeltag. Doch hier, im geizigen Licht des Mondes, schienen sie plötzlich zu glänzen. Zwei kleine Eisbrocken.
»Was ist?«
Astas Stimme klang gepresst, als sie sagte: »Wir … sind verschieden. Ich bin vom Blut unserer Mutter und du vom Blut unseres Vaters. Ich versuche zu trösten, und du tötest.«
3. Kapitel
Rom 854
Rom. Die Heilige Stadt, in der in jedem Winkel die Schatten der Apostel von Liebe, Vergebung und dem Trost des Paradieses nach einem gottgefälligen Leben raunten. Wo die Gebeine der Märtyrer unter den Altären der Kathedralen den Beistand des Allmächtigen verhießen. Wo ein gütiger Papst die Menschen mit seiner Liebe umschloss … Und zugleich: die Stadt, auf deren von Brücken überspannter Lebensader stinkende Abfälle und Fäkalien trieben, wo ehemals glanzvolle Quartiere zu Ruinen verkamen, wo Kardinäle mit Huren Kinder zeugten, wo man morgens die Opfer der Sicarii einsammelte, die im Auftrag der Mächtigen ein Leben beendet hatten. Ein Ort der Gegensätze, wie es ihn wohl nirgendwo sonst auf der Welt gibt, dachte Aristid, der Gardist des Papstes, der gerade den geschmähten Fluss überschritt und wegen des grauenhaften Gestanks den Arm vor die Nase hielt.