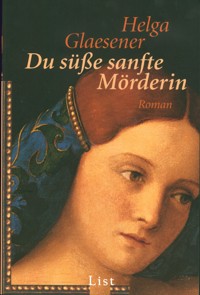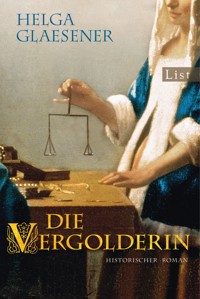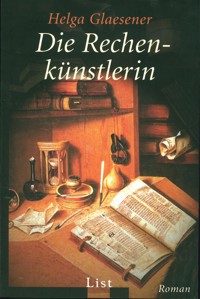7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rom 1559: In einem alten Hafenturm wird die verstümmelte Leiche eines Jungen entdeckt. Der Tote trägt eine Rose im Haar und niemand scheint ihn zu vermissen. Mehr noch: Es gibt jemanden in der heiligen Stadt, der alles daran setzt, die Aufklärung des Mordes zu verhindern. Skandalös, findet Richter Benzoni und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Mörder ? auch dann noch, als die Spur in eine bestürzende Richtung läuft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Nach Monaten der Sedisvakanz, die die heilige Stadt in blutige Wirren tauchte, steht im Jahre 1559 endlich eine neue Papstwahl und damit die Rückkehr von Recht und Ordnung bevor. Tommaso Benzoni, Richter über die beiden Tiberhäfen, ist erleichtert. Endlich kann er sich wieder seiner Arbeit zuwenden und über Zollbetrug und Schlägereien richten, als in der Nähe des Hafens die übel zugerichtete Leiche eines Jungen entdeckt wird.
Der Tote entpuppt sich als käuflicher Spielgefährte reicher Männer, dessen Ableben niemand betrauert. Auch die Behörden, die für die Aufklärung des Mordfalls zuständig wären, zeigen sich auffallend desinteressiert. Erzürnt beginnt Tommaso selbst nach dem Täter zu forschen. Doch als im Körper der Leiche ein kostbares Messer gefunden wird, dessen Besitzer der Kardinal Carafa ist, laufen Tommasos Ermittlungen in eine bestürzende Richtung: seine eigene Ehefrau, die schöne Vittoria, hat offensichtlich etwas zu verbergen…
Die Autorin
Helga Glaesener wurde 1955 geboren. Sie studierte Mathematik und Informatik und lebt heute mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Aurich, Ostfriesland. Besonders ihre historischen Romane wie Die Rechenkünstlerin, Du süße sanfte Mörderin und Die Safranhändlerin fanden ein begeistertes Publikum und wurden große Erfolge.
Von Helga Glaesener sind in unserem Hause bereits erschienen:
Du süße sanfte Mörderin Der indische Baum Die Rechenkünstlerin Die Safranhändlerin Der Stein des Luzifer
Helga Glaesener
Wer Asche hütet
Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0503-5
List Verlag 1. Auflage August 2003 © 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG © 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München/List Verlag Umschlagkonzept: HildenDesign, München – Stefan Hilden Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kampa Werbeagentur, München–Zürich, unter Verwendung eines Gemäldes von Raffael, »Leo X. mit den Kardinälen Giulio de’ Medici und Luigi de’ Rossi« (Ausschnitt), Uffizien, Florenz
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Fortes fortuna adiuvat
Für Matthias, mit Liebe
Man fällt eine Zeder, wählt eine Eiche. Den einen Teil des Holzes wirft man ins Feuer und röstet Fleisch in der Glut und sättigt sich an dem Braten.
Aus dem Rest des Holzes aber macht man sich einen Gott, ein Götterbild, vor dem man niederkniet, zu dem man betet und sagt:
Rette mich, du bist doch mein Gott.
Wer Asche hütet, den hat sein Herz verführt und betrogen.
(Jesaja 44)
PROLOG
Rom im Dezember 1558
Ich habe ein krankes Töchterchen, würde er sagen.
Evaristo Campello hatte sich das genau überlegt. Sein säumiger Kunde war kein Lämmlein, das wusste ganz Rom. Aber ein krankes Töchterchen … Er grübelte über einen Namen, den er dem Mädchen geben könnte, während er in dem prunkvollen Zimmer wartete, dessen weinrote, mit Goldfäden durchzogene Ledertapeten ihn einschüchterten und auf dessen weißem Marmorboden seine Füße froren.
Maria. Das klang fromm und einfach. Ein einfaches, frommes Mädchen mit einem einfachen, frommen Vater, der Medizin bezahlen musste. Ein Blutleiden, Monsignore, würde er sagte, wenn der hohe Herr nachfragte. Eine Prüfung des Herrn. Er würde seinen Blick verschämt zu Boden senken …
»Monsignore Carafa ist beschäftigt«, erklärte eine heisere Stimme in seinem Rücken.
Evaristo fuhr herum, als hätte man ihn bei etwas ertappt. Er schluckte, wütend und hilflos. In seinem Haus in der Via Trinitatis wartete Pietro, der Hai, dem er seine Eichhörnchenpelze verpfändet hatte. Zahle heute, hatte Pietro gesagt, oder zahle nie. Für die Pelze bekomme ich, was du mir schuldest. Er würde mehr bekommen. Er würde ein Vermögen gewinnen.
»Der Maestro di Camera ist erkrankt … Der Sekretär ist verreist …« Evaristo bemühte sich, seiner Stimme einen eisigen Tonfall zu verleihen. »Der Mantel wurde Monsignore vor nun acht Monaten geliefert. Er hat ihn getragen, oh doch, ich weiß das, denn ich habe ihn damit vor der Bank von Gottardo und Ceuli gesehen. Er hat ihm also gefallen… und ist es da … nach acht Monaten … nach acht Monaten, in denen ich immer wieder vertröstet wurde …«
»Der Monsignore ist beschäftigt. Ihr müsst gehen.« Der Diener war krank und hatte keine Lust zu streiten. Und vor allem wollte er keinen Ärger mit seinem Herrn.
Evaristo sank das Herz. Signor Trotti, ein Sänger der Sixtinischen Kapelle, hatte eine Cappa aus Eichhörnchenpelz bestellt. Er war kein so nobler Kunde wie der Kardinal, aber er würde zahlen, und damit wären Evaristos schlimmste Sorgen bereinigt. Nur – um die Cappa zu liefern, musste er die Eichhörnchenfelle haben. Und die würde Pietro, der Gauner, natürlich nicht herausrücken, weil er seine schlimme Lage genau kannte.
»Ich werde bleiben«, sagte Evaristo fest. »Ich werde mit Monsignore Carafa sprechen. Und wenn man mir das verweigert, dann werde ich … vor dem Gericht des Senatore klagen«, behauptete er kühn.
Der Diener war ein Mann mit üblen Augen. Evaristo schwor darauf, dass das Wesen eines Menschen in seinen Augen sichtbar wurde. Dieser Lakai, dem die Nase triefte und das Sprechen Schmerzen bereitete, hatte die leicht vorgewölbten, stechenden Augen einer Wespe. Er schielte damit, als dürfe das eine Auge nicht wissen, was das andere sah. Ein Lump. Der willfährige Sklave seines Herrn.
»Wartet«, sagte der Mann.
Erleichtert atmete Evaristo auf. Der Kardinal hatte einen schlechten Ruf. Man munkelte von Kutschen, die nachts vor seinem Palazzo hielten und denen in Seide gekleidete Damen mit geschminkten Gesichtern entstiegen. Evaristo hatte dafür Verständnis. Ein Mann ist ein Mann. Es hieß auch, dass der Kardinal zur Gewalttätigkeit neigte. Aber immerhin trug er den Mantel der Heiligen Kirche. Ein Mädchen mit einer Blutkrankheit, das ohne Medizin sterben würde, musste doch eine milde Saite in ihm zum Klingen bringen. Und wenn er kein Mitleid hatte, würde er dennoch zahlen, um ihn loszuwerden. Er war so reich, dass er die zweihundert Scudi kaum merken würde.
Aus einem Zimmer, das auf der anderen Seite des mit einem Heckenlabyrinth bepflanzten Innenhofes lag, drang plötzlich eine Stimme. Sie sagte etwas, nur zwei, drei Worte, die sich vor Zorn aber fast überschlugen. Evaristo jagte ein Schauer über den Rücken. Zweifellos die Stimme des Hausherrn, denn wer sonst würde sich erdreisten, so herumzuschreien? Er war an einem schlechten Tag gekommen, das wurde ihm plötzlich klar. Sehnsüchtig lugte er zur Tür. Wenn der Diener wiederkam, um ihm mitzuteilen, dass Monsignore Carafa unabkömmlich sei, würde er gehen. Mit dem Hinweis, dass er innerhalb der nächsten Woche …
Der Allmächtige hat mich für so etwas nicht geschaffen, dachte er.
Seine Augen wanderten verschreckt durch das Zimmer und blieben auf einer matt glänzenden Elfenbeinschatulle haften, die auf einem Tischchen an der Wand lag. Zögernd näherte er sich dem Kleinod. Er verharrte davor und wartete, dass der Diener zurückkehrte, um ihn hinauszuwerfen. Warum ließ der Mann sich so viel Zeit? Eine Frauenstimme gab in einem der hinteren Räume einen scharfen Befehl. Danach war wieder alles still.
Vorsichtig hob Evaristo den Deckel an.
Eine Waffe. Ein Messer mit einer dreikantigen Klinge und gefährlich aussehendem Widerhaken. Er kannte sich damit nicht aus, aber er sah, dass der Stein im Griff ein leuchtender Smaragd von ungewöhnlicher Klarheit war, der mindestens den Wert des Mantels besaß.
Noch immer kein Geräusch aus den Nebenzimmern.
Evaristo nahm das Messer in die Hand. Ihm war, als blinzele ihm aus dem grünen Stein der Leibhaftige selbst entgegen. Nimm, sagte der Böse. Es steht dir zu.
Matteo Alberini, dem die Hutreinigung gegenüber gehörte, war im Schuldgefängnis gestorben, obwohl seine Tante ihm täglich feinstes, weißes Brot gebracht hatte. Die Strolche, die Wächter, mussten es gestohlen haben, sagte sie, denn der Leichnam hatte nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Das Auge des Leibhaftigen glitzerte höhnisch.
Entschlossen legte Evaristo das Messer auf das Samtbett zurück. Sein Herz klopfte, als wolle es die Brust durchschlagen. Er musste noch einige Minuten warten, ehe sich die Schritte näherten, die er fürchtete und zugleich ersehnte, weil sie der Folter des Wartens ein Ende bereiteten.
Die Tür flog auf – aber es war nicht der Diener, der in der Öffnung erschien.
Evaristo verneigte sich. Nein, er fiel auf die Knie und warf sich zu Boden. Er war viel zu aufgeregt, um zu verstehen, was der Mann mit dem schwarzen Backenbart in dem purpurnen Gewand der Kardinäle zu ihm sagte.
»Die Rechnung, Monsignore«, stotterte er. »Der Mantel …« Vor allem ruhig Blut bewahren. Ruhig Blut.
Als er den Kopf hob, um von – wie hatte er sein Mädchen noch genannt? – zu erzählen, traf ihn ein Fußtritt ins Auge. Er geriet ins Wanken und riss entsetzt den Mund auf. Noch ein Tritt, der ihn auf den Rücken warf. Und weitere Tritte.
Sein Gesicht wurde warm von Blut.
I
Der Allmächtige hatte beschlossen, die heilige Stadt vom Blut zu reinigen. So kam es Tommaso Benzoni jedenfalls vor.
Er stand zu Füßen der Stadtmauer, als der gewaltige Wolkenbruch niederging. Das Wasser fegte über den aufgeweichten Boden, es riss die Erde mit sich und schoss in Sturzbächen zur Straße hinab, wo es sich in einem Netz von Pfützen sammelte, die gierig nach weiteren Wegen suchten. Der Tiber – ein schäumendes, graues Band im Tal – leckte an den Pferdeweiden des Testaccio, und die Häuser in der Innenstadt duckten sich, als spürten sie die Peitsche des Allerhöchsten über ihren Dächern. Gott zürnte, weil er den Anblick des Bluts nicht mehr ertrug.
Rom, dachte Tommaso voller Groll. Die heilige Stadt war nie ein friedlicher Ort gewesen, aber die letzten vier Monate … Die Kardinäle hatten von August, als Paul IV. starb, bis zum Weihnachtsfest gebraucht, um sich auf einen neuen Papst zu einigen. In dieser herrenlosen Zeit hatten die Leute gewütet, als hätten sie nie von Gesetzen gehört. Der Fischhändler oben in der Via Anicia hatte den Laden seines Konkurrenten angezündet und dessen Enkeltochter gebraten, Pompeo Colonna hatte seine Schwiegermutter erwürgt, der mantuanische Gesandte die schimpfende Tante der schönen Ortensia Griffo niedergestochen, die Brüder Foriano hatten ihre Schwester erdrosselt, drei Tage vor der Hochzeit, der Himmel mochte wissen, warum. Wer sich scheute, die eigenen Hände zu beschmutzen, hatte sich an die Sicarii gewandt, die bezahlten Mörder, die in den Schenken an der Piazza Borghese ihre Aufträge so unbekümmert entgegennahmen, als wären sie einfache Kaufleute. Die Römer wussten, dass der neue Pontifex ihnen Absolution für die Untaten während der Sedisvakanz gewähren würde, und entsprechend hatten sie gehandelt.
Nein, dachte Tommaso, während das Wasser sein Kraushaar ins Gesicht spülte, die Himmel weinen nicht, sie senden die zweite Sintflut und verfluchen ihr Versprechen des Regenbogens.
Er schob die Hände in die aufgeweichten Ärmel seines Talars und hob fröstelnd die Schultern, wobei sein Blick über die Stadtmauer schweifte, bis er an dem Turm hängen blieb, den seine Leute gerade durchsuchten. Die sittenlose Zeit war vorbei. Die römischen Gerichte hatten die Zügel wieder in der Hand, und selbst eine vergleichsweise geringe Untat wie der Diebstahl eines Vortragskreuzes wurde unnachgiebig verfolgt. Gut so.
Nur, dachte er verdrossen, warum müssen sie gerade das Ripatribunal damit behelligen? Dem kleinen römischen Hafengericht unterstanden zwölf Sbirri, das reichte mit Müh, um die beiden Stadthäfen zu überwachen.
»Willst du nicht … Tommaso! Komm rüber. Es stinkt wie in der Kloake, aber hier ist es wenigstens trocken.« Ugo, der Notaio des Gerichts, winkte aus der Turmtür, doch Tommaso tat, als hätte er nicht gehört. Er sah, wie Ugo sein Barett über die Ohren zog und losrannte, wobei ihm der nasse Mantel gegen die Beine klatschte. Prustend blieb der kleine Mann vor ihm stehen.
»Es ist, als würdest du einen Floh in einem Haufen Mist suchen. Weißt du, wie viele Türme das sind bis zu San Pancrazio? Dreißig? Nein, mehr …« Zitternd versuchte er zu schätzen. »Und dazu die verdammten Wehrgänge! Und die Arkaden und der ganze Dreck davor und dahinter … Was bitte hat die Mauer mit dem Hafen zu tun? Drei, Tommaso, drei Türme stehen an der Ripa. Der Rest gehört zu Trastevere, und das ist Gebiet des Governatoregerichts. Weshalb ist von denen keiner hier? Die haben achtzig Sbirri, die sie über die lausigen Treppen jagen könnten. Die wären in einem Tag fertig. Wir brauchen …« Entmutigt warf er die Arme in die Luft.
Sie musterten die Mauer mit ihren doppelstöckigen Arkadenbögen, hinter denen sich Stiegen und Nischen verbargen – unzählige Versteckmöglichkeiten. Akkurat alle hundert Fuß wurde die Mauer von einem quadratischen, mehrstöckigen Turm unterbrochen. Türme und Mauer waren über tausend Jahre alt, und an den Wänden wuchs Moos, und in den Gängen und Räumen und im Deckengebälk hausten Ratten und Mäuse. Man verlangte von ihnen, einen Augiasstall auszumisten. Und der Sinn der ganzen Aktion ist möglicherweise, dass Strata sich einen Misserfolg erhofft, dachte Tommaso, von seinem eigenen Gedanken überrascht.
Andrea Strata, der Römische Ankläger, war am vergangenen Vormittag in sein Ufficio im Hafentribunal gekommen und hatte ihm mitgeteilt, dass zwei Rosenkranzschnitzer aus der Kirche San Pietro in Montorio ein Vortragskreuz und Altargerät gestohlen hatten. Der Sakristan, der gerade den Abfall in den Klostergarten brachte, hatte die beiden Strolche davonrennen sehen. Man konnte sie fassen, aber es war ihnen zuvor gelungen, ihre Beute zu verstecken. Vermutlich in einem der Stadttürme, hatte Strata gesagt. Und daher hatte er verlangt … Nein, gebeten, er war höflich gewesen. Er hatte gebeten, bei der Suche zu helfen, aber durchblicken lassen, dass sein Freund, der Governatore, äußerst ungehalten wäre, wenn die Männer vom Ripatribunal diese Gefälligkeit abschlügen.
»Und wenn es gerade das ist, was er will – dass wir erfolglos bleiben?«, wiederholte Tommaso seinen Verdacht laut.
Ugo, der mit beiden Händen das Barrett hielt, starrte ihn entgeistert an.
»Andrea Strata. Wir suchen, aber wir finden nichts. Er geht zum Heiligen Vater und berichtet von unserer Unfähigkeit oder dem mangelnden Eifer oder weiß der Himmel und schlägt vor, das unnütze Ripatribunal mit dem des Governatore zu vereinigen. Er hat das schon mal versucht. Zweimal, unter Papst Paul.«
Ugo stöhnte und spuckte trübe in das aufgeschwemmte Gras zu seinen Füßen. Er war fast fünfzig – kein gutes Alter, um die Arbeit zu verlieren.
»Muss ja nicht sein«, schwächte Tommaso ab. Eine Zeit lang schwiegen sie, während das Regenwasser durch die Nähte ihrer Stiefel sickerte und ihre Füße in Eisklumpen verwandelte. Sie sahen das Licht der Fackeln hinter den Fensterchen, und gelegentlich trat einer der Sbirri halbherzig in einen Arkadengang, zog sich aber schleunigst wieder zurück, wenn ihm der Regen ins Gesicht peitschte.
»Warum ausgerechnet hier?«, grübelte Tommaso.
»Was? Keine Ahnung. Warum nicht?« Ugo verstummte.
Lorenzo, der Bargello des Ripagerichts, der die Suche leitete, war auf der Plattform des Turms erschienen. Seine lange, fadendünne Gestalt in den goldgelben Kleidern leuchtete vor dem schwarzen Himmel. Er hob die Arme zum Zeichen, dass die Männer bisher nichts entdeckt hatten.
Tommaso winkte zurück und fuhr lebhafter fort: »Strata hat betont, dass wir bei den Hafentürmen mit der Suche anfangen sollen. Aber warum? Die Diebe sind von der Kirche losgelaufen. Also sollte man doch annehmen …«
»Vielleicht haben die Mönche die Kerle bis zur Ripa verfolgt und gesehen, dass sie das Zeug dort noch bei sich hatten.«
»Dann hätte Strata uns kaum gebeten, sämtliche Türme zu durchforsten. Er hätte gesagt: Von hier bis … Er hätte die Suche eingeschränkt.«
»Wenn er nicht so ein Dreckskerl wäre.«
»Wenn er nicht …« Tommaso musste plötzlich lachen. Er klopfte seinem frierenden Notaio auf die Schulter. »Ein Dreckskerl würde uns hier mit der Suche anfangen lassen, auch und gerade wenn feststünde, dass die Diebe bereits hinter den ersten drei Türmen gefasst wurden. Richtig, Mann.«
Er reckte das Gesicht gegen den Himmel und genoss mit einem Mal die prickelnden Stiche auf der Haut. Strata versuchte, ihnen eins auszuwischen. Und er selbst war ein Idiot, dass ihm das erst jetzt klar wurde. Die Sedisvakanz, dieser massenhafte Ausbruch von Gewalt, gegen die kein Einschreiten mehr möglich gewesen war, hatte sein Gehirn aufgeweicht. Er grübelte zu viel, war zu weich. Das war sein Fehler.
»Komm!« Ohne abzuwarten, ob sein Notaio ihm folgte, tastete er sich seitwärts den glitschigen Hang hinab. Ugo rief etwas zum Turm hinauf und beeilte sich, ihm zu folgen. Er keuchte, und Tommaso ging langsamer. Eine ganze Weile liefen sie schweigend nebeneinanderher, immer bemüht, sich mit den Armen vor den schlimmsten Böen zu schützen. Die Straße wurde steiler. Weingärten tauchten auf, die sich bis zur Mauer hinaufzogen. Schwarze Flächen, die mit ihren kahlen Stöcken wie Friedhöfe aussahen.
»Was genau wurde gestohlen?«, rekapitulierte Tommaso. »Ein Kreuz und Altargerät, ja. Aber was für Gerät? Wie viel und wie schwer war das alles? Hatten die Diebe einen Sack dabei? War der Diebstahl geplant und gab es Komplizen, denen sie die Sachen zuwerfen konnten? Das würde erklären, warum die Mönche nichts gefunden haben. Falls Strata sie überhaupt hat suchen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sie in ihre Zellen zurückscheuchte und alles zu einer Angelegenheit des Fiscus erklärte.«
»Verfluchtes …! Ich meine das Wetter. Bitte, red nicht mehr von Strata, Tommaso. Tu mir den Gefallen.« Ugo glitt im Matsch aus, hielt sich an seinem Vorgesetzten fest, und einen Moment standen sie still und rangen um ihr Gleichgewicht.
»Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht aufzuhören?« Der Notaio klapperte mit den Zähnen. »Du hast einen guten Namen in Rom. Warum nicht eine Kanzlei aufmachen? Erinnerst du dich an die Sache mit della Cornea? Der seinen Halunken losgeschickt hat, um diese Hure zusammenzuschlagen, diese Griechin? Es hat den Leuten gefallen, wie du seinem Rüpel die Strafe auf den Rücken diktiert hast. Endlich mal die Peitsche von einer blinden Justitia geschwungen – so sehen sie das. Und dass Cornea, dies Schwein, dich nicht umgebracht hat … Geh langsam, ich bin kein Windhund. Sie denken, dass du mächtige Verbindungen haben musst. Wenn du eine Kanzlei aufmachtest, würden sie dir die Tür …«
»Er hat mich in Ruhe gelassen, weil ihm der Governatore wegen einer anderen Sache auf den Fersen war.«
»Na und? Wichtig ist, was die Leute glauben. Geht’s hier rauf? Ich versteh nicht, warum die Fratres keinen anständigen Weg anlegen. Die kriegen doch alles mit dem Karren geliefert. So ein Dreck.«
Tommaso blieb plötzlich stehen. »Siehst du? Da hinten, den Klostergarten? Stell dir vor, du wärst der Dieb. Du trägst einen Sack – wir nehmen einen Sack an – und dein Kumpan das Kreuz. Die Sachen sind schwer, aber ihr wollt euch nicht davon trennen. Der Sakristan im Garten hat euch gesehen. Ihr hört, wie er die Mönche zusammentrommelt. Vielleicht tauchen die ersten Verfolger schon auf. Wohin also? Rauf zur Mauer? Oder in eine andere Richtung?«
Ugo wiegte den Kopf. »Keine weiteren Komplizen?«
»Nur die beiden«, bestimmte Tommaso.
»Wenn sie sich in einem der Türme versteckten, säßen sie in der Falle. Sie könnten natürlich versuchen, über die Arkaden zu entkommen, aber … nein, zu gut einsehbar. Ich denke … ich denke gar nichts. Wer weiß, was im Kopf eines Lumpen vor sich geht, der den Allmächtigen bestiehlt.«
»Also doch über die Weingärten? Aber … so ist es nicht gewesen.«
Ugo wischte mit dem Ärmel die Haare aus dem Gesicht und sah ihn fragend an.
»Die Flechtzäune. Sie hätten sie niedergerissen, wenn sie versucht hätten, über die Gärten zu entkommen. Aber die Zäune sind heil. Oder doch nicht?« Tommaso kletterte in seinen triefenden Kleidern auf einen vom Blitz gefällten Baum. Nein, die Zäune, die von der Stadtmauer bis zur Straße hinabreichten, waren alle intakt. »Sie sind also doch zu den Türmen. Welchen würdest du wählen, Ugo?«
Missmutig wies der Notaio auf den nächsten, der sich von den anderen nur dadurch unterschied, dass seine Eingangstür mit einer Berberitze zugewachsen war. »Ist es deine Frau?«
»Was?« Tommaso hob den Talar an und kletterte über totes Geäst.
»Deine Frau. Denkst du, sie hätte etwas dagegen, wenn du als Anwalt arbeitest?« Ugo beeilte sich, zu ihm aufzuschließen. »Ihr Onkel war vor dir Giudice della Ripa. Und davor ihr Vater. Könnte ja sein, dass ihr das was bedeutet. Der Titel. Nicht so großartig wie Senatore oder Governatore, aber doch … respektabel. Durch Papstbreve ernannt, Continuo commensale und so, ’ne Menge Geld und was da alles dranhängt. Ich meine, es wär ja verständlich, wenn sie andere Vorstellungen …« Er brach ab, plötzlich verlegen.
Sie hatten den Turm erreicht, und Tommaso legte den Kopf in den Nacken, um zum Dach hinaufzusehen.
»Geht mich nichts an. Entschuldige. Außerdem versteht sowieso keiner, was im Kopf einer Frau vor sich geht. Faustina und ich sind seit zwanzig Jahren miteinander verheiratet, und noch heute weiß ich … Du willst da rein? Na schön. Ist mir alles recht.«
»Ich hab keine Ahnung, was Vittoria denkt. Sie war die letzten Monate verreist, und ich habe noch keine zehn Worte mit ihr gesprochen.«
»Sicher, ich meinte ja auch …«
»Ich weiß nicht, was sie denkt. Sie ist mir so fremd wie die Königin von Saba. Klar?« Tommaso riss sich bei dem Versuch, durch die Berberitze zu dringen, einen Dorn in die Haut. Er fluchte leise. Seine gute Laune war verschwunden. Der Mief feuchter, verschimmelter Erde schlug ihm entgegen, als er das Gemäuer betrat. Er ging ein paar Schritte und begann mit der Durchsuchung. Die Beute war kümmerlich. Ein Mäusenest unter dem Treppenaufgang, vergammelte Herbstblätter und überall Staub und Spinnweben, die sich wie Leimfäden in seinen Talar hängten.
Gereizt erklomm er die Steintreppe.
»Du denkst, die sind da raufgegangen? Wenn du nichts dagegen hast – ich bleibe lieber unten. Ich kann Treppen ohne Geländer nicht ausstehen.«
Tommaso hatte das Zwischengeschoss erreicht. Viel sehen konnte er nicht, denn der Raum bekam nur wenig Licht durch die Schießscharten und drei winzige Fenster an der stadteinwärts gewandten Mauer. Er versuchte, die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, aber er musste Schritt für Schritt den Raum abtasten, um herauszufinden, dass es auch hier nichts gab. Als er durch eines der Fenster lugte, sah er Lorenzo in seinen leuchtenden Kleidern – der Himmel mochte wissen, warum er sich immer wie ein Blattgoldengel ausstaffierte – mit seinen Sbirri den Berg erklimmen.
Strata macht einen Affen aus mir, dachte er. Ich hätte ihn davonjagen sollen und zum Teufel mit dem Governatore. Lustlos erklomm er das oberste Geschoss. Hier war es heller, da Licht durch eine Dachöffnung fiel. Unschlüssig blieb er stehen.
»Lorenzo ist da. Er will wissen, ob er raufkommen soll«, tönte Ugos Stimme dumpf aus dem Erdgeschoss.
Ohne viel Hoffnung bückte Tommaso sich unter der Treppe hinweg, die aufs Dach führte, und durchsuchte die Ecken des Raums – die einzigen Orte, die als hastig gewähltes Versteck in Frage kamen. Nichts, wie er befürchtet hatte.
Lorenzo stieg die Treppe hinauf. Klack-trapp, klacktrapp, präzis wie die Trommeln der Galeeren an der Ripa Grande. Der Bargello war ein guter Mann. Zuverlässig. Das vor allem. Es hieß, dass er sich bei den Auspeitschungen, die er zu überwachen hatte, nie um einen Schlag verzählte. Weder im Guten noch im Schlechten. Gewissenhaft, jawohl. Unbestechlich. Penetrant wie ein Glockenspiel. Engstirnig, umständlich, stur … Nein, das war ungerecht.
Verdrossen sah Tommaso das magere Gesicht mit dem akkurat gestutzten Lippen- und Kinnbärtchen im Treppenschacht auftauchen und schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Nur sehr viel Schmutz hier, Giudice.« Lorenzo erklomm die letzten Stufen und versuchte, Haltung anzunehmen und Tommaso gleichzeitig den Weg ins Untergeschoss freizugeben. Für dieses Kunststück musste er seine Bohnengestalt verrenken. Er stutzte – und begann zu hüsteln. »Ein Sack, Giudice.«
»Was?«
»Verzeihung, aber wenn man den Kopf schräg hält, kann man von hier aus zwischen der Treppenstütze und der Decke den Zipfel von etwas Hellem …« Sie rempelten aneinander, als Tommaso ihn zur Seite drängte. »Dort, wo der Balken in die Wand hinein …«
Tommaso sah es schon. Ein weißer Sack, so groß wie ein Kalb. Er hing an einem zerfransten Seil, das mehrfach um einen gebogenen, rostigen Nagel in der Decke geschlungen war. Ohne auf Lorenzos respektvollen Protest zu achten, erklomm Tommaso die bröckligen Stufen und ließ sich auf die Knie nieder, um den Sack zu erreichen. Aber das verflixte Ding hing zu dicht an der Wand. Sein Talar bekam über den Knien schmierige Schmutzspuren, das war alles, was er erreichte. Er kletterte auf den Boden zurück und beäugte das Fundstück von unten.
»Es kann auf keinen Fall die Beute aus dem Kirchenraub sein. Von der Größe her nicht, und … Spinnweben und Staubflusen. Das hängt dort seit Ewigkeiten.«
Lorenzo grunzte zustimmend, ohne sich die Enttäuschung anmerken zu lassen.
»Hol’s trotzdem runter.«
Der Bargello rief nach seinen Sbirri und befahl einem von ihnen – Ernesto, einäugig, nach Knoblauch stinkend, dem zuverlässigsten seiner Leute –, einen langen Ast oder Stock zu besorgen.
Auch Ugo wagte sich endlich die Treppen hinauf. Neugierig sahen sie zu, wie Ernesto wenig später auf der Treppe kniete und nach der Schlinge angelte. Die Feuchtigkeit oder Mäuse mussten ihr zugesetzt haben, denn als ein Seitentrieb des Astes den Sack anstupste, stürzte er mit einem dumpfen Plopp zu Boden.
Lorenzo musterte die Beute so misstrauisch, als könne sie lebendig werden und ihn anspringen. Er knurrte Ernesto an, und der Sbirro zog sein Messer, um das Tuch aufzuschneiden. Er stellte sich dabei breitbeinig über den Fund, so dass Tommaso im ersten Moment nicht erkennen konnte, was da auf dem Boden lag, als der Stoff auseinander fiel. Aber er sah, wie Lorenzo sich bekreuzigte. Die beiden traten zur Seite, um ihm den Blick freizugeben.
Ein Kind mit vertrockneter Haut und spröden, tausendfach geringelten Locken von lehmgelber Farbe. Tommaso fuhr mit der Zunge über die Lippen. Die Haut sah aus, als käme sie aus der Gerberei und hatte sich straff über die Gesichtsmuskeln nach hinten gezogen. Die Augenhöhlen waren leer, und eine Ohrmuschel und die Nasenspitze fehlten. Die Lippen waren über die Zähne zurückgezogen, so dass es aussah, als grinse die kleine Leiche ihnen entgegen. Aus den Falten des breiten weißen Seidenschals, der das Kind wie eine Tunika einhüllte, rollten Käferlarvenhülsen.
»So ein Dreck. Und da denkt man, man hat alles gesehen!« Ugo ging zu einem der Fensterchen und schaute betont gleichgültig hinaus. »Der Turm liegt nicht beim Hafen, Tommaso. Die Leiche gehört dem Governatore. Das geht uns nichts an.«
Ein totes Kind. Tommaso atmete tief, um seine gereizten Magennerven zu beruhigen. Rom war eine verdorbene Stadt. Er hatte so viele tote Kinder gesehen, dass er sie nicht mehr zählte – nackte und ordentlich bekleidete, die meisten in Lumpen. Aber nie hatte er ein Kind in einem Seidenschal gesehen. »Wie lange mag es tot sein?«
»Vertrocknet wie ’n Haufen Mist in der Sonne. Da kann man nur raten«, murmelte einer der Sbirri, ein Neuer, vorwitzig. Unter Lorenzos Blick zog er den Kopf ein, aber seine Augen hingen lüstern an der Leiche.
»Ist nicht unsere Sache. Wir sind hier, um ein Kreuz zu suchen«, sagte Ugo, und einen Moment lang herrschte angespanntes Schweigen.
»Ich weiß nich …« Der Sbirro konnte den Mund nicht halten. »Ich glaub … keine Ahnung, aber ich glaub, ich kenn das Kind.« Zweifelnd kratzte er mit dem Fingernagel den Dreck hinter seinem Ohr zusammen. »Nämlich die Rose, die’s im Haar hat … die Seidenrose. Ich glaub …« Tommaso hob die Hand, um Lorenzo daran zu hindern, den Mann zu unterbrechen. »Ja, ich weiß es. Seltsam, was man so im Kopf hat. Der hat sich auf dem Campo de’ Fiori rumgetrieben. Oder doch nich? Nee, ich glaub, der Bengel war größer.«
»Der Leichnam ist vertrocknet, vielleicht ist er dabei eingeschrumpft. Äpfel schrumpfen auch«, brummelte Ugo. Der Sbirro, sichtlich geschmeichelt ob der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, nickte eifrig.
»Die Leiche ist in Seide gehüllt. War der Junge reich? Kannst du dich daran erinnern?«, fragte Tommaso.
»Weiß ich nich, aber … was andres weiß ich. Dass er nämlich Putto hieß.« Der Sbirro begann zu grinsen. »Weil er ’n kleines Ferkel war. Verzeihung, Herr. Aber ich hab’s wieder. Er war eins von den gottlosen Bälgern, die am Campo de’ Fiori für ’ne Hand voll Münzen ihren Hintern an die reichen Signori verkaufen. Putto. Ihr begreift, Herr? Den Witz?« Er nahm Tommasos scharfen Blick nicht wahr. »Glaubt mir, Herr, es is ’n Segen«, schwatzte er weiter, »dass einer den Jungen weggemacht hat, bevor er zu ’nem ausgewachsenen Strolch wurde, was ganz sicher passiert wär. Der war nämlich ’n richtiges Luder. Is hinter jedem her, auch hinter anständigen Bürgern, und hatte dabei ’n Mundwerk …«
»Sei still, der Giudice denkt nach!«, fauchte Lorenzo ihn an.
Das stimmte aber nicht. Der Giudice hatte genau zugehört. Und nun lauschte er auf das Prasseln des Regens, der auf die Holzluke im Dach trommelte wie die Schlegel eines himmlischen Tambours und an den göttlichen Zorn gemahnte.
»Wahrscheinlich hat einer der Freier den Jungen umgebracht. Das würde erklären, warum er in diesem Zeug steckt.« Ugo bequemte sich von seinem Fleck am Fenster fort und stellte sich vor die schrumplige Gestalt. Angeekelt blickte er darauf nieder. Er hatte sein Barett wieder aufgesetzt, und aus der Krempe rann in einem dünnen Rinnsal Wasser zu Boden. »Er geht uns nichts an.«
Lorenzo räusperte sich. »Soll ich den Jungen fortschaffen lassen, Giudice?«
Wenn der Tote wirklich ein Strichjunge war, gehörte er auf den Schindanger vor der Porta San Paolo zwischen die Hingerichteten und die Verblendeten, die sich mutwillig in den Tod gestürzt hatten.
»Giudice?«, wiederholte Lorenzo mit Grabesstimme.
Auf jeden Toten kam eine Schicht ungelöschten Kalks, und wenn das Loch voll war, wurde es geschlossen. Das richtige Ende für jemanden, die seinen Körper an reiche Gönner vermietete. Die Namen dieser Gönner waren dabei keineswegs unbekannt. Antonio Del Buffalo, Ascanio Caffarelli, Giovanni und Battista Capogalli … Adlige, reiche Kleriker, fast ausschließlich Leute aus gutem Haus. Sie machten keinen Hehl aus ihrer Neigung. Die Vorliebe für hübsche Jungen war eine letzte pikante Steigerung in diesem Rom, das sich an der Wiedererstehung der Antike berauschte. Für die Bücherschränke die Philosophen, für die Gärten die nackten Göttinnen – und die Putti ins private Gemach.
»Giudice …«
»Bring ihn zum Barbier«, befahl Tommaso.
»Bitte?«, entfuhr es Ugo.
»Zum Barbier oder zu einem Arzt. Man soll eine Totenschau vornehmen. Was ist? Wir haben einen Leichnam gefunden. Wir wissen nicht, woran er gestorben ist, also wird er nach dem Bando von fünfundvierzig ärztlich untersucht. Gibt’s was auszusetzen?«
»Einen Strich…?« Der Notaio verstummte. Mit verkniffenen Lippen trat er zurück und sah zu, wie das tote Kind erneut in sein Leichentuch eingeschlagen und von den Sbirri die Treppe hinuntergeschafft wurde.
Tommaso kramte den Schlüssel aus der Tasche seines Talars und schloss die Haustür auf. Er hätte sich nicht selbst mühen müssen. Er hätte mit dem eisernen Türring, der ordinärerweise die Form eines nackten Busens aufwies, gegen das Holz klopfen können, und auf das Pochen wäre Castro gekommen, sein Maestro di Casa, und hätte ihm die nassen Sachen abgenommen, trockene Kleider gebracht, nach Essen geklingelt.
Tommaso wollte nichts davon. Er öffnete sein eigenes Haus verstohlen wie ein Dieb, und als er die große Halle betrat – einen Saal, der die Hälfte des Erdgeschosses einnahm und seinem früheren Besitzer einmal als Kontor gedient hatte –, schlich er auf leisen Sohlen weiter. Der umsichtige Castro hatte eine brennende Öllampe auf dem Tischchen neben der Treppe abgestellt. Das reichte, um die Stufen der Marmortreppe zu unterscheiden, die hinauf in das Wohngeschoss führte.
Tommaso griff sich die Lampe, aber mitten auf der Treppe blieb er stehen und hob das Licht über das Geländer. Das milchige Oval des Lichts erhellte die Malereien auf den Wänden. Sein Haus war vom Vorbesitzer in Nachahmung der antiken Paläste errichtet worden, so, wie es in Rom gerade Mode war. Undeutlich konnte man auf den Fresken Bacchus und Ariadne mit flammenden Kronen erkennen. Den Gott Jupiter auf seinem Thron. Darüber etwas Symbolisches, das Tommaso für das Rad des Schicksals hielt. Auf der gegenüberliegenden Seite ruhte Venus in Begleitung verschiedener nackter Jünglinge, deren Identität Tommaso nicht kannte und die auf ihn allesamt wie eine Bande Lüstlinge wirkten. Die ganze Halle war ein einziges Gemälde, gemalt von einem Künstler, der weder ein Meister der Proportionen noch der Perspektive war und versucht hatte, diesen Mangel durch besonders grelle Farben wettzumachen.
Tommaso hatte das göttliche Spektakel nie etwas ausgemacht – bis zum Abend seiner Hochzeit, als Vittoria Gaddi zum ersten Mal den Fuß über die Schwelle seines Hauses setzte. Die Statuen zwischen den hohen Fenstern, plumplaszive Göttinnen, hatte er glücklicherweise bereits beim Einzug entfernen lassen. Und der Fußboden mit seinem schlichten schwarzweißen Mosaik war ohne Tadel. Aber die Fresken …
Er hatte seine ihm frisch vermählte Frau beobachtet und war beruhigt gewesen, sie lächeln zu sehen. Nicht nur beruhigt, das Herz hatte ihm vor Erleichterung bis zum Hals geschlagen, obwohl ein Lächeln auf dem Gesicht einer Braut, die von Dutzenden von Gästen umgeben ist, kaum Aussagekraft haben konnte. Vittoria hatte sich zu ihm umgedreht und – immer noch lächelnd – gefragt, wie der Weg zum Speisesaal sei, und nichts hatte die Katastrophe des Abends angekündigt.
Tommaso wusste, dass er sich mit der Einrichtung seines Hauses keine Mühe gegeben hatte. Der Mann, dem es ursprünglich gehörte, ein Bankier aus Siena, hatte bei seinem Umzug die meisten Möbel mitgenommen. Also hatte Tommaso Tisch und Stühle für den großen Saal gekauft und eine Kredenz, die weder zu dem einen noch zu dem anderen passte, und außerdem ein Bett und ein paar Truhen. Sonst nichts. Möbel langweilten ihn.
Als Ottavio Gaddi, sein Vorgesetzter und Freund, zu ihm gekommen war, um ihm mitzuteilen, dass er bald sterben werde und ihn zuvor mit seiner Nichte Vittoria zu verheiraten wünsche, hatte er sich notgedrungen nach weiterem Mobiliar umgeschaut. Zumindest nach dem einen, unverzichtbaren. Er hatte sein schmales Nussholzbett in das Studiolo verfrachtet und ein mit gedrechselten Säulen, Himmel und Brokatvorhängen versehenes Ehebett gekauft. Da er Vittoria niemals gesehen hatte, kannte er ihren Geschmack nicht. Als das Bett in dem Schlafzimmer mit den roten Seidentapeten zusammengebaut wurde, hatte er das Gefühl, es wäre allzu verschwenderisch mit fliegenden Schnitzgestalten und Blattgold versehen. Außerdem biss sich die Tapetenfarbe mit der der Vorhänge. Aber die Zeit drängte, denn Ottavio Gaddi ging es schlecht, und er wollte die Hochzeit unbedingt noch miterleben. Tommaso hatte sich also mit dem Gedanken getröstet, dass die Frau, die er heiratete, ihr Heim vermutlich ohnehin selbst einrichten wollte, und der Mangel an Mobiliar ihr womöglich als Präsent erscheinen würde.
Doch Vittoria hatte nichts eingerichtet.
Sie hatte ihm auch ihre Meinung zu den Schnitzengelchen nicht mitgeteilt. Als die Gäste gegangen waren, hatte sie ein paar Worte an die Dienerschaft gerichtet, danach hatte sie sich in das Schlafzimmer zurückgezogen, mit ihrer Kammerfrau geplaudert und eine Tasse Schokolade getrunken. Sie hatte ihm ein Glas Wein in den Salon gebracht und ihm einen Kuss auf das Haar gehaucht. Aber als er wenig später mit klopfendem Herzen – denn Vittoria Gaddi war wunderschön – an ihre Tür pochte, musste er feststellen, dass sie sich eingeschlossen hatte.
Zwei Wochen später hatte sie ihn verlassen. Warum? Er hatte keine Ahnung. Es war der Tag nach Gaddis Begräbnis gewesen, der Tag, an dem der Fischladen gebrannt hatte. Tommaso war völlig erschöpft nach Hause gekommen, und Castro hatte ihm die Nachricht mit einer Schüssel Aalauflauf serviert. Er war sich keiner Schuld bewusst. Er hatte sie nicht bedrängt, ihr keine Vorwürfe gemacht und sie – der Himmel bewahre – schon gar nicht geschlagen. Er hatte ihr Zeit geben wollen und den ganzen Tag in der Kanzlei verbracht. Und dennoch war sie gegangen.
Irgendwo im Garten schrie eine Katze. Es klang wie das Weinen eines kleinen Kindes, und Tommaso merkte plötzlich wieder, wie kalt ihm war. Er gab das Grübeln auf und erklomm die restlichen Stufen. Sein Bett, sein eigenes, stand mit warmem Federzeug und Kissen im Studiolo und wartete auf ihn.
Als er das oberste Geschoss erreichte, sah er, dass die Tür zum Schlafzimmer einen Spaltbreit offen stand, und augenblicklich begann sein Herz zu rasen. Castro hielt auf Ordnung. In diesem Haus waren sämtliche Türen geschlossen. Vielleicht hatte das Hausmädchen geschludert. Aber wenn nicht …
Sein Herz sprengte ihm fast die Brust. Dass Vittoria möglicherweise nur wenige Schritte von ihm entfernt atmete und unter den Decken lag, ließ seine Gedanken wirbeln. Er kannte die Gründe nicht, die sie fortgetrieben hatten, vielleicht galten sie nicht mehr, und sie war zu ihm zurückgekehrt. Vielleicht … Beschämt über seine eigene Sehnsucht, zauderte er.
Und ging dann doch nicht in das Zimmer. Sein Stolz und ein Rest Verstand verboten es ihm.
Das Mädchen hatte sein Bett im Studiolo aufgeschlagen, hatte frisches Wasser in die Messingschüssel gegossen und reine Tücher bereitgelegt. Hastig zog er sich die nassen Sachen vom Leib und blies das Ölflämmchen aus. Die Läden der Balkontür waren zurückgeschlagen, und das Mondlicht fiel durch die eisengerahmten Glaskarrees der Tür. Es zeigte ihm den Schatten seiner nackten Gestalt im Spiegel. Er betrachtete seinen krausen Haarschopf, einen voluminösen schwarzen Pelz, den kein Kamm zähmen konnte, seine scharfe, bucklige Nase, die Silhouette seines Körpers, die einen leichten Bauchansatz zeigte …
Wenn er wollte, konnte er über die Galerie gehen, die das Studiolo mit dem Schlafzimmer verband, und sich kraft seines Rechts als Ehemann überzeugen, ob Vittoria in ihrem gemeinsamen Bett lag. Und wenn sie da war … Er konnte Krach schlagen. Er konnte die Tür eintreten und sich nehmen, was ihm gehörte, und sein Dienstpersonal würde wahrscheinlich Beifall klatschen und er selbst aufhören, sich wie ein gedemütigter Esel zu fühlen.
Er tat nichts davon. Stattdessen kroch er ins Bett, zog die Federdecke bis zum Hals und verschränkte die Arme unter dem Kopf.
Sie ist zu schön, dachte er, während die Wärme allmählich seine Zehen auftaute und er durch die Glasscheiben den Mond betrachtete. Ich verfluche ihre Schönheit.
II
Tonio hockte in seinem Versteck hinter der Mauerbrüstung des verrotteten Ponte Santa Maria und kaute angespannt die rohen Ziegenhoden, wobei er immer wieder über die Mauerbrocken lugte. Er musste sich vor Lelio in Acht nehmen. Lelio tat samtweich, aber wenn er zuschlug – am liebsten in den Magen –, hatte man hinterher tagelang Bauchweh.
Im Moment drohte allerdings keine Gefahr. Lelio saß einen Steinwurf entfernt auf der Treppe, die zum Tiber hinabführte, und war mit einem einarmigen Mann beschäftigt, der ihn so stark interessierte, dass er kein Auge für die Umgebung hatte. Fürs Erste war Tonio sicher.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!