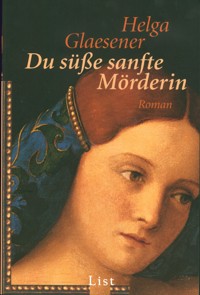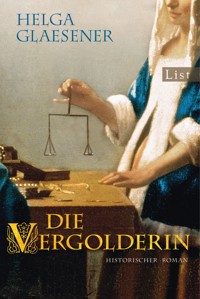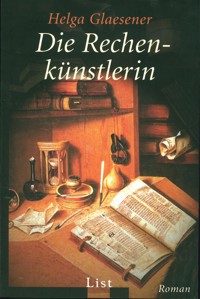7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Toskana Ende des 18. Jahrhunderts. In den sanften Hügeln, den schmalen Gässchen lauert der Tod. Die eigenwillige Florentinerin Cecilia Barghini sucht mit Enzo Rossi, Richter in Montecatini, nach dem Mörder eines Waisenkindes und gerät selbst in einen bösen Verdacht. Ihre Tätigkeit im Waisenhaus von Montecatini bringt Cecilia Barghini auf die Spur eines Mordes: Ein kleiner Junge ist unter seltsamen Umständen aus einem Fenster gestürzt. Die Leitung des Hauses will das Ereignis vertuschen. Gemeinsam mit Enzo Rossi, dem Richter der kleinen Stadt, begibt sich Cecilia auf die Suche nach dem Täter. Als sie erste Spuren finden, macht in Montecatini plötzlich ein Gerücht die Runde: Cecilia soll Gelder des Waisenhauses unterschlagen haben. Mitten in der Nacht wird Cecilia als Betrügerin verhaftet und nach Florenz ins Gefängnis gebracht. Nur Enzo Rossi steht auf ihrer Seite. Kann er ihre Unschuld beweisen und dem Mörder das Handwerk legen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Waisenhaus von Montecatini bringt Cecilia Barghini auf die Spur eines Mordes: Ein kleiner Junge ist unter seltsamen Umständen aus einem Fenster gestürzt. Die Leitung des Hauses will das Ereignis vertuschen. Gemeinsam mit Enzo Rossi, dem Richter der kleinen Stadt, begibt sich Cecilia auf die Suche nach dem Täter. Als sie erste Hinweise finden, macht in Montecatini plötzlich das Gerücht die Runde, Cecilia habe Gelder des Waisenhauses unterschlagen. Mitten in der Nacht wird Cecilia als Betrügerin verhaftet und nach Florenz ins Gefängnis gebracht. Nur Enzo Rossi steht auf ihrer Seite. Können die beiden Cecilias Unschuld beweisen und dem Kindermörder das Handwerk legen?
Die Autorin
Helga Glaesener, 1955 geboren, hat Mathematik studiert, ist Mutter von fünf erwachsenen Kindern und lebt in Aurich, Ostfriesland. Seit ihrem ersten Bestseller Die Safranhändlerin hat sie zahlreiche spannende historische Romane veröffentlicht.
Von Helga Glaesener sind in unserem Hause bereits erschienen:
Wespensommer
Wölfe im Olivenhain
Die Safranhändlerin
Safran für Venedig
Wer Asche hütet
Du süße sanfte Mörderin
Die Rechenkünstlerin
Der indische Baum
Der Stein des Luzifer
Der falsche Schwur
Im Kreis des Mael Duin
Der singende Stein
Der Weihnachtswolf
Der schwarze Skarabäus
Helga Glaesener
DasFINDELHAUS
Historischer Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0499-1
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch 1. Auflage März 2010 2. Auflage 2010 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009/List Verlag Konzeption: semper smile Werbeagentur GmbH, München Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München (unter Verwendung einer Vorlage von Zero Werbeagentur, München) Titelabbildung: © The Infant Samuel, Sant, James (1820–1916), Bury Art Gallery and Museum, Lancashire, UK, View Over Florence, Rottmann, Carl (1797–1850) Hamburger Kunsthalle, Hamburg; beide Bilder Bridgeman Art Library
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Für Anne,
die die Nachbarstadt im Land der Phantasie bewohnt.
PROLOG
MONTECATINI, TOSKANA, MÄI 1782
Guido Bortolin trank den letzten Schluck des Tages immer auf der Holzbank vor seiner kleinen Hütte. Er liebte den toskanischen Himmel, der ihn und sein Heim nachts mit einer blauen Decke voller funkelnder Sterne bedeckte. Er liebte den Geruch der Kräuter und Wildblumen, die im hinteren Teil des Waisenhausgartens wucherten. Er liebte das Konzert der Grillen und sogar die emsigen kleinen Mücken, die ihn niemals stachen, weil sie wussten, dass er ebenfalls einer von den Emsigen war. Gott meinte es gut mit ihm.
Zufrieden schaute der Gärtner zu den Bohnenbeeten, mit denen er die Waisenkinder ernährte, und dann wieder zum Himmel. Er war angenehm betrunken, und auch das gefiel ihm. Salute!
Als ihm kalt wurde – es ging bereits auf Mitternacht zu – stand er auf. Zeit zum Schlafen, dachte er mit einem gemütvollen Gähnen, aber die Düfte der Nacht verführten ihn noch zu einigen Schritten. Liebevoll streichelte er die gelben Blüten des Besenginsters und schaute nach den beiden kleinen Pfirsichbäumen, die er im vergangenen Jahr gepflanzt hatte und die ihm den Mist aus der Abortgrube mit einem prächtigen Wuchs dankten.
Und dann sah er die Frau.
Sie kam aus dem westlichen Teil des Gartens, wo nichts als Unkraut spross, weil der Boden für Gemüse zu steinig war. Weiße Kleider bedeckten ihren Körper, und ihr Gesicht war hinter einem ebenfalls weißen Schleier versteckt. Entsetzt tastete Guido nach dem Pfirsichstämmchen, um sich festzuhalten. Er zwinkerte.
Als sein Blick wieder klar wurde, war die Frau verschwunden. Der Wein, dachte er benommen, dieser verflixte Wein! Er wollte schon kehrtmachen, aber da merkte er, dass die Frau nur einige Schritte weitergegangen war. Auf das Haus zu. Der Wind blähte die Schleier, und sie wirkte hell und strahlend vor den schwarzen Büschen, und das Licht, das sie trug, flackerte im Mondschein.
Nun packte ihn die Angst. Er war ja nicht dumm. Er wusste, was hier los war. Großtante Duilia hatte oft genug davon erzählt – nachts, wenn er bei ihr im Bett lag. Sie war eine Dame von enormer Fülle gewesen, und an ihren weichen Leib gebettet hatte er die Geschichten von Rachele, der Kindesmörderin, geliebt. Aber jetzt, als er hier stand, fuhr ihm die Angst wie ein Blähfurz durch den Leib.
Benommen sah er zu, wie die Weiße auf den schmalen Wegen zwischen den Beeten zu der schäbigen Villa schwebte. Sie kannte sich aus, natürlich. Schließlich hatte sie hier gelebt. Als Kind und später als junge, verheiratete Frau. Ihr Ehemann hatte darauf bestanden, dass sie im Haus ihrer Eltern wohnen blieb, weil er sich vor ihr fürchtete, wie Großtante Duilia erzählte.
Dort oben in dem Turm, der an den westlichen Teil der Villa angebaut war, hatte man ihr ein Zimmer eingerichtet, das sie nicht verlassen durfte, denn sie war ein bösartiges Geschöpf, das die Bediensteten erschreckte und quälte. Besonders die Kinder. Weil Kinderchen unschuldig sind, hatte Tante Duilia erklärt, und das Böse hasst die Unschuld. Ihrem Reitburschen hatte sie mit der bloßen Faust das linke Auge ausgeschlagen. Und dem Küchenmädchen kochende Ribollita über die Brust gegossen, woran das arme Wesen später auch gestorben war.
Und jetzt ging sie zu ihnen. Zu den Kinderchen, die dort im Haus arglos in ihren Strohbettchen lagen und schliefen.
Guido merkte, wie ihm die Flasche aus der Hand glitt. Jede Faser seines Körpers sehnte sich zurück zur Hütte, er wollte unter die rote Wolldecke kriechen, sich das Kissen unter die Wange stopfen und alles vergessen.
Stattdessen verharrte er auf seinem Platz zwischen den Pfirsichbäumchen und stierte zum Haus hinüber. Rachele hatte ihr Kind mit in den Turm nehmen müssen, denn der Vater hatte sich von einem Säugling, den sie pflegen musste, eine Verbesserung ihres Zustandes erhofft. Erweichte das Lachen eines Kindes nicht jeder Mutter Herz? Doch dann hatte die Amme Rachele dabei erwischt, wie sie den Jungen ersticken wollte. Allerdings hatte sie der Herrschaft nichts davon berichtet, weil sie fürchtete, für ihre Unachtsamkeit gescholten zu werden.
Ich bin achtsam, dachte Guido mit einem kalten Schauer auf dem Rücken. Aber ich laufe auch nicht los und reiße Assunta aus dem Schlaf. Erschrocken stand er da und wurde Zeuge, wie Rachele die kleine Tür des Dienstboteneingangs öffnete. Sie verschwand, und mit ihr die Lampe.
Guido wandte den Kopf und schaute zu den Turmfenstern, überzeugt, dass hinter ihnen das Licht wieder auftauchen würde, wenn Rachele den Raum erreichte, in dem sie ihr Kindlein schließlich ermordet hatte.
Doch die kleinen Wanddurchbrüche blieben dunkel.
Guido bückte sich langsam und hob seine Flasche auf. Er hatte Mühe, zu seiner Hütte zurückzufinden, verstört und betrunken, wie er war. Als er zu dem Besenginster kam – dem letzten Ort, von dem aus man freie Sicht auf die Villa hatte – entdeckte er den Lampenschein erneut. Die Flamme war nicht zum Turm gewandert, sie irrlichterte durch den Schlafsaal der Buben.
Seine Augen weiteten sich, als ihm klar wurde, was das bedeutete.
1. KAPITEL
Ich bin eine jämmerliche Heuchlerin, dachte Cecilia Barghini, während sie missmutig neben ihrer ältlichen Verwandten Rosina durch die Gässchen von Montecatini schritt, um das Waisenhaus des Städtchens aufzusuchen. Konnte es etwas Jämmerlicheres geben, als eine Wut auf Waisenkinderchen zu haben, die hungerten und sich wegen der Krätze die Haut blutig rubbelten und husteten und spuckten und unbeweint auf ihren Strohmatten dahinstarben?
Sie selbst führte ein bevorzugtes Leben. Ihre wohlhabende Großmutter hatte sie in Florenz zu einer Dame erzogen. Und nun – nach einer geplatzten Verlobung und dem stürmischen Zerwürfnis mit Großmutter – lebte sie in Montecatini und kümmerte sich um die Tochter des Stadtrichters. Das war vielleicht nicht der brillante Lebensweg, den Großmutter für sie geplant hatte, aber sie mochte Giudice Rossi und die kleine Dina, und in jedem Fall war sie tausendmal besser dran als die armen Dinger im Waisenhaus. Schrecklich, dass sie ihnen nicht mehr Anteilnahme entgegenbringen konnte.
»Ich wünschte, wir hätten schon Nachmittag«, rief sie in Rosinas Ohr, um sich in dem Stimmengewirr verständlich zu machen, das auf der Straße herrschte. »Ich wünschte, ich müsste nicht zur Komiteesitzung, und ich wünschte … Ach, ich bin schrecklich!«
»Was sagst du, Liebes?« Zerstreut fasste die alte Dame nach Cecilias Hand. Es war ein Maitag im Jahre 1782. Über Montecatini strahlte ein nahezu weißer Himmel, und im Stoff ihrer Sonnenschirme fingen sich die Blumendüfte aus den Gärten. Das Städtchen platzte schier aus den Nähten. Jedermann schien Einkäufe erledigen zu müssen oder wollte jemanden besuchen oder einen Stoffballen oder Holzgitter transportieren. Rosinas Augen leuchteten, während sie die Leute beobachtete, und manchmal kicherte sie. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens in einem Stift für mittellose Damen verbracht, was entsetzlich öde gewesen musste. Als Cecilia ihr die Stelle einer Gesellschafterin anbot, hatte sie ihr Glück kaum fassen können. Du bist ein Engel, mein Schatz – das war der Satz, den sie pausenlos wiederholte.
Aber auch diese gute Tat war eigentlich heuchlerisch gewesen: Cecilia benötigte eine Anstandsdame, damit es in der Gesellschaft von Montecatini kein Geschwätz darüber gab, dass sie allein in ihrer Wohnung lebte. Und sie hatte Rosina ausgewählt, weil die alte Frau keine Fragen stellte und sich nicht in ihr Leben einmischte. Keine Zuneigung unter Verwandten, wie Rosina fest glaubte. Reiner Eigennutz.
Nun ja, dachte Cecilia und drückte mit einem wehmütigen Lächeln die Hand der alten Frau, inzwischen vielleicht schon ein bisschen Zuneigung.
Sie wichen einem Esel aus, der einen hundertmal geflickten Sack schleppte, und dann einem trüben Rinnsal, das sich aus einem Hauseingang ergoss. Als sie in ein Seitengässchen abbogen, wurde es ruhiger. »Ich wünschte, ich könnte die Kleinen so gern haben wie du«, sinnierte Cecilia. »Im Ernst, Rosina. Sie haben jemanden verdient, der sich wirklich Sorgen um sie macht, den es kümmert, was mit ihnen geschieht. Der ihre Namen kennt und …«
»Aber Liebes, was redest du denn? Du sorgst doch für sie wie ein Engel! Bedenke nur, sie werden Hüte bekommen. Wie richtige Jungen und Mädchen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn du Signora Macchini nicht überredet hättest, ihr Service mit den indianischen Blumen für die armen Würmchen zu spenden. Du bist wunderbar, nur dass du zu viel grübelst.« Rosina drückte Cecilias Hand in stürmischer Zärtlichkeit.
Was Cecilias Bemühen beim Sammeln von Spenden für das Waisenhaus anging, hatte die alte Dame allerdings recht: Die neuen Kittelchen und Decken – und natürlich die Hüte, wenn man Signora Secci tatsächlich zu solch einem ungewöhnlichen Kauf überreden konnte – waren ihr Verdienst. Es verging keine Woche, in der sie nicht in irgendeinem Salon stand, um der Hausherrin ein paar Scudi für das Waisenhaus abzuschwatzen. Ihre Leibchen sind zu dünn. Sie husten sich die Seele aus dem Leib, die armen Kinderchen … Aber ich gehe nicht in ihre Schlafräume, ich streichle ihnen nicht über die struppigen Köpfe und weigere mich, in ihre Gesichter zu sehen. Wenn das keine Heuchelei ist!
Sie hatten die kleine Straße, in der sich das Waisenhaus befand, erreicht. »Meinst du, es ist genug?« Besorgt hob Rosina das Tuch von ihrem Korb, in dem sie das Gebäck für die Waisenkinder trug. Cecilia verkniff sich ein Lächeln, als sie sah, wie die alte Frau schneller ging und schließlich auf den Rasen lief und die kleinen Lumpengestalten um sich scharte. Plappernd und lachend verteilte sie ihre Köstlichkeiten, und ein Mädchen rieb die Wange am Seidenstoff ihres Kleides.
Rasch wandte Cecilia sich zu dem Weg, der um das Haus herumführte. Der Eingang zum Stiftungssaal lag im hinteren Teil des Grundstücks, dort, wo sich der verwilderte Garten ausbreitete. Sie blieb stehen, als sie das wadenhohe Gras mit den roten Tupfern aus Kronenwindröschen und Spargelbohnen erreichte. Wieder einmal bedauerte sie, dass es unmöglich war, diesen Teil des Grundstücks zu verkaufen, um mit dem Erlös das Waisenhaus zu renovieren. Aber diese Möglichkeit war von der Familie, die vor einem halben Jahrhundert ihr nobles Wohnhaus den Waisen geschenkt hatte, in der Stiftungsurkunde ausdrücklich verboten worden.
Cecilias Blick schweifte zur Tür.
Ich gehe hinein, und ich komme wieder heraus – zwei Stunden meines Lebens, mehr ist das nicht, dachte sie und hoffte von Herzen, dass die Säuglinge schliefen. Denn deren Greinen würde sie unweigerlich an das Kind erinnern, das zwei Jahre zuvor in ihrem eigenen Leib gestorben war. Durch ihre Torheit. Weil sie nicht bedacht hatte, dass ein zu eng geschnürtes Mieder ein Ungeborenes umbringen konnte. Sie hasste das gelbe Haus und die Sitzungen und die Kinder und die Hemdchen, die im Garten auf der Wäscheleine flatterten, weil all das sie an ihre Schuld erinnerte. Ich hasse meine eigene Sünde, dachte sie unglücklich.
»Scusi, Signorina.«
Erschreckt fuhr sie herum. Vor ihr stand der Waisenhausgärtner. Guido Bortolin, zehn Scudi Lohn, dachte sie mechanisch. Dazu Kost und Unterkunft. Unentbehrlich, wenn die armen Würmer nicht verhungern sollten, denn er senkte die Verpflegungskosten um ein respektables Drittel, indem er die Bohnen anbaute, mit denen jedes Essen gestreckt wurde.
»Ja bitte?« Sie merkte selbst, wie ungeduldig ihre Stimme klang.
Der Mann nahm die Mütze ab und klemmte sie unter seinen Arm. »Ich will es jemand sagen!« Er wartete offensichtlich auf eine Antwort.
»Gewiss, Guido, nur … worum geht es denn?«
»Dass Sie etwas tun müssen, scusi, Signorina. Sie und die anderen Damen. Zum Schutz der Kinderchen.« Seine dicken Lippen blähten sich, während er sie anstarrte. Er war nicht schwachsinnig, auch wenn manche Menschen es befremdlich fanden, dass er seinen Gemüsebeeten Frauennamen gab. Der Salat kommt von Letizia, wenn’s recht ist … Felicita gibt fade Petersilie … Er hatte die Beete mit Frauennamen belegt, weil sie wie Frauen unterschiedlichen Grillen nachhingen. Felicita vertrug kein Geröll, Delia soff, Letizia gedieh nur mit Schweinepisse …
»Warum müssen wir etwas zu ihrem Schutz tun, Guido?«
»Weil sie zurückgekehrt ist. Rachele. Das ist es. Sie ist aus ihrem Grab raus und gewandelt. Hier im Garten. Und es ist nur noch drei Wochen hin. Dann sind die sechsundsechzig Jahre um.«
Ratlos schaute Cecilia in das faltenzerfurchte Gesicht.
»Und dann wird sie’s wieder tun«, erklärte der Mann, er wurde langsam ungeduldig. »Donnerstag in drei Wochen. Das ist der Tag, wo sie ihr Kind umgebracht hat. Sie hat es aus dem Fenster geworfen. Da, aus dem Turm.«
»Wer hat jemanden aus dem Fenster geworfen?«
»Rachele. Die Kindsmörderin. Am Donnerstag in drei Wochen ist es sechsundsechzig Jahre her. Dann ist der Jahrestag, und dann wird sie es wieder …«
»Guido …«
»Geht mich nichts an, Signorina, weiß ich selbst. Ich wollt’s nur sagen. Dass ich sie gesehen habe. Und dass es nur noch drei Wochen und zwei Tage hin ist. Sind doch auch Geschöpfe Gottes, die Kinderchen … hinter all der Blödigkeit … nach meiner Meinung … scusi … Bin ja nur ein dummer alter Gärtner … Was weiß schon ein Gärtner …« Guido strich sich die schmierigen weißen Haarsträhnen hinters Ohr, setzte die Mütze wieder aufs Haupt und kehrte beleidigt zum Flieder zurück. Verdutzt starrte Cecilia ihm nach.
Es dauerte zwei Stunden, ehe die Frage der Hüte entschieden war. Es würde keine Hüte geben. Signora Secci, die resolute Leiterin des Waisenhauskomitees mit einer Neigung zu gelben Kleidern, in denen sie wie eine Bonbonniere aussah, hielt nichts davon, die Kinder zu verzärteln – ganz gleich, wie billig die Hüte erstanden werden konnten. Man musste die armen Würmchen auf ihr hartes Leben vorbereiten, damit sie es in Gottesfurcht durchstehen konnten. Hüte leisteten dabei keinen Nutzen. Als Cecilia das Waisenhaus wieder verließ, drehte sich ihr der Kopf.
Sie und Rosina erreichten den Marktplatz, als die Glocke von San Pietro gerade zwölf schlug. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sofort in den Palazzo della Giustizia zu eilen, das schäbige graue Gebäude in der Ecke des Platzes, in dem Enzo Rossi mit seiner Tochter wohnte. Sie hatte für Dina einen Stundenplan erstellt, und für die Zeit bis zum Mittagessen war Französischunterricht vorgesehen. Aber nun zögerte sie. Das Gericht tagte – und wie immer, wenn das Wetter es zuließ, bei geöffneten Türen.
Rosina zupfte an ihrem Ärmel.
»Ich weiß«, flüsterte Cecilia. »Lass uns einen Moment zuschauen.«
Sie liebte diese Prozesstage. Besonders seit Zaccaria – der Bauer mit dem polternden Sinn für Gerechtigkeit, den die Montecatiner zum Assessore des Richters gewählt hatten – die Kunst des Lesens beherrschte. Möglichst beiläufig tat sie einige Schritte, um in den Hort der Gerechtigkeit zu spähen. Die Gerichtsverhandlungen fanden im ehemaligen Theater von Montecatini statt, einem Gebäude mit Zuckergussfassade und einem martialischen Zinnenkranz, das direkt an das Wohnhaus des Richters grenzte.
Rossi, mager, mit schwarzen gewellten Haaren, in denen sich erste Geheimratsecken zeigten, saß in seiner roten Robe hinter dem Richtertisch. Rechts von ihm blätterte Zaccaria in der Kurzfassung der toskanischen Gesetze, zu seiner Linken gähnte Signor Secci, der Ehemann der Komiteevorsitzenden, die den Waisen gerade die Hüte verweigert hatte. Er langweilte sich unverhohlen und bedauerte wahrscheinlich wieder einmal, dass er nicht eiserner widerstanden hatte, als die Montecatiner ihn zum zweiten Assessore wählten. Er war Bankier, und auch seine Bankgeschäfte ließ er lieber von seinen Angestellten erledigen.
Ein Dutzend Zuschauer lungerten auf den Bänken im Teatro, andere hatten sich Stühle vom gegenüberliegenden Kaffeehaus ausgeborgt und verfolgten die Versammlung vom Marktpflaster aus, wo ihnen die Maisonne ins Gesicht schien. Das ungewohnt zahlreiche Publikum ließ vermuten, dass entweder der Gegenstand der Verhandlung oder die beiden streitenden Parteien von Interesse waren.
»Was hat das mit den Kerzen zu tun?«, dröhnte Rossis Stimme über den Platz. Die Lammsgeduld, die er sich aufzuerlegen suchte, verdeckte nur kümmerlich seine Gereiztheit. Er war ein kluger Mann mit einem enormen Gedächtnis und rascher Auffassungsgabe, und jede Art von Umständlichkeit reizte ihn aufs Blut.
»Ihre Zahl. Die Zahl der Kerzen.« Zaccaria hatte Mühe, die Stelle in seinem Gesetzbuch zu finden.
»Was ist damit?«
»Filippo hat gesagt, dass er zwölf Kerzen gestiftet hat. Darüber gibt es …« Die Prozedur des Lesens nahm Zeit in Anspruch. Der Bauer hielt inne, leckte den Zeigefinger und blätterte weiter.
Cecilia sah, wie Rossi mit den Fingern auf der Tischplatte trommelte.
»Wer dem Esel das Tanzen beibringt«, rief einer der Zuschauer, und die Leute lachten.
»Wie flegelhaft. Man darf doch nicht lachen, wenn das Gericht tagt«, entrüstete sich Rosina im Flüsterton.
»Hier! Acht Kerzen höchstens! Zwei große und sechs kleine.« Zaccaria schloss das Buch, seine Faust krachte auf den Buchdeckel. »Begreift ihr das?« Er ließ den Blick über die Zuhörerschaft schweifen, die natürlich gar nichts begriff und ihn erwartungsvoll anglotzte. »Der Granduca hat ein Gesetz erlassen, das bestimmt, wie viele Kerzen in welchen Gottesdiensten erlaubt sind. Bei einer Trauerfeier nicht mehr als acht. Aber als Giulia – Gott segne die Gute – unter die Erde kam, haben zwölf Kerzen gebrannt. Das war übrigens anständig von dir, Filippo. Nicht jeder handelt so, wenn sein Weib im Sarg liegt, wo es nicht mehr keifen kann«, lobte Zaccaria den Angeklagten, einen kleingewachsenen Mann mit krummem Rücken und Stoppelbart. »Aber …«
»Sie hat die zwölf Kerzen verdient«, unterbrach Filippo ihn bedachtsam. »Zwölf Kinder in vierzehn Jahren – und alle am Leben gehalten. Für jedes Kind ’ne Kerze, hab ich mir gedacht. Wenn ich auch nicht weiß …«
»… wie du deine mutterlosen Kinder durchbringen sollst.«
»Wie ich das bezahlen soll, wollt ich eigentlich sagen.« Filippo wischte die Hand am Hosenboden ab, verlegen wegen der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. Zaccaria nickte ihm ermutigend zu. Ein Blick von Mann zu Mann, von Hungerleider zu Hungerleider, obwohl es ihm selbst gar nicht schlechtging. Er war ein tüchtiger Bauer.
Nun wandte Zaccaria sich wieder ans Publikum. »Liebe Leute, jemandem wie Padre Ambrogio, der von unseren Steuern ernährt wird und sich um niemanden als sich selbst kümmern muss, kann es natürlich gleich sein, wenn Filippos arme Kinder vor Hunger weinen …«
Der junge Priester, offenbar der Kläger, zuckte zusammen. Er war selbst so arm wie die sprichwörtliche Kirchenmaus, und dass der Kerzenzieher von ihm sein Geld wollte, konnte man ihm kaum zum Vorwurf machen.
Filippo mochte das auch begreifen, denn er erklärte: »Einen Scudo zahl ich, aber mehr kann ich nicht. Ehrlich.«
»Und genau das mein ich, Mann …«
Rossi hatte genug von der Lammsgeduld. Er legte seinem Beisitzer die Hand auf den Arm. »Du hast zwölf Kerzen bestellt, du bezahlst sie, Filippo.«
»Oder auch nicht.« Zaccaria packte wieder sein Buch und hielt es siegessicher in die Höhe. »Worauf es ankommt, ist Folgendes: Du hast den Padre zwölf Kerzen anzünden lassen. Ergo …« Das lateinische Wort, das er von Rossi aufgeschnappt hatte, glitt wie Rosenwasser über seine Lippen. »Ergo ist die Trauerfeier ungesetzlich gewesen, nach dem Buchstaben des Gesetzes. Ergo musst du nicht zahlen, denn niemand kann von dir erwarten, dass du Geld hinlegst für was Ungesetzliches. Das würde dich ja direkt zum … zum Komplizen machen. Du darfst das gar nicht!«
»Aha«, sagte Rossi.
Zaccaria gefiel dieses Aha nicht. Den Zuschauern ebenso wenig. Man konnte sehen, dass die Beweisführung des aufmüpfigen Bauern sie bezauberte. Außerdem gehörte es zum guten Ton, gegen die Ansprüche der Kirche zu rebellieren, seit der Granduca ihr ein Recht nach dem anderen beschnitt.
»Cecilia …«, wisperte Rosina.
»Psst, nur noch einen Augenblick.«
»Da wir uns gerade mit den Gesetzen befassen«, sagte Rossi. »Paragraph vier-sieben-drei: Die Richter sollen nach dem wahren und allgemeinen Verstand der Worte des Gesetzes verfahren und unter keinem erdenklichen Vorwand eines Unterschieds zwischen dem Wort und dem Sinn des Gesetzes von der klaren Vorschrift dieser Gerichtsordnung abweichen.«
»Paragraph vier-drei-sieben von was?«, wollte Zaccaria wissen.
Rossi machte einen tiefen Atemzug. Einen Moment lang schwieg er, dann sagte er: »Du zahlst, Filippo. Das war’s! Basta.«
»Aber …«, wandte Zaccaria ein.
»Und du – reg mich nicht auf. Der Nächste. Vincenzo Mughini …«
Mit einem leisen Lachen ergriff Cecilia Rosinas Arm.
»Das mit Filippo ist nicht richtig«, meinte Dina, als die Familie abends im Speisezimmer des Palazzo della Giustizia die gemeinsame Mahlzeit zu sich nahm. Rossis Tochter war im vergangenen Monat elf Jahre alt geworden. Ihr schmales Äffchengesicht wirkte noch eckiger als früher, und die dürre Gestalt war in die Höhe geschossen. Nicht einmal der freundlichste Betrachter, dachte Cecilia bekümmert, kann in diesem Persönchen Anzeichen aufblühender Schönheit entdecken. Was für ein Jammer, dass sie im Aussehen nach dem Vater kam. Ihre Mutter Grazia, Cecilias verstorbene Cousine, war eine Schönheit gewesen. »Es ist gemein, dass seine Kinder hungern müssen«, erklärte Dina mit vollem Mund.
»Zunächst einmal schluckst du, bevor du sprichst, und dann: Dein Vater«, Cecilia betonte das letzte Wort, »muss das Gesetz vertreten. Er kann nicht richten, wie er will. Das hat Zaccaria nur noch nicht verstanden. Und … woher weißt du überhaupt, was dieser Filippo … Bist du draußen herumgestromert?«
»Sie haben doch gesagt, ich soll auf Sie warten. Aber dann sind Sie nicht gekommen, und da bin ich auf den Markt gegangen. Und da Sie noch zu tun hatten, hab ich mir’s angehört«, sagte Dina und gab sich keine Mühe, ihr Lachen zu verbergen.
Rossi, der die Käsekräutersuppe löffelte und dabei seine Juristenzeitung studierte, zog amüsiert die Augenbrauen hoch.
Für Dina war das natürlich ein Zeichen der Ermutigung. »Wer die Waisen betrübt, soll einen Stein um den Hals gebunden bekommen und im See versenkt werden. Das hat Jesus gesagt«, erklärte sie kühn.
»Im See versenken, ja?« Rossi legte seine Zeitung beiseite. »Der Kerzenzieher hat nur fünf Kinder, aber die will er auch satt bekommen.«
»Dann muss er mehr arbeiten.«
»Er arbeitet so viel, wie er kann.«
»Aber Filippos Kinder haben keine Mutter mehr. Und sie haben auch keine Kleider und nichts zu essen.« Das Letztere war Spekulation und wurde deshalb mit besonderem Nachdruck vorgetragen.
»Vielleicht hätte Filippo gut daran getan, in diesem Fall zwölf Kittel statt zwölf Kerzen zu kaufen?«, schlug Rossi vor.
»Filippo …« Dina zerbrach sich den Kopf, aber es fiel ihr nichts mehr ein, was sie zugunsten ihres Schützlings hätte vortragen können. »Jedenfalls werde ich ihn und seine Kinderchen besuchen und ihnen Kekse aus der Küche bringen. Und das darf ich, weil es mildtätig ist. Und deshalb gehört sich’s«, behauptete sie frech.
»Und über das, was sich sonst noch gehört, wirst du für den Rest des Abends in deinem Zimmer nachdenken.« Cecilia wies zur Tür. Sie sah zu, wie Dina mit einem Lachen hinausrannte – nicht im Geringsten unglücklich darüber, der langweiligen Tischrunde zu entrinnen.
»Und was ist so lustig?«, fragte Cecilia.
Rossi zwinkerte ihr zu. »Ich gratuliere dir. Prachtvolle Arbeit.«
»Sie weiß, bei wem sie sich so etwas erlauben kann.«
»Tatsächlich?« Er amüsierte sich immer noch.
»Kinderlachen – Freud im Haus«, nuschelte Rosina mit halbvollem Mund und schielte zur Suppenterrine. Sie versuchte wenig zu essen, wie es einer Dame anstand, aber ihr Appetit war ungeheuer. Cecilia argwöhnte, dass die Bewohnerinnen des Stifts, in dem sie ihr halbes Leben zugebracht hatte, gehungert hatten.
Gutgelaunt schöpfte Rossi der alten Dame nach. »Und wie beurteilt der Rest des Hauses das Verfahren?«, fragte er Cecilia über die Terrine hinweg.
»Filippo kann nichts dafür, dass er dumm ist. Er tut mir leid.«
»Das ist anständig gedacht, nur leider ohne Bedeutung für das Urteil. Aber wenn es dich tröstet … Er braucht keine Steuern zu bezahlen. Das ist ein neues Gesetz des Granduca. Wer mehr als zwölf Kinder hat, wird von den Steuern befreit. Mit dem Geld, das Filippo dadurch spart, kann er die Kerzen bezahlen. Und das – versteh mich bitte recht – ist keine Freundlichkeit, mit der ich das Gesetz aushebeln will, sondern ein Glücksfall für ihn.«
»Hast du ihm seinen Glücksfall erklärt?«
»Natürlich.«
»Warum hast du es nicht gleich während der Versammlung getan? Dann hätten die anderen Leute auch etwas davon gehabt, und alle wären zufrieden gewesen.«
»Hm.« Sie sah, wie Rossis Miene sich verdüsterte. Er griff nach seiner Zeitung, faltete sie neu und legte sie wieder neben seinen Teller. »Wie es aussieht, hatte ich in der Verhandlung Besuch.«
»Was für Besuch?«
»Ein junger Mann. Pockennarben im Gesicht, und an der linken Hand fehlt ihm ein Finger. Ich kenne ihn. Einer von Tacito Luporis Sbirri. Ich habe ihn ein paar Male in Buggiano getroffen.«
»Pocken sind schlimm«, nuschelte Rosina, schon nicht mehr ganz nüchtern.
Rossi hob sein Glas und prostete ihr lächelnd zu.
»Und was wollte er?«, fragte Cecilia beunruhigt.
Rossi seufzte. Er stand auf, ging zum Fenster, verschränkte die Arme über der Brust und blickte hinaus. Seine gute Stimmung war wie fortgeblasen. »Ich denke einmal… vielleicht … Munition für einen Krieg sammeln?«
Krieg, dachte Cecilia, ja. Giusdicente Tacito Lupori, Rossis Vorgesetzter, der die höchste Gerichtsbarkeit über das Valdinievole-Tal ausübte, war ein lächerlicher Mann. So sah er aus, so hatte Cecilia ihn eingeschätzt, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte mit der parfümierten Perücke und seinem übertrieben feinen Justaucorps mit dem angesteckten Blumensträußchen, das er trug wie andere einen Orden.
Inzwischen wusste sie, dass er alles andere als lächerlich war. Wie Rossi kam er aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hatten beide durch das Genieexamen, mit dem der Granduca die Klügsten seines Volkes förderte, die Möglichkeit bekommen zu studieren. Aber im Gegensatz zu Rossi war Lupori dadurch nicht glücklich geworden. Er wurde von einem krankhaften Ehrgeiz zerfressen, der sich aus Gründen, die sie nie ganz verstanden hatte, besonders an seinem Kollegen rieb.
»Ist es dir recht, Liebes, wenn ich in der Küche nach dem Rechten sehe?« Rosina riss Cecilia aus ihren Gedanken. Wenn man es genau nahm, schickte es sich nicht, dass sie Cecilia mit dem Giudice allein ließ, aber sie nahmen es alle nicht genau, und so huschte die alte Frau hinaus, um die Reste der Käsesuppe aufzuessen.
»Der Mann hasst mich«, meinte Rossi vom Fenster her düster. »Frag mich, was ihn treibt – ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er niemals Ruhe geben wird. Er kriecht mit Stielaugen über mir und sucht nach einer ungeschützten Stelle, um zuzuschnappen. Findest du, dass ich übertreibe? Herrgott, mir ist, als hätte ich ständig eine Wespe auf der Haut.« Wieder schaute er zum Fenster hinaus, mit schmalen Lippen, voller Sorge.
»Wie sollte er es gegen dich ausnutzen können, wenn du den Leuten ein Gesetz erklärst?«
»Kann er nicht. Das ist es ja. Der Kerl hat mich so weit, dass ich zucke, noch bevor er zuschlägt.«
»Und nun?«
»Weiß ich auch nicht. Ich verhandle inzwischen so korrekt, dass jeder meiner Prozesse in die Paradigmensammlung des Granduca eingehen könnte. Warum schickt er mir immer noch seine Spitzel?«
»Um zu piken?«, schlug Cecilia vor.
Rossi zuckte die Schultern und schwieg. »Wollen wir fortgehen?«, sagte er plötzlich. Die Frage war wohl nicht als Scherz gemeint – dazu schaute er sie zu aufmerksam an.
»Wohin?«
»Man hat mir eine Stelle in Collodi angeboten.«
»Davonlaufen?«
»Es gibt Hunde, die lassen nicht mehr los, wenn sie sich festgebissen haben – du kannst auf sie einprügeln, du kannst sie totschlagen. Es nutzt nichts. So einer ist Lupori.«
»Davonlaufen?«, wiederholte Cecilia entrüstet.
Er musste lachen. »Wir lassen uns also nicht den Schneid abkaufen?«
»Auf keinen Fall. Nicht von diesem Mann. Was ist los mit dir, Giudice Rossi? Wo bleibt deine Courage?«
»Courage ist leicht, wenn man nur auf sich selbst zu achten hat.« Er errötete plötzlich und blickte wieder zum Fenster hinaus.
Cecilia betrachtete ihn, und eine Welle von Zärtlichkeit durchflutete sie. Seine ewig unordentlichen Haare, die abgewetzte Weste, die er trug, weil es ihn nicht kümmerte, was für eine Figur er abgab, die langen, schmalen Hände, die Gesetzestexte kommentierten und Urteile schrieben und mit denen er sich auch schon geprügelt hatte, als es nicht anders ging … Was für ein Mensch, dachte sie liebevoll.
Wie lange arbeitete sie nun in seinem Haushalt? Anderthalb Jahre? Zwei Heiratsanträge hatte er ihr in dieser Zeit gemacht, und sie hatte beide Male abgelehnt, weil sie in Situationen kamen, in denen sie nach Mitleid schmeckten. Stattdessen hatte sie ihre eigene Wohnung bezogen, um jedem Gerücht, sie wäre etwas anderes für den Giudice als eine selbstlose Verwandte, die ihm bei der Erziehung des Kindes half, den Boden zu entziehen. War sie zu stolz? Zu dumm?
Sie wollte etwas sagen, aber in diesem Moment kam Anita herein, um die Teller abzuräumen. Die junge Köchin schepperte mit dem Geschirr und machte Vorschläge, die einen Seeteufel in Weißwein betrafen, und als sie wieder ging, war der Zauber des Augenblicks verflogen.
»Wusstest du, dass Luporis Frau Mitglied des Waisenhauskomitees ist?«, fragte Cecilia.
»Kein Wunder. Der Mann poliert seine Kutsche und seine Jackenknöpfe. Da muss natürlich auch die Signora glänzen.«
»Aber das tut sie nicht.« Cecilia war verblüfft, als sie merkte, wie schwer es ihr fiel, das Bild von Silvia Lupori vor ihrem inneren Auge heraufzubeschwören. Sie war eine blasse Erscheinung, dünn und hochgewachsen – daran konnte sie sich erinnern. Doch schon bei der Farbe ihres Haares wurde sie ratlos. Kleidete Silvia sich modisch? Auf keinen Fall so elegant, dass es auffiel. Wie klang ihre Stimme? Sie wusste es nicht. »Jedenfalls tut sie sich nicht hervor. Ich könnte nicht einmal sagen, ob ich sie heute bei der Komiteesitzung gesehen habe. Ob ich versuchen sollte, eine Freundschaft mit ihr zu beginnen?«
»Lass die Finger von den beiden«, sagte Rossi, und seine Stimme klang noch dunkler als gewöhnlich.
Silvia Luporis Haar war blond, jedoch so ausgetrocknet, dass es einen spinnwebenartigen Silberton angenommen hatte. Das stellte Cecilia drei Wochen später bei der nächsten Sitzung des Waisenhauskomitees fest.
Signora Secci hatte ihre Mitstreiterinnen zu Zimtkonfekt eingeladen, weil sie der Meinung war, dass der selbstlose Dienst der Barmherzigkeit einen Moment des Innehaltens brauchte, damit die Kräfte nicht erlahmten. Sie hatten sich im Boudoir des Waisenhauses getroffen, nun saßen sie in kleinen Grüppchen auf den altmodischen Klauenfußstühlen der Vorbesitzer beisammen und plauderten.
»Was kann denn so schlimm daran sein, wenn die Kleinen Hüte tragen? Verstehe ich nicht«, seufzte Cecilias Freundin Marianna über ihrer Schokolade, die sie aus englischen Tassen mit Goldrand tranken. Sie war die Jüngste in diesem Kreis wohltätiger Damen, hübsch mit einem Wust lockiger brauner Haare, und es war unübersehbar, dass sie sich die meiste Zeit langweilte. »Ich kenne keinen trübsinnigeren Ort als dieses Haus. Glaubst du im Ernst, dass eines der Kinder sich ins Glücklichsein verstiege? Nicht mit hundert Hüten auf dem Kopf. Sieh dir doch nur dieses arme Häschen an.« Sie flüsterte, weil Signora Secci in Hörweite saß.
Das Waisenmädchen, das Marianna meinte, huschte verschreckt mit einem Tablett zwischen den Damen umher. Es trug ein Kleid aus ungefärbter Wolle, unter dem sich die mageren Hüften abzeichneten, und die Zuckerdose auf dem Tablett klapperte, weil die Kleine zitterte. Nun stand sie vor Silvia Lupori. Die Frau rührte sich nicht, als sie ihr Zuckerdose und Gebäckschale entgegenhielt.
Hochmütiges Biest, urteilte Cecilia, aber dann korrigierte sie sich. Die Frau des Giusdicente war nicht hochmütig, sondern offenbar krank. Sie tupfte sich mit einem Schnupftüchlein die Nase und war trotz der angenehmen Wärme in einen dicken Wollschal gehüllt.
»Schnepfe! Silvia ist nicht besser als der Frosch, den sie geheiratet hat«, flüsterte Marianna, die Cecilias Blick mit den Augen gefolgt war. »Wusstest du, dass sie Opium schluckt? Nicht nur hier und da ein Gran zur Aufheiterung … Mengen!« Marianna rollte ob dieser köstlichen Entgleisung mit den Augen. Spätestens seit Dottore Billings, der Leiter des örtlichen Irrenasyls, ihnen das Werk seines Landsmannes Young über die Folgen des Opiummissbrauchs zugänglich gemacht hatte, galt es im Valdinievole-Tal als unschicklich, der Droge zu frönen.
»Und …« Das Beste kam noch. »Signora Danesi hat sie letztens vor dem Altar von San Pietro Apostolo tanzen sehen! Glaubst du’s? Nun, vielleicht war es nicht wirklich Tanzen, aber … gesummt hat sie auf jeden Fall. Bedenk nur: vor dem Altar! Das ist … das täte nicht einmal ich. Nicht einmal betrunken.«
Hatte Silvia bemerkt, dass man über sie sprach? Sie stand plötzlich auf und durchquerte den Raum, wobei sie unsicher ihre Hände bewegte, als suchte sie etwas zum Festhalten. Ihr Gesicht war bleich und von Schweiß überzogen.
Marianna verschwand errötend hinter ihrem Fächer, während Cecilia sich erhob, um der Frau ihren Platz anzubieten. Opium oder nicht, Signora Lupori ging es schlecht. Doch die Kranke lehnte sich stattdessen gegen eine Kommode und verschränkte die Arme über der Brust, was unerzogen und … männlich wirkte. Ihr zusammengefalteter Fächer hing an ihrem Finger wie ein störendes Requisit.
»Das ist also das berühmte Buch?«
Verwirrt starrte Cecilia erst die Signora und dann die rot eingebundene Kladde an, die neben ihr auf einem Tischchen lag – das Buch, in dem sie auf Geheiß von Signora Secci die finanziellen Umstände des Waisenhauses dokumentierte. »Ich wusste gar nicht, dass das Kontenbuch berühmt ist.«
»Sie nennen es das Buch des Jüngsten Gerichts, nicht wahr?« In Silvias trüben Augen blitzte Spott auf.
Ja. Und herzlichen Dank – wer auch immer über den Scherz geschwatzt haben mag, dachte Cecilia. Ihr Mitgefühl kühlte merklich ab. »Signora Lupori …«
»Sagen Sie Silvia zu mir.« Die Bitte um die vertrauliche Anrede kam so herablassend, dass sie eher wie eine Beleidigung als wie ein Freundschaftsangebot klang. Ohne um Erlaubnis zu fragen, griff die Frau nach dem abgewetzten Buch.
Cecilia hatte ihm in einem verdrossenen Moment den Namen Buch des Jüngsten Gerichts verpasst, weil in ihm – der himmlischen Buchführung entsprechend – die Taten der Montecatiner verzeichnet wurden. Die guten, womit die Spenden an das Waisenhaus gemeint waren, und die schlechten. Letztere bestanden aus den Forderungen, die von Bürgern an das Waisenhaus gestellt wurden, denn Signora Secci hielt es für niederträchtig, wenn jemand Lohn beanspruchte oder ein Entgelt für Waren wünschte, die den Waisen zugutekamen. Wo blieb da die christliche Barmherzigkeit?
Gleichgültig glitt Silvias Blick über die Spalten. Sie klappte das Buch wieder zu und legte es auf den Tisch zurück. »Halten Sie das alles nicht auch für eine Torheit?« Mit einer ungeduldigen Bewegung zog sie den Schal straffer, so dass ihre spitzen Schultern durch das Gewebe stachen. Einen Moment stand sie still und kerzengerade. Dann sagte sie: »Wenn wir auch nur einen Funken jener Güte besäßen, derer wir uns rühmen, dann würden wir in die Schlafsäle hinabgehen und den Bälgern die Hälse umdrehen. Stimmen Sie mir nicht zu, Cecilia?«
Sie wartete keine Antwort ab – Cecilia wäre auch beim besten Willen nichts eingefallen – und kehrte ohne Gruß zu ihrem Platz zurück. Eine versteinerte, leidende Frau mit ungeheuerlichen Manieren.
»Hexe!«, prustete Marianna hinter ihrem Fächer.
Als die Damen eine halbe Stunde später auseinandergingen, sah Cecilia Luporis Kutsche vorfahren. Sie trat in den Schatten eines Ölbaums, als sie bemerkte, dass der Giusdicente sich aus dem Polster erhob und über das Kutschtreppchen auf die Straße stieg, um seine Frau zu begrüßen. Da es Frühling war, hatte er für sein Knopfloch ein frisches Sträußchen pflücken lassen. Ranunkeln. Trotz der Hitze trug er wieder seine Perücke. Das Gesicht darunter war angespannt. Cecilia sah, wie er sich auf seinen Stock stützte. Jede Bewegung schien ihn zu schmerzen, und einen Moment lang verspürte sie den gottlosen Wunsch, ihn möge dahinraffen, was auch immer ihn quälte. Signora Secci trat hinzu, und die beiden plauderten miteinander, aber nur kurz, denn auf die Signora wartete ihr eigener Lakai mit dem Korbwagen.
Silvia hatte es sich mittlerweile im Wagen bequem gemacht. Als ihr Gatte sich mit schmerzlich verzogenem Gesicht neben ihr niederließ, flüsterte sie ihm etwas zu. Cecilia hatte nicht die blasseste Ahnung, was es gewesen sein könnte, aber sie sah, wie Lupori eine bösartige Grimasse schnitt. Er hob seinen Gehstock und bohrte ihn dem Kutscher in den Rücken. Silvia lachte leise.
2. KAPITEL
In der folgenden Nacht hatte sie wieder den Alptraum. Seltsamerweise war sie sich während dieses einen, besonderen Traumes immer bewusst, dass sie schlief. Sie saß mit Großmutter Bianca am Weihnachtstisch – manchmal auch im Theater, an der Tafel einer befreundeten Familie oder in einer Herberge, die sie in Wirklichkeit nie besucht hatten – und aß. Dabei schwoll ihr Bauch. Der Traum verlief jedes Mal auf die gleiche Weise: Großmutter erregte sich über den Taillenumfang ihrer Enkeltochter, Cecilia suchte den Abort auf oder eine Besenkammer … ein Boudoir … ein Musikzimmer … und kramte fieberhaft nach Bändern und Tüchern. Es kam darauf an, den Bauch zu umwickeln, um ihn am Platzen zu hindern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!