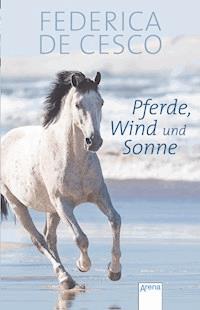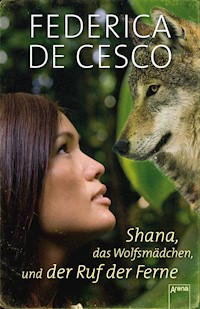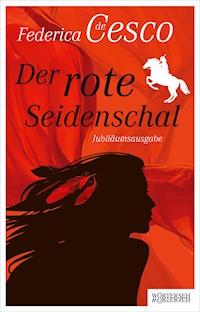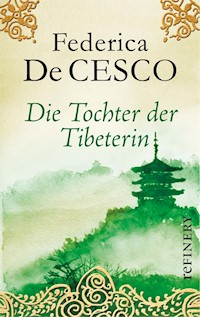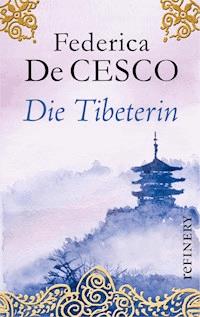Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon immer spürte die junge Archäologie-Studentin Leo, dass sie anders ist. Obwohl sie ein Kind war, das alle in ihren Bann zog, fühlte sie sich immer auf eigentümliche Weise fremd. An ihrem 20. Geburtstag offenbart Leos Großmutter ihr schließlich ein wohl gehütetes Familiengeheimnis … Leo stammt von einem alten Schamanenvolk ab, das vor Jahrtausenden im mittleren Orient lebte. Ihre Ahnen verehrten den Geier als das heiligste aller Wesen, das Seite an Seite mit den Schamanen für das Wohl der Bevölkerung kämpfte. Um sich auf die Suche nach ihren Wurzeln zu machen, reist Leo nach Anatolien zu einem rätselhaften Steintempel ihrer Ahnen. Als die Grabungsstätte in Gefahr gerät, beruft sich die junge Frau auf ihre besondere Gabe. Als Erbin der sagenumwobenen Vogelmenschen ruft sie das erste Mal in ihrem Leben die Geier um Hilfe an, und die Tiere gehorchen ihr … Eine mystisch-abenteuerliche Reise zwischen den Welten - voller Weisheit, Kraft, Sprachgewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FEDERICA DE CESCO
DAS ERBE DER VOGELMENSCHEN
Roman
Für Kazuyuki
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2020 Europa Verlag AG, Zürich
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
Redaktion: Franz Leipold
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Gesetzt aus der Bembo
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-317-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
1.Der namenlose Türkis
2.Die Katze kennt die Geschichte
3.Wir haben noch kein zivilisiertes Benehmen
4.Eine neue Heimat für die Seele
5.Horus war ein Vogelmensch
6.Kalter Kaffee
7.Er hatte sich alles ganz anders vorgestellt
8.Schatten in der Höhle
9.Archäologie ist fürs Erinnern
10.Menschen sind gar nicht so wichtig
11.Der schönste Prinz der Welt
12.Flug durch die Wolken
13.Sie fertigt nachts eine Maske an
14.Die ersten Zeiten dieser Welt
15.Die Vogelmenschen treten in Erscheinung
16.Auf dem Festungsturm brennt ein Feuer
17.Kenan malt Bilder in einer Garage
18.Leo hat nicht immer in der Schule geschlafen
19.Eine Minute kann sehr lang sein
20.Geheimnisvolle alte Geschichten
21.Leo schätzt Feingefühl im Benehmen
22.Sibel Ardalan ist schön und traurig
23.Wo Karpfen schwimmen, spricht die Geschichte höflich
24.Diplomatie kann charmant sein
25.Die Geier fliegen aus den Wolken hervor
26.Schlangen fallen vom Himmel
27.Leo will ihre Erinnerungen bewahren
28.Vielleicht geht es um eine Verwandlung
29.Das Leben geht ohne Erwartungen vorbei
30.Ein Geschenk der Geier-Königin
31.Die Stimme der Maske
32.Ein Mantel aus Pfauenfedern
33.Verwandte
34.Die Rache der Geier-Königin
35.Epilog
1DER NAMENLOSE TÜRKIS
Leo erwachte früh an jenem Morgen. Eine Weile lag sie ganz still unter der Daunendecke und ließ ihre Gedanken ohne klare Vorstellung wandern. Leo hatte bei offenem Fenster geschlafen; jetzt fror sie. Zwischen den Vorhängen dämmerte ein beeindruckender leuchtender Himmel. Und von einem Atemzug zum nächsten fiel ihr ein, dass heute der 23. März war und dass sie zwanzig Jahre alt wurde. Jäh richtete sie sich auf, schlurfte über den kalten Boden ins Bad und nahm eine Dusche, erst warm, dann kalt. Sie hatte nur wenig geschlafen, aber das kalte Wasser tat ihr gut: Sie fühlte sich ausgeruht und erfrischt. Ihr nasses Haar klebte auf ihren Schultern. Sie warf es mit beiden Händen aus dem Gesicht. Ihr gelocktes Haar war blond, mit einem silbrigen Schimmer, aber zu dicht und wirr, um es durchzukämmen. Leo sah immer unfrisiert aus, doch sie hatte sich damit abgefunden. Sie wickelte ein Handtuch um ihre Hüften, stellte sich vor den Spiegel und betrachtete ihre Gestalt.
Leo war auffallend hochgewachsen, so schmal, dass sie fast mager wirkte, mit langen Armen und Beinen, eingefallenem Bauch und kaum angedeuteten Brüsten. Dieser Eindruck von Zartheit täuschte. Sie hatte feste, gut durchtrainierte Muskeln. Ihre Bewegungen waren schnell, drahtig und konzentriert. Betrachtungen dieser Art führten bei ihr immer zu der gleichen Schlussfolgerung: Sie ähnelte eher einem Jungen – einem »Jüngling« hätte man früher gesagt, wie sie in Kunstbüchern aus der Jugendstil-Epoche dargestellt wurden. Und sie war über diesen Vergleich nicht unglücklich, sondern im Gegenteil freudig erregt.
Sie föhnte ihr Haar, zog Jeans und ein frisches T-Shirt an. In der Wohnung war alles still. Jan – ihr Vater – nahm an einem Seminar in Genf teil, aber auf dem Tisch im Wohnzimmer standen in einer Vase drei Osterglocken. Daneben lag ein Bildband über die Pyramiden von Gizeh, eine wertvolle bibliophile Ausgabe, herausgegeben von der Deutschen Orient-Gesellschaft. »Alles Gute« hatte ihr Vater dazu auf eine Karte gekritzelt. Leo verbiss sich ein Lächeln. Typisch Vater, kurz und bündig. Natürlich hatte er es wieder eilig gehabt. Sie wohnten in Clarens, einem Städtchen in der Nähe des mondänen Montreux, am Genfer See, und auf der Autobahn herrschte konstantes Chaos.
Leo lief schnell zur Bäckerei auf der anderen Straßenseite, holte sich zwei frische Croissants. Sie ließ sich Kaffee einlaufen und frühstückte, den Bildband vor sich auf dem Tisch, sorgfältig bestrebt, keine Flecken zu machen. Als sie fertig war, schüttelte sie die Krümel aus den Seiten, ging in ihr Zimmer und setzte sich vor den Computer.
Schon den ganzen Morgen dachte sie daran, dass sie nach dem Essen nach Lausanne fahren wollte. »Komm um vier«, hatte ihre Großmutter Katja gesagt. »Aber nicht früher. Du weißt, dass ich mich nach dem Essen eine Weile hinlege. Danach trinken wir in Ruhe eine heiße Schokolade.«
Großmutters Schokolade war cremig, mit Ingwer und Rosenknospen gewürzt. Katja goss sie aus einer silbernen Kanne in entzückend bemalte Sammeltassen. Dazu gehörte ein großer Klacks Schlagsahne. Die Schokolade gab es keineswegs alle Tage, sondern nur zu besonderen Anlässen. Leo freute sich, obwohl Großmutter diesmal eine ungewöhnliche Bemerkung hinzugefügt hatte.
»Schokolade beruhigt die Nerven. Nimm dich zusammen. Ich will keine Hysterie in meinem Wohnzimmer.«
Hysterie? Leo konnte sich nicht erinnern, jemals hysterisch gewesen zu sein. Auch nicht als pubertierende Halbwüchsige. Sie war fast immer nüchtern, vernünftig und freundlich. Jetzt fühlte sie eine Art von vager Beklemmung in sich.
Was Leo bei der Stange hielt, war die Hoffnung, dass sie heute ein paar Dinge mehr erfahren würde. Eine Hoffnung, die viel tiefer reichte, als sie annahm. Heute also – an ihrem 20. Geburtstag. Heute könnte es sein, dachte Leo voller Ungeduld. Sie verstand allerdings nicht, warum Großmutter sie plötzlich wie ein rohes Ei behandelte. Wie wird man eigentlich hysterisch?, fragte sie sich.
Wie auch immer, Leo traf pünktlich bei der Großmutter ein. Diese gratulierte ihr zum Geburtstag und überreichte ihr, noch während sie sprach, einen kleinen Beutel aus mit Perlen besticktem Hirschleder. Zum Vorschein kam eine Silberkette mit einem Talisman: eine Vogelfeder, ebenfalls aus Silber, mit einem großen tiefblauen Türkis. Leo bedankte sich innig und von ganzem Herzen. Vor Freude fiel ihr nichts anderes ein, was sie noch hätte sagen können.
»Diesen Schmuck hat mir Hugo geschenkt, nachdem wir beschlossen hatten, zu heiraten«, sagte ihre Großmutter mit einer Stimme, die seltsam bewegt klang »Der Schmuck stammt von seiner Mutter Melania. Hugo Cloud Singer Walker war ein Dakota-Sioux, wie du weißt. Noch im 18. Jahrhundert gehörte sein Volk zu den mächtigsten Stammesverbänden Nordamerikas. Die Sioux hat man zwar besiegt, aber niemals unterworfen! In ihrer Tradition gelten Türkise als heilig. Jeder Stein weist eine andere Farbe auf, man findet unendlich viele Schattierungen von Blau. Die Indianer geben jedem Stein einen Namen. Es sind sakrale Gegenstände. Man muss sie mit Ehrfurcht behandeln.«
Während ihre Großmutter die Zusammenhänge erklärte, befestigte sie die Kette um Leos Hals. Das Schmuckstück war wundervoll gearbeitet. Leo schwieg ein paar Sekunden lang. Von einem Atemzug zum nächsten war sie in einen seltsamen Bewusstseinszustand getreten, der in ihr eine kurze, heftige Unruhe auslöste, eine Welle euphorischer Erregung. Sie berührte den Talisman mit der Fingerkuppe, und Katja sagte:
»Du musst ihm einen Namen geben. Das braucht nicht unbedingt heute oder morgen zu sein. Lass dir Zeit.«
Sie füllte Leos Tasse, gab Schlagsahne hinzu. Inzwischen strich Bijou, die braune Perserkatze mit den goldenen Augen, um Großmutters Sessel herum, bevor sie lautlos auf ihre Knie sprang und sich gemütlich zusammenrollte. Katja streichelte sie geistesabwesend.
»So. Und jetzt hör mir zu. Und tu mir den Gefallen, unterbrich mich bitte nicht. Was du im Augenblick denkst, ist nicht relevant, und ich muss mich konzentrieren.«
Leos Großmutter Katja war in Wien geboren. Der Vater war ein angesehener Arzt, die Mutter Cellistin. Als Kind hatte es ihr an nichts gefehlt. Geld, Bildung, Kultur öffneten ihr die Tür zur feinen Gesellschaft. Ihre Erinnerungen an damals waren verzierte Kronleuchter, bestickte Tischdecken, wertvolle Teppiche und erlesenes Porzellan. Sogar das Nachtgeschirr in ihrem Kinderzimmer entstammte der königlichen Manufaktur in Delft. Darüber hinaus hatte sie das musikalische Talent ihrer Mutter geerbt. Aber Katja spielte nicht Cello, sondern Klavier. Sie spielte wundervoll und ohne Noten. Irgendwie, auf irgendeine Weise, konnte sie das, ohne dass man sie jemals weitergehend unterrichtet hätte. »Mein Klavierlehrer war eine Niete«, kommentierte sie später die Situation. Sie hatte bereits mit sieben Jahren ihre ersten öffentlichen Auftritte. Doch dann kam der Krieg. Der Krieg veränderte alles.
Heute blickte sie auf eine lange Karriere als begeistert gefeierte Pianistin zurück, aber seit einigen Jahren gab sie nur noch Benefizkonzerte. »Es macht mich glücklich, Sinnvolles zu tun«, hatte sie unlängst zu Leo gesagt. »Die ganz großen Momente sind für mich nicht, wenn ich vor einem Publikum in Abendrobe spiele, sondern wenn ich spüre, dass wir gemeinsam ein konkretes Zeichen gegen Ungerechtigkeit setzen.«
Katja hatte auf einem verstimmten Klavier in den Ruinen der Markthalle von Sarajevo gespielt, wo es nach Pisse stank. Sie hatte in Pflegeheimen für Schwerkranke und Behinderte gespielt. Und kürzlich für den WWF, der ein Spendenkonto zum Schutz der Naturwälder eröffnet hatte. All das beeindruckte Leo sehr. Ihr gefielen Katjas Weisheit und bisweilen krude Ehrlichkeit.
Katja hielt sich fast übertrieben gerade, den Kopf hoch erhoben. Sie hatte sandfarbenes Haar, und ihre Augen schimmerten wie polierter Schiefer. Sie benutzte nur selten eine Lesebrille. Ihr Blick war intensiv und forschend, ihre Lippen hatte sie stets rot geschminkt. Sie trug am liebsten Weiß: weiße Hose, weißer Pullover mit Rollkragen. Und sie machte nie einen Fleck. Im Sommer verbarg sie ihren Hals unter einem »Carré« von Hermès, von denen sie eine ganze Sammlung besaß. Dazu silberne Armspangen oder eine Brosche mit Korallen und leuchtenden Türkisen. Gold mochte sie nicht. »Gold bringt Unglück«, sagte sie.
Katja ließ sich gerne bewundern. Sie erweckte den Anschein von Hochmut, allerdings mit einer Art von distanziertem Humor, der sich bisweilen zynisch anhörte. Ihr Selbstvertrauen war unerschütterlich.
Seitdem sie sich aus dem Berufsleben zurückgezogenen hatte, wohnte Katja in Lausanne, am Quai d’Ouchy, gleich hinter dem vornehmen Hotel d’Angleterre. Ihre Sicht auf den Genfer See war dadurch eingeschränkt, aber es machte ihr nichts aus. Katja war dreimal verheiratet gewesen. Ihren ersten Mann, einen Hollywood-Star – dumm und sexy, wie sie sagte –, hatte sie nach einigen Monaten vor die Tür gesetzt. »Er trank, wurde dick und war nicht mehr interessant«, kommentierte sie lapidar. Hollywood war sowieso ein Ort, den sie ausgesprochen vulgär fand.
Danach war sie mit Max van der Weyden, einem flämischen Professor für Physik, verheiratet gewesen. Jan, ihr gemeinsamer Sohn, war in der Schweiz aufgewachsen und hatte in Gstaad im renommierten Internat »Le Rosey« studiert. Nach sechs Jahren hatten Katja und Max im gemeinsamen Einvernehmen die Scheidung eingereicht.
»Es hat uns beide lange Zeit im Inneren beschäftigt«, hatte Katja ihrer Enkelin anvertraut. »Max war gutherzig und freundlich, ein Teddybär zum Schmusen, und eine Zeit lang war es herrlich mit ihm. Er mochte auch die Musik, selbst wenn Aaron Copland ihm mehr lag als Bela Bartok. Doch Max befasste sich permanent mit Quantenphysik. Und ich verstand überhaupt nichts von der hehren Sprache der Fachwissenschaft. Ich versuchte trotzdem, bei Stimmung zu bleiben, aber wir konnten nicht verschiedener sein. Am Ende waren wir beide unglücklich. Unsere Ehe bestand nur noch auf dem Papier. Es hatte keinen Sinn mehr.«
»Jan hat viel von seinem Vater«, sagte ihre Großmutter manchmal zu Leo. »Pass auf, dass er nicht langweilig wird!« Daraufhin fühlte sich Leo verpflichtet, ihren Vater in Schutz zu nehmen.
»Du tust ihm unrecht. Er kann sehr lustig sein.«
»Aber gewiss. Zu Neujahr und zu Pfingsten.«
In ihrem Leben hatte Katja eine einzige große Liebe gekannt: Hugo Cloud Singer Walker, einen Tenor, der in den USA in einem Reservat aufgewachsen war. Die Ehe endete 37 Jahre später mit Hugos Tod. »Jeder geht anders mit der Trauer um«, hatte Katja damals gesagt. »In schwierigen Lebenslagen war es stets die Musik, die mir geholfen hat. Als ich Hugo verlor, saß ich zwei Tage später vor dem Flügel. Die Musik gab mir Ruhe und Kraft. Sonst hätte ich mir im Wohnzimmer die Pulsadern aufgeschnitten und eine große Schweinerei hinterlassen.«
Katja hatte mit Hugo kein zweites Kind gehabt. Jan trug den Namen seines flämischen Vaters. Er hatte Lena Mingroot geheiratet, eine Bibliothekarin, die an der Universität von Löwen arbeitete. »Flamen unter sich«, pflegte Katja zu sagen. Lena war klein, hübsch gewachsen, mit den anmutigen Gebärden und dem graziösen Gang einer Ballerina.
Die Schwiegereltern? Die waren weit weg, lebten in der Demokratischen Republik Kongo, einer ehemaligen belgischen Kolonie, wo sie Bantu–Kindern aus prekären Verhältnissen das Einmaleins beibrachten. So weit, so gut. Und Leo kam zwei Jahre später zur Welt. Es war eine schwere Geburt. Lena liebte ihre kleine Tochter sehr, allerdings auf eine seltsame, scheue Art. Und als Leo 13 Jahre alt war, zog sich Lena zurück. Nicht völlig, nicht auf einmal, jedoch zielstrebig. Sie trug ihre Verantwortung, gewiss. Sie gab ihr Bestes, aber sie wollte in erster Linie sich selbst gegenüber aufrichtig sein. Sie wollte nicht depressiv werden.
Ihre Ehe mit Jan? Beide konnten schlecht mit Konflikten umgehen. Jan schrieb ein Buch über die Spuren der Kelten in Mitteleuropa und kreiste nur noch um sich selbst. Mit Yoga und den Sprüchen des Dalai Lama hatte er nichts am Hut. Lena erklärte, dass sie zu ihren Eltern nach Afrika gehen wollte. Sie hatte sie schon so lange nicht mehr gesehen. Oh, nur für ein paar Monate. Vielleicht würde sie auch länger bleiben, wer weiß. Und Leo könnte ja beim Vater wohnen und sie in den Schulferien besuchen.
Jan meinte, das sei keine schlechte Idee, und wollte wissen, was Leo davon hielt.
Dabei fragte sich Leo, ob ihr Vater nicht merkte, dass Lena krank war. Krank an Geist und Seele? Ihre kindliche Vorstellungskraft ließ sie spüren, dass Lenas Gefühle ihr gegenüber zunehmend verwirrter und ungerechter wurden. Es bedrückte sie sehr, den Grund dafür nicht zu wissen. Sie war sich keiner Schuld bewusst. Sie wusste nur, dass Lena ihr Weggehen wie eine Befreiung empfand. Weg von dem Mann, weg von der Tochter! Sie wollte ihr vergangenes Leben entsorgen, wie einen vollen Müllsack hinter einer Mauer.
Leo litt sehr unter der Trennung. Aber es war besser für Lena, dass sie ging. Leo war vernünftig genug, um das zu beurteilen. Sie legte der Mutter keine Steine in den Weg.
Seitdem waren sieben Jahre vergangen. Und jetzt saß Leo bei ihrer Großmutter im Jugendstil-Wohnzimmer, balancierte ungeschickt eine wertvolle Porzellantasse und wartete voller Ungeduld auf das, was Katja ihr zu sagen hatte. Umso grösser war ihre Enttäuschung, als sie bemerkte, wie Katja plötzlich unsicher wurde. Solange sie sich erinnern konnte, hatte Leo noch nie erlebt, dass sich ihre Großmutter verhaspelte. Ihre Aussagen waren stets gelassen und perfekt formuliert. Jetzt suchte sie nach Worten, schüttelte den Kopf oder schnippte ungeduldig mit den Fingern. Dabei schaute sie Leo nicht an, sondern starrte an ihr vorbei auf irgendeinen Punkt hinter ihrer Schulter. Ihr Geist schien in verschiedenen Sedimenten zu tasten. Es war, als folgten ihre inneren Augen den von Schicht zu Schicht gleitenden Gedanken, während sich ihre Stimme, die von Natur aus rau klang, allmählich festigte. Nach und nach gewann sie ihre übliche Sicherheit zurück, ihre Augen suchten die Augen von Leo, und ihr Blick war offen und amüsiert wie zuvor. Als ob sie mit ihrer ganzen Haltung ausdrücken wollte: »So, gleich haben wir’s hinter uns. Aller Anfang ist schwer!«
Und von da an sprach sie, ohne nochmals zu stocken, mit bildhaften und ausdrucksbetonten Worten. Leo unterbrach sie kein einziges Mal, nicht nur, weil sie sich an die Abmachung hielt, sondern weil sie so verdutzt war, dass ihr keine passende Bemerkung einfiel. Zeitweise kam sie in Versuchung, laut zu lachen, was unangebracht und taktlos gewesen wäre. Und gleichzeitig konnte sie sich der beklemmenden Faszination nicht entziehen, die Großmutters Worte bei ihr auslösten. Redete sie von Träumen, die eher in die Praxis eines Psychiaters gehörten, oder von Ereignissen, die sie aus dem Stegreif erfand? Eine halbe Stunde war vergangen, und Großmutter hörte nicht auf draufloszureden. Leo balancierte ihre Porzellantasse und saß fassungslos da. »Wie ein erstarrtes Kaninchen vor einer Klapperschlange«, würde sie später ihren Zustand beschreiben.
Immerhin wusste Leo bereits, dass man sich in seinem eigenen Gedankenfluss verlieren konnte. Und einige beunruhigende Situationen hatte sie auch schon erlebt. Nach dem letzten Vorfall war sie bei einer Neurologin gelandet. Und Katja hatte seltsam reagiert, als sie ihr den Zwischenfall schilderte. Vordergründig desinteressiert. Als ob sie sagen wollte: Nun mach doch nicht so ein Theater daraus! Leo hatte sich ratlos gefühlt. War Großmutter womöglich schon reif für die Klapsmühle? Alles in allem hatte sie nicht diesen Anschein erweckt. Sie machte eigentlich einen sehr beherrschten, mitunter sogar gebieterischen Eindruck. Ihre Schilderungen waren sehr bildhaft und voller Gleichnisse, aber Katja sprach ja oft im Ton einer Märchenerzählerin. Im Übrigen war sie scharfzüngig, mit einem Hang zum pikanten Sarkasmus, der auch jetzt gelegentlich zum Vorschein kam. Nichts für empfindliche Gemüter. Dazu kam, dass sie in ihrer selbstherrlichen Art von ihrer Geschichte vollkommen überzeugt schien. Leo war bestürzt. Denn das, was Katja jetzt erzählte, war eine vollkommene Umwandlung jener Geschichte, die Kinder im Vorschulalter oder unter dem Weihnachtsbaum erzählt bekommen und die tiefe Empfindungen in ihnen weckt, Empfindungen, die zu dem gehörten, was man für gewöhnlich unter »Urvertrauen« verstand. Rationale Gedanken hatten da nichts zu suchen. Und nun schilderte Katja die gleiche Geschichte, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Leo versuchte sich einzureden, dass Katja fabulierte, wie das bei alten Menschen bisweilen vorkommt, aber allmählich war sie dessen nicht mehr so sicher. Vielleicht war ihr Katja in Gedanken ganz nahe – viel näher, als Leo ahnen konnte.
Nachdem Katja endlich fertig war, schickte sie Leo in die Küche, um ihr ein Glas Wasser zu holen. Leo kam zurück und reichte ihrer Großmutter wortlos das Glas. Katja trank das Wasser ohne Hast, behielt jeden Schluck ziemlich lange im Mund. Ihr matt gepudertes Gesicht war mit einem leichten Schweißfilm überzogen. Als Leo ihr das Glas aus der Hand nahm, brachte sie ein elegantes Taschentuch zum Vorschein, tupfte sich Stirn und Lippen ab und sagte ohne Umschweife:
»So. Und jetzt denkst du, dass ich eine Meise habe.«
»Eigentlich nicht. Aber …«
»Glaubst du mir nicht?«
Leo holte tief Luft.
»Um die Wahrheit zu sagen, kein einziges Wort!«
»Um die Wahrheit zu sagen«, wiederholte Katja mit einer Handbewegung, die ihren Ärger ausdrückte. »Fuck off! Wozu habe ich mir eigentlich den Mund fusselig geredet?«
Worauf Bijou von ihren Knien sprang und würdevoll das Wohnzimmer verließ.
2DIE KATZE KENNT DIE GESCHICHTE
Danach – nach dieser Sache – geschah eine Zeit lang gar nichts. Seitens ihrer Großmutter herrschte Funkstille. In dieser Zeit begann Leo nachzudenken. Ihre Großmutter war 83 Jahre alt, aber nach wie vor mit Gesundheit, Ausdauer und Willenskraft ausgestattet. Sie empfand eine tiefe Achtung für sich selbst und für ihre Kunst. Musik war stets der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Ja, und vielleicht träumte sie von Musik und wusste in ihren Träumen von Dingen, die weit zurück in Raum und Zeit lagen? Sie hatte Leo eine Geschichte erzählt, die es in sich hatte. In vieler Hinsicht allerdings ein völliger Quatsch. War es die Sache überhaupt wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen?
Leo hatte eine besondere Eigenart: Sie vermittelte den Anschein, als höre sie dem, was gerade gesagt wurde, nicht genau zu. Ihr Gesicht hatte dabei einen Ausdruck, den man – je nachdem – als abwesend oder gelangweilt bezeichnen konnte. In Wirklichkeit war sie ganz Ohr, und ihr Verstand forschte unablässig nach dem Grund der Dinge. Was auch hinter Großmutters spleeniger Story stecken mochte, womöglich war am Ende doch etwas Wahres dran.
Irgendwie musste sie ihre Unruhe loswerden. Sie konnte zumindest Katja fragen, woher die Geschichte stammte und wann und wo sie diese erfahren hatte. Sie haderte eine Zeit lang mit sich selbst, bevor sie sich entschloss, noch einmal mit der Großmutter zu reden.
»Nett, dass du anrufst«, sagte Katja freundlich. »Wie geht es dir?«
»Ich habe noch ein paar Fragen …«
»Noch Fragen? Ich dachte doch, das Thema sei für dich erledigt.«
Der Spott der alten Dame hatte Leo nie etwas ausgemacht. Das Wortgeplänkel zwischen ihnen gehörte dazu.
»Großmutter, sei so gut …«
Katja unterbrach sie.
»Komm um fünf. Ich mache uns Schokolade und werde mir Zeit für dich nehmen.«
Leo war immer pünktlich. Um fünf war sie wieder bei der Großmutter, trank die heiße Schokolade und knabberte Mandelplätzchen. Katja saß entspannt in ihrem Sessel. Sie trug ihren weißen Pullover, das Haar hatte sie mit einem silbernen Kamm hochgesteckt. Der Steinway ragte als imposantes Dekor-Element hinter ihr hoch, und auf dem spiegelblanken Deckel lag friedlich die Katze.
Großmutter beobachtete Leo, während sie trank, und lächelte unergründlich.
»Gut?«
Leo konnte es nur bestätigen.
»Himmlisch!«
Großmutter nickte.
»Danke. Die Wortwahl scheint mir angemessen. Und du bist zu mir gekommen, um ein paar weise Gedanken mitzunehmen?«
»Ehrlich gesagt, die Sache lässt mir keine Ruhe.«
»Warum glaubst du mir eigentlich nicht?«
Leo merkte, dass ihre Hand leicht zitterte, und stellte behutsam die Tasse auf den Tisch. Bloß keinen Fleck oder – schlimmer noch – Scherben, das hätte noch gefehlt!
»Ich fühle mich …«
Katja hob die Brauen.
»… verarscht?«
»Eindeutig.«
Obwohl Großmutter in jungen Jahren das gekannt hatte, was sie als »gute Kinderstube« bezeichnen würde, war sie recht ausgefuchst. Gelegentliche Kraftausdrücke kamen ihr ganz natürlich über die Lippen und wirkten, von ihr ausgesprochen, geradezu smart. De facto hatte sie außer ihren drei Ehen ziemlich viel erlebt, und auch die Hippiezeit war nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Sie hatte John und Yoko gekannt, hatte im Schlamm von Woodstock unter einem dreckigen Umhang geschlafen, in den Armen eines »sexy Kerls«, dessen Namen sie vergessen hatte. Sie hatte Mai 1968 in Paris miterlebt, war mit Freunden aus dem Quartier Latin auf Barrikaden geklettert, hatte Pflastersteine gegen die Polizei geschleudert. Sie war sogar für einen Tag in Haft gewesen. »Das gehörte einfach zum guten Ton, dass man dabei war«, kommentierte sie nachträglich. Später hatte sie mit Brigitte Bardot und Roger Vadim splitternackt in den Dünen von Saint-Tropez getanzt, hatte harte Sachen getrunken und geraucht. Sie war mit einer Freundin als Rucksack-Touristin durch Nordafrika getrampt. Ein Frachtdampfer hatte sie über das Mittelmeer gebracht. Sie waren bis nach Agadez gekommen. Immer per Autostopp. Auf den Rastplätzen hatten sie Joints mit den Fahrern geraucht. Und keiner hatte sie ausgeraubt, vergewaltigt oder erstochen. Sie hatten nichts anderes erlebt als Entgegenkommen und Gastfreundschaft. Es waren andere Zeiten.
Großmutter trauerte dieser Zeit nicht nach. Das Leben war, wie es war, man musste sich anpassen. Ihr Urteil war scharf und unsentimental. Nachsicht schien es für sie nicht zu geben. Wenn auch das Wort »herzlos« in ihren Fall entschieden ungerechtfertigt war, versetzte ihre herbe Art manche Leute in unbehagliche Stimmung. Ihr wahres Wesen blieb für viele ein Rätsel. Doch Leo sah tiefer. Was für viele wie Anmaßung wirkte, waren vielleicht nur sorgsam gehütete Verletzlichkeit und Mitleid für die Menschen, deren tragische Unvollkommenheit sie längst durchschaut hatte.
»Hör zu«, sagte Katja. »Niemand kann dir den Gefallen tun, dir alles richtig zu erklären. Aber wenn du etwas mit genügendem Nachdruck wissen willst, sind Fragen noch immer das Beste.«
Sie lehnte sich zurück, nahm eine abwartende Haltung ein. Und Leo stellte Fragen. Und noch mehr Fragen. Es kamen ihr immer wieder neue in den Sinn. Katja verlor nie die Geduld und erklärte ihr alles ganz genau, weder bevormundend noch herablassend. Leo wurde klar, dass Offenheit genau das war, was sie erwarten oder erhoffen konnte. Dabei hatte Katja stets ihre eigene Art zu sprechen, diesen unnachahmlichen Ton einer Märchenerzählerin. Ihre Worte beschrieben, ganz unabhängig von ihrer Bedeutung, ein Fliegen oder ein Schweben, eine vibrierende Tragfläche faszinierender Möglichkeiten – eine Ekstase. Sie sprach von allem fast gleichzeitig, aber alles, was sie sagte, hatte Hand und Fuß. Und Leo begriff recht bald, warum die Geschichte nicht in fremde Ohren dringen durfte, sondern als wohlgehütetes Familiengeheimnis von einer Generation auf die nächste übertragen wurde. Anders wäre es ja kaum denkbar gewesen. Sie begriff auch, warum einige Nachkommen nicht dazu fähig gewesen waren, die Bürde zu tragen. Klar doch, völlig einleuchtend.
Und es spielte kaum eine Rolle, wenn die ursprünglichen Tatsachen sich irgendwann in einen Mythos verwandelt hatten und der Mythos in Aberglauben.
»Damit muss immer gerechnet werden«, sagte ihre Großmutter. »Im Mittelalter sperrte man uns in einen Eisenkäfig, bevor man uns, an Händen und Füssen gefesselt, zum Scheiterhaufen schleppte. Nachdem man uns mit einer Zange die Fingernägel ausgerissen hatte. Keine sympathische Art, über den Jordan zu gehen. Wir waren feinere Sitten gewohnt. Das Gute an der Sache: Unsere Geschichte liegt so unendlich weit zurück, dass wir am Ende nationenlos wurden. Und mit der Zeit anfingen, die Nationen zu hassen. Und die Religion, wirst du fragen? Derzeit imponiert uns keine. Früher war alles anders, da arbeiteten wir noch mit der Religion Hand in Hand, verfolgten wir doch ähnliche Ziele. Aber nach und nach wurde das Vertrauen erschüttert. Wir entwickelten uns nicht mehr gemeinsam, sondern strukturell völlig verschieden. Und irgendwann ging alles aus den Fugen. In der Zwischenzeit hat sich nicht viel daran geändert. Wir denken nach wie vor: Wozu das formelle Getue, wenn man es auch anders machen kann?«
Großmutter hob die Kanne, während sie weitersprach, und Leo hielt ihr die Tasse hin.
»Da wir aus einem anderen Zeitalter kommen, sehen wir an der Weltgeschichte vorbei. Das ist unser Privileg. Aber man kann nicht in aller Ewigkeit vor unseren Augen die Welt in Stücke schlagen, ohne dass wir randalieren. Irgendeine Bemerkung?«
»Mir wird es allmählich zu viel.«
»Betrachte doch die Situation, wie sie ist. Und mache kein Drama daraus. Wie, glaubst du, sind unsere Vorfahren damit fertiggeworden? Gerieten sie in Rage, haben sie immer getan, was sie zu tun hatten.«
»Gab es für sie eine besondere Methode?«
»Eine einzige. Und die gilt immer noch: Du kommst aus einer Tür, gehst durch die nächste und wechselst von einer Welt in die andere. Fertig. Wichtig ist, dass du beide Welten klar im Kopf behältst. Mit etwas Übung kriegst du das schon hin.«
Bijou öffnete ihr goldenen Augen, gähnte und streckte sich. Leo zog sich mit einiger Anstrengung aus dem Sessel empor. Sie ging zu der Katze und streichelte sie.
»Hast du gut zugehört, Bijou?«
»Wozu?« sagte Großmutter. »Sie kennt ja längst die Geschichte.«
3WIR HABEN NOCH KEIN ZIVILISIERTES BENEHMEN
»Schon möglich, dass die Katze die Geschichte längst kennt«, sagte Leo. »Aber ich weiß erst seit zwei Wochen davon.«
»Wer borniert ist, braucht eben mehr Zeit.«
Leo kraulte die Katze, die behaglich schnurrte.
»Sag mal, Bijou, kennst du einen guten Analytiker? Einfühlsam und per se ohne religiöse Verkrampfung? Großmutter will nämlich, dass ich die Guten belohne und die Bösen bestrafe. Produktiv und performativ soll ich sein. Und mildtätig obendrein. Angeblich bin ich dazu verpflichtet. Ich befürchte, ich entwickle eine Phobie.«
»Du verfügst über einen bemerkenswerten Wortschatz, mein Kind.«
»Ich habe Abitur gemacht.«
»Ich nicht. In Wien kam ich nicht dazu. Der Krieg. Wenn Vater nicht eingezogen wurde, dann lag es nur daran, weil er Asthmatiker war. Auswandern? Kam nicht infrage! Er trug eine Verantwortung. Du kannst dir kaum vorstellen, wie es damals war: Wir waren in unserer beschissenen Welt gefangen. Österreich war an das Deutsche Reich gebunden. An jedem Gebäude flatterten Flaggen mit Hakenkreuzen. Soldaten waren überall und sangen rührselige Schnulzen: ›Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein‹. Und eins, zwei, die Absätze knallten im Takt. Meine Mutter hatte einen Cousin, ein hohes Tier bei der Partei. Ich wurde gezwungen, für die hohen Offiziere zu spielen, für Goebbels und einmal sogar für Hitler. Eine Sonate von Beethoven. Nach dem Konzert ließ er mich kommen. Der Cousin stand auch da, warf sich stolz in die Brust. Ich machte artig einen Knicks. Der Führer lobte mich sehr und tätschelte mir die Wange. Er war parfümiert. Ein französisches Parfüm, das es heute noch gibt. Ich habe den Geruch noch in der Nase. So was vergisst man nie.
Seltsamerweise hatte ich nicht das Gefühl einer Gefahr, auch wenn die Gefahr um uns herum ihre Fangarme ausbreitete. Jüdische Familien verschwanden über Nacht. Oder auch Leute, die sich politisch nicht konform verhielten. Ihre Wohnungen wurden geplündert oder beschlagnahmt. Das Dilemma meiner Eltern war, dass sie mir etwas mitteilen mussten. Etwas, das keinen Aufschub duldete. Aber was sie mir zu sagen hatten, konnte mein Kopf mit ziemlicher Sicherheit nicht fassen. Verstehen setzt eine Spannkraft voraus, die die gesamte im Gedächtnis bewahrte Zeit umfasst und mit einbezieht. Ich war noch viel zu jung, und meine täglichen Gedanken, die reichten bei Weitem nicht aus. Dabei stand eine Katastrophe bevor, und was den Eltern blieb – war ein Funken Hoffnung: Ich könnte ja später dieses und jenes Ereignis zusammenbringen, aufrollen und wieder neu knüpfen. Und möglicherweise eines Tages die Zusammenhänge erkennen. Sagt man nicht, dass ein Stern, dessen Licht uns heute erreicht, schon vor Millionen von Jahren erloschen sein könnte?
Außerdem eilte die Sache: Vater stand bereits unter Bewachung, weil Juden in seiner Praxis immer willkommen waren. Und so kam es, dass mir Fakten geschildert wurden, die – auf den ersten Blick – nichts mit der empirischen Wirklichkeit zu tun hatten. Das, was meine Eltern mir anvertrauten, hätten sie mir genauso gut in einer fremden Sprache vermitteln können. Und gerade deswegen berührte es mich tief. Es war, als ob ich in der Dunkelheit ein Buch zu fassen bekam und es lesen konnte. Vor meinen kindlichen Augen entfaltete sich eine fantastische Sage, die meiner Vorstellungswelt auf geheimnisvolle Weise entsprach und auf meiner Netzhaut haften blieb wie ein Nachbild. Natürlich wurde mir mit Nachdruck eingeschärft, darüber Stillschweigen zu bewahren. Aber ich war sowieso nicht sehr mitteilsam, und außerdem war das Märchen allzu fantastischintim, um mit anderen geteilt zu werden.
Bald jedoch verschärfte sich die Lage. Und Vater musste seine Patienten informieren, dass es ihm zunehmend schlechter ging – sein Asthma war daran schuld. Und dass er sich gezwungen sah, die Praxis zu schließen, was allgemein sehr bedauert wurde. Die Praxis befand sich neben unserem Wohnhaus. Wer wusste schon, dass es eine Verbindungstür durch den Keller gab? Und wer konnte ahnen, dass es meinem Vater eigentlich nicht schlechter ging als zuvor? Und dass meine Eltern ein Dutzend jüdischer Nachbarn in der Praxis versteckt hatten? Familien, die nicht mehr rechtzeitig hatten fliehen können. Menschen, die zu unserem Leben gehörten. Mit denen wir seit Jahren befreundet waren. Alle Fenster waren fest geschlossen, man hörte keine Stimme, kein Licht drang nach draußen. Aber wie das so ist, Gerüchte entstanden und gerieten in Umlauf. Und einige Wochen später, frühmorgens, hämmerte die Gestapo an die Tür. Ich sah mit Entsetzen, wie diese Menschen, die ich alle kannte, aus ihrem Versteck gezerrt wurden. Man pferchte sie in einen Lastwagen und brachte sie nach Bergen-Belsen. Sogar die Kinder, mit denen ich jeden Tag gespielt und Schularbeiten gemacht hatte. Natürlich wurde auch mein Vater verhaftet. Meiner Mutter krümmte man kein Haar. Der Cousin wollte nett zu ihr sein. Und Hitler hatte mir ja die Wange getätschelt. Allerdings wurde das Haus beschlagnahmt. Wir wurden, wie man sagt, ›auf die Straße gesetzt‹. Mutter durfte nur einen Koffer mitnehmen. Der Cousin, das hohe Tier, wollte selbst unter unseren Kronleuchtern speisen.
Vater hatte eine Gabe – oder eine Veranlagung, nenne es, wie du willst –, jedenfalls eine Fähigkeit zum dreidimensionalen Blick. Bei seinen Patienten visualisierte er sofort die kranken Organe. Er nahm in Sekundenschnelle ihr inneres Wesen wahr. Er konnte ihre verborgenen Gedanken lesen, was er nicht oft tat, und zwar aus reinen Gewissensgründen, denn er war ein Mann mit Prinzipien.
Das Lager war mit einem Zaun aus Brettern und Stacheldraht gesichert; nachts wurde es von Patrouillen mit Schäferhunden bewacht und von Scheinwerfern erleuchtet. »Arbeit macht frei« stand als Willkommensspruch über den Eingang geschrieben. Man wurde zu irgendeiner sinnlosen Arbeit gezwungen, bis man vor Erschöpfung umfiel. Und was in einigen Baracken vor sich ging, konnte Vater sich vorstellen. Vater hörte das Rascheln, Flüstern, Schluchzen und Stöhnen. Und später sah er, wie man die Leichen fortschaffte. Vater unterdrückte zähneknirschend seinen Horror, hob den Spaten mit aufgeschürften Händen. Ein trockener Husten schüttelte seine Brust. Er spuckte grünen Schleim und speicherte Informationen. Sein Ohr lauschte ständig auf das, was um ihn herum geschah. Er verfasste Organisationsdiagramme, prägte sich die tägliche Routine ein und behielt alles systematisch im Kopf. Und es dauerte nicht lange, da hatte er den einzig möglichen Fluchtweg ausgemacht. Allerdings musste alles stimmen: die Uhrzeit, die Schatten. Die Wachen konnte man reinlegen, sobald die Stunde der Ablösung kam. Mit den Hunden konnte man reden. Doch, doch, Vater kannte ihre Sprache. Jeder andere hätte die Gelegenheit genutzt und das Weite gesucht. Nicht mein Vater. Er musste sein Leben nach Grundsätzen führen, die keiner verstand. Es gab diese Geschichte, die immer wieder erzählt wurde. Sie war und blieb die Definition unseres Seins. Er musste dieser Geschichte gerecht werden.
Das bedeutet: zunächst seine Freunde, andernfalls würde keiner von ihnen mit dem Leben davonkommen. Er durfte keine Zeit mehr verlieren. Sie wirkten gefroren wie die Erde, hatten glasige Augen und Raureif auf den Lippen. Vater beschrieb ihnen im Flüsterton den genauen Weg, immer wieder, bis sie ihn auswendig kannten. Er prägte ihnen die richtige Stelle ein, die Stelle, die das dämmrige Winterlicht ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr berührte; dort gab es eine Lücke zwischen den Brettern. Die Scheinwerfer glitten darüber hinweg. Er sprach im Geist zu den Hunden. Keinen Mucks, ja? Er schärfte es den Hunden ein, und die Hunde gehorchten. Den ausgemergelten Fliehenden schenkte er geheime Energien, die sie stärkten. Sie baten ihn eindringlich, mit ihnen zu flüchten. Einige Frauen weinten, aber lautlos. Er sagte nein, immer wieder nein. Es kamen ja jeden Tag andere, die ihn nötig hatten. Und so war es dann auch: Alle, die seine Angaben befolgten, entkamen und retteten ihr Leben. Er selbst blieb im Lager. Er war stets ein besonnener Mann gewesen, ein Arzt eben. Jetzt hatte ihn die Unvernunft gepackt, eine Art heiliger Wahnsinn. Wir wissen nicht, wie viele von dem Fluchtweg Gebrauch machten, aber es musste sich um eine beträchtliche Zahl gehandelt haben. Höchstwahrscheinlich wurde er denunziert. Es gab Spitzel im Lager. Er wurde nicht vergast, nein. Er sollte nicht zwischen unbekannten Leichen verwesen. In seinem Fall vollstreckte man keine abstrakte Strafe. Man wollte an ihm ein Exempel statuieren. Deshalb prügelte man ihn halbtot, führte ihn als Wrack vor und knüpfte ihm einen Strick um den Hals. Und alle Lagerinsassen mussten dabei zusehen, sogar die Kinder. Die Eltern hielten ihnen die Augen zu.«
Leo schüttelte deprimiert den Kopf.
»Ich will nicht am Galgen baumeln!«
»Das will keiner. Aber auch du könntest in Situationen kommen, die das Äußerste von dir verlangen. Heute sind wir fähig, Konvergenzen zwischen Nano- und Biotechnologie zu entwickeln und mithilfe der Gentechnik die gesamte Lebenswelt von Menschen, Tieren und Pflanzen auf den Kopf zu stellen. Wir haben ein leistungsfähiges Gehirn, das schon, aber kein zivilisiertes Benehmen. Das wird schon kommen. In zehntausend Jahren, vielleicht. Wenn die Welt bis dahin noch besteht. Inzwischen sind wir zu allem fähig.«
Großmutter Katja hatte gut reden. Sie war bereits über achtzig, aber Leo hatte noch ihr Leben vor sich. Und die Perspektiven waren nicht gerade rosig.
»Und wie ging es für dich weiter, damals nach dem Krieg?«, wollte Leo wissen.
»Das weißt du doch. Mutter und ich lebten in einem ungeheizten Zimmer. Wasser schleppten wir in einem Eimer drei Stockwerke hinauf. Mutter hatte Tuberkulose, aber wir hatten Glück im Unglück. Das Rote Kreuz brachte uns in die Schweiz und besorgte uns eine Unterkunft bei einer netten Familie. Mutter kam in ein Sanatorium, erholte sich und lebte noch einige Jahre glücklich in Schönried. Sie liebte die Berge. Ich war 15, als ich in einer Mädchenschule in Thun als Klavierlehrerin angestellt wurde. Was komisch war, denn die Mädchen waren ja fast alle im gleichen Alter. Dann bekam ich meine ersten Engagements als Solistin, und damit startete meine Karriere. Und jetzt lassen wir es dabei bewenden, ja? Ich will nicht mehr davon reden.«
Leo nickte schweigend.
»Und wie bringe ich das Ganze meinem Vater bei?«
»Warte auf den richtigen Augenblick. Es wird nicht allzu schwierig sein. Ich habe ihm schon einiges erklärt. Von nun an mische ich mich nicht mehr ein. Das ist jetzt dein Problem.«
»Aufrichtigen Dank!«
»Gern geschehen. Sonst noch etwas?«
Leo zögerte.
»Wusste meine Mutter Bescheid?«
»Ich habe nie versucht, mit Lena darüber zu reden.«
»Warum nicht?«
Katjas Miene versteinerte sich.
»Das solltest du doch wissen. Weil sie Angst vor dir hatte. Deswegen.«
Leo traf es wie ein Schlag in die Magengrube. Ein langes Schweigen folgte. Was Katja sagte, entsprach einer Wahrheit, die Leo stets unterdrückt hatte. Es hatte schon früher solche Momente gegeben. Momente, in denen sie sich am liebsten vor der Welt verkrochen hätte. Jetzt aber spürte sie das Wachsen ihrer inneren Kraft und konnte die Wahrheit akzeptieren.
Schließlich brach sie das Schweigen mit den Worten:
»Werde ich irgendwann wieder … normal sein?«
»Normalität ist kein willkürlich definierbarer Zustand. Unser Gehirn ist eine komplexe Konstruktion. Normal sein, dazu bist du nicht gemacht. Überlasse das Normalsein den anderen, Leo.«
»Kein Wahnsinn, also?«
»Doch, aber einen heiligen. Dein Urgroßvater kämpfte für die Gerechtigkeit. Er wusste, welches Risiko er einging. Möglich, dass er exaltiert war, aber auf keinen Fall meschugge.«
»Warum hast du mir das alles nicht schon früher gesagt? Du hast es ja auch bereits mit neun Jahren erfahren?«
»Das verdankte ich den besonderen Umständen. Und auch du wirst zunehmend merken, dass du anders bist. Ohne gleich in die Metaphysik zu flüchten. Die bringt dir nämlich nur Scherereien.«
»Ich weiß.«