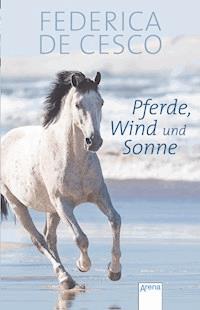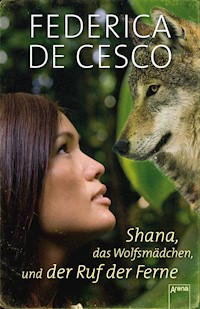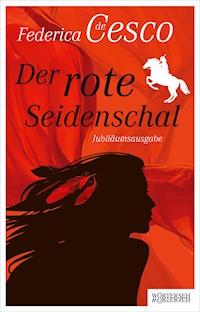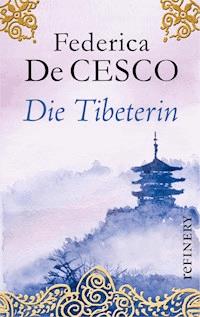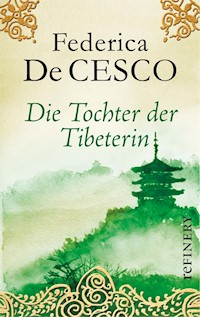
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tibet-Romane
- Sprache: Deutsch
Schweren Herzens hat die tibetische Ärztin Tara den eigenwilligen Nomaden und Fluchthelfer Atan, der ihr Herz erobert hat, ziehen lassen und ist mit ihrer Nichte Kunsang in die Schweiz zurückgekehrt. Sie leitet eine kleine Privatpraxis für tibetische Heilkunde, stürzt sich in die Arbeit, um der Einsamkeit zu entkommen. Kunsang fasst eine starke Zuneigung zu ihrem Großvater Tashi, der ihr die Lieder und Mythen des alten Tibet beibringt. Als er stirbt, gerät sie in eine schwere Krise: Kunsang wird magersüchtig, nimmt Drogen und droht in ein zwielichtiges Milieu abzurutschen. Tara gibt sich die Schuld, versucht vergeblich, das Mädchen zu verstehen. Beim Durchsuchen von Kunsangs Zimmer findet sie deren Tagebücher, in denen sie fassungslos von der Liebe ihrer Nichte zu Atan erfährt. Eines Tages ist das Mädchen spurlos verschwunden. Wochenlang ist die Familie außer sich vor Sorge – bis ein Brief aus Lhasa eintrifft. Tara handelt rasch, sie bucht einen Flug nach Tibet. Ihre einzige Hoffnung ist Atan; gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Kunsang …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Schweren Herzens hat die tibetische Ärztin Tara den eigenwilligen Nomaden und Fluchthelfer Atan, der ihr Herz erobert hat, ziehen lassen und ist mit ihrer Nichte Kunsang in die Schweiz zurückgekehrt. Sie leitet eine kleine Privatpraxis für tibetische Heilkunde, stürzt sich in die Arbeit, um der Einsamkeit zu entkommen. Kunsang fasst eine starke Zuneigung zu ihrem Großvater Tashi, der ihr die Lieder und Mythen des alten Tibet beibringt. Als er stirbt, gerät sie in eine schwere Krise: Kunsang wird magersüchtig, nimmt Drogen und droht in ein zwielichtiges Milieu abzurutschen. Tara gibt sich die Schuld, versucht vergeblich, das Mädchen zu verstehen. Beim Durchsuchen von Kunsangs Zimmer findet sie deren Tagebücher, in denen sie fassungslos von der Liebe ihrer Nichte zu Atan erfährt. Eines Tages ist das Mädchen spurlos verschwunden. Wochenlang ist die Familie außer sich vor Sorge – bis ein Brief aus Lhasa eintrifft. Tara handelt rasch, sie bucht einen Flug nach Tibet. Ihre einzige Hoffnung ist Atan; gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Kunsang …
Die Autorin
Frederica de Cesco, Tochter einer Deutschen und eines Italieners, wuchs in verschiedenen Ländern auf und hat bereits über fünfzig Romane geschrieben. Heute lebt die Bestsellerautorin mit ihrem japanischen Ehemann in der Schweiz.
Von Frederica de Cesco sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Tibeterin
Die Tochter der Tibeterin
Seidentanz
Die Traumjägerin
Das Vermächtnis des Adlers
Wüstenmond
Federica de Cesco
Die Tochter der Tibeterin
Roman
Ullstein
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-96048-024-2 Neuausgabe bei Refinery
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Dezember 2004
4. Auflage 2014
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München
© 2001 by Marion von Schröder Verlag
Redaktion: Johannes Thiele
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Für Dechen Dolkar, die mir den Weg zeigte. Und natürlich für Kazuyüki.
»Woher wüssten wir, wie wir leben sollen, wenn wir nicht an etwas glaubten, das größer ist als wir? Wer würde uns lehren zu leben?«
CHIPAROPAI, Medizinfrau der Yuma
»Wenn ich an den Menschen denke, sehe ich ihn umgeben von unzähligen Leben, die gemeinsam mit ihm existieren. Da sind nicht nur die Lebenden, auch die Toten scharen sich um ihn.«
KAZUO OHNO
Prolog
Sonntag morgen, halb elf. Basel erstarrte im eisigen Sprühregen; es war März und noch kalt. Über dem gotischen Münster wanderten Nebel. Der Regen verdunkelte den roten Sandstein, und beide Türme ragten hoch und kräftig empor wie Arme zum Gebet. Die Menge wartete; ein Wirrwarr von Stimmen erfüllte den Vorplatz, die aufgespannten Schirme leuchteten bunt und fröhlich. Ich war mit meiner Mutter aus Zürich gekommen, Tenzin hatte das organisiert und uns die Einladungen besorgt. Amlas Augen strahlten in verhaltener Freude. Auf ihrem straff geflochtenen Haar glänzten Regentropfen. Sie trug mit feinem Stolz die tibetische Tracht; ihre hohe Gestalt, ihr ovales, kupferbraunes Antlitz zogen manchen Blick auf sich. Die Menschen waren sehr zahlreich an diesem regnerischen Morgen, sie standen gruppenweise, und es kamen immer noch mehr. Ihre Gesichter zeigten eine Mischung aus Neugierde und Erwartung, angeregt und glücklich. Ein Ausdruck, der mir gefiel. Und mitten unter dem Regen empfand ich auf einmal eine wohltuende Vertraulichkeit im Niederplätschem der Tropfen, ein Befreundetsein mit der Lebensluft, die mich umfing, auch wenn sie kühl war. Die Gegenwart der schützenden Geister wurde mir ebenso bewusst wie im weiten tibetischen Raum. Unruhige, geniale Geister waren es, die hier wirkten, und die alten Steine beherbergten Visionen. Schon möglich, dass die Menschen hierzulande mühevoller zum inneren Frieden gelangten als bei uns, dass ihr Dasein sich stärker in alltäglicher Hektik erschöpfte. Und doch wussten auch diese Menschen mit festem, klarem Instinkt, wonach sie strebten und was gut für sie war. Daran dachte ich, als die Tore des Münsters aufgingen und die geladenen Gäste das Gotteshaus betraten. Kein Drängen und Stoßen, nein, ein ruhiges, beharrliches Strömen. Wir fanden bald unsere Plätze, und ich sagte zu Amla:
»Weißt du, ich habe mir überlegt, dass es schwierig sein könnte. Sie werden mich nicht zu Seiner Heiligkeit vorlassen.«
»Das macht nichts«, erwiderte sie gelassen. »Er wird dich schon sehen.«
»Aber die Sicherheitskräfte, stell dir das mal vor!«
»Er wird dich erkennen«, sagte Amla mit Nachdruck.
»Wie kommst du darauf?«
Sie schüttelte nachsichtig den Kopf.
»Es ist wirklich nicht nötig, dass du dir Sorgen machst.«
»Wie meinst du das, Amla? Ich verstehe dich nicht.«
Sie blieb mir die Antwort schuldig. Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Freiwillig gab sie nichts preis, das war es an ihr, was mich so oft nervös machte! In Amlas Vorstellungskraft lag nicht der geringste Zweifel. Ihr Glaube war unerschütterlich. Alles was geschehen musste, würde geschehen, und mein Anteil daran würde unvermeidlich und entscheidend sein. Jetzt aber spürte sie meine Verdrossenheit, denn für sie war ich nach wie vor ohne Geheimnis. Ihre warme, kräftige Hand suchte die meine, drückte sie. Die Berührung gab mir eine Ermutigung, ein gutes, starkes Gefühl. In mir kehrte Ruhe ein, eine wunderbare Ruhe. Nicht meine Geschichte war es, die hier erzählt werden sollte, sondern die Geschichte vieler Menschen und Dinge – eine Fabel voller Freude und Trauer, voller Liebe auch, Ehre, Mut und Schmerz. Ja, es war richtig, dass sie erzählt wurde, an diesem ganz besonderen Morgen. Und ich träumte, dass es eine Minute geben könnte oder eine Sekunde oder auch nur den Bruchteil einer Sekunde, während der Lebende und Tote ihre Hände verschränkten und sich in ihrem leuchtenden Kreis alle Kraft und Bedeutung sammelten. Darauf hoffte mein inneres Auge. Und gleichzeitig bewirkte der Zwiespalt in mir, dass ich allem misstraute, was unvorhersehbar und magisch war. Soweit ich mich entsinnen konnte, war mein Sehnen stets durch übermäßige Gedanken getrübt: Ich grübelte und zweifelte und analysierte. Und wünschte mir trotzdem, von ganzem Herzen und mit aller Kraft, an diesem Tag der Freude ein Wunder zu erleben.
1. Kapitel
Ich träumte nicht mehr wie früher. Nicht mehr von Chodonla jedenfalls. Von anderen Dingen. Und von Tibet, das zu mir herüberblickte über ganze Erdteile und Ozeane, eine Welt voller Licht und Schrecken, karger Berge, ziehender Wolken und heulender Winde. Was hatte ich damals von Lhasa gesehen? Hässlichkeit, Wellblech, Beton. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen. Wie fremd ich mich gefühlt hatte, obgleich ich in Lhasa geboren war! In der Dunkelheit meiner Erinnerung lag ein anderes Lhasa verborgen. Jahrelang hatte ich ein Bild gehütet, das es nicht mehr gab. Wir alle erliegen ja Trugbildern, lassen uns vom Irrationalen leiten. Zum Glück war ich nicht – wie manche Exiltibeter – in zwei Welten aufgewachsen. Das mochte meine Stärke sein; ich konnte die Zähne zusammenbeißen, den Dingen, die ich einst geliebt hatte, den Rücken kehren.
Mit Kunsang sprach ich selten darüber. Sie war auf besondere Art verschlossen; und obwohl sie erst fünfzehn war, wurden ihre Worte und Handlungen gelegentlich von Wahrnehmungen geprägt, die ich nicht deuten konnte. Oft kam sie mir sogar älter vor als ich. Wir Tibeter glauben an die Wiedergeburt, mir schien, dass Kunsang in den paar Jahren ihres irdischen Daseins schon mehrere Leben gelebt hatte. Zwischen uns lag eine Distanz, die mich oft überwältigte und erschreckte. Atan konnte mit ihr besser umgehen. Er wusste seit frühester Kindheit, wie ein Ereignis das nächste nach sich zieht oder wie sich gewisse Dinge unabhängig voneinander ergänzen.
Um alles zu verstehen, muss ich zum Kern der Geschichte zurück. Vergessen wäre vielleicht besser, aber vergessen konnte ich nicht. Waren es die Träume, die mich in jenes Land zurückgeführt hatten, das es nicht mehr gab? Wie es oft bei Exiltibetem vorkommt, hatte ich von meinem Geburtsort unklare und romantische Vorstellungen; die Realität war mir brutal und ernüchternd ins Gesicht gesprungen.
Atan, so hieß der Mann, den das Schicksal mir als Gefährten zugeführt hatte. Auch er hatte viele Leben gelebt. Nichts und niemand konnte ihn unvorbereitet treffen, abgesehen von ihm selbst. Das jedenfalls war mein Eindruck von ihm. Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Leben jemals einem Menschen begegnet war, der sich nicht vor dem Tod fürchtete. Atan war ein Mann, der alles über den Tod zu wissen schien, sich aber nicht vor ihm fürchtete. Das war das Außergewöhnliche an ihm. In meiner Welt hatte es solche Menschen zuvor nie gegeben. Meine Welt war voll von Menschen gewesen, die nicht begriffen, dass sie sterben konnten. Als Ärztin war mir das stets bewusst; dessen ungeachtet war mein Leben erfreulich unsentimental gewesen, bis sich mir eine neue Welt auftat, so fremd und beunruhigend wie die Welt der Dinosaurier.
Begonnen hatte alles 1968, als ich mit meiner Familie in einer stockfinsteren Sturmnacht aus Lhasa floh; in Tibet übten die chinesischen Rotgardisten die abscheulichsten Greueltaten aus. Es war eine Periode kollektiven Wahnsinns; viele Tibeter wählten damals das Exil. Während der überstürzten Flucht ging meine vierjährige Zwillingsschwester Chodonla verloren. Das Kind galt jahrelang als vermisst, bis sich herausstellte, dass Chodonla in einem Waisenhaus in China erzogen und als Lehrerin ausgebildet worden war. Ihr Mann war tot; sie hatte eine kleine Tochter, Kunsang. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie wieder in Lhasa, ging jedoch jeder Verbindung mit uns aus dem Weg. Wir konnten uns ihr Verhalten nicht erklären. Für meine Eltern war die Frage bedeutungslos. Chodonla war am Leben, nichts anderes zählte!
Ich hatte nicht ihre Gutgläubigkeit. Das Gefühl, dass sie in Gefahr war, ließ mich nicht los und war ebenso erschreckend wie einst meine Ungewissheit. Chodonla lebte in einer anderen Welt, und doch war sie ein Stück von mir. Die Verbundenheit zwischen Zwillingen berührt die Dinge, die tief in uns wurzeln, im Dunkel der Erinnerung des gemeinsamen Mutterleibes. Ich hatte das zunehmende Bedürfnis, Chodonla vor etwas unabwendbar Brutalem retten zu müssen. Ich sträubte mich dagegen, aber meine Unruhe wuchs; die ganze Situation war unerklärbar und erschien mir gleichwohl als ein objektives Phänomen, als etwas Reales. Und so kündigte ich kurz entschlossen meine Stelle im Kantonsspital Aarau, fuhr nach Nepal, ging bis nahe an die tibetische Grenze, nach Pokhara, wo meine Kusine Karma in einem Lager für tibetische Flüchtlinge die Krankenstation leitete. Heute verstehe ich, wie seltsam meine Reaktion meiner Familie vorgekommen sein musste. Ich hatte mich auf das Gebiet der Mikrochirurgie spezialisiert, nähte Blutgefäße unter dem Mikroskop, die kaum einen halben Millimeter maßen, und war auf meinem Gebiet eine anerkannte Spezialistin. Und plötzlich – wie aus heiterem Himmel – war ich fasziniert von der lamaistischen Heilkunst, die auf Massage, Aderlass und Hitzetherapie gründet. Irgendwann eröffnete mir der Gedanke, die westliche Medizin mit der zweitausend Jahre alten asiatischen Heilkunst zu verbinden, bestrickende Perspektiven. Karma war von einem berühmten Menrampa, einem tibetischen Professor, unterrichtet worden. Ich bat sie, mich als Schülerin aufzunehmen. Dabei kehrte ich der westlichen Medizin keineswegs den Rücken; meine Frage lautete lediglich: »Was hat die tibetische Medizin mehr zu bieten?« Es war durchaus keine rhetorische Frage: Karma war bereit, ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Ich lernte viel von ihr, es war von großer Bedeutung für mich und half mir auf meinem Weg weiter.
Von Karma erfuhr ich auch, dass meine Gefühle bezüglich Chodonla mich nicht getäuscht hatten. Und später war es Atan, der meine bösen Ahnungen schonungslos bestätigte. Je länger ich in jener Zeit darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich irgend etwas in dieser Angelegenheit tun musste. So beschloss ich, mit Atan nach Tibet zurückzukehren, um Chodonla zu sehen. Es wurde eine gefahrvolle Reise über die Pässe, und zum Schluss kam ich zu spät: Chodonla war tot, und ich gab mir die Schuld, dass ich zu lange gewartet hatte.
Doch da war ihre kleine Tochter. Mit Atans Hilfe hatte ich Kunsang aus Tibet fortgebracht. Es geschah gewaltsam; was ich dem Kind angetan hatte, würde ich wohl nie gänzlich erfahren. Kunsang äußerte sich nicht dazu. Ich gab mir Mühe, ihr näher zu kommen, und manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie mir vertraute. Ein andermal hätte ich ihr – sehr untibetisch – Tritte versetzen können. Würde irgend jemand in der Lage sein, den ganzen Umriss ihres Wesens zu erkennen? Ich wusste ja nicht einmal, ob sie sich selbst richtig kannte.
Gleich nach unserer Ankunft im Tashi-Pakhiel-Camp wurde Kunsang in die dritte Klasse aufgenommen. Ich merkte sehr bald, wie wenig sie hierher gehörte. Ihr Verstand war bereits viel weiter. Wer ihr Vater war? Chodonla hatte ihr Geheimnis mit in den Tod genommen. Von Sun-Li, dem Liebhaber ihrer Mutter, hatte Kunsang lediglich erfahren, dass ihr Vater Chinese war und sie aus diesem Grund nach China gehörte. Sun-Li war stets freundlich und gut zu ihr gewesen, und Atans Rolle in dieser Geschichte mochte sie nicht ganz überzeugt haben. Erst allmählich wurde ihr klar, dass tibetische Familien die schlimmsten Gefahren auf sich genommen hatten, um Chinas Diktatur zu entfliehen. Für Kunsang, die fließend chinesisch sprach, war das zuerst unbegreiflich gewesen. Sie selbst war ja – den Umständen entsprechend – behütet aufgewachsen.
Ich hatte damals nicht geglaubt, dass ich es schaffen würde, mit Kunsang das Sunpa-Khanpo-Kloster zu erreichen. Atan lag schwer verletzt in den Festungsruinen des siebten Panchen-Lamas. Ich hatte nur an seine Rettung gedacht, jedes gefährliche Risiko ausgehalten und schließlich mein Ziel erreicht. Der Abt hatte sofort eine Rettungsmannschaft auf den Weg geschickt. Doch ich konnte nicht länger warten: Man hatte für Kunsang einen Steckbrief herausgegeben, und die Schneefälle drohten jeden Tag einzusetzen. Tukten Namgang, der Abt, leitete alles schnellstens in die Wege; aus seiner Umsicht sprach große Vertrautheit mit Situationen dieser Art. Wir schlossen uns einem Händler und seinen drei Söhnen an, die mit Maultieren und einem Dutzend schwer bepackter Yaks über die Grenze gingen. Kunsang und ich galten als Familienangehörige; in unseren Pilgerpässen standen falsche Namen. Kunsang hatte ihr Haar schneiden müssen; sie trug es für gewöhnlich mit langen Fransen. Ihre unbedeckte Stirn war blasser als die übrige Gesichtshaut. Ich rieb ihr Gesicht mit Nussöl ein, um die Haut gleichmäßig zu tönen. Tagelang hatten wir die Grunzlaute der mit Warenballen bepackten Yaks und das Bimmeln ihrer Messingglöckchen in den Ohren gehabt. Noch war das Hochland an der Grenze Nepals schneefrei. Der erste Schneesturm setzte erst kurz vor dem chinesischen Grenzposten ein, und das war wiederum unser Glück. Andere Karawanen, die alle das gute Wetter genutzt hatten, stauten sich jetzt vor dem Zoll. Von orkanartigen Winden umbrandet, stapften die Grenzwächter im frischen Pulverschnee, auf der Suche nach Schmuggelware, und fanden natürlich welche. Fast jeder Händler musste Buße zahlen, bevor die Karawane weiterziehen konnte. Kunsang und mir schenkten die Chinesen nur geringe Aufmerksamkeit. So kamen wir über die Grenze. Wir begleiteten die Karawane bis nach Namche. Von dort aus gab es eine Flugverbindung nach Pokhara. Kunsang wurde ein Flüchtlingspass ausgestellt.
Bis ich Atan wiedersah, sollten acht Monate vergehen.
2. Kapitel
Wie war es gewesen, als wir uns wiedersahen, Atan und ich? Kritisch und aus der Distanz betrachtet, war jene Zeit im Tashi-Pakhiel-Camp, in der ich mich verzweifelt in meine tägliche Arbeit stürzte, für mich keine verlorene Zeit. Meine Gedanken waren andauernd beschäftigt, für unerfüllte Träume blieb nicht der kleinste Raum. War Atan am Leben, würde er es wohl versuchen, mich wiederzusehen. Aber nichts war sicher. Mit Karma sprach ich wenig darüber. Ich erinnerte mich an ihre Worte damals: »Du wirst seinetwegen leiden, Tara«, und hielt lieber den Mund. Ärzte haben keine Zeit für Neurosen. Liebeskummer? Seelenleid? Im Bett 4 liegt eine Frau, der du das Bein amputieren musst! Doch nachts, als ich mir meines Körpers und der Einsamkeit bewusst wurde, fühlte ich mich heimgesucht von seiner Gegenwart, hörte ich wieder seine Stimme und die Worte, die er damals beim Abschied gesprochen hatte: »Willst du auf mich warten, Tara? Ich komme zu dir. Du musst nur Geduld haben, es kann ziemlich lange dauern.«
Und ich? Was hatte ich geantwortet? Im Grunde genommen war ich keineswegs romantisch veranlagt. Aber damals war mir, als ob eine höhere Macht mir einen Verstand gegeben hatte, der mir ein klares und tiefes Gewissen verlieh. Und so hörte ich mich sagen:
»Ich warte auf dich. Wenn es sein muss, mein Leben lang.«
Einfach gesagt, wenn ich’s bedenke. Die Worte waren mir leicht über die Lippen gekommen. Heute schien mir, als sagten sie im Grunde nicht viel aus; ich war durch Erfahrung abgebrüht geworden. Inzwischen lief mein Leben routiniert ab. Ich arbeitete mit Karma in der Krankenstation, und Kunsang ging zur Schule. Von rascher Auffassungsgabe, zog sie aus den Unterrichtsstunden größeren Nutzen als ihre Mitschüler. Beliebt war sie nicht; sie hielt sich abseits. Dass sie Halbchinesin war, hatte sich bald herumgesprochen. Irgendwie hatte sie gelernt, ihr Gesicht ausdruckslos zu halten; mich jedoch täuschte sie nicht. Sie hatte Schweres durchgemacht, den Tod ihrer Mutter nicht überwunden, und vielleicht auch nicht ihre gewaltsame Trennung von Sun Li. Ihre Haltung war kühl, aber der Klang ihrer Stimme entzückte. Ohne es zu wollen, übte sie auf alle, die mit ihr in Berührung kamen, einen seltsamen Zauber aus. Gelegentlich bemerkte ich, dass sie gedankenverloren vor sich hin summte. Ihr Gesicht war nicht glücklich dabei; sie schien sich nicht einmal bewusst zu sein, dass sie sang. Eines Tages, als sie am Tisch saß und malte, fiel es mir besonders auf. Dass sie gerne und gut malte, wusste ich von Atan. Ihre Farben waren von großer Leuchtkraft, obwohl die Darstellung kindlich blieb. Ihre Bilder zu deuten war nicht einfach, denn in dem, was Kinder malen, liegt das Wesentliche im Nichtdargestellten. Trotz der Vielfalt und Schönheit der Farben zeigte die Strichführung Unsicherheit: Die Figuren strebten von der Bildmitte fort, als ob sie sich auflösen und verschwinden wollten. Es ist für jeden Menschen schwer, mit der Unausweichlichkeit seiner Einsamkeit fertig zu werden, aber ein Kind leidet mehr darunter. Es kann nichts anderes erreichen, als dass es seine Einsamkeit erkennt, anerkennt und sich daraus entwickelt. Kunsangs Mutter war tot, die alte Ani Wangmo und Sun Li, der sie legal adoptiert hatte, waren aus ihrem Leben verschwunden. Und Atan? Gab es ihn wirklich? Er kam und er ging. Mit dem feinen Instinkt des Kindes spürte Kunsang meine eigene Unsicherheit.
»Wo ist Onkel Atan? Wann kommt er endlich?«, fragte sie mich eines Tages.
Ich wandte den Blick ab und antwortete heiter:
»Bald. Er kommt bald. Er hat doch versprochen, dir das Reiten beizubringen.«
Sie wurde nachdenklich.
»Wird er reiten können? Mit seinem schlimmen Bein?«
»Aber sicher«, erwiderte ich. »Du warst doch dabei, als ich die Kugel entfernte.«
Sie nickte, mit starrem Gesicht.
»Er hat schrecklich geblutet.«
Mein Herz zog sich schmerzvoll zusammen.
»Das wird ihm wenig ausmachen. Er wurde schon oft verletzt, weißt du.«
Sie blickte sinnend vor sich hin.
»Ich werde ihm sagen, dass ich auf ihn warte«, meinte sie.
»Sie hat viel Phantasie«, sagte ich später zu Karma.
»Ich weiß nicht«, antwortete Karma, »da ist etwas anderes.«
»Wie meinst du das?«
»Kinder stellen sich Menschen vor, als stünden sie wirklich vor ihnen.«
Kunsang malte stundenlang, selbstvergessen und wie aus einem inneren Zwang heraus. Dabei sang sie die ganze Zeit vor sich hin. Wie lässt sich eine Stimme beschreiben? Damals, in Karmas kleinem Steinhaus, hörte ich sie zum erstenmal. Kunsang sang völlig unbefangen, wie ein Vögel mit den Flügeln schlägt. Ihre Stimme war kindlich, und sie sang auch ohne Worte; es war eher eine Modulation, und ich erkannte in ihr verschiedene Ansätze von tibetischen Volksliedern, die ineinander übergingen. Sie trug diese Melodien, so schien mir, unbewusst mit sich herum; womöglich waren sie für sie unbedeutend. Doch während sie malte, meldeten sie sich in ihrem Gedächtnis zu Wort. Es waren verschiedene Erinnerungen und Gefühle, denen sie sich unbefangen überließ, wie Kinder das zu tun pflegen. Mir fiel auf, wie mühelos, rein und klar ihre Stimme auch die schwierigsten Melodien wiedergab. Wir leben in einer rationalen Welt, und sobald ein Wesen unverfälscht seine Gefühle preisgibt, geraten wir in Verlegenheit.
Ging sie ihren Tätigkeiten nach, vermied ich es, über ihre Schulter zu blicken; ich wäre mir zudringlich vorgekommen. Umso erstaunter war ich, als Kunsang mir ein paar Tage später mit einem kleinen Lächeln auf dem Gesicht das fertige Bild hinhielt.
»Da! Ich habe Onkel Atan gemalt.«
Eine plötzliche Unruhe überkam mich; mein Herz schlug schneller. Aufgewühlt, wie ich war, vermochte ich das Bild nur mit einem Seitenblick zu streifen. Kunsang hatte Atan als riesenhafte, nahezu animalische Erscheinung gemalt, in einem groben Fellumhang. Die Hosen steckten in verschnürten Gamaschen. Das bronzefarbene Gesicht war von rabenschwarzen Flechten umrahmt, aus den großen Augen blickten ebenfalls schwarze Pupillen. Von der Darstellung ging etwas Wildes, Gebieterisches aus. Wenn man den Bildern ein eigenes Wesen zuspricht, ist das nicht anders als mit Worten: Sie werden lebendig, entfalten ihre Kraft. Ich staunte, dass Kunsang, so jung sie war, die Weite der Welt in ihrem Bild schon miteinbezogen hatte. Das kleine Mädchen hatte in Lhasa ein nüchternes, phantasieloses Leben gekannt. Die Chinesen dachten praktisch; die Regierung lockte die Siedler mit Geld und Vorteilen nach Tibet. Viele Neuankömmlinge sahen sich hier plötzlich in einen Lebensstandard versetzt, der unvergleichlich viel höher lag als der, den sie im Mutterland gekannt hatten. Alle wollten schnell Geld verdienen, für Gefühle hatten sie wenig übrig, und nur manche waren ehrlich davon überzeugt, auf ihre Art an der Vervollkommnung der Welt beteiligt zu sein. Einheimische und Chinesen begegneten sich gleichgültig, beinahe freundlich. Die älteren Tibeter lebten in großen Sehnsüchten; eine ungeheure Zäsur hatte ihr Leben gespalten. Die junge Generation war geschmeidiger, widersprüchlicher in ihrer ganzen Art. Kritischer? Ich vermochte mir kein gültiges Urteil zu bilden.
»Er wird bald da sein«, sagte Kunsang im Tonfall einer großen Befriedigung.
Im Tashi-Pakhiel-Camp ging ich im Kreis und kam trotzdem vorwärts. Alles, was hier geschah, war provisorisch, anregend, erregend. Hier konnte alles mögliche passieren. Ich hatte die Siedlung schon immer als überraschend gepflegt empfunden, eine Oase der Ruhe in einem Land, das Touristen ein willkommenes exotisches Chaos bot. Als ob die Flüchtlinge sich hier einen Ort der Besinnung einrichteten, eine Art Filmkulisse. Der massive, gelbgetünchte Klosterbau bildete den Mittelpunkt des Dorfes; Stoffbahnen mit Segenssprüchen flatterten vor dem Eingangsportal. Auch dies war nicht »stilecht«, denn Klöster wurden ursprünglich an abgelegenen Orten errichtet: Die Mönche (oder die Nonnen) sollten nicht abgelenkt werden. Aber hier war das Kloster ein Wahr- und Erkennungszeichen, ein stetig schlagendes Herz. Regelmäßig stieg der Rhythmus der Trommeln aus dem Inneren der Mauern auf, kreiste über die Siedlung, ein gewaltiges Vibrieren. Die Menschen, die Angst und Schmerz erlebt hatten und nachts schreckerfüllt aufwachten, hörten den Rhythmus wie der Fötus im Mutterleib das Pulsieren des Blutes. Und schliefen beruhigt wieder ein.
Karmas kleines Reihenhaus, aus groben Steinen erbaut, befand sich unweit der Krankenstation. Hinter einer Hecke lag eine kleine Rasenfläche. Tausendschön und kleine bunte Nelken, die wenig Pflege bedurften, blühten in Töpfen. Im Wohnzimmer befand sich, wie in allen tibetischen Häusern, eine Altarwand mit dem vergilbten Porträt des Dalai Lama, sieben Silberschalen und zwei schöne alte Butterlampen. Täglich füllte Karma frische Blumen in die Vasen. Die Möbel bestanden aus einer Sitzbank mit Kissenrollen und dunkelblauen, verstaubten Teppichen. Nachts schlief Kunsang dort, weil im winzigen Schlafzimmer kein Platz mehr war. Karma und ich teilten uns ein enges Sofabett. Zu der Wohnung gehörte eine Kochnische, die ständig in größter Unordnung war, und ein dürftig eingerichteter Waschraum. Der Duschkopf war in die Wand montiert, und der Lehmboden mit einem Abflussrohr versehen.
Hier lebte ich nun beinahe zwei Jahre, arbeitete in der Krankenstation und nahm Unterricht bei Karma. Ihre Unterweisung zog mich in ein ganzes Netz von Verwandlungen und Geheimnissen; gleichwohl empfand ich selten ein wirkliches Gefühl der Fremdartigkeit. Karmas Wissen offenbarte mir Dinge, die schon in mir waren, vielleicht seit Jahrhunderten; es galt lediglich, sie zu nutzen. Jede Handlung entsprang einer langen Tradition. Mir schien, als ob ich diese schon immer wahrgenommen hatte. Rückblickend betrachtet war es eine merkwürdige Unterweisung, nicht systematisch wie ein übliches Medizinstudium, sondern fließend wie die Zeit; eine Lehre, die mir beibrachte, was zu hm war, damit das Leben weiterging.
Ende April erhielten wir die Nachricht, dass Jonten Kalon, der alte, ehrwürdige Menrampa, gestorben war. Sein Tod überraschte uns kaum; er war längst über neunzig gewesen, hatte viele Jahre in chinesischer Gefangenschaft verbracht und war grausam gefoltert worden. Bei diesem Ereignis kamen mir die Worte des alten Mannes wieder in den Sinn: »Wenn ein Mensch merkt, dass sein Atem zum Ende zugeht, möchte er denen, die nach ihm kommen, den Rhythmus des eigenen Atems übermitteln. Und der Atem des Arztes ist seine Erfahrung. Er möchte sein Wissen weitergeben.«
»Er hat mich gut unterrichtet«, sagte Karma. »Und das, was ich von ihm lernen konnte, habe ich dir beigebracht. So muss es sein.«
Ich sagte zu Karma:
»Es gibt Momente im Leben, so intensive Augenblicke, dass wir davon geprägt werden. Einer dieser Momente war, als ich Jonten Kalon traf.«
Sie lächelte.
»Und die anderen?«
Ich wandte die Augen ab.
»Er wäre verrückt, wenn er so weitermachen würde«, sagte ich, und sprach natürlich von Atan.
»Er ist verrückt, das ist doch klar«, erwiderte Karma, die sofort verstanden hatte.
»Na ja, wenn du es sagst …«
»Du kannst es mir glauben. Auf der anderen Seite … Ich denke, dass du etwas in ihm bewirkt hast.«
Ich hob den Kopf.
»Was denn, Karma?«
»Vielleicht hast du seinem Leben einen Sinn gegeben?«
Ich schwieg und betrachtete das Bild, das Kunsang von Atan gemalt hatte. Es hing vor mir an der Wand und hätte ebenso gut ein Bär oder ein Baum sein können. Auf merkwürdige Weise entsprach das Bild genau dem Menschen, den ich kannte. Die Schatten vergangener Zeiten huschten beständig über sein Gesicht. Er hatte sein Leben lang Pferde zugeritten und Waffen getragen, und doch war etwas Sanftes in ihm, in seinem Lächeln. Er war auf seine Art ein Weiser.
»Aber er wird wiederkommen«, sagte ich laut, für mich selbst.
Karma sah mich an, ein kleines Lächeln hob ihre Lippen.
»Was das betrifft, ich denke, ja.«
Der Monsun setzte ein. Schon vormittags war die Hitze drückend. Die fernen Berge waren nebelverhüllt; tagsüber herrschte nur fahles Licht. Wolken quollen empor, mit ihnen kamen die Gewitter. Der Himmel wurde schwarz und grau und schmutzig grün. Unaufhörlich krachte der Donner; ein Schlag war noch nicht verhallt, schon schmetterte der nächste. Es hörte sich an, als berste der Himmel von fern her über den Bergen mit klaffenden Rissen auf.
Schwefelblaue Flammen erleuchteten das Hochtal. Dann wieder tropfte Hitze aus dem schmelzenden Regen. Unermüdlich prasselte Wasser aus sämtlichen Dachrinnen, zersplitterten weiße Sterne im Sand, bildeten sich riesige Pfützen. Der Monsun war die schlimmste Jahreszeit in Nepal. Und solange Monsun war, würde Atan nicht kommen.
Vom Regen wie von einem Vorhang eingeschlossen, stapfte ich von unserem Haus zur Krankenstation und wieder zurück. Die Patienten waren durchgeschwitzt und apathisch, die klammen Bettlaken rochen nach Urin. Die tägliche Routine brachte mir, wie immer, Erleichterung. Es gab Arbeit, Berge von Arbeit. Jeder einzelne Kranke brauchte Zuwendung. Einige hatten Typhus, andere Malaria, die meisten Lungenentzündung, Infektionen und Durchfall. Viele von ihnen waren außerdem Opfer der schweren Folgen ihrer Flucht: Knochenbrüche, Erfrierungen. Doch der gewaltige Lebenswille der Tibeter überraschte mich stets aufs neue. Ich sprach darüber mit Mathai Shankar, dem Leiter der Krankenstation. Seine Sanftheit und Güte ließen vergessen, dass er ein Rana war, aus dem Kriegergeschlecht der indischen Radjsputen, die ein Jahrhundert lang despotisch über Nepal geherrscht hatten. Dr. Shankar hatte in Bombay studiert und war vom Gesundheitsministerium nach Pokhara geschickt worden. »Diese Menschen ringen bis zuletzt mit dem Tod. Es ist eine große Anstrengung, in den Bergen zu leben. Wieviel Selbstüberwindung und Härte das braucht, wie viel Einsicht in die absoluten Notwendigkeiten, können wir kaum ermessen. Wären derartige Menschen nachgiebig und weich, sie müssten versagen, zerbrechen.«
Ich dachte an Atan, an seine ungeheure Anpassung an die Umstände und Widrigkeiten, sein zähes Festhalten und Nichtaufgebenwollen. Der Mensch in den Bergen sucht nicht den Tod, sondern die Erfüllung des Lebens.
»Auch Sie haben etwas davon«, setzte Mathai Shankar mit seiner leisen, wohlklingenden Stimme hinzu.
»Ich?« Ich lachte verlegen. »Ich bin wohlbehütet in der Schweiz auf gewachsen. Ich bin verweichlicht …«
»Sie sind zäher, als Sie glauben«, sagte Shankar. »Sie können viel aushalten und machen nie schlapp.«
»Wäre weniger zu tun«, sagte ich, »könnte ich mich durchaus aufs Ohr legen und ein faules Leben führen. Aber so, wie das hier aussieht? Und wenn man etwas macht, soll man es recht machen.«
»Und das ist alles?«, schmunzelte Shankar.
Er kannte mich gut und erwartete keine Antwort. War ich aufrichtig mit mir selbst? Nein, natürlich nicht. Man verfällt einer Leidenschaft ganz oder nicht, und wenn nicht, dann ist es keine Leidenschaft. Wenn doch, muss sie Erfüllung finden.
In letzter Zeit machte Kunsang einen merkwürdig teilnahmslosen Eindruck. Offenbar bekam ihr das Klima nicht. Allmählich, ich konnte nicht einmal sagen, wie es vor sich ging, entstand eine Art stumme Spannving zwischen uns. Kunsang, die nie ein lebhaftes Kind gewesen war, wurde ausgesprochen still. Sie schien nicht gerade betrübt, doch sie war jetzt noch stärker in sich gekehrt. Ihre Augen glänzten matt, ihre Mundwinkel zogen sich leicht herab. Ihre Art zu reden wurde verschlossen, nahezu einsilbig. Ich dachte, nach dem Monsun wird sich alles wieder einrenken, doch Karma hatte in vielerlei Hinsicht ein feineres Gefühl als ich.
»Kunsang muss von hier weg. Es ist nötig, glaube mir! Ich beobachte sie schon lange. Sie lebt in einer Art Betäubung und bringt keine Bereitschaft mehr auf, sich zu entwickeln.«
»Sie schien doch die Ereignisse gut überstanden zu haben …«
»Das dachte ich zunächst auch«, sagte Karma. »Aber wir täuschen uns. Das Gewerbe ihrer Mutter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts davon wusste.«
»Sie konnte das doch gar nicht so genau wissen«, versuchte ich abzuschwächen.
»Hast du mit ihr mal darüber gesprochen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Nein, natürlich nicht!«
»Sie ist zwölf, Tara. Kinder sind gute Beobachter und registrieren unser Verhalten genau. Wir sprechen bestimmte Dinge nicht an, weil wir vorgeben, ein Kind schützen zu wollen. Aber im Grunde schützen wir uns selbst.«
Ich konnte ihr nicht widersprechen; das alles traf irgendwie zu. Karma fuhr fort:
»Kunsang hat einen Flüchtlingspass. Ihre Mutter wurde von den chinesischen Behörden verfolgt, weil sie für die Untergrundkämpfer tätig war. Die einzige Familie, die Kunsang noch hat, lebt in der Schweiz. Man wird ihr politisches Asyl gewähren.«
Ich wusste, dass Karma die Wahrheit sprach. So jung Kunsang auch war, die Ereignisse konnten nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein. Sie brauchte ein anderes Leben. Ich sagte:
»Ich wollte eigentlich hier warten …«
Karmas Augen wurden schmal.
»Auf ihn?«
Ich empfand ein undeutliches Gefühl der Bitterkeit, der Hoffnungslosigkeit. Und ich konnte es auch nicht vermeiden, dass aus meinen Worten eine gewisse trotzige Zurückhaltung sprach.
»Ich habe ihm versprochen, auf ihn zu warten, ohne zu wissen, wann er kommt …«
Ich wollte hinzufügen: »und ob er noch am Leben ist«, aber ich sprach die Worte nicht aus. In mir lebte instinktiv die alte Empfindung, dass Worte in unserem Geist Wirklichkeit annehmen.
Karma sah mich scharf an. Sie fühlte wohl, was ich empfand.
»Es ist keine gute Reisezeit«, sagte sie versöhnlich. »Warte, bis der Monsun vorbei ist.«
Spät am Abend setzte ich mich zu Kunsang, die bereits auf der Sitzbank, die ihr als Bett diente, in ihre Decken gehüllt lag. Wieder einmal kam mir deutlich die Erinnerung an das erste Mal, als ich sie gesehen hatte, in diesem Fertigbau für chinesische Kaderleute, am Ufer des Tsangpo. Damals lag sie auf einem Feldbett und schlief; ich entsann mich ihrer Wangenlinie, des zart geschwungenen, kindlichen Halses, des langen Haars, schimmernd wie Quecksilber. Das Haar hatte ich ihr schneiden müssen, wie ein Junge hatte sie eine Zeitlang ausgesehen, doch jetzt wuchs es nach und erreichte fast ihre Schultern. Sie betrachtete mich aus ihren mandelförmigen Augen, aus denen etwas unleugbar Fremdes sprach.
»Kunsang, würde es dir Freude machen, mit mir in die Schweiz zu kommen? Zu den Großeltern?«
Ihr Gesicht blieb ausdruckslos.
»Sie kennen mich nicht.«
»Nein, aber sie werden dich von ganzem Herzen lieben. Du hast deine Mutter verloren, aber du bist nicht ganz allein, weißt du. Du hast eine große Familie.«
Sie sah mich an mit diesen merkwürdigen, tiefen Blick.
»Immer, wenn ich dich ansehe, muss ich an meine Amla denken …«
Ich sagte dumpf:
»Das ist auch richtig so. Wir waren ja Zwillinge und standen uns sehr nahe.«
In Wirklichkeit stimmte es nicht ganz, aber ich wollte, dass sie es glaubte. Sie schwieg, bewegte ihre dünnen Finger in der anmutigen Art, die einst die von Chodonla war.
»Nun?«, sagte ich.
Kunsang war ein Kind, das niemals gedankenlos sprach.
»Ich reise gerne in die Schweiz«, antwortete sie nach einer Weile. »Aber mein Onkel hat versprochen, dass er bald kommt. Ich will zuerst auf ihn warten.«
Ich fühlte meine Wangen heiß werden. Ich hatte immer geglaubt, dass ich wohl fähig sein würde, mit Gleichmut an Atan zu denken. Die meiste Zeit hielt ich sein Bild auf Distanz von mir, gebot allen aufwühlenden Erinnerungen vor der Pforte meines Bewusstseins Halt. Es lohnte sich nicht, redete ich mir ein, mein Leben auf ihn auszurichten. Ich würde dadurch nur abgelenkt werden. Es war merkwürdig, wie die Worte des kleinen Mädchens mich beruhigten, mir Trost und Hoffnung gaben. An der schlichten Einfalt von Kunsangs Glauben zerschellten meine Zweifel. Ohne dass ich es mir eingestand, war ich es so müde, mir Sorgen zu machen, voll zorniger Verachtung für mich selbst. Immer das gleiche dumme Spiel, zu dem ich mich hergab! In meinem Alter! Aber man kann in jedem Alter jemanden herbeisehnen. Es ist ein Bedürfnis, das befriedigt werden will. Von nun an, dachte ich, will ich nicht mehr fragen, ob er kommt oder nicht. Ich würde mir eine Frist setzen. Und dann eine Entscheidung treffen.
3. Kapitel
Wir richten uns alles nach unserer Phantasie ein und sind oft unfähig, einfach die Wirklichkeit zu erleben. Die Vergangenheit mischt sich in die Gegenwart, verblichene Szenen werden lebendig. Ich wollte sie verdrängen, als ob es sich um etwas Verbotenes handele. Nein, es war kein Zustand ruhiger Gelassenheit, in dem ich mich befand. Das einst Erlebte blieb zutiefst gegenwärtig, ein Schatten, der mich auf Schritt und Tritt begleitete. Und für manche dieser Bilder übernahm ich keine Verantwortung.
Dabei kam mir mein Vater in den Sinn, dessen Geist sich durch Raum und Zeit bewegte. Ich konnte es ihm nicht gleichtun, ich rannte gegen Mauern. Ich weiß natürlich nicht genau, wie mein Vater das fertigbrachte, und die Erklärung, die Atan mir damals gegeben hatte, befriedigte mich nicht. Das Wesentliche würde mir immer ein Rätsel bleiben. Ich nehme an, mein Vater hatte sich selbst als Versager empfunden, und sein späteres Schicksal hatte ihn – wie anders wäre es möglich gewesen? – in diesem Gefühl bestätigt. Er hatte in Atan ein Ideal gesehen, den Menschen, der er sein wollte und nie hatte sein können, jedenfalls nicht im gegenwärtigen Leben. Ich jedoch musste, um meinen Vater genau zu verstehen, immer wieder zu diesem Bild zurückehren: die beiden verzweifelt weinenden kleinen Mädchen, die von den Rotgardisten gezwungen wurden, ihren Vater zu steinigen, und dann dieser Mann, der plötzlich aus dem Nichts auftauchte: ein königlicher Wolf, der winselnde Schakale verscheuchte. Ich weiß es nicht genau, aber ich neige dazu anzunehmen, dass dieses Bild die Erinnerung meines Vaters unauslöschlich geprägt hatte. Er hatte sich in Tagträumen verloren, seinem Retter eine Geschichte zugedacht, zuerst verschwommen und zögernd, dann für ihn immer deutlicher erkennbar. Und nun, ein alter Mann am Ende seines Lebens, ließ er die Erinnerung vorbeiziehen, bis das einst Erlebte, aus welcher Ferne es auch gekommen sein mochte, greifbar und zutiefst gegenwärtig wurde. Schon möglich, dass jeder Mensch, der in unser Leben auf irgendeine Art eingreift, jemand anders ist, als der, wofür wir ihn halten. Aber im Fall meines Vaters und Atans stimmten Traum und Wirklichkeit überein. Auf irgendeine verschrobene Art hatte Vater die Gewohnheit angenommen, in der Wirklichkeit nichts als die Spiegelung eines Traumes zu sehen. Und wenn ihn zuweilen das Echo einer fernen Stimme erreichte, die ihm vorwarf, er lebe auf der Flucht vor der Welt, so zuckte er nur die Schultern – was wussten die anderen schon?
Ich hatte eine Fehlgeburt versorgt; die Frau hatte viel Blut verloren, und wir mussten eine Transfusion machen. Als wir fertig waren, ging es ihr schon wieder gut genug, um ihren gänzlich verstörten Mann trösten zu können. Müde kam ich aus der Krankenstation, wir hatten starken Westwind; der Luftstrom brandete gegen die Himalayakette an, und der aufgewirbelte Schnee verwandelte sich in Regen. Die windgeschüttelten Pappeln, die braunen Hügel unter dem grauen, ausgewaschenen Himmel schienen wie in Cellophanbeutel gehüllt. Ich ging schnell, die Tropfen prasselten wie Hagel auf meinen Schirm, der sein Gewicht rasch zu verdoppeln schien. Ich trug Gummistiefel, watete knöcheltief im Schlamm, der aus dem verwüsteten Ackerland die Straßen überschwemmte. Ein paar abgemagerte Hunde stöberten in vermoderten Abfallhaufen. Unzählige Male hatte ich mir ausgemalt, wie es sein würde, wenn Atan und ich wieder zusammenkamen. Und dann geschah es auf die einzige Weise, die ich mir nicht vorgestellt hatte: Ich lief um die Pfützen mit gesenktem Kopf, als ich unversehens gegen einen Mann prallte, der reglos wie aus Stein mitten auf der Straße stand. Ich blickte unter meinem Schirm hervor und sah ihn. Ich konnte nichts sagen, nichts denken – ich stand wie gelähmt. Merkwürdigerweise war meine Wahrnehmung weniger auf seine Erscheinung gerichtet, als auf etwas Nebensächliches: den Geruch nach Fett, Holzkohle und Holunder, der herb und vertraut aus seinem Fellmantel strömte. Ich entsann mich, im Bruchteil eines Atemzuges, wie oft ich unter diesem Mantel geschlafen hatte.
Wie lange wir so verharrten, weiß ich nicht. Wären wir Europäer oder Amerikaner gewesen, so hätten wir unseren Gefühlen durch Umarmungen und Küsse mitten auf der Straße Ausdruck gegeben. Doch wir waren Asiaten; wir wussten beide, dass unsichtbare Augen uns beobachteten, und von erwachsenen Menschen wird Zurückhaltung erwartet. Obendrein war ich Ärztin, man zollte mir Respekt. Und so standen wir beide unbeweglich, sahen uns lediglich an. Was Atan durch den Kopf ging, konnte ich nur erahnen; sein Gesicht war ausdruckslos. Er berührte nicht einmal meine Hand. Ich stand stocksteif vor ihm, mit starrem Blick. Meine Gedanken rasten wild durch den Kopf, während keine Silbe über meine Lippen kam. Atan brach als erster das Schweigen.
»Man sagte mir, dass ich dich in der Krankenstation finde.«
Wieder wurde mir die besondere Art bewusst, in der Atan sprach. Er gebrauchte seine Stimme in der Weise der Leute, die nicht gehört werden wollen, wenn sie sich unterhalten, der Späher, der Gefangenen, der Untergrundkämpfer. Eine Stimme ohne jede Schwingung, ohne Resonanz und Klang. Vielleicht war es nicht seine ursprüngliche Stimme, aber diese Sparsamkeit des Tons war ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie zu einem Teil von ihm geworden war. Nie hatte ich gehört, dass Atan die Stimme erhob, nicht einmal zu einem Befehl.
Ich schluckte und konnte spüren, wie mein Herz raste.
»Hast du gegessen?«
Der vertraute spöttische Funke tanzte in seinen Augen.
»Noch nicht.«
»Komm!«, sagte ich und fügte hinzu:
»Kunsang ist in der Schule.«
»Wie geht es ihr?«, fragte er.
»Sie wusste, dass du kommen würdest«, sagte ich. »Das ist sehr merkwürdig.«
Er nickte, nicht im geringsten erstaunt.
»Sie ist ein mutiges Kind«, sagte ich.
»Ja, das ist sie.«
Er ging an meiner Seite, mit lautlosen Schritten; mir fiel auf, dass er das Bein etwas nachzog.
»Wie steht es mit deiner Wunde?«
»Du hast sie gut zusammengeflickt.«
»Nein. Es war schlampige Arbeit. Schmerzt sie dich noch?«
Er lachte leise.
»Nur bei feuchtem Wetter. Ich werde alt.«
»Und die Kopfwunde?«
Er schob seinen olivgrünen Filzhut in den Nacken. Die Narbe an der linken Stirnseite, wo die Kugel ihn gestreift hatte, würde sich wohl kaum ganz zurückbilden. Aber ich war zufrieden, dass sein Auge unversehrt geblieben war.
»Du hast Glück gehabt.«
»Mit einer Ärztin zu reisen hat Vorteile.«
Ich lachte, weil ich glücklich war und doch nicht wusste, was ich tun oder denken sollte. Immer noch aufgewühlt durch seine Gegenwart, stapfte ich ihm voraus, durch den aufgeweichten Vorgarten, stieß die Tür auf und stellte den Schirm ab. Er ließ seinen Fellumhang von den Schultern gleiten und schüttelte ihn, bevor er hinter mir in die Wohnung trat. Ich machte Licht; die trübe Neonröhre flammte auf.
»Setz dich«, sagte ich. »Karma hat gekocht, ich brauche das Essen nur aufzuwärmen. Wo bist du untergebracht?«
In der Nähe des Klosters befand sich ein Gästehaus. Frauen und Männer schliefen in getrennten Gemeinschaftsräumen. Manchmal waren die Räumlichkeiten überfüllt, aber in der Zeit des Monsuns fand man leicht eine Unterkunft.
Er ließ sich auf der Sitzbank nieder; es war wirklich erstaunlich, wie gelenkig das Bein wieder war. Ich zog meine Windjacke aus, völlig versunken in der Wahrnehmung seiner Gegenwart. Dadurch, dass er zu mir gekommen war, hatte er die Spannung gelöst, unter der ich seit Monaten stand. Aber gleichzeitig wusste ich mit unerträglicher Sicherheit, dass da nichts Endgültiges war, nichts, was mich binden oder beschweren konnte. Er hatte versprochen, dass er kommen würde, und er war da. Morgen war ein anderer Tag.
Während ich in der Kochnische hantierte, schien mir, dass ich mehr Lärm als gewöhnlich machte. Meine Hände zitterten. Ich gab mir Mühe, meine Erregung zu beherrschen. »Sei keine Närrin! Er ist da, und wird wieder gehen. Was soll er hier im Camp? Mit alten Männern Bier trinken und Erinnerungen tauschen? Du bist eine intelligente Frau, Tara, du darfst dir nichts vormachen. Du wirst ihn aufgeben müssen, das ist besser für alle. Er ist am Leben geblieben, das sollte dir genügen.«
Unser Speisezettel war einfach, nahezu phantasielos, aber Karma kochte gut. Ihre scharf gewürzten Momo – mit Hammelfleisch gefüllte Teigtaschen – schmeckten ausgezeichnet. Buttertee stand immer in der Thermosflasche bereit; mir war er zu salzig, ich bevorzugte morgens Milchtee. Ich goss Atan Buttertee ein, stellte die Thermosflasche auf den Tisch und brachte die aufgewärmten Momo in einer Schale. Wie immer aß Atan langsam und mit Bedacht; ich selbst brachte kaum einen Bissen hinunter. Wie hypnotisiert saß ich ihm gegenüber, konnte die Augen nicht von dem nussbraunen Gesicht wenden, von den großen Pupillen unter den geschwungenen Augenlidern. Mir schien, sein Gesicht war ruhiger als früher, aber ich mochte mich täuschen. War er jemals ruhig gewesen?
»Der Monsun ist schlimm in diesem Jahr«, sagte ich. »Ich dachte nicht, dass du kommen würdest.«
»Ich war in Indien.«
»Was hast du in Indien gemacht, Atan?«
Er warf mir einen langen Blick zu.
»Du weißt doch, ich hatte eine Aufgabe zu erledigen.«
»Ach ja, deine Aufgabe …« Ich lächelte flüchtig. »Und … hast du sie erledigen können?«
»Ich würde sagen, ja.«
»Hast du Seine Heiligkeit gesehen?«
»Man hat mich nicht vorgelassen. Diese verdammten Bullen sind alle gleich, ob sie einen Helm oder eine Mönchsrobe tragen. Aber die Dokumente, die ich für Seine Heiligkeit zusammengestellt habe, wurden ihm übergeben, das jedenfalls steht fest.«
»Wie kannst du dir so sicher sein?«
Er runzelte leicht die Stirn.
»Ich habe das Orakel befragt. Es hat den Geist meiner Mutter gerufen. Ihre Antwort war ja.«
Bei diesen Worten war Atans Stimme melancholisch geworden. Auf seinem Gesicht lag jener erregende Ausdruck von Traum, den Menschen manchmal annehmen, wenn sie die Zuversicht und den Glauben ihrer Jugend wieder heraufbeschwören. Atan sah es als Tatsache an, dass die Unterlagen, für dessen Aufspüren er zehn Jahre seines Lebens geopfert hatte, sich nun in den Händen des Dalai Lama befanden. Früher hätte ich nur mit Mühe seine Überzeugung geteilt, aber ich hatte in Tibet gelernt, die Visionen der Orakel zu achten. Atans Mutter Shelo war eine Heldin des tibetischen Widerstandes und eine berühmte Träumerin gewesen. Die Nomaden lebten seit vielen Generationen in enger Verbindung mit der Natur, daran hatte weder die chinesische Besatzung noch der moderne Zeitgeist etwas ändern können. Irgendein tiefer Instinkt sagte ihnen, dass man von einer Welt in eine andere wechseln kann.
Ich sagte:
»Und was wirst du jetzt tun, Atan? Jetzt, wo deine Aufgabe erfüllt ist?«
Er nickte vor sich hin, mit einem merkwürdigen Glitzern in den Augen.
»Darüber muss ich nachdenken.«
»Vielleicht gibt es für dich noch andere Aufgaben.«
Er nahm erneut einen Schluck Tee, wobei seine dunklen Augen mich über den Rand der Schale betrachteten. Endlich nickte er.
»Auch darüber habe ich nachgedacht.«
»Ja?«
»Ich habe auch an dich gedacht. Genau genommen jeden Tag.«
Ich erwiderte fest und voll seinen Blick.
»Ich auch«, erwiderte ich rau. »So habe ich es überstanden.«
Die Bewegung hatte ich nicht geplant, dass ich meine Hand neben die seine auf den Tisch legen würde. Er folgte meiner Geste mit den Augen, hob seine Hand; gerade als er sie auf die meine legen wollte, schweiften seine Augen von mir ab, richteten sich auf die Tür.
»Kunsang«, sagte er und zog seine Hand zurück.
Bei den Nomaden war der sechste Sinn so fein wie bei einem Tier, und ich wunderte mich nicht, dass ich ihre Schritte erst einen Atemzug später hörte. Das Mädchen stellte draußen ihren Schirm ab, stieg vor der Haustür aus ihren Gummistiefeln und trat ein. Sie streifte mich mit einem schnellen, überraschten Blick, der dann weiterglitt und sich auf die große, dunkle Gestalt richtete, die im schummrigen Lichtschein sichtbar wurde. Dabei ging über Kunsangs Gesicht ein so helles Leuchten, dass ich unwillkürlich ihr Glück mitempfand.
»Onkel Atan!«
Die Art, wie sie mit ihm sprach, entbehrte nicht der herkömmlichen Formen, die ein Kind einem Erwachsenen schuldet. Chodorda hatte Kunsang gute Manieren beigebracht; nach alldem, was geschehen war, sah ich es mit Freuden. Bisher hatte ich mir keine Vorstellung davon machen können, wie das Mädchen Atan begegnete. In jener Nacht, als wir sie aus dem chinesischen Baulager entführt hatten, war sie verstört und misstrauisch gewesen, voll widersprüchlicher Empfindungen. Nun stand sie vor ihm, in Pulli und Jeans, ihre Füße steckten in nassen Baumwollsocken. Das blauschwarze Haar umrahmte ihre länglichen Wangen. Ich dachte, sie würde vielleicht befangen sein, doch nein, ich entdeckte in ihr viel Neugierde und eine große Lebhaftigkeit.
»Bleibst du jetzt bei uns, Onkel Atan?«
Schmunzelnd deutete er auf das Bild, das ich mit Reißnägeln an der Wand befestigt hatte.
»Soll ich das sein?«
Sie nickte glücklich.
»Ja. Erkennst du dich wieder?«
Er ließ sie nicht aus den Augen.
»Warum hast du mich gemalt, Kunsang?«
Sie antwortete mit großer Natürlichkeit:
»Weil ich wollte, dass du kommst.«
Er lächelte, wenn auch nur flüchtig.
»Siehst du, jetzt bin ich da.«
Sie nickte. Sie war überzeugt, dass sie etwas bewirkt hatte. Die triumphierende Schalkhaftigkeit ihrer Augen zeigte es deutlich genug.
»Du hast versprochen, mir das Reiten beizubringen.«
Atans Ausdruck verfinsterte sich.
»Im Augenblick kann ich das Versprechen nicht halten. Ilha ist tot.«
Kunsangs Lächeln verschwand. Ihre Züge drückten Bestürzung aus.
»Dein schönes Pferd? Tot?«
Ich erinnerte mich an den perlmuttweißen Hengst mit dem edlen Kopf und der üppigen, gekräuselten Mähne.
»Was ist geschehen?«
»Er muss etwas gefressen haben, was ihm nicht bekommen ist. Er starb an Koliken. Ich konnte nur hilflos zusehen. Er war seit zwölf Jahren mein Bruder.«
»Und was nun, Onkel Atan?«
»Der Verlust eines Pferdes ist schwer zu ertragen. Bei uns erzählt man sich die Geschichte eines Reiters, der die Knochen seines verstorbenen Lieblingspferdes in seiner Jurte aufbewahrte.«
»Ich kann das verstehen«, sagte ich.
Er nickte.
»Man kann ein Pferd nicht zähmen wie einen Hund. Nun bin ich auf der Suche nach einem Freund. Vielleicht lässt sich ein solches Tier finden. Aber mein Herz ist gebrochen.«
Kunsangs Lippen waren blass geworden. Sie sahen sich an; Atan las in den Augen des Kindes stillen Schmerz und antwortete darauf mit einem Blick.
»Dann werde ich warten«, sagte sie. »Bis du wieder einen Freund hast. Du musst dir ein neues Pferd anschaffen.«
»Das wird gar nicht so einfach sein.«
»Ich kenne ein Pferd«, erwiderte sie lebhaft. »Ich habe es oft gemalt. Wie gefällt es dir?«
Eifrig wühlte sie in einer Kladde, in der sie ihre Zeichnungen aufbewahrte, und brachte das Bild eines Pferdes zum Vorschein. Atan besah es sich aufmerksam. Das Pferd war, im Gegensatz zu Ilha, pechschwarz, mit einer kurzen, struppigen Mähne.
»Es ist sehr schmutzig und krank«, sagte Kunsang.
»Krank?«
Atan verzog das Gesicht. »Ich kann mit einem kranken Tier nichts anfangen.«
Sie schüttelte den Kopf, dass die Haare flogen.
»Es ist nur krank, weil es schlecht gepflegt ist. In Wirklichkeit ist es stark und schön. Es gehört einem Bauern, ganz in der Nähe. Du musst es dir unbedingt ansehen, Onkel Atan.«
Ein Pferd? dachte ich verwundert. Woher kennt Kunsang ein Pferd? Kunsang besaß eine scharfe Beobachtungsgabe, aber von dem, was sie auf ihren Streifzügen durch die Umgebung entdeckte, wusste ich nichts. Von einem Pferd hatte sie mir nie erzählt. Inzwischen hantierte ich in der Kochnische und brachte auch Kunsang eine Schale Momo. Sie setzte sich und aß mit Appetit. Atans Augen waren unverwandt auf sie gerichtet. Schließlich sagte er: »Gut. Ich sehe mir das Pferd an. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich es kaufe.«
Sie nickte zufrieden und sprach nicht mehr darüber.
Etwas später kam Karma aus der Krankenstation. Karma war groß, mit einem vollen Gesicht, das einen herzförmigen Haaransatz hatte. Ihr ganzes Wesen strahlte Ruhe aus. Sie war älter als ich und empfand mir gegenüber eine Art mütterliche Verantwortung. Ich wusste, dass ihre Gefühle für Atan zwiespältig waren; sie schätzte seinen Wagemut ebenso, wie sie seiner Unrast misstraute. Ich hatte keine Ahnung, was Karma, die viel Lebenserfahrung hatte, in den Augen dieses Mannes alles sah; Dinge vielleicht, die ich nicht wahrhaben wollte. Doch Karma war auch sehr verständig, imbefangen und heiter. Und sie hatte eine lose Zunge, war in ihren Urteilen über ihre Nächsten sehr aufrichtig.
»Mir scheint«, sagte sie gleich nach der Begrüßung, »dass Sie gerne mit der Grenzmiliz Verstecken spielen.«
Er zwinkerte ihr zu.
»Ach, diese Schwachköpfe …«
»Sie sind verdammt herablassend«, sagte Karma, doch in ihren Worten lag Anerkennung. »Leider sind chinesische Gehirne Mühlen, die langsam, aber pulverfein mahlen.«
»Ich habe harte Knochen.«
»Was ich damit sagen will: Sie haben Computer.«
»IT-Spurensuche ist nur bei gutem Wetter möglich. Bei Monsun spielt jede Datenbank verrückt.«
Karma gab auf.
»Danke, dass Sie Kunsang zu uns gebracht haben«, sagte sie schlicht. »Sie ist ein eigenwilliges Kind und wäre für ein Leben in China ungeeignet gewesen.«
Doch Atan stimmte ihr nicht zu.
Kunsang war Halbchinesin – Khang ma char - weder Regen noch Schnee, wie man in Tibet solche Kinder nannte. Sun Li hatte die nötigen Schulgelder bezahlt, und ihre Intelligenz war gut ausgebildet. Verglichen mit ihrem Leben in Tibet hätte es Kunsang in China sicher gut gehabt. Sie war durchaus im Bilde gewesen, was Chodonla erlebt und erduldet hatte. Sie wusste nicht alles, nein, einige Fakten hatte Chodonla dem Kind gewiss ersparen wollen. Niemand hatte Kunsang jemals klar und deutlich erzählt, was eigentlich vorgefallen war. Aber Kunsang hatte ihre Mutter unbekleidet gesehen und war nicht naiv. Und wenn Chodonla chinesische Kunstseide trug, sich Schmuckspangen und künstliche Blumen ins Haar steckte – in einer Stadt, wo die Mehrzahl der Frauen mit handgestrickten Wollpullovern, zerfetzten Turnschuhen und billigen Parkas vorlieb nahm –, konnte sich auch eine Elfjährige eine Menge vorstellen. Kunsang sprach jedoch nie darüber. Das gefiel mir nicht. Aber noch widerstrebte es mir, dem Mädchen die ganze Wahrheit zu erzählen. Solange sich ein Kind als Mittelpunkt der Welt fühlt, kann der Schaden nicht groß sein, dachte ich und hoffte, dass es den Tatsachen entsprach.
»Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, obwohl Sie das nicht tun mussten.«
Er lächelte unfroh.
»Ich habe mehrere Leben.«
»Gut. Und wie viele noch?«
»Einen anständigen Topf voll«, sagte Atan gedehnt.
Ich verzehrte mich vor Verlangen, mit ihm allein zu sein. Ich fühlte den Funkenstrom, der zwischen uns hin und her ging, so stark, dass es mich fast erstickte. Es war, als gingen seine Worte nicht durch die Luft, sondern durch mein Blut. Aber ich war Karmas Gast …
»Er wird natürlich nicht bleiben«, sagte sie, als Atan gegangen war und ich Kunsang zu Bett geschickt hatte.
»Ach, Karma«, sagte ich, »es tut mir Leid. Ich bin ein wenig aus den Fugen.«
»Du bist wie eine mondsüchtige Katze«, sagte Karma. »Aber das hilft dir nicht. Er wird sein bisheriges Leben nicht aufgeben. Wozu auch? Siehst du ein anderes für ihn?«
Ich biss mir auf die Lippen.
»Nein, natürlich nicht.«
Sie sagte ja nur die Wahrheit. Er würde wieder gehen, und sei es aus bloßer Unstetheit. Er war ein Nomade, der das Abenteuer liebte und Geschmack an der Gefahr fand.
»Hat er dir eigentlich gesagt, was er in Indien zu tun hatte?«
»Er wollte Seine Heiligkeit sehen.«
»Und? Ist es ihm gelungen?«
Ich berichtete Karma von dem wenigen, was ich wusste, und stellte einmal mehr dabei fest, wie stark ich auf Vermutungen angewiesen war.
In dieser Nacht fand ich lange keinen Schlaf. Atans Rückkehr hatte mir keinen Frieden gebracht. Ich empfand eine derart wilde Angst vor der Einsamkeit, dass ich mich bei ihrem ersten Anfall weigerte, sie wahrhaben zu wollen. Diese Herzensangst war neu für mich; sie schien keinen wahren Sinn zu haben. Und doch war sie da. Nebelhaft und mehr in Bildern als in Gedanken erkannte ich, dass meine Unruhe ganz unangemessen war. Verletzungen heilen, Narben können verschwinden. Aber noch war es nicht so weit. Noch war die Wunde tief und blutete.
4. Kapitel
An den nächsten Tagen ertappte ich Kunsang dabei, wie sie Atan in den Ohren lag, sich das Pferd anzusehen. Atan gab sich große Mühe mit Kunsang und war immer sehr geduldig mit ihr. Sie hatten rasch einen Grad der Übereinstimmung erreicht, bei dem der Altersunterschied nicht zählte. Die Intensität und die Offenheit ihrer Beziehung hatten auf dem Weg der gemeinsam ausgestandenen Gefahren eine wahrhafte Gemeinschaft zwischen einem Kind und einem Mann geschaffen, der in gewisser Weise seine eigene Kindheit nie richtig aus den Augen verloren hatte.
»Na schön«, sagte er, »sehen wir uns das Tier mal an.«
Der Regen hatte nachgelassen, aber nur für kurze Zeit; der Himmel war schmutzig gelb, und Nebel stieg aus den aufgeweichten Feldern. Es war mein freier Nachmittag, und Kunsang fragte mich, ob ich mitkommen wollte.
»Willst du das Pferd auch sehen?«
Sie hatte immer einen starken Bewegungsdrang gehabt. Ich ließ sie gewähren, auch wenn ihre Streifzüge sie manchmal weit abseits des Camps führten. Nepalesen sind im Allgemeinen gutmütige Menschen; dass tibetischen Kindern Böses geschah, war nahezu ausgeschlossen. Ich nahm meinen Regenschirm unter den Arm.
»Also gut. Wohin gehen wir?«
»Zu Amir Shastra, du kennst ihn doch.«
Ich zog eine leichte Grimasse. Amir Shastra besaß ein kleines Gut, das an das Camp grenzte. Da die Arbeit auf den Feldern ihm nicht genug einbrachte, hatte er einen kleinen Kramladen eröffnet, wo die Flüchtlinge alles Überflüssige fanden, das ihnen ihr spärlich bemessenes Geld aus der Tasche lockte: Transistorradios, Mobiltelefone, altmodische Fernsehapparate, chinesische Uhren, Parfüms, Billigmode in aktuellen Trendmustem. Shastra gab bereitwillig Kredit zu unverschämten Zinsen und profitierte von den Flüchtlingen ohne jede Hemmung.
Ich warf Atan einen Blick zu, den er verstand.
»Wie kommt Shastra zu einem Pferd?«, fragte ich.
Kunsang wusste es nicht; sie hatte das Pferd gesehen und ein paarmal versucht, es mit Gras zu füttern. Shastra hatte sie gescholten; das Tier sei gefährlich.
»Aber das glaube ich nicht, Onkel Atan. Es hat bloß Angst. Und es ist wirklich ein sehr schönes Pferd.«
Atans Gesichtsausdruck zeigte, dass er den Weg nur auf sich nahm, um dem Mädchen eine Freude zu machen. Wir verließen das Camp, stapften auf der aufgeweichten Hauptstraße um Pfützen herum, kamen an verfallenen Stupas und Haufen von dampfendem Kuhmist vorbei. Kunsang schlurfte in ihren Gummistiefeln schnell und zielstrebig voran. Atan und ich behielten unsere Gedanken für uns. Wir wollten ihre Begeisterung nicht vorzeitig dämpfen.
Shastras kleines Steinhaus trug ein überdimensionales Firmenschild, grau vor Regen, mit der Bezeichnung Shastra’s Bazar in nepalesischer, englischer und tibetischer Sprache. Ich dachte, dass wir erst nach dem Pferd fragen müssten, doch Shastra hatte das Tier unter einem Wellblechdach gleich hinter dem Haus angebunden. Wir sahen ein Füllen, pechschwarz mit weißen Fesseln und einer ebenfalls hellen Mähne. Es war entsetzlich mager und hatte ein eiterndes Geschwür am Hals. Als wir näher traten, stellten sich die Ohren wie spitze Dolche an dem schmalen Kopf auf; mit einem nervösen Schwung wandte es sich um, starrte uns voller Argwohn an. Die Augen waren groß, bläulich schimmernd, mit einem scharf aufzuckenden Glanz, der darauf hinweist, dass ein Tier gefährlich werden kann.
»Ist es nicht schön, Onkel Atan?«, flüsterte Kunsang. Sie wollte sich dem Tier nähern, doch Atan hielt sie zurück, mit einem leichten Händedruck auf der Schulter. Ich verstand nichts von Pferden; immerhin zeigte mir Atans Haltung, dass er aufmerksam geworden war. Langsam trat er heran, ohne das Tier zu berühren. Ich sah, wie das schmutzige Fell des Füllens in ängstlicher Erwartung erschauerte.
In diesem Augenblick trat Shastra aus dem Haus. Er war ein kleiner schnaufender Mann mit einem großen Kopf, der einen gewaltigen Bauch vor sich hertrug. In den Ohren hatte er goldene Ringe. Er nickte mir zu und bedachte Atan mit einem merkwürdigen Blick, misstrauisch, schlau und äußerst aufmerksam, wobei sich seine Pupillen zu dunklen Knöpfen zusammenzogen. Mit hoher Fistelstimme und in korrektem Englisch eröffnete er sofort das Gespräch.
»Sie interessieren sich für das Pferd, Kushog?«
Atan bedachte den Händler mit einem kurzen Blick, der sich sofort wieder auf das Füllen richtete. Bevor er antwortete, ließ er einige Sekunden verstreichen.
»Ich glaube nicht. Woher haben Sie es?«
»Ein Kunde hat es mir gebracht. Er hatte einen Eisschrank auf Abzahlung gekauft und konnte seine Schulden nicht bezahlen.«
Shastra zog mit kurzem Zungenschnalzen die Schultern hoch. »Er hatte den Hengst von einem Freund aus Bhutan, sagte er. Ein prachtvolles Tier, Kushog, wirklich einzigartig. Er selbst hatte keine Ahnung, was für ein Juwel er mir brachte.«
»Es ist krank«, sagte Atan gleichgültig.
»Das Geschwür?« Shastra hob protestierend beide Hände. »Aber Herr, wer wird im Monsun nicht krank? So ein Tier braucht gutes Futter und die richtige Pflege. Ich möchte ihm diese Behandlung auch zukommen lassen, aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann, und meine Frau fürchtet sich vor dem Pferd. Aber es lohnt sich, Kushog, es lohnt sich wirklich. Und Sie sind ein Mensch, der das beurteilen kann.«
Atan schwieg, sah an ihm vorbei, auf den Rappen, der mit zurückgelegten Ohren dastand. Als wenn das Tier seinen Blick gespürt hätte, durchlief ein Zittern seinen Körper. Unter dem feuchten Fell begannen die Muskeln zu spielen. Sein Schweif schlug an die Flanken. Kunsang machte eine freudige Bewegung auf das Pferd zu. Sofort fuhr der Hengst zurück. Dann senkte er den Kopf, mit zitternden Nüstern, und sah sie von der Seite an. Atan sprach sehr ruhig.
»Bleib ihm vom Leib, Kunsang.«
Sie wich zurück. Der Händler lachte.
»Die Kleine mag das Pferd. Sie kommt jeden Tag und spricht mit ihm. Das Tier ist gutartig, wenn man mit ihm umgehen kann.«
Atan blieb schweigsam. Nach einer Weile jedoch trat er langsam heran und legte dem Pferd die Hand auf die Schulter, so leicht und ruhig, als ließe sich ein Insekt darauf nieder. Ich sah, wie das schmutzige Pferd in ängstlicher Erwartung ein wenig erschauerte, bevor es sich wieder entspannte.
»Das Pferd wurde misshandelt«, sagte er.
»Oh, nein, Kushog! Zumindest nicht von mir«, rief Shastra entrüstet. »Was vorher mit ihm geschah, nun, darüber weiß ich nichts. Immerhin gehört dieses Pferd zu den heißblütigen Tieren. Obwohl jedes Pferd Temperament hat, wenn man so will. Aber von dem hier würde ich sagen, dass – nun ja – dass es früher geschlagen wurde. Ein Mensch, der im frühen Alter geschlagen wird, wird meistens gehorsam, nicht wahr? Aber bei einem Pferd liegen die Dinge natürlich anders.«
Atan hob die Brauen.
»Da mögen Sie recht haben. Ein Pferd vergisst nicht.«
Der Rappe, der noch immer die Ohren zurückgelegt und den Kopf abgewandt hatte, schien ihm aufmerksam zuzuhören. Er befand sich in einem Zustand absoluter Wachsamkeit. Ein wildes, feinfühliges Geschöpf, das man gedemütigt hatte. Gleichwohl zeigte sein körperliches Fluidum, das die äußere Schale durchdrang, die physische Selbstbehauptung eines edlen Tieres.
»Kommen Sie, Kushog!« Shastra verzog den Mund und zeigte alle Zähne. »Kommen Sie, wir trinken Tee und reden! Das Tier zahlt sich für Sie aus – dafür verbürge ich mich.«
Ich dachte, wenn Atan den Wunsch hatte, das Tier zu kaufen, würde er hart und unerbittlich feilschen. Shastra wollte das Tier loswerden, so viel war klar, aber nicht, ohne den besten Preis herauszuholen. Ich sagte zu Kunsang:
»Komm, wir gehen. Lass deinen Onkel entscheiden, ob er das Pferd will oder nicht.«
Kunsangs Augen wurden starr. Ich hatte inzwischen gelernt, ihr starkes innerliches Sich-Sträuben zu erkennen. Sie war ganz auf Abwehr. Was wurde nur aus ihr, wenn dieser Hang, den sie hatte, sich bei ihr durchsetzte? Aber das Leben ist immer schwierig, wenn man Kinder aufzieht.