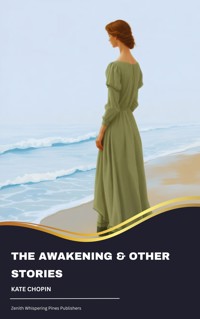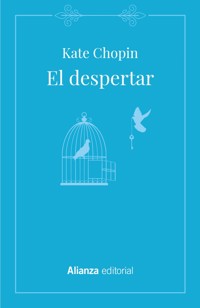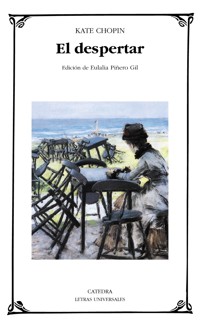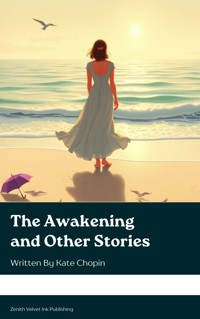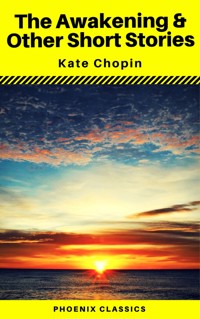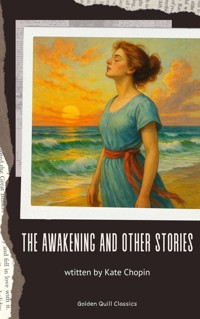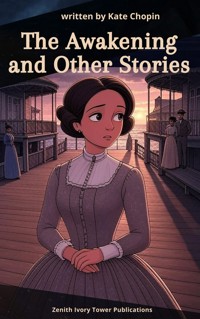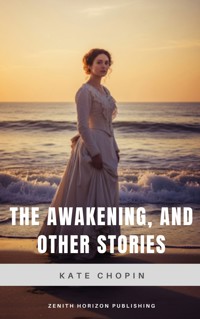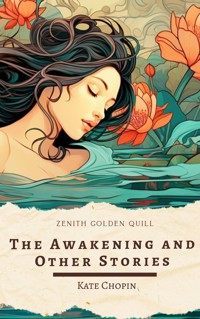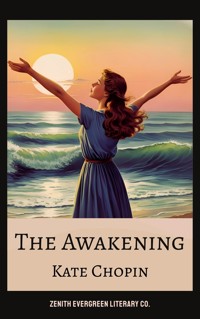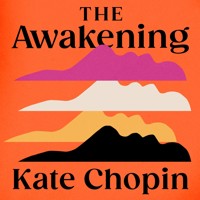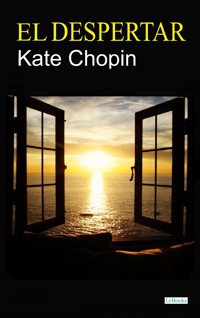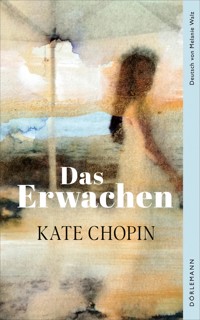
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kate Chopins berühmtester Roman gilt als Meilenstein der feministischen Literatur und nimmt die Klassiker des Modernismus vorweg. Wir tauchen tief ein in das Bewusstsein der jungen Mutter Edna Pontellier, die in einem Sommerurlaub am Meer allmählich beginnt, ihr konventionelles Leben zu hinterfragen. Während ihr Mann weiter seinem Beruf nachgeht, verbringt Edna den Großteil ihrer Zeit im Gespräch mit anderen Frauen am Strand. Sie lernt schwimmen, beginnt wieder zu malen – und verliebt sich in Robert, der jedoch bald aus ihrem Leben verschwindet. Nach dem Ende der Sommerferien kehrt Edna verändert in ihr altes Leben zurück. Sie möchte die neuentdeckten Freiheiten nicht aufgeben und entfremdet sich immer mehr von ihrem Mann, beginnt schließlich sogar eine Affäre. Doch sie kann Robert nicht vergessen, den sie bei ihrem nächsten Aufenthalt am Meer tatsächlich wiedersieht. Aber Edna und Robert müssen sich trennen – und Edna gibt sich der Verzweiflung hin. Einer der größten Texte der amerikanischen Literatur – in einer furiosen Neuübersetzung von Melanie Walz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kate Chopin
Das Erwachen
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Melanie Walz
Mit einem Nachwort von Barbara Kingsolver
Dörlemann
I
Ein grün-gelber Papagei in einem Käfig draußen vor der Tür wiederholte unablässig:
»Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi! Richtig so!«
Er konnte etwas Spanisch und auch eine Sprache, die niemand verstand, vielleicht mit Ausnahme der Spottdrossel, die auf der anderen Seite der Tür hing und mit nervenzerrüttender Beharrlichkeit ihre zarten Töne in die Brise hinausflötete.
Mr. Pontellier, außerstande, seine Zeitung halbwegs in Ruhe zu lesen, erhob sich mit einem Gesichtsausdruck und einem Ausruf der Verärgerung.
Er ging die Galerie entlang und über die schmalen »Brücken«, die die Lebrun-Häuschen miteinander verbanden. Er hatte vor der Tür des Haupthauses gesessen. Der Papagei und die Spottdrossel gehörten Madame Lebrun und hatten das Recht, so viel Lärm zu machen, wie sie wollten. Mr. Pontellier genoss das Privileg, ihre Gesellschaft zu verlassen, wenn sie nicht mehr unterhaltsam waren.
Er blieb vor der Tür seines eigenen Häuschens stehen, das vierte Haus, vom Hauptgebäude aus gezählt, und das vorletzte in der Reihe. Er setzte sich in einen Schaukelstuhl aus Rohr, der dort stand, und vertiefte sich wieder in die Zeitung. Es war Sonntag; die Zeitung stammte vom Vortag. Sonntagszeitungen hatten Grand Isle noch nicht erreicht. Mit den Börsenberichten war er bereits vertraut, und er überflog zerstreut die Leitartikel und vereinzelten Nachrichten, für deren Lektüre er keine Zeit gehabt hatte, als er am Tag zuvor in New Orleans aufgebrochen war.
Mr. Pontellier trug eine Brille. Er war um die vierzig, von mittlerer Größe und eher schlanker Statur und leicht gebeugt. Sein Haar war braun und glatt, mit Seitenscheitel. Sein Bart war fein säuberlich gekürzt.
Hin und wieder hob er den Blick von der Zeitung und sah sich um. Im Haus war mehr Lärm als je zuvor. Das Gebäude wurde »das Haus« genannt, um es von den Häuschen abzuheben. Die Vögel waren immer noch mit ihrem Schnattern und Pfeifen beschäftigt. Zwei junge Mädchen, die Farival-Zwillinge, spielten auf dem Klavier ein Duett aus Zampa. Madame Lebrun eilte geschäftig hin und her, gab einem Laufjungen sehr laut Befehle, wenn sie im Haus war, und gab mit nicht weniger lauter Stimme einem Bediensteten im Esszimmer Anweisungen, wenn sie draußen war. Sie war eine blühende, hübsche Frau, immer in Weiß und mit Halbärmeln gekleidet. Beim Kommen und Gehen raschelten ihre gestärkten Röcke. Etwas weiter entfernt ging eine Dame in Schwarz vor einem der Häuschen auf und ab und betete ihren Rosenkranz. Ziemlich viele Leute aus der pension waren in Beaudelets Lugger zur Chênière Caminada gefahren, um die Messe zu hören. Einige junge Leute spielten unter den Eichen Krocket. Mr. Pontelliers Kinder waren darunter – zwei stämmige kleine Burschen von vier und fünf Jahren. Eine dunkelhäutige Kinderfrau beaufsichtigte sie mit geistesabwesender, versonnener Miene.
Schließlich zündete sich Mr. Pontellier eine Zigarre an und rauchte, wobei er die Zeitung müßig aus der Hand fallen ließ. Er richtete den Blick auf einen weißen Sonnenschirm, der sich im Schneckentempo vom Strand her näherte. Er sah ihn deutlich zwischen den knorrigen Stämmen der Wassereichen und auf dem Streifen gelber Kamillenblüten. Der Golf lag wie in weiter Ferne und verschwamm mit dem Blau des Horizonts. Der Sonnenschirm kam langsam näher. Unter dem rosa Futter des Schirms waren seine Frau, Mrs. Pontellier, und der junge Robert Lebrun. Als sie das Häuschen erreichten, setzten die beiden sich etwas erschöpft auf die oberste Stufe der Veranda, lehnten sich zum Ausruhen jeweils an einen Pfosten und sahen einander an.
»Wie unvernünftig! Bei solcher Hitze um diese Zeit baden zu gehen!«, rief Mr. Pontellier. Er selbst war bei Tagesanbruch ins Wasser gesprungen. Deshalb kam ihm der Vormittag so lang vor.
»Du bist von der Sonne fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt«, fügte er hinzu und sah seine Frau an wie einen wertvollen, leicht beschädigten persönlichen Besitz. Sie hielt die Hände hoch, starke schöne Hände, betrachtete sie kritisch und zog ihre hellbraunen Ärmel über die Handgelenke hoch. Der Anblick erinnerte sie an die Ringe, die sie ihrem Mann gegeben hatte, bevor sie zum Strand gegangen war. Sie hielt ihm schweigend die geöffnete Hand hin, und er verstand. Nahm die Ringe aus der Westentasche und ließ sie auf ihre Handfläche fallen. Sie steckte sie an ihre Finger; dann faltete sie die Hände um die Knie, sah zu Robert hinüber und begann zu lachen. Die Ringe funkelten an ihren Fingern. Er antwortete mit einem Lächeln.
»Worum geht es?«, fragte Pontellier und blickte träge und amüsiert von einem zum anderen. Es war irgendein völliger Blödsinn; irgendein Erlebnis draußen im Wasser, das sie ihm beide gleichzeitig erzählen wollten. Erzählt klang es nicht halb so unterhaltsam. Das merkten sie und auch Mr. Pontellier. Er gähnte und reckte sich. Dann stand er auf und sagte, er hätte nichts dagegen, zum Hotel Klein’s zu gehen und eine Partie Billard zu spielen.
»Kommen Sie doch mit, Lebrun«, schlug er Robert vor. Aber Robert sagte ganz offen, er wolle lieber hierbleiben und sich mit Mrs. Pontellier unterhalten.
»Na gut, wenn er dir auf die Nerven geht, schick ihn fort, Edna«, erklärte ihr Mann beim Aufbrechen.
»Hier, nimm«, rief sie und reichte ihm den Sonnenschirm. Er nahm ihn und hielt ihn über seinen Kopf, als er die Stufen hinunterging und sich entfernte.
»Kommst du zum Abendessen?«, rief seine Frau hinter ihm her. Er verharrte für einen Augenblick und zuckte mit den Schultern. Er tastete in seiner Westentasche, in der ein Zehn-Dollar-Schein steckte. Er war unschlüssig; vielleicht würde er für das frühe Abendessen zurückkommen, vielleicht auch nicht. Das hing ganz davon ab, wem er bei Klein’s begegnete und wie viele sich an dem Spiel beteiligen würden. Das sagte er nicht, aber sie begriff es, lachte und nickte ihm zum Abschied zu.
Beide Kinder wollten ihrem Vater nachlaufen, als sie ihn gehen sahen. Er küsste sie und versprach, ihnen Bonbons und Erdnüsse mitzubringen.
II
Mrs. Pontelliers Augen waren aufmerksam und klar, von gelblichem Braun wie ihr Haar. Sie hatte eine Art, den Blick schnell auf etwas zu richten und nicht abzuwenden, als wäre sie in ein inneres Gewirr von Kontemplationen oder Gedanken versunken.
Ihre Augenbrauen waren eine Spur dunkler als das Haar. Sie waren dicht und fast horizontal und betonten den Ausdruck ihrer Augen. Sie war eher gut aussehend als schön. Ihr Gesicht bezauberte durch eine gewisse Offenheit und ein widersprüchliches subtiles Mienenspiel. Sie war von liebenswerter Wesensart.
Robert drehte sich eine Zigarette. Er rauche Zigaretten, weil er sich Zigarren nicht leisten könne, sagte er. Er hatte eine Zigarre in der Tasche, ein Geschenk von Mr. Pontellier, die er nach dem Abendessen rauchen wollte.
Das schien völlig angemessen und verständlich zu sein. Vom Kolorit war er seiner Freundin nicht unähnlich. Das glatt rasierte Gesicht betonte die Ähnlichkeit noch deutlicher, als sie es sonst gewesen wäre. Seine offene Miene war von keinem Schatten der Sorge belastet. Seine Augen sammelten und reflektierten das Licht und die Trägheit des Sommertages.
Mrs. Pontellier griff nach einem Fächer aus Palmblättern, der auf der Veranda lag, und begann sich zu fächeln, während Robert kleine Wölkchen Zigarettenrauch ausblies. Sie plauderten ohne Unterlass über alles um sie herum; über ihr lustiges Abenteuer im Wasser, das seinen amüsanten Aspekt wiedererhalten hatte; über den Wind, die Bäume, die Leute, die zur Chênière gefahren waren; über die Kinder, die unter den Wassereichen Krocket spielten, und über die Farival-Zwillinge, die nun die Ouvertüre von Dichter und Bauer übten.
Robert redete viel über sich. Er war sehr jung und wusste es nicht besser. Mrs. Pontellier sprach aus dem gleichen Grund nur wenig von sich. Beide interessierten sich für das, was der andere erzählte. Robert sprach von seiner Absicht, im Herbst nach Mexiko zu gehen, wo das Glück auf ihn warte. Er beabsichtigte immer, nach Mexiko zu gehen, aber irgendwie gelang es ihm nie. Unterdessen gab er sich mit seiner bescheidenen Stellung in einem Handelshaus in New Orleans zufrieden, wo ihm seine Vertrautheit mit Englisch, Französisch und Spanisch als Buchhalter und Schreiber gute Dienste leistete.
Wie immer verbrachte er seinen Sommerurlaub mit seiner Mutter auf Grand Isle. In früheren Zeiten, an die Robert sich nicht erinnern konnte, war »das Haus« die luxuriöse Sommerresidenz der Lebruns gewesen. Inzwischen, flankiert von dem Dutzend oder mehr Häuschen, immer voller exklusiver Besucher aus dem Quartier Français, ermöglichte es Madame Lebrun, den bequemen und angenehmen Lebensstil aufrechtzuerhalten, der ihr von angestammtem Recht zuzustehen schien.
Mrs. Pontellier erzählte von der Mississippi-Plantage ihres Vaters und von ihrem Kindheitszuhause in dem alten ländlichen Bluegrass-Kentucky. Sie war Amerikanerin, mit einem Tropfen französischen Bluts, das sich aufgelöst und verflüchtigt hatte. Sie las einen Brief ihrer Schwester vor, die im Osten lebte und sich verlobt hatte. Robert war interessiert und wollte wissen, wie die Schwestern als Mädchen gewesen waren, wie der Vater war und wie lang die Mutter schon tot war.
Als Mrs. Pontellier den Brief zusammenfaltete, war es Zeit, sich für das frühe Abendessen umzuziehen.
»Léonce wird nicht kommen«, sagte sie mit einem Blick in die Richtung, in die ihr Mann verschwunden war. Robert nahm das auch an, da ziemlich viele Männer aus den Clubs in New Orleans bei Klein’s waren.
Als Mrs. Pontellier zu ihrem Zimmer ging, stieg der junge Mann die Treppe hinunter und schlenderte zu den Krocketspielern, wo er sich die halbe Stunde vor der Essenszeit mit den kleinen Pontellier-Kindern vergnügte, die ihn sehr gern hatten.
III
Es war elf Uhr nachts, als Mr. Pontellier vom Hotel Klein’s zurückkam. Er war bester Laune, munter und redselig. Sein Eintreten weckte seine Frau, die im Bett lag und schlief. Er redete mit ihr, während er sich auszog, erzählte Anekdoten, Neuigkeiten und Klatschgeschichten, die er tagsüber aufgeschnappt hatte. Aus den Hosentaschen holte er eine Handvoll zerknüllter Banknoten und ziemlich viele Silbermünzen hervor und legte alles, was er noch in den Taschen hatte, Schlüssel, Taschenmesser, Taschentuch, durcheinander auf den Toilettentisch. Sie war völlig verschlafen und antwortete ihm nur in halben Sätzen.
Er fand es sehr entmutigend, dass seine Frau, das Wichtigste in seinem Leben, so wenig Interesse an Dingen zeigte, die ihn betrafen, und so wenig Wert auf ein Gespräch mit ihm legte.
Mr. Pontellier hatte die Bonbons und Erdnüsse für die Kinder vergessen. Dennoch liebte er sie sehr und ging in das Nebenzimmer, um nach ihnen zu sehen und sich zu versichern, dass sie gut schliefen. Das Ergebnis seiner Nachforschung war alles andere als zufriedenstellend. Er drehte und wendete die Kleinen im Bett. Einer der beiden begann zu strampeln und von einem Korb voller Krabben zu reden.
Mr. Pontellier ging zu seiner Frau zurück mit der Information, dass Raoul hohes Fieber habe und sie nach ihm sehen müsse. Dann zündete er sich eine Zigarre an und setzte sich neben die offene Tür, um zu rauchen.
Mrs. Pontellier war sich ziemlich sicher, dass Raoul kein Fieber hatte. Er sei in guter Verfassung zu Bett gegangen und habe den ganzen Tag keine Beschwerden gehabt. Mr. Pontellier war mit Fiebersymptomen zu vertraut, um sich getäuscht zu haben. Er versicherte ihr, dass das Kind in diesem Augenblick im Nebenzimmer dahinschwand.
Er warf seiner Frau ihre Unaufmerksamkeit vor, ihre gewohnte Vernachlässigung der Kinder. Wenn es nicht die Aufgabe einer Mutter war, sich um die Kinder zu kümmern, wessen dann um Himmels willen? Er selbst hatte mehr als genug mit seinen Finanzgeschäften zu tun. Er konnte nicht zwei Dinge auf einmal erledigen; draußen in der Welt für seine Familie sorgen und zu Hause bleiben, um sich darum zu kümmern, dass ihnen nichts widerfuhr. Er redete monoton und beharrlich.
Mrs. Pontellier sprang aus dem Bett und ging in das Nachbarzimmer. Sie kam bald zurück, setzte sich auf die Bettkante und lehnte ihren Kopf an das Kissen. Sie sagte nichts und weigerte sich, ihrem Mann zu antworten, als er ihr Fragen stellte. Als er seine Zigarre geraucht hatte, ging er ins Bett und war in einer halben Minute eingeschlafen.
Mrs. Pontellier war inzwischen hellwach. Sie weinte ein wenig und wischte sich die Augen mit dem Ärmel ihres peignoir. Sie löschte die Kerze, die ihr Mann hatte brennen lassen, schlüpfte mit nackten Füßen in ein Paar mules aus Satin am Fußende des Betts und ging hinaus auf die Veranda, wo sie sich in den Korbstuhl setzte und langsam hin und her schaukelte.
Es war schon nach Mitternacht. Alle Häuschen waren dunkel. Ein einziges schwaches Licht kam aus dem Hausflur. Es war nichts zu hören außer dem Heulen einer alten Eule oben in einer Wassereiche und der ewigen Stimme des Meeres, die auch zu dieser friedlichen Zeit nicht verstummt war. Sie brach wie ein klagendes Wiegenlied über die Nacht herein.
Die Tränen strömten so schnell aus Mrs. Pontelliers Augen, dass der feuchte Ärmel ihres peignoir sie nicht mehr trocknen konnte. Mit einer Hand hielt sie sich an der Rückenlehne des Stuhls fest; ihr Ärmel war fast bis zur Schulter des erhobenen Arms gerutscht. Sie wandte sich um, schmiegte ihr erhitztes nasses Gesicht in die Armbeuge und weinte dort weiter, ohne sich darum zu scheren, ihr Gesicht, ihre Augen, ihre Arme zu trocknen. Sie hätte nicht sagen können, warum sie weinte. Erfahrungen wie das Vorhergegangene waren in ihrem Eheleben nicht ungewöhnlich. Sie hatten nie viel Gewicht gehabt angesichts der großzügigen Zuwendung ihres Mannes und einer gegenseitigen Zuneigung, die stillschweigend und selbstverständlich geworden war.
Eine unerklärliche Bedrückung, die aus einem unvertrauten Bereich ihres Bewusstseins zu kommen schien, erfüllte ihr ganzes Wesen mit undeutlicher Furcht. Wie ein Schatten, wie ein Nebel über dem Sommertag ihrer Seele. Sonderbar und ungewohnt; es war eine Laune. Sie machte ihrem Mann in ihren Gedanken keine Vorwürfe, haderte nicht mit ihrem Schicksal, das ihre Schritte zu dem Weg gebracht hatte, den sie genommen hatten. Sie weinte sich einfach nur gründlich aus. Die Moskitos fielen freudig über sie her, stachen in ihre festen runden Arme und nagten am nackten Spann ihrer Füße.
Den kleinen bissigen, schwirrenden Plagegeistern gelang es, eine Laune zu vertreiben, die sie sonst eine halbe Nacht länger in der Dunkelheit gefangen gehalten hätte.
Am nächsten Morgen war Mr. Pontellier rechtzeitig auf den Beinen, um den Rockaway zu nehmen, der ihn zu dem Dampfer am Kai bringen würde. Er fuhr in die Stadt zu seiner Arbeit, und sie würden ihn auf der Insel erst am nächsten Samstag wiedersehen. Er hatte seine Fassung wiedererlangt, die in der Nacht etwas ramponiert gewesen war. Es eilte ihn, zu gehen, denn er freute sich auf eine fröhliche Woche in der Carondelet Street.
Mr. Pontellier gab seiner Frau die Hälfte des Geldes, das er am Abend aus Klein’s Hotel mitgebracht hatte. Wie die meisten Frauen mochte sie Geld und nahm es nicht ungern.
»Ich werde ein schönes Hochzeitsgeschenk für Schwester Janet kaufen!«, rief sie, während sie die Geldscheine glättete und sorgfältig zählte.
»Ha! Meine Liebe, wir wollen Schwester Janet etwas Besseres bieten«, sagte er lachend und küsste sie zum Abschied.
Die Jungen rannten hin und her, hielten sich an seinen Beinen fest und verlangten von ihm, ihnen alles Mögliche mitzubringen. Mr. Pontellier war sehr beliebt, und Frauen, Männer, Kinder, sogar Kinderfrauen fanden sich immer ein, um sich von ihm zu verabschieden. Seine Frau stand winkend und lächelnd da, und die Jungen riefen laut, als er in dem alten Rockaway die sandige Straße hinunter verschwand.
Einige Tage später kam aus New Orleans eine Schachtel für Mrs. Pontellier. Von ihrem Mann. Sie war gefüllt mit friandises, mit üppigen wohlschmeckenden Kleinigkeiten – den köstlichsten Früchten, patés, erlesenen Weinen, verlockenden Sirups und Bonbons im Übermaß.
Mrs. Pontellier war mit dem Inhalt solcher Schachteln immer sehr großzügig; sie war es gewohnt, diese Geschenke zu erhalten, wenn er nicht zu Hause war. Die patés und Früchte wurden in das Esszimmer gebracht, die Bonbons wurden herumgereicht. Und die Damen, die mit spitzen und kennerischen Fingern und ein wenig gierig ihre Wahl trafen, erklärten allesamt Mr. Pontellier zum besten Ehemann der Welt. Mrs. Pontellier musste zugeben, dass es keinen besseren geben könne.
IV
Es wäre ziemlich schwierig für Mr. Pontellier gewesen, sich selbst oder jemand anderem zu erklären, woran seine Frau es ihren Kindern gegenüber fehlen ließ. Es war mehr ein Gefühl als eine Gewissheit, und das Gefühl konnte er nicht ausdrücken, ohne es sofort zu bereuen und umfangreich Abbitte zu leisten.
Wenn einer der kleinen Pontelliers sich beim Spielen wehtat, war es nicht seine Art, sich weinend in die Arme seiner Mutter zu werfen, um sich trösten zu lassen; nein, er raffte sich lieber auf, wischte sich die Tränen aus den Augen und den Sand aus dem Mund und spielte weiter. Als die Knirpse, die sie waren, hielten sie zusammen und behaupteten sich mit ihren Fäusten und erhobenen Stimmen in kindlichen Auseinandersetzungen, wobei sie gegen die Knirpse anderer Mütter meistens die Oberhand hatten. Die schwarze Kinderfrau war in ihren Augen ein rechter Störfaktor, nur dazu da, Jäckchen und Hosen zuzuknöpfen und die Haare zu bürsten und zu scheiteln, da es offenbar ein gesellschaftliches Gesetz war, dass Haare gescheitelt und gebürstet gehörten.
Kurzum, Mrs. Pontellier war keine mütterliche Frau. Die mütterlichen Frauen schienen in diesem Sommer auf Grand Isle vorzuherrschen. Sie waren leicht zu erkennen, wenn sie mit ausgebreiteten schützenden Flügeln ausschwärmten, sobald ihrer kostbaren Brut irgendein wirkliches oder eingebildetes Leid drohte. Sie waren Frauen, die ihre Kinder vergötterten, ihre Ehemänner anbeteten und es für ein heiliges Privileg hielten, selbst als Individuen unsichtbar zu sein und sich als dienstbare Engel Flügel wachsen zu lassen.
Manche waren in dieser Rolle bezaubernd; eine von ihnen war die Verkörperung aller weiblichen Reize und Tugenden. Sollte ihr Mann sie nicht abgöttisch lieben, wäre er ein Unmensch, des Todes durch langsame Folter würdig. Sie hieß Adèle Ratignolle. Es gab keine Worte, sie zu beschreiben, bis auf die überkommenen, die so oft dazu dienten, die längst verflossene Heldin einer romantischen Erzählung oder die feenhafte Erscheinung unserer Träume zu beschwören. An ihrem Zauber war nichts Unterschwelliges oder Verborgenes: Ihre Schönheit war unübersehbar, strahlend und offenkundig; das Haar wie aus gesponnenem Gold, das kein Kamm, keine Klammer bändigen konnte; die blauen Augen, die nur mit Saphiren zu vergleichen waren; zwei geschürzte Lippen, so rot, dass man bei ihrem Anblick nur an Kirschen oder eine andere köstliche Frucht denken konnte. Sie wurde allmählich etwas fülliger, doch das tat der Anmut jedes ihrer Schritte, jeder ihrer Haltungen, jeder ihrer Gesten keinen Abbruch. Man hätte sich ihren weißen Hals nicht weniger rundlich oder ihre schönen Arme nicht schlanker wünschen mögen. Nie waren Hände zierlicher als ihre, und es war ein Vergnügen, sie zu beobachten, wenn sie eine Nadel einfädelte oder ihren goldenen Fingerhut an den eleganten Mittelfinger steckte, wenn sie an den kleinen Strampelanzügen nähte oder ein Leibchen oder Lätzchen anfertigte.
Madame Ratignolle hatte Mrs. Pontellier sehr gern, und oft nahm sie ihre Näharbeit mit, um nachmittags bei ihr zu sitzen. Sie saß bei ihr an dem Nachmittag, als die Schachtel aus New Orleans gekommen war. Der Schaukelstuhl war ihr überlassen, und sie nähte fleißig an einem winzigen Strampelanzug.
Das Schnittmuster dafür hatte sie Mrs. Pontellier zum Ausschneiden mitgebracht – ein Wunderwerk der Schneiderkunst, dazu ersonnen, den Körper eines Babys so wirksam zu umschließen, dass aus dem Kleidungsstück nur zwei kleine Augen zu sehen wären, wie die eines Eskimos. Die Anzüge waren für den Winter vorgesehen, wenn hinterhältige Winde sich die Kamine herunterstahlen und böswillige Luftzüge ihren Weg durch Schlüssellöcher fanden.
Mrs. Pontellier machte sich keine größeren Sorgen um die gegenwärtigen materiellen Bedürfnisse ihrer Kinder, und sie sah keinen Sinn darin, Vorausahnungen und Winterkleidung zum Gegenstand ihrer sommerlichen Gedanken zu machen. Aber sie wollte nicht unfreundlich oder desinteressiert erscheinen und hatte deshalb Zeitungen mitgebracht, die sie auf dem Boden der Galerie ausbreitete, und unter Madame Ratignolles Aufsicht hatte sie ein Schnittmuster des undurchdringlichen Kleidungsstücks angefertigt.
Robert war anwesend und saß da wie am Sonntag zuvor, und Mrs. Pontellier hatte wieder auf der obersten Treppenstufe Platz genommen, träge an den Pfosten gelehnt. Neben ihr lag die Schachtel mit den Bonbons, die sie von Zeit zu Zeit Madame Ratignolle hinhielt.
Diese schien sich nicht entscheiden zu können, wählte zuletzt eine Stange Nougat, allerdings unsicher, ob die Süßigkeit zu schwer sein, ihr möglicherweise schaden könnte. Madame Ratignolle war seit sieben Jahren verheiratet. Etwa alle zwei Jahre bekam sie ein Kind. Inzwischen hatte sie drei Kinder und dachte an ein viertes. Sie sprach immer von ihren »Umständen«. Diese »Umstände« waren in keiner Weise erkennbar, und niemand hätte davon gewusst, wenn sie das Thema nicht unablässig erwähnt hätte.
Robert wollte sie beruhigen und versicherte, er habe eine Dame gekannt, die sich von Nougat ernährt habe die ganze Zeit ihrer – doch als er sah, dass Mrs. Pontellier rot wurde, besann er sich und wechselte das Thema.
Mrs. Pontellier hatte zwar einen Kreolen geheiratet, fühlte sich aber in der Gesellschaft von Kreolen nicht besonders wohl; nie zuvor hatte sie so eng mit ihnen zu tun gehabt. In diesem Sommer bei Lebruns gab es nur Kreolen. Sie kannten sich alle und fühlten sich als eine große Familie, in der die freundschaftlichsten Beziehungen bestanden. Was für sie bezeichnend war und Mrs. Pontellier am meisten beeindruckte, war der gänzliche Verzicht auf Prüderie. Die freie Ausdrucksweise war ihr zuerst unbegreiflich gewesen, obwohl sie darin keinen Widerspruch zu der stolzen Keuschheit sah, die einer kreolischen Frau angeboren und unmissverständlich zu sein scheint.
Nie würde Edna Pontellier vergessen, mit welchem Entsetzen sie gehört hatte, wie Madame Ratignolle dem alten Monsieur Farival die haarsträubende Geschichte eines ihrer accouchements erzählt hatte, ohne eine einzige intime Einzelheit auszulassen. Sie hatte sich inzwischen an solche schockierenden Erlebnisse gewöhnt, ohne verhindern zu können, dass ihr die Röte in die Wangen stieg. Mehr als einmal hatte ihre Ankunft eine deftige Geschichte unterbrochen, mit der Robert eine Gruppe amüsierter verheirateter Frauen unterhalten hatte.
In der pension war ein Buch herumgereicht worden. Als sie an der Reihe war, es zu lesen, tat sie es mit größtem Erstaunen. Sie fühlte sich genötigt, das Buch heimlich und allein zu lesen, obwohl keine der anderen das getan hatte – und es beim Geräusch sich nähernder Schritte zu verstecken. Bei Tisch wurde es offen kritisiert und freimütig diskutiert. Mrs. Pontellier hörte auf, erstaunt zu sein, und schloss daraus, dass man immer mit Wundern rechnen müsse.
V
Sie bildeten eine harmonische Gruppe an diesem Sommernachmittag – Madame Ratignolle mit ihrer Näharbeit, die sie oft unterbrach, um eine Geschichte oder ein Ereignis zu erzählen, betont durch dramatische Gesten ihrer vollkommenen Hände, Robert und Mrs. Pontellier, die müßig dasaßen, bisweilen ein Wort, Blicke oder Lächeln wechselten, die ein gewisses vorangeschrittenes Stadium von Vertrautheit und camaraderie andeuteten.
Den letzten Monat hatte er in ihrem Schatten gelebt. Niemand hatte sich darüber Gedanken gemacht. Viele hatten vorausgesagt, dass Robert sich Mrs. Pontellier widmen würde, wenn er kam. Schon als Fünfzehnjähriger vor elf Jahren, und seitdem jeden Sommer, hatte sich Robert auf Grand Isle als hingebungsvoller Galan einer edlen Dame oder Demoiselle erwiesen. Manchmal war es ein junges Mädchen, manchmal eine Witwe, aber immer wieder auch eine interessante verheiratete Frau.
Zwei Saisons nacheinander hatte er im Sonnenschein von Mademoiselle Duvignés Gegenwart gelebt. Aber sie war zwischen zwei Sommern gestorben; und Robert gab sich untröstlich und warf sich Madame Ratignolle zu Füßen, um die Krumen von Mitgefühl und Trost zu erhaschen, die zu erübrigen sie die Gnade besaß.
Mrs. Pontellier gefiel es, dazusitzen und ihre schöne Gefährtin zu betrachten, als wäre sie eine untadelige Madonna.
»Wer könnte die Grausamkeit hinter diesem lieblichen Äußeren ermessen?«, murmelte Robert. »Sie wusste, dass ich sie einst verehrt habe, und sie ließ sich von mir verehren. Es hieß: ›Robert, komm, geh; steh auf, setz dich; tu dies, tu das; sieh nach, ob das Baby schläft; such bitte meinen Fingerhut, den ich weiß Gott wo vergessen habe. Komm und lies mir Daudet vor, während ich nähe.‹«
»Par exemple! Ich musste dich nie bitten. Du warst immer da, zu meinen Füßen, wie eine lästige Katze.«
»Sie meinen, wie ein ergebener Hund. Und sobald Ratignolle auf der Bildfläche erschien, erging es mir wie einem Hund. ›Passez! Adieu! Allez vous-en!‹«
»Vielleicht wollte ich Alphonse nicht eifersüchtig machen«, wandte sie mit übertriebener Naivität ein. Alle mussten lachen. Die rechte Hand eifersüchtig auf die linke! Das Herz eifersüchtig auf die Seele! Aber in dieser Hinsicht ist der kreolische Ehemann nie eifersüchtig; für ihn hat sich die verzehrende Leidenschaft mangels Benutzung aufgebraucht.
Unterdessen erzählte Robert Mrs. Pontellier von seiner damaligen aussichtslosen Liebe zu Madame Ratignolle, von schlaflosen Nächten und verzehrenden Flammen, bis selbst das Meer kochte, wenn er hineinsprang. Während die nähende Dame einen kleinen laufenden Kommentar äußerte:
»Blagueur – farceur – gros bête, va!«
Diesen halb ironischen Ton schlug er nie an, wenn er mit Mrs. Pontellier allein war. Sie wusste nicht so recht, was sie davon halten sollte; im Augenblick war ihr nicht klar, wie viel davon Scherz war und was ernst gemeint. Es stand außer Frage, dass er oft Liebesschwüre an Madame Ratignolle gerichtet hatte, ohne je zu denken, er würde ernst genommen. Mrs. Pontellier war froh, dass er ihr gegenüber diese Rolle nicht gewählt hatte. Es wäre unerfreulich und ärgerlich gewesen.
Mrs. Pontellier hatte ihr künstlerisches Zubehör mitgebracht, mit dem sie manchmal auf unprofessionelle Weise herumschmierte. Ihr gefiel das Herumschmieren. Es verschaffte ihr Genugtuung wie keine andere Beschäftigung.
Sie hatte schon lange den Wunsch, sich an Madame Ratignolle zu versuchen. Niemals war die Dame als Sujet so einladend gewesen wie in diesem Augenblick, als sie dasaß wie eine sinnliche Madonna, im Schimmer des vergehenden Tages, der ihr herrliches Kolorit beglänzte.
Robert trat zu ihr und setzte sich auf die Stufe unter Mrs. Pontellier, um ihr bei der Arbeit zuzusehen. Sie handhabte ihre Pinsel mit einer Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die sich nicht langer und enger Vertrautheit mit ihnen verdankte, sondern naturgegebener Fähigkeit. Robert verfolgte ihr Tun mit großer Aufmerksamkeit und kleinen bewundernden Ausrufen auf Französisch an Madame Ratignolle gerichtet.
»Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connait, elle a de la force, oui.«
In seiner selbstvergessenen Aufmerksamkeit lehnte er einmal seinen Kopf sanft an Mrs. Pontelliers Arm. Und sie schob ihn ebenso sanft weg. Ein zweites Mal wiederholte er die Zudringlichkeit. Sie hielt es für Gedankenlosigkeit, aber dem wollte sie sich nicht unterwerfen. Sie machte keine Einwände, sondern wehrte ihn nur ruhig, aber entschlossen ab. Er entschuldigte sich nicht. Das vollendete Bild hatte keine Ähnlichkeit mit Madame Ratignolle. Diese war sehr enttäuscht, dass es ihr nicht ähnlich sah. Aber es war kein schlechtes Bild und in mancher Hinsicht zufriedenstellend.
Mrs. Pontellier dachte offensichtlich anders darüber. Nachdem sie den Entwurf kritisch betrachtet hatte, schmierte sie eine breite Farbspur auf die Oberfläche und zerknüllte das Papier.
Die kleinen Jungen stürmten die Treppe hoch, und die Kinderfrau folgte in dem respektvollen Abstand, der von ihr verlangt wurde. Mrs. Pontellier ließ die Jungen ihre Farben und das Zubehör ins Haus bringen. Sie wollte sie noch ein bisschen bei sich behalten, um mit ihnen zu sprechen und zu scherzen. Aber danach stand ihnen der Sinn nicht. Sie waren nur gekommen, um den Inhalt der Bonbonschachtel zu erkunden. Ohne Widerrede akzeptierten sie, was sie ihnen zuteilte; jeder hielt seine knubbeligen Händchen wie eine Schale in der vergeblichen Hoffnung, sie gefüllt zu sehen, und dann trollten sie sich.
Die Sonne war tief im Westen angelangt, und die leise und wollüstige Brise aus dem Süden kam mit dem verführerischen Duft des Meeres. Frisch herausgeputzte Kinder sammelten sich für ihre Spiele unter den Eichen. Ihre Stimmen waren laut und durchdringend.
Madame Ratignolle faltete ihre Nähsachen zusammen, steckte Fingerhut, Scheren und Fäden ordentlich in das kleine Paket, das sie fest verschnürte. Sie sagte, ihr sei unwohl. Mrs. Pontellier holte eilig Kölnisch Wasser und einen Fächer. Sie betupfte Madame Ratignolles Gesicht mit dem Eau de Cologne, und Robert betätigte den Fächer mit unnötiger Kraft.
Der Anfall war bald vorüber, und Mrs. Pontellier war sich nicht recht schlüssig, ob nicht etwas Phantasie im Spiel gewesen war, denn die rosige Farbe war aus dem Gesicht ihrer Freundin nicht gewichen.
Sie sah zu, wie die hübsche Frau die lange Zeile der Galerien mit der Anmut und Überlegenheit entlangging, die manchmal Königinnen unterstellt wird. Ihre Kleinen liefen ihr entgegen. Zwei von ihnen klammerten sich an ihre weißen Röcke, den dritten nahm sie von der Kinderfrau entgegen und trug ihn mit tausend Liebkosungen in ihren liebevollen Armen. Obwohl der Doktor ihr verboten hatte, auch nur eine Nadel vom Boden aufzuheben, wie jeder wusste!
»Wollen Sie baden gehen?«, fragte Robert Mrs. Pontellier. Es war weniger eine Frage als eine Einladung.
»O nein«, erwiderte sie in unentschlossenem Ton. »Ich bin müde; ich denke nicht.« Ihr Blick wanderte von seinem Gesicht zu dem Golf, dessen sonores Murmeln sie wie eine liebevolle und zugleich drängende Aufforderung erreichte.
»Ach, kommen Sie!«, beharrte er. »Sie sollten das Baden nicht vergessen. Kommen Sie. Das Wasser ist sicher herrlich; es wird Ihnen nicht schaden. Kommen Sie.«
Er griff nach ihrem großen sperrigen Strohhut, der neben der Tür an einem Haken hing, und setzte ihn ihr auf. Sie stiegen die Stufen hinunter und gingen zusammen in Richtung Strand. Die Sonne stand tief im Westen, und die Luft war weich und warm.
VI
Edna Pontellier hätte nicht sagen können, warum sie, obwohl sie mit Robert zum Strand gehen wollte, es zuerst abgelehnt und ihm dann nachgegeben hatte, geleitet von einem der beiden gegensätzlichen Impulse, die sie antrieben.
Eine Art Licht begann schwach in ihr zu glimmen – das Licht, das den Weg zeigt und ihn verbietet.
In dieser frühen Phase verwirrte es sie nur. Es brachte sie zum Träumen, zur Nachdenklichkeit und zu dem schattenhaften Seelenkummer, der um Mitternacht über sie gekommen war, als sie sich ihren Tränen überlassen hatte. Kurzum, Mrs. Pontellier empfand allmählich eine Ahnung von ihrer Stellung im Universum als Menschenwesen und begann ihre Beziehungen als Individuum zur Welt in ihrem Inneren und um sie herum zu begreifen. Dies mag auf der Seele einer jungen Frau von achtundzwanzig wie eine schwerwiegende Erkenntnis erscheinen – vielleicht mehr Erkenntnis, als es dem Heiligen Geist in der Regel passt, einer Frau zukommen zu lassen.
Aber der Anfang der Dinge, vor allem der einer Welt, ist notgedrungen undeutlich, verworren, chaotisch und überaus verstörend. Wie wenige von uns können sich aus solchen Anfängen befreien! Wie viele Seelen werden in seinem Tumult vernichtet!
Die Stimme des Meeres ist verführerisch; ununterbrochen, flüsternd, verlangend, murmelnd lädt sie die Seele ein, sich für kurze Zeit in Abgründe der Einsamkeit zu begeben, sich in Labyrinthen seelischer Kontemplation zu verirren.
Die Stimme des Meeres spricht zu der Seele. Die Berührung des Meeres ist sinnlich, sie umschließt den Körper mit einer sanften engen Umarmung.
VII
Mrs. Pontellier neigte nicht zu Vertraulichkeiten, sie widersprachen ihrer Natur. Schon als Kind hatte sie ihr kleines Eigenleben ganz in sich selbst gelebt. Sehr früh im Leben hatte sie intuitiv die Doppelseite des Lebens erfasst – die äußere Existenz, die sich anpasst, und die innere, die Fragen stellt.