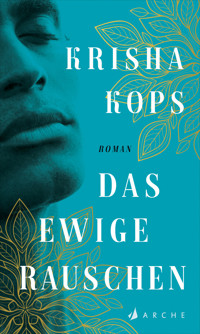
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche Literatur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fest in der Erde steht ein Banyanbaum. Durch seine Blätter und Luftwurzeln streichen die Winde. Sie erzählen ihm die Geschichte von Abbayi und seiner deutsch-indischen Familie. Sie erzählen von einem Mädchen, das an der Ostsee geboren wird und während der Nachkriegszeit mit seiner Familie durch Deutschland zieht. Von einem indischen Bauern, der für seine Tomatenpflanzen singt und für seine beiden Frauen. Von einem Glückssucher, dem die Welt zu klein für seine Ideen ist und der sein Heimatland verlässt. Von einer Frau, die sich in den Fremden verliebt, und schließlich von einem jungen Mann, der sich zeit seines Lebens zwischen den Welten bewegen wird. ›Das ewige Rauschen‹ ist ein großer wie lebenspraller Roman über die Fragen, wer wir sind, wo wir Wurzeln schlagen – und was wir dafür brauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Krisha Kops
Das ewige Rauschen
Das Zitat "Ṛgveda I.24.7" wurde abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Verlags der Weltreligionen: Rig-Veda – Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis. Aus dem vedischen Sanskrit übersetzt und mit einem Kommentar herausgegeben von Michael E. J. Witzel und Toshifumi Goto unter Mitarbeit von Eijiro Doyama und Mislav Ježic. © Verlag der Weltreligionen Frankfurt a.M. 2007. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Verlag der Weltreligionen Berlin.
© 2022 Arche Literatur Verlag AG, Zürich–Hamburg
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Covermotive: © Shutterstock/Yana_Iv und © Shutterstock/Lumezia
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03790-142-7
www.arche-verlag.com
www.facebook.com/ArcheVerlag
www.instagram.com/arche_verlag
Für Raja, den König
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
Unter all den Bäumen bin ich (Kṛṣṇa) der Banyanbaum
Bhagavadgītā, X.26
O you shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond,
have you forgotten the little child, like the birds that have
nested in your branches and left you?
…
He longed to be the wind and blow through your resting
branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water,
to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like
those ducks among the weeds and shadows.
Rabindranath Tagore, The Banyan Tree
Prologwind
Diese Geschichte ist so wahr, wie nur irgendeine Geschichte wahr sein kann. Und weil Wahrheit schmerzt, ist jedes Wort eine Kerbe in meiner grauen Borke, jeder Satz mit meinem Milchsaft geschrieben auf die Blätter, die ich eines Tages sein werde. Dies ist die Geschichte des Dazwischen, des Halb-Halb, des Viertel-Viertel-Viertel-Viertel, des Alles und des Nichts. Wie ich vom Abend- zum Morgen- ins Zwischenland kam. Wie ich an diesem Ort Wurzeln zu schlagen vermochte, in dieser namenlosen Erde auf einer Grenze zwischen hier und da und dort. Auf diesem Faltengebirge, das Stunde um Stunde wächst, da sich die indische mit der eurasischen Platte verkeilt und dem Himmel entgegenstrebt. Diesem heiligen Berg, von dem aus ich fast alles übersehen kann, Zeiten, Orte, Seinsweisen. Ich, Mitternachts- und Zwielichtskind, zwischen Gestern, Nacht und Morgen. Bei meinen weiblichen, männlichen und unfruchtbaren Blüten: Dies ist die Geschichte eines Werdens, einer Metamorphose, von Tod und Wiedergeburt, Verlust und Gewinn. Eine Geschichte des Selbst, damit es sich erinnert, wie es zu sich kam.
Die Geschichte des Selbst besteht aber auch immer aus den Geschichten der Anderen, der Vorfahren, die, folgt man denn dem Geäst des Familienbaums, alle zurück zum selben Stamm führen. Diese eine ist unser aller Geschichte, ein Geflecht aus Luftwurzeln, von denen manche sich schon längst in den Boden vergraben haben, während andere noch immer im Wind baumeln.
Dies ist die Geschichte eines Jungen, bevor er wurde, wer oder was er ist.
Es sind die Winde, der Atem der Götter, die mir Geschichten zutragen, denn ich kann vieles, aber nicht alles besehen. Wenn sie durch meine Blätter rascheln und meine Zweige biegen, wenn die Wolken auf mich herabregnen, berichten sie mir von dem, was sie gesehen und gehört haben. Selbst die Gerüche aus vergangenen Zeiten wehen sie mir entgegen. Sie flüstern mir Worte zu, die sich auf ihren fernen Reisen manchmal etwas drehen und wenden. Worte, von denen sie das eine oder andere im Flug verlieren und es durch ein eigenes ersetzen.
Aus dem Osten kommen die Winde geflogen und aus dem Westen. Oft in der Gestalt von Vāyu, auch genannt Pavana, der Atem des Gottes Varuṇa, sowie als Rudra, der aus Brahmās Stirn Geborene. Sie sind es in all ihren verschiedenen Formen und Manifestationen. Vāyu, der Tausendäugige, sieht alles und ist so schnell wie die Gedanken der Menschen. Rudra sieht ebenso vieles mit seinen fünf Köpfen, er, der Gott der Erneuerung, der Regenbringende. Und wenn nicht, flüstern es ihnen ihre Söhne, die Maruts, die Wolken und Stürme, die jeden einzelnen Regentropfen beim Namen kennen: Bāriś, Barsāt, Varuśamu und all die anderen. Nicht immer sind sich Vāyu und Rudra eins, glaubt Vāyu doch noch an das Gute in den Menschen, beschönigt sogar, wenn es sein muss, wohingegen Rudra dunkel ist wie die Unterseiten seiner Nimbuswolken.
Kaum etwas entgeht den Winden. Sie schleichen durch Türspalte, Fensterritzen, Kamine, gar durch Nasenlöcher, um Gedanken flüstern zu hören. Wenn die Nase einmal verstopft sein mag, bahnen sie sich ihren Weg durch Ohren und Münder. Sie vermischen Innen und Außen, füllen und leeren Lungen, machen so Luft zu Atem. Sie lesen die Luftwirbel, die die Menschen mit ihren Bewegungen in den Raum schreiben, genauso wie die in der Luft hinterlassene Haut, die Haare und Düfte. So tun sie es seit Anbeginn der Zeit, wirbeln und zirkulieren um die Erde, wieder und wieder, in Höhen und Tiefen, durch alle Erdsphären, über alle Breiten- und Längengrade, zergehen und entstehen, bis sie sich in meiner Baumkrone wiegen.
Ich lausche den Winden gerne, denn sie kennen keine Grenzen, weder in Raum noch in Zeit.
Bauchvollwind
Die Geschichte beginnt an dem Ort, an dem sich Leben und Tod, Freude und Trauer, ja Hoffnung und Verzweiflung nicht näher sein könnten. An einem Tag, an dem die Winde so wild wehen, so stark, dass die Wetterfahnen auf den Dächern sich in Übelkeit um ihre eigene Achse drehen, mal nach links, mal nach rechts. Es ist der Tag seiner Geburt. Windmesser haben längst das Messen aufgegeben, Antennen beugen sich in ergebener Achtung vor den Lüften, Windsäcke zittern in alle Himmelsrichtungen, und selbst die Windrosen wissen nicht, ob es von Nord, Ost, Süd, West oder aus allen Richtungen gleichzeitig bläst.
Diesmal ist es nicht Vater Ramu, der schreit, sondern Mutter Marlis. Sie schreit die Krankenschwester an, den Arzt und manchmal sich selbst. Vor allem schreit sie ihre Mutter Loni an, die nervöser ist als bei Marlisʼ Geburt, die die Ärzte mit Vornamen anspricht und den Krankenpflegern, ja selbst den Putzkräften erklärt, was sie zu tun haben. Loni, die klein ist, aber oho, manchmal auch jaja oder einfach nur pfff. Marlis kann Ramu nicht anschreien, der ist nicht da. Er wollte, aber er konnte nicht, wirklich nicht, er hatte einen Termin, einen ganz wichtigen, den er schon seit Wochen immer wieder verschob.
Das Kind denkt nicht im Geringsten daran, den Mutterleib zu verlassen. Nicht, weil es (wie Gott Indra) meint, dass ihm solch ein Aus- beziehungsweise Eingang in die Welt nicht würdig sei. Eher, da es weiß, wie einfach es da drinnen und wie schwierig es da draußen ist, es weiß, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich geborgener fühlt, und dass von nun an alles ein Abschiednehmen und ein Sich-Entfernen sein wird. Marlis aber hat die Nase beziehungsweise den Bauch voll, schreit jetzt auch das Kind an, droht ihm gar mit einem Skalpell, sodass es sich doch entscheidet, das Licht der Welt zu erblicken. Und vielleicht sieht es tatsächlich etwas kurz nach seiner Geburt, so wie es Marlis anstarren wird, ohne zu schreien, ohne mit den winzigen Wimpern zu zucken.
Marlis zerdrückt die Hand der Krankenschwester, auch wenn es eigentlich Ramus Hand sein sollte – Hauptsache, sie hat etwas zum Zerdrücken. Schmerz schneidet Falten in ihr Gesicht. Die Haarsträhnen, die sie sonst so akribisch ordnet, kleben auf ihrer Stirn. Sie atmet ein letztes Mal tief aus, stärker als die Winde Vāyu und Rudra, die draußen toben. Ein letztes Stöhnen, ein letzter Schrei. Dann Stille, etwas mehr Stille, noch ein wenig, ein Starren, ein Staunen, und dann, ja, dann schreit ein Kind. Nicht wie Ramu, nicht wie Marlis, aber es schreit einen Schrei, den alle Neugeborenen gemein haben, egal, welche Sprachen, welche Dialekte oder Slangs sie eines fernen Tages sprechen werden.
Dieser Junge ist für Marlis ein Neubeginn. Er ist ein wenig Babygott Viṣṇu, der auf einem Banyanblatt durch die Sintflut der Gebärmutter getragen wird, sanft geschaukelt über die Wellen, bis er das Höhlentor durchdringt und in der Welt strandet. Mit seinem ersten Einatmen inhaliert er das ganze Universum, mit all seinem Sein und Nichtsein, und mit seinem Ausatmen erschafft er zumindest für Marlis ein neues: ein Universum, das etwas mehr im Gleichgewicht steht.
Manchmal hat Marlis das Gefühl, als hätte sie alles gegeben, was ihr nicht ohnehin schon genommen wurde. Ihr Gesicht hat sie nicht nur ein Mal verloren, denkt sie, auch ein Stück ihrer Seele, ihren Körper hat sie gegeben, als lägen um sie verstreut ihre Gliedmaßen, ihr Rumpf, ihr Kopf und sie wäre nur noch einzig und allein ein Herz, das erstaunlicherweise noch schlägt.
Und so gebiert sie ihre eigene Liebe, denn auf die der anderen konnte sie sich niemals verlassen. Dieser Junge ist ihr zweites Leben, ihre zweite Chance, mit ihm kann sie bei शून्य anfangen, sagen die Winde und verdrehen dabei wieder einmal ein Wort und das Alphabet. Bei Śūnya, bei null anfangen, meinen sie damit. Ihr Sohn ist die Chance, alles gut, alles besser zu machen, ist ihre Möglichkeiten, Träume und Vielleichts. Ihr Alles.
Marlis gibt dem Jungen einen Namen, aber die Winde sprechen ihn nicht aus. Und wenn doch, scheint der Name wie so vieles andere in dieser Geschichte erfunden zu sein, von den Winden verzerrt, und doch kommt er mir manchmal wahrer vor als wahr. Für den Moment einige ich mich mit ihnen auf Abbayi: der Junge.
Glückshormone vernebeln den Verstand, Tränen verwischen die Sicht, sodass keiner erkennt, dass das, was sie lediglich für ein Muttermal an Abbayis Bein halten, in Wirklichkeit ein kleines Stück Rinde ist. Es ist etwas dunkler, etwas rauer als ein Leberfleck und befindet sich auf der Innenseite des rechten Oberschenkels, ganz oben im Schritt. Auch später wird ihm keiner Aufmerksamkeit schenken, nicht einmal der Junge selbst – zumindest solange es nicht wächst. Nicht einmal die Blattadern unter seiner Haut entdecken sie, gleichen sie doch den menschlichen ungemein.
Nur die Winde wissen es, wie sie so vieles wissen.
Passagierinpassagierinwind
Eigentlich beginnt die Geschichte bereits mit einem anderen Wind. Mit dem आत्मन्, sagt Wind Vāyu und meint damit den Ātman, die Psyche, Spiritus, die Seele, den Geist, den Atem, das Ein- und Ausatmen, das Heben und Senken von Mutter Marlis’ Brustkorb. Die Geschichte beginnt inmitten der Winde, irgendwo zwischen den Haufenwolken, zwischen dem 15. und dem 75. Längengrad.
Wie ein Singvogel meinen Kern einst im Schnabel trug, trägt ein Flugzeug Marlis in seinem Bauch über Grenzen, über Land und Leute hinweg. Während Wind Rudra, Kraft des Monsuns, Schwerkraft und Schwerelosigkeit in einem Auf und Ab und Hin und Her gegeneinander ausspielt, ist Marlis zumindest froh, dass ihr eigener Magen leer ist. Sie verliert an Höhe, schwankt, schwebt, fällt der Landebahn Bangalores entgegen, wie auch mein Kern einst auf die Erde hinabfiel, von einer Sphäre in die nächste, durch Wolken und Welten, dem Zufall entgegen, weil der Vogel seinen Schnabel zum Singen öffnete.
Sie steht im Flughafen, angelehnt an einen Telefonkasten, in der einen Hand einen Hörer, in der anderen eine kleine Reisetasche vollgestopft mit Erinnerungen: Kleider, Schmuck, Parfüm, Champagner – Geschenke von Ramu. Sie steht an diesem Nicht-Ort in Indien, in Fast-Indien, steht im Transit und kann nicht weiter, denn sie hat kein Visum. Sie hat keins, weil der Mann, den sie liebt, den sie bis ins Verderben liebt, der hier sein oder zumindest den Telefonhörer abheben sollte, ihr versicherte, dass sie keins bräuchte.
Das war vor ein paar Tagen, als er wieder eine seiner spontanen Ideen hatte, eine Idee, die für Marlis hieß, so schnell wie möglich mit einer Boeing B747, LH754, von FRA nach BLR zu fliegen. Immer wenn er solche Einfälle hatte, und er hatte reichlich davon, sagte ihr etwas – vielleicht ihre Vernunft, ihr Verstand oder ihre Erfahrung –, dass sie sich nicht wieder darauf einlassen sollte. Aber sie konnte nicht anders, zu schmeichelhaft waren seine Worte, zu strahlend sein Lächeln, zu klug seine Argumente.
Nun steht sie da, zwischen hier und dort, abgereist und nicht angekommen, und wartet, wie sie so oft auf ihn gewartet hat. Ihr ganzes Leben, so kommt es ihr manchmal vor, ist ein Warten auf etwas, von dem sie sich nicht sicher ist, was es wirklich ist, von dem sie sich irgendwann einredete, dass er es sei. Es sollte doch anders sein, denkt sie sich, als sie ihn erblickt, seinen Maßanzug, seine italienischen Schuhe, seine braune Haut, seine brauneren Locken, seine noch brauneren Iriden. Seine großen Lippen, seine noch größeren Augen. Er überzeugt die Behörden, Marlis ins Land zu lassen, und sie ist sich unsicher, ob es an dem Bündel Geld liegt, das er immerzu bei sich trägt, oder an seinen Worten, die so vieles sein können, klug, liebevoll, aber auch verletzend.
Sie will ihm diesmal böse sein, will es wirklich, aber sie kann nicht, sosehr sie es versucht, sosehr sie auf dem Weg zum Wagen ihre Stirn auch in Falten legt und unter abgewandtem Blick in Lakonie verfällt. Die ganzen Tausenden Kilometer, der schlechte Schlaf, das ungenießbare Essen, nur um die wenigen Stunden, die sie mit ihm hat, im Streit zu verbringen? Außerdem hat er diese Art zu tun, als sei nichts gewesen, die indirekt ein Vorwurf ist, man selbst würde übertreiben. Manchmal hasst sie ihn für dieses Desinteresse, manchmal liebt sie ihn, weil er so undramatisch ist. Er erzählt von seinen Geschäftsideen, seinen neuen antiken Möbeln, von diesem und jenem, während Marlis stumm das nächtliche Bangalore an sich vorbeiziehen sieht und die Winde kaum hinterherkommen. Noch versteht sie nicht, oder will nicht verstehen, dass es nicht einer seiner Tricks ist, sondern seine Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.
Sie machen sich auf den Weg ins Hotel, denn viel Zeit bleibt nicht, haben sie doch schon ein Jahrzehnt mit Vielleichts und Eines-Tages und Ich-bin-mir-nicht-sichers verschwendet. Außerdem hat Marlis nur einen Zweiundsiebzig-Stunden-Zwischenstopp zwischen Hin- und Rückflug. Ja, es war seine Idee.
Sie hasst ihn dafür.
Sie liebt ihn dafür.
Erst als sie im Hotelzimmer vor ihm steht, bemerkt sie wieder, dass er nicht sonderlich groß ist, etwa so klein wie sie, dass er größer erscheint durch die Dinge, die er tut, die Sätze, die er sagt, die Menschen, mit denen er sich umgibt. Aber wie meint er doch immer: Im Liegen ist das egal, da sind wir alle gleich. Sonst jedoch sind sie wie Tag und Nacht, Für- und Gegenwind, immer uneins; und doch würde die eine ohne den anderen nicht existieren können. In dieser Geschichte sucht nicht der Prinz die Prinzessin, sondern die Prinzessin den Prinzen, sucht, was sie selbst nicht hat, aber auch niemals in jemand anderem finden kann.
Trotzdem gibt es diese Momente, wie rar sie auch sein mögen, in denen sie sich begegnen. Wie jetzt, da seine Lippen ihre umschließen, er ihren Widerwillen wegküsst, sie entkleidet, während sich draußen langsam die Dunkelheit in Helligkeit auflöst. Normalerweise ist sie es, die seine Lustlosigkeit, Müdigkeit, manchmal sogar den Geschmack der anderen Frauen wegküsst. Warum nicht mal so, denkt sie sich und gibt nach, erst mit ihren Lippen, dann mit der Zunge, den Händen, schließlich mit ihrem Geist.
Du hast es aber eilig, sagt Marlis.
Wir haben nur zweiundsiebzig Stunden Zeit, nicht wahr?, entgegnet Ramu.
Vielleicht hast du recht.
Daraufhin nimmt er die Champagnerflasche, lässt den Korken knallen und sagt: Heute zeugen wir ein Kind. Heute werde ich vom Sohn zum Vater.
Ramu ist ein Wissenschaftler, er weiß, dass die Kohlensäure den Alkohol schneller in die Gedanken sprudelt. Bei Marlis ist das egal, ihr Verstand ist ohnehin schon seit Jahren von diesem Mann berauscht. Und etwas sagt ihr – vielleicht ihre Unvernunft, ihr Verlangen oder ihre Unwissenheit –, dass es so sein muss, dass hier und jetzt die letzten zehn Jahre ein Ende finden. Zehn Jahre an Leid und Liebe, Streit und Versöhnung, Trennung und Zurückeroberung. Dann bewegt sich ihr Brustkorb schneller auf und ab und auf und ab, Atem mischt sich, bis Tag und Nacht das Zwielicht gebären. Ein Junge wird in Marlisʼ wartenden Bauch geliebt, während sich draußen die Winde neugierig gegen die Fensterscheibe drücken, vergebens anklopfen, um hereingelassen zu werden.
Marlis nimmt seit einem Tag nicht mehr ihre Pille.
Sie kam mit einem leeren Bauch und fliegt mit einem vollen wieder davon. Noch bevor der Junge das erste Mal die Winde in seine Lungenflügel zieht, noch vor seinem ersten Wimpern- oder Herzschlag ist er ein Migrant, geschmuggelt im Leib seiner Mutter, Passagier in einer Passagierin, Reisender im Bauch eines Bauches. Jetzt ist er der Samen, der schon kein Samen mehr ist, der Kern, der fallen wird und alles Werdende bereits in sich trägt.
Fastunbefleckteempfängniswind
Die Geschichte beginnt noch früher, dreißig Jahre früher, um genau zu sein. Mit einem spätherbstlichen Südwind und Loni, die in einer italienischen Eisdiele in Hagen arbeitet, während sie leise Volare vor sich hin summt. Wie in den meisten guten Geschichten ist Loni eine Prinzessin, Prinzessin Draupadī, nur weiß sie es nicht, als sie Primo das erste Mal erblickt. In diesem Moment ist ihr Kopf ohnehin so sehr mit Sehen beschäftigt, dass ihm nicht viel Platz zum Denken bleibt, ihr selbst das Volare im Mund stockt.
Primo hat einen weiten Weg hinter sich, seine Vorfahren kamen einst aus Italien, überquerten die Alpen, die Berge und Täler, um ein besseres Leben in Deutschland zu finden – ein Leben, in dem man sich in Hagen in eine italienische Eisdiele setzen kann. Aber kein Weg war so lang wie der, den er gerade hinter sich hat.
Der Weg zum und vom Grab seiner Mutter.
Die Trauer macht seine Beine schwer, er setzt sich hin. Sie macht seinen Blick apathisch, seine Gedanken taub, seine Stimme verloren, als er bei Loni ein Eis bestellt. Sie findet ihn schick, weiß nicht, dass der Tod seinen Kleidungsstil bestimmt. Sie mag seine dunklen lockigen Haare, seine große Statur, die breiten Schultern, die starken Hände. Er mag ihr hübsches rundes Gesicht, denkt sich aber, dass alles Mögen in diesem Moment nur profan sein kann.
Loni stellt ihm ein Erdbeereis mit extra Sahne hin und fragt: Warum hast du eine schwarze Armbinde an?
Die Trauer, die ich um mein Herz trage, sagt er, soll jeder sehen. Deswegen trage ich sie auch am Arm.
Ich weiß nicht, ob Wind Vāyu Primos Sätze lyrischer macht, ihm seine Worte in der Luft verdreht, ich mag sie so, wie sie sind. Trotzdem frage ich Vāyu, ob dies wirklich seine Worte seien. Erst beteuert er es jaulend, blinzelt mit seinen Tausenden Augen und fährt mit seinen windigen Fingern durch die Blätter, bevor er nach abermaligen Fragen meinerseits eingesteht, dass Primo eigentlich nur sagt: Meine Mamma ist gestorben.
Jetzt sieht jedenfalls auch Loni seine Trauer, selbst wenn sie die Augen schließt, sieht sie sie noch. Sie schämt sich für ihre Frage.
Könnte ich noch mehr Sahne haben?, fragt Primo. Und noch was: Willst du … Willst du dich vielleicht an Silvester treffen? Dann trage ich auch keine schwarze Binde mehr. Und keine schwarze Krawatte.
Loni schreibt ihm die schönste Rechnung, die sie jemals geschrieben hat, signiert mit einer Telefonnummer und ihrem Namen, der i-Punkt ein Herz, das flattert, wenn man genauer hinschaut. Primo lässt die Hälfte des Eises stehen, Loni vergisst den Text von Volare.
An Silvester denkt Bodo, seine Tochter feiere im behüteten Zuhause einer Freundin, obwohl sie sich in Wirklichkeit mit Primo auf einer Hausparty trifft. Primos Krawatte ist so rot wie Lonis Lippenstift. Jazz im Hintergrund, Prosecco im Vordergrund. Primo auf der einen Seite des Sofas, Loni auf der anderen. Mit jedem Lied rutscht er etwas näher, mit jedem Schluck tragen die Perlen den Rausch in die Köpfe. Vater Ramu scheint nicht der Einzige zu sein, der um die Macht des Schaumweins weiß, und Mutter Marlis nicht die Einzige, die das Prickeln auf der Zunge schätzt.
Mittlerweile ist Primo so nahe zu Loni gerutscht, dass er in ihr Ohr flüstern kann, und so flüstert er sie in das Zimmer nebenan. Er flüstert ihre Bluse und ihre Haare auf. Dann trägt Primo keine Krawatte mehr, Loni kaum noch Lippenstift. Eine starke Hand streichelt sanft ein rundes Gesicht, eine kleinere greift in volles italienisches Haar. Loni ist in Wirklichkeit Śatarūpā, die mit den hundert Formen, und Primo ist Gott Brahmā, der erst, als er Śatarūpā berührt, versteht, was eine wirkliche Berührung ist. Aberhundert Dinge hat er zuvor berührt, raue, harte, kühle, auch warme, weiche, sanfte wie Samt und Seide. So etwas wie Śatarūpās Haut und Haar jedoch ist ihm noch nie unter, über und zwischen die Finger gekommen.
Loni und Primo befinden sich zwischen dem einen und dem anderen Jahr, die in einem Zischen und Knallen aufeinandertreffen, ineinander übergleiten wie Primos Hand unter Lonis Bluse und Rock. Unerfahren tastet sie sich voran, sucht, verheddert sich, zieht sich zurück, um neuen Mutes anzusetzen. Draußen bricht der Himmel in Farben, und drinnen macht man alles, fast alles, was man ihnen weder zu Hause noch in der Schule beibrachte.
Lonis Kopf ist so sehr mit Küssen beschäftigt, dass ihr kaum Platz zum Denken bleibt.
Um Mitternacht, als die Minuten- und Stundenzeiger in einer Achse verschwinden, sich der eine hinter dem anderen versteckt, als die Nadel des Plattenspielers aus der Rille springt und es Loni mittlerweile überall kribbelt, geschieht das Wunder: die unbefleckte, die fast unbefleckte Empfängnis. Was genau geschieht, das sehen weder die Winde noch ich, denn Brahmā und Śatarūpā liegen in einer Lotusblüte, die sich bereits über ihnen geschlossen hat. Oder ist es doch nur eine Bettdecke?
Primo, so tuschelt zumindest Wind Rudra in eines meiner Blätter, kommt zu früh und doch nicht früh genug. Empfängt Loni ein Geschenk des Himmels? Oder des Zufalls? Oder hat Primo gar die asketischen Kräfte, sie durch seine Gedanken zu schwängern? Nein, nein, sagt Wind Vāyu, in Wahrheit tragen die Götter Mitra und Varuṇa dafür Verantwortung. Denn weit oben, über dem berstenden Himmel, dort, wo die Götter weilen, erblicken die Zwillingsbrüder die schönste aller Nymphen und vergießen ihren Samen, der zur Erde fällt, vorbei an explodierenden Feuerkörpern, durch ein offenes Dachfenster, vorbei an einer verwaschenen Bettdecke.
Sanskritsilbenwind
Wenn die Geschichte dort beginnt, dann muss sie auch hier beginnen, zwischen dem Golf von Bengalen und dem Arabischen Meer, zwischen den Flüssen Kṛṣṇā und Kāvēri, hier, wo sowohl der Nordost- als auch der Südwest-Monsunwind über Reisfelder bläst und Pappel-Feigen biegt. Bei Shridar, dem unglücklichsten glücklichen Mann von ganz Südindien. Shridar mit dem rasiermesserglatten Gesicht und dem weiß-schwarz-weißen, nach hinten pomadisierten Haar.
Er vermag es, gleichzeitig mit dem Mund zu lachen und mit den Augen zu trauern, mit den Worten zu lieben und mit der Stimme zu hassen. Er kann streicheln, bis es einen schmerzt. Shridar würde es niemals zugeben, aber man sieht es, wenn er seine Töchter anblickt, hört es, wenn er mit ihnen spricht: vier an der Zahl. Eine Tochter ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit, zwei sind bereits ein Unglück, drei ein finanzielles Desaster – aber vier? Vier sind der sichere Ruin.
Dabei sind sie alle auf ihre Art ansehnlich, man nennt sie die schönäugigen Schwestern, die eine mit Lotus-, die andere mit Reh-, die dritte mit Fisch- und die vierte mit Kuhaugen. Die Schönste ist die vierte, Sri Devi, nicht nur wegen ihren großen, lang bewimperten Augen, sondern wegen ihres Lachens. Ein liebliches Lachen, das sie zumeist hinter einer Hand oder ihrem Sari-Ende versteckt, als würde sie dadurch, den Heiligen gleich, eine Leuchtkraft bewahren, die sich sonst verlieren könnte.
Vahva, womit habe ich vier Töchter verdient? Nicht zwei, nicht drei, sondern vier?, fragt sich Shridar, während ihm sein Kummer nach und nach auch seine letzten schwarzen Haare ergrauen lässt. So viele, er könnte bald Gott Dakṣa mit seinen unzähligen Töchtern Konkurrenz machen. Trägt seine Frau daran Schuld? Sollte er sie dafür ächten? Oder schleppt er karmische Lasten aus seinem vorherigen Leben mit sich? Shridar glaubt an die alten Schriften, in denen es heißt, dass unsere Taten uns auf Schritt und Tritt begleiten wie ein Schatten. Und wenn ja, könnte er die Namen der Götter eines Tages an seinem Sterbebett säuseln, um Gnade zu erlangen?
Er ist Ortsmagistrat, ein geschäftiger wie ehrbarer Mann, der mit der ihm unterstehenden Polizei und ihren Stöcken für die Briten immer pünktlich die Steuern eintreibt. Er, der Meister der Zahlen, der jedes Leben des Dorfs mit Nummern versehen in seinen Büchern stehen hat, Bücher, die ihm von einem Höherkastigen, einem Brahmanen, hinterhergetragen werden.
Umso glücklicher ist Shridar, als er eine seiner Töchter, Sri Devi, die Kuhäugige, mit Anand verheiratet, einem großen Mann, lang und dünn, als hätten ihn die Götter auseinandergezogen. Sein Spitzname ist Hanuman, der Affengott, weil er mit seinen drahtigen Beinen so schnell von seinem Haus über den Marktplatz zu seiner Farm und wieder zurückläuft, ohne auch nur einen Tropfen Schweiß zu verlieren. Der Tag, an dem ein Schweißtropfen Anands den Boden berührt, wird den Kosmos aus dem Gleichgewicht bringen, mahnen die Dorfbewohner. Das wird der erste Tropfen der Sintflut sein.
Anand ist zwar nur ein Farmer mit Erde unter den Fingernägeln, aber dafür ist der neue Schwiegersohn ein tüchtiger Geschäftsmann aus der gleichen Kaste, jemand, der weiß, wie man aus wenig Land etwas Land macht und aus etwas viel. Aus zwei goldenen Kühen vier, aus vier acht und aus acht sechzehn.
Und ja, die Mitgift ist verhältnismäßig gering.
Sri Devi und Anand heiraten unter dem Banyanbaum inmitten des Dorfs. Der Baum ist nicht so alt wie ich, aber seine Krone ist groß genug, damit der ganze Ort darunter Platz findet, und so dicht, dass die um die Stämme und Luftwurzeln stehenden Gäste fast nicht mitbekommen, wie nach und nach das Tageslicht schwindet. Sri Devi und Anand gehen einen Bund ein, so fest wie die Schnur, die Sri Devi fast jedes Jahr zum Wohl ihres zukünftigen Mannes um den Hauptstamm der Banyan-Feige binden wird. Einen Bund wie der Knoten in ihrem weißen Sari mit rotem Saum und seinem gleichfarbigen Dhoti, seinem Beinkleid. Wie die zwei Fäden mit den goldenen Scheiben, die er ihr um den Hals bindet.
Sie gehören jetzt zusammen, weil Reddys Reddys, Naidoos Naidoos und Raos Raos heiraten. Weil die Familien es so wollen. Sie gehören zusammen, weil sie sich gegenseitig Girlanden um den Hals legen und Sri Devi so viel Gold trägt, dass man ihre Haut kaum mehr erkennen kann. Genauso wenig wie ihr Lächeln, das sie hinter einer mit Henna verzierten Hand verbirgt. Sie gehören zusammen, weil der Brahmane Sanskritmantren in das heilige Feuer murmelt, um das Sri Devi und Anand kreisen, und sie sieben Gelübde sprechen, die sie nahezu alle brechen werden. Weil die Sterne diesen Tag bestimmt haben und man das Brautpaar nach dem Bad mit Kurkuma und Öl beschmiert. Weil Anand Sri Devi Silberringe an die Fußzehen steckt.
Sri Devi heiratet Anand, und die ganze Familie heiratet mit, eigentlich das ganze Dorf.
Sie beziehen ein einfaches Haus am Rande der Ortes, das äußerlich den anliegenden ähnelt, im Inneren aber wird sich, wie in jedem anderen auch, sein ganz eigenes Drama abspielen. Und das, obwohl Anand niemals so ein unglücklicher Mann wie Shridar sein wird, denn seine Frau hält sich an die Wahrscheinlichkeit der Natur: Sohn, Tochter, Sohn.
Drei Kinder sind eine gute Zahl, da heißt es nur, die Frau sei von Lust getrieben, nicht, sie sei eine Hure, wie bei fünf. Nach dem über alles geliebten, vergötterten, verhätschelten, weil erstgeborenen Sohn namens Ravi erblickt die erste Tochter, Dipa, dann schließlich Ramu, der ewige Drittgeborene, das oft von Staub getrübte Licht der südindischen Welt.
Eigentlich müsste sich Dipa so fühlen, als sei sie das schwarze Schaf. Mit ihrer Haut, die so viel dunkler ist als die der anderen, fast wie ein verkokeltes Scheit, und diesen Augen, die weder die Form eines Rehs, einer Kuh, eines Lotus, geschweige denn die eines Fischs haben. Diejenigen, die hinter vorgehaltenen Sari-Tüchern wispern, nicht Anand sei in Wirklichkeit der Vater, sondern jemand anderes, jemand Dunkleres, gar ein Außenkastiger, ein von Sri Devi berührter Unberührbarer, die wissen nicht, dass sich während Dipas Empfängnis die Nacht in Sri Devi schlich und die Liebessäfte dunkel färbte.
In der Nacht von Ramus Zeugung hingegen – als am Himmel ein Halbmond wie an Shivas Stirn hängt und Anand langsam Sri Devis vorgehaltene Hand zur Seite schiebt, um sich vom Licht ihres Lächelns blenden zu lassen, er sie dann ablenkt, indem er ihr eines seiner Geheimnisse ins Ohr flüstert, damit er zeitgleich seine Hand unter ihren Nachtrock wandern lassen kann – weiß noch niemand, nicht einmal Anand selbst, dass er auch Sri Devis Schwester, Lila, der Rehäugigen, die ein paar Straßen nebenan nächtigt, alsbald Geheimnisse ins Ohr flüstern wird.
Nein, noch weiß niemand, dass er ein lüsterner Schlafwandler ist. Und niemand weiß, dass nicht nur er allein in dieser Nacht seine Frau liebt, sondern auch die Götter sie liebkosen. Anand und Sri Devi glauben, es sei nur der kühle Wind, der durch das Fenster weht, sich unter ihre Decke schleicht und ihre nasse Haut bedeckt. Der Sonnengott schenkt ihnen ein Kind, das ein wenig Gott Viṣṇu, ein wenig Brahmā, ein wenig Śiva und viele andere ist.
Sri Devi macht Lonis fast unbefleckte Empfängnis mit einer doppelten wieder gut.
Hochzeitshaubenwind
Die Winde wispern in meine Zweige noch ältere Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, in denen Loni noch nicht war. Von ihren Eltern Marta und Bodo, von den Wurzeln, die hinaus bis nach Westpommern wachsen, dorthin, wo die Oder ins Haff fließt. Marta lernt auf Schloss Stettin kochen und wird auch den Rest ihres Lebens den Suppenlöffel für die einen oder anderen rühren. Sie weiß es nicht, aber auch sie ist eine Göttin, oder zumindest eine Halbgöttin, die wie einst die anderen Götter eine Milchsuppe quirlt. Eine Suppe der Unsterblichkeit, die zu allen Seiten schäumt und wellt und aus der selbst ich vor langer Zeit erwuchs.
Schloss Stettin, Stolz der Greifen und Schweden und Polen und Preußen. Und von Marta, wenn keiner zugegen ist, sie das Quirlen vergisst, ihr Kinn in die Luft reckt, ihre Arme hinter dem Rücken verschränkt und majestätischen Schritts die endlosen Gänge entlangstolziert. Sie hat fast schon auf jedem der antiken Stühle gesessen, mal hundert, mal zweihundert Jahre unter ihrem Hintern, bis die Winde ihr den Geruch von verbrannter Milch entgegenwehen.
Die weiße Kochhaube und -schürze, die sie für ihre Ausbildung benötigt, schneidert ihr Bodo von der anderen Seite der Baumbrücke. In der Schneiderei angekommen, bewegen sich ihre Augen wie so oft schnell, von oben nach unten, von links nach rechts und zurück, als könnte ihnen etwas entgehen. Die Haube steht ihrem schönen runden Gesicht ganz vorzüglich, sagt der Mann mit dem Zentimetermaß um den Hals, als sie die Dienstkleidung in der Schneiderei anprobiert.
Das stupsnasige Gesicht mit den blauen, sich jetzt noch hektischer bewegenden Augen wird rot.
Bestimmt würdest du – entschuldigen Sie bitte, ich meine natürlich, würden Sie – noch vorzüglicher aussehen, wenn ich Ihnen ein Kleid nähen würde. So mit Rüschen und Schleppen. Wie die Damen in den Magazinen. Mach doch … Machen Sie doch Ihr Haar auf.
Doch Marta öffnet nie ihr festes blondes Haar, besonders nicht in der Gegenwart von Männern. Obwohl ihr Gesicht beim Anprobieren unter der weißen Haube noch röter wird, fast wie Chilipulver, liebt sie einen anderen, einen Fritz aus der Küche. Fritz ist eigentlich Künstler und schnitzt ihr Herzen aus Roter Bete im Frühling und aus Kürbis im Herbst. Das Problem mit ihm ist, dass seine Kunst nicht bedingungslos ist, er ihr immer nur unter die Schürze will. Beim Schälen, beim Garen, beim Abwaschen. Die Schürze gehört dir nicht, sagt sie ihm immer wieder. Wenn er anschließend schelmisch-enttäuscht lächelt, fügt sie hinzu: noch nicht.
Eines Tages sieht sie Fritz mit einem Zimmermädchen auf dem Gepäckträger seines Sesselrads durch die Stadtmauern in den Wald fahren. Ihre Schürzenschleife am Rücken flattert wie ihr langes Haar im Wind, ist leichter gebunden als Martas. Weil Fritz keine Zeit für das Wort noch hat, zerdrückt Marta jetzt ein protestierend-pochendes Herz aus Roter Bete, bis es dunkel aus ihren Händen tropft, an ihren Armen herunterrinnt. Sie weint in ihre Schürze, wischt sich ihre Tränen und den Saft damit weg, als ihr Blick in ihrer Schürze hängen bleibt. Sie schaut auf die Rote Bete, in die Schürze, auf die Rote Bete und muss an den Mann denken, der ihr das weiße Vortuch genäht hat, an die Kleider der Damen in den Magazinen. Sie sollte ihm die Schürze zurückgeben, kommt es ihr, sie gehört ihm.
Martas Hass auf Fritz wird zu ihrer Liebe für Bodo.
In diesem Sommer heiratet sie ihn, den Schneider, der ihr ein Kleid mit Rüschen und Schleppen näht, weißer als ihre Schürze, die Hochzeitshaube mit einem Schleier versehen. Das Gesicht darunter noch röter als das Kumkumpulver auf der Stirn verheirateter indischer Frauen.
Als Bodo den Schleier hebt und grinst, sagt er: Fräulein, ich meine, verehrte Frau, ich glaub, nein, ich bin mir sicher, Ihr schönes Gesicht passt gut auf das meine.
Ich finde, ich passe gut in dein Kleid, also mein Kleid, also …, antwortet Marta.
Bodo wirkt selbst an ihrem Hochzeitstag nicht groß, auch nicht sonderlich attraktiv mit seinem schütteren Haar. Dafür steht ihm sein extravaganter selbst geschneiderter Anzug mit der Fliege. Wichtiger aber ist das Strahlen, das ihn umgibt, vor allem, wenn er von morgen und übermorgen redet, all den Dingen, die er jetzt zusammen mit Marta erreichen und erleben will. Noch weiß Marta nicht, dass er nicht nur ein Talent als Schneider, sondern auch als Geschichtenerzähler hat, eine Gabe, die er ihrer gemeinsamen Tochter vererben wird.
Vielmehr fühlt sie sich an diesem Tag wie eine starke Frau, da sie der Überzeugung ist, dass sie es war, die sich ihren Mann aussuchte. Erst nachts, als Bodo nackt neben ihr schläft und sie ihre Hochzeitshaube in der Ecke des Zimmers liegen sieht, fühlt sie sich schwach, zumal sie sich nicht mehr sicher ist, ob sie Bodo, ob sie irgendjemanden jemals heiraten wollte und ob Liebe, die aus Hass erwächst, wirkliche Liebe ist.
Fast zur gleichen Stunde, als sich Bodos Gesicht erneut auf das ihre legt und ihr Haar einmal mehr durchwühlt, so berichten es zumindest die Winde, erschießt jemand einen Herzog und seine Herzogin in einer Stadt namens Sarajevo. Danach wird die ganze Welt nicht mehr so sein, wie sie davor war, auch Deutschland wird nicht mehr Deutschland und Polen nicht mehr Polen sein, so wie Marta nie wieder die freie Marta von vor der Hochzeit sein wird. Sie flieht mit Bodo, weit weg, auf eine Insel in der Ostsee, wohin ihnen der Krieg, so hoffen sie, niemals folgen kann.
Mir scheint es, als hätten die Winde wieder einmal mit zu dicken Backen geblasen, als hätten sie die Uhrzeiger der Ziffernblätter verdreht, um ihre Geschichten noch dramatischer zu machen, als sie ohnehin schon sind. Doch was bleibt mir anderes übrig, als ihnen zu glauben.
यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद्य-
स्मान्नणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक-
स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्
Höher als der nichts anderes ist vorhanden,
Nichts Kleineres und nichts Größeres, was auch immer,
Als Baum im Himmel wurzelnd steht der Eine,
Der Purusha, der diese ganze Welt füllt.
Śvetāśvatara-Upaniṣad III.9
Blätterhaarwind
Eigentlich müsste ich lange vor dieser Zeit beginnen, in einer Zeit vor den vier Zeitaltern, als Wahrheit und Lüge, Himmel und Hölle, Leben und Tod, Tag und Nacht, ja selbst die gegensätzliche Zweiheit noch nicht sind. Noch bevor sich die Ozeane mischten, als Gott Viṣṇu auf seiner Schlange im kosmischen Schlaf ruht und der vierköpfige Gott Brahmā auf einem Lotus aus seinem Bauchnabel erwächst, um das Universum aus dem Schlummer zu holen. Noch bevor man den Milchozean quirlte, ich aus seinem Schaum entstand, oder ein Teil von mir, und die Dämonen mit den Göttern um den Nektar des Ozeans kämpften. Ich kann die Jahresringe schon gar nicht mehr zählen, so viele Maserungen haben sich über die Jahrzehnte, -hunderte, -tausende angesammelt, so ergraut ist hier oder da meine Blätterpracht.
Ich sollte zumindest den Minister des blauen Gottkönigs Rāma erwähnen, dessen Finger vor Abertausenden Jahren den juwelenen Ohrring einer Mutter verschwinden lassen. Und die Söhne, die sie darum bittet, ihren Ohrring wieder zurückzubringen, besonders den einen Sohn, den jüngsten, der es vollbringt. Seine Nachfahren werden eine Kaste formen, die den Namen dieses Ohrrings tragen: Kamma.
Die gleichen Nachkommen, die wiederum Tausende Jahre später für einen der mächtigsten Könige Südindiens, Kṛṣṇdevarāya, eine Schlacht nach der anderen bestreiten und so Macht und Ruhm erlangen. Bis sie weiterwandern, ins Herz des indischen Südens, wo die Mangos süßer sind als meine Früchte. Wo man Affen jagt und in jedes Haus einen Gebetsraum baut und wo die Steine auf den Bergen so aussehen, als hätten die Götter mit ihnen Murmeln gespielt.
Dort lassen sie sich unter einem meiner Verwandten nieder, einem Banyanbaum, der im 15





























