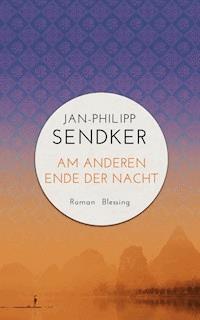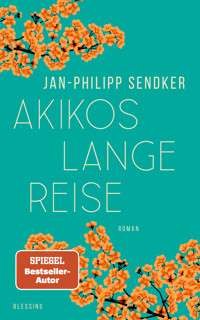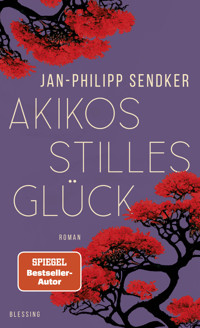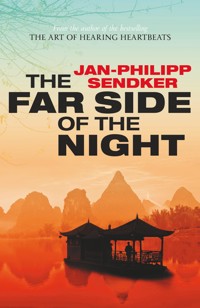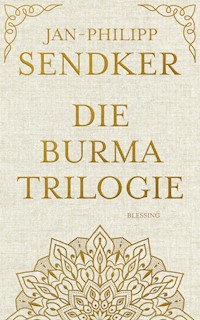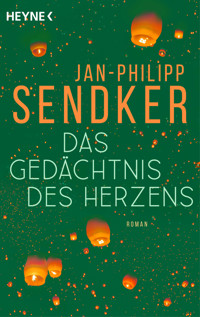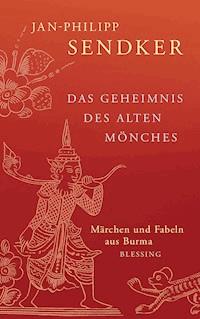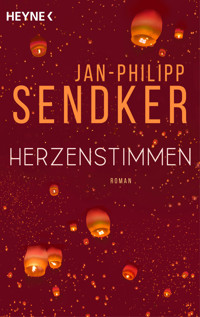9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die China-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der durch die Kraft der Gefühle verzaubert. Spannend, geheimnisvoll, berührend.
Paul hat sich in die Einsamkeit einer Insel vor Hongkong zurückgezogen. Nur hier kann er die Erinnerungen an seinen mit acht Jahren verstorbenen Sohn vor dem Lärm der Welt schützen. Als sein einziger Freund, der Kommissar Zhang, einen offiziell für gelöst erklärten Mordfall aufrollt, lässt Paul sich widerstrebend in den ungleichen Kampf gegen die chinesische Obrigkeit hineinziehen. Im Angesicht extremer Gefahr öffnet sich ihm ein Pfad zurück ins Leben.
Nichts scheint Paul Leibovitz aus seiner selbst gewählten Isolation herausreißen zu können. Auch nicht die engelsgleiche Geduld und das Liebeswerben von Christine Wu. Aber dann macht Paul die Bekanntschaft einer Amerikanerin, deren Sohn in China ermordet wurde. Ihre Verzweiflung über den Verlust rührt an seinem eigenen Trauma. Noch scheut er davor zurück, sich an der Aufklärung zu beteiligen, die sein Freund Zhang auf eigene Faust unternimmt. Christine, die aus leidvoller Erfahrung weiß, wie in China die Behörden mit ungebetener Neugierde umgehen, hat Paul Leibovitz das Versprechen abgenommen, sich aus diesem mysteriösen Fall herauszuhalten. Paul ist hin und her gerissen und droht seinen letzten Halt zu verlieren.
Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte und ein Kriminalfall, der in die Abgründe des modernen China führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Seit dem tragischen Tod seines Sohnes lebt Paul auf einer kleinen Insel vor Hongkong. Er hängt seinen Erinnerungen nach und meidet Kontakt zu anderen Menschen. Auch die engelsgleiche Geduld und das Liebeswerben von Christine Wu prallen an ihm ab. Als Paul die Bekanntschaft einer Amerikanerin macht, deren Sohn in Hongkong ermordet wurde, rührt ihre Verzweiflung über den Verlust an seinem eigenen Trauma. Zuerst scheut er davor zurück, sich an der Aufklärung zu beteiligen. Als er sich doch dafür entscheidet, öffnet sich ihm im Angesicht dieser Herausforderung ein Pfad zurück ins Leben und zur Liebe.
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asien-Korrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009) und Herzenstimmen (2012). Seine Romane sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 3 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.
JAN-PHILIPP
SENDKER
Das Flüstern der Schatten
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Vollständige deutsche Taschenbuchneuausgabe 09/2016
Copyright © 2007 der Originalausgabe by Karl Blessing Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © 2016 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München, unter Verwendung eines Motivs von © GettyImages/ViewStock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-01484-1V002www.heyne.de
Für Anna,Florentine und Jonathan
PROLOG
Er war ein schmächtiges Kind. Schon bei der Geburt. 2980 Gramm, kaum mehr als ein Frühchen. Trotz der Woche, die er länger als geplant im Leib seiner Mutter zugebracht hatte. Kein Grund zur Sorge, versicherten die Ärzte. Das wird er aufholen.
Seine Haut wirkte blass, fast durchsichtig und noch zarter als die der anderen Neugeborenen. An den Schläfen, am Kinn und an den Händen schimmerten die blauen Äderchen durch, selbst noch nach den ersten Wochen, in denen sich Säuglinge normalerweise in gut gepolsterte Babys verwandeln.
Seine Schreie waren weniger schrill, weniger durchdringend und von geringerer Ausdauer als die der anderen. Er war schnell erschöpft, auch später, als Drei-, Vierjähriger. Wenn die anderen Kinder auf dem Spielplatz in der Bowen Road oder später am Strand von Repulse Bay nicht wussten, wohin mit ihrer Energie, wenn sie kletterten, tobten oder mit wildem Geschrei ins Wasser rannten, saß er im Sand und blickte ihnen nach. Oder er krabbelte auf den Schoß seines Vaters, legte den Kopf auf dessen Schulter und schlief ein. Er war sparsam in seinen Bewegungen. Als spürte er, dass er mit seinen Kräften haushalten musste, dass seine Zeit begrenzt sein würde. Kein Grund zur Sorge, glaubten die Ärzte. Jedes Kind ist anders.
Er blieb ein zierlicher Junge. Dünne Beinchen und Ärmchen ohne muskulöse Konturen, stöckchengleich, auch mit sechs Jahren noch so leicht, dass ihn sein Vater mit einem Arm packen und in die Luft stemmen konnte. In der Schule, im Unterricht, gehörte er zu den Stillen. Wenn die energische Frau Fu ihn etwas fragte, wusste er in den meisten Fällen die richtige Antwort, aber von sich aus sagte er nichts. In der Pause spielte er lieber mit den Mädchen oder saß allein auf dem Hof und las. Am Nachmittag, wenn die anderen Jungen sich in Fußballer oder Basketballer aufteilten, ging er zum Ballettunterricht. Seine Eltern waren dagegen gewesen. War er nicht schon Außenseiter genug? Ein Sonderling ohne enge Freunde. Er brauchte nicht lange zu betteln. Die stille Enttäuschung in seinem Gesicht war eine eindringliche Bitte, die ihm sein Vater nicht abschlagen konnte.
Wenige Wochen später klagte er das erste Mal über Schmerzen. Die Glieder taten ihm weh, vor allem die Beine. Ganz normal sei das, tröstete ihn der Ballettlehrer, viele Kinder litten darunter, wenn sie mit dem Tanzen beginnen, vor allem, wenn sie es mit jener Hingabe tun, die ihn auszeichnete. Muskelkater von den ungewohnten Bewegungen, vermutete auch sein Vater. Ein befreundeter Orthopäde beruhigte die Eltern. Wahrscheinlich wächst der Junge, da sei ein kräftiges Ziehen in den Knochen nichts Ungewöhnliches. Das gehe vorbei. Kein Grund zur Sorge. Dann kam die unerklärliche Müdigkeit hinzu. Er schlief während des Unterrichts ein, konnte sich schlecht konzentrieren und verbrachte die Nachmittage zumeist auf dem Sofa im Wohnzimmer.
Wären sie schneller zum Arzt gegangen, wenn man die Beschwerden nicht auf das Ballett hätte schieben können? Wenn er ein vor Kraft strotzender Junge gewesen wäre, einer, bei dem jede anhaltende Müdigkeit, jeder Gewichtsverlust sofort aufgefallen wäre? Hätten sie seine Klagen ernster nehmen müssen? Waren sie unachtsam oder leichtfertig gewesen? Sie konnten nicht einmal mit Sicherheit sagen, wann die Schmerzen zum ersten Mal aufgetreten waren. Meredith konnte sich überhaupt nicht erinnern. In der fraglichen Zeit war sie in London gewesen. Oder in New York. Oder in Tokio. Jedenfalls nicht in Hongkong. Aber du, Paul, du musst es doch wissen, hatte sie gesagt und ihn angeblickt. Und auch der Arzt hatte den Kopf gewandt und ihn angeschaut. Er überlegte. Er schwieg. Er wusste es nicht.
Es hätte am Ende keinen Unterschied gemacht. Das betonten die Onkologen bei jeder Gelegenheit. Paul war sich nicht sicher, ob sie es nur sagten, um ihn zu beruhigen, damit ihn, neben der panischen Angst um das Leben seines Sohnes, nicht auch noch das schlechte Gewissen quälte, oder ob es den Tatsachen entsprach. Früherkennung spielt bei Leukämie im Gegensatz zu den meisten anderen Krebsarten keine Rolle, erklärten die Ärzte ihm wieder und wieder, oft ungefragt und immer etwas übereifrig. Als würden sie seine Schuldgefühle voraussetzen. Als wären diese berechtigt. Und selbst wenn sie Recht hatten, selbst wenn ein früherer Arztbesuch nichts an der Krankheit, an der Behandlung, an der Prognose und der Überlebenschance geändert hätte, was bedeutete das schon? Trost? Paul und Meredith Leibovitz hatten als Eltern versagt, da gab es für ihn gar keine Zweifel. Ihr Sohn war ihnen in die Obhut gegeben worden, sie waren für sein Wohlergehen, für seine Gesundheit verantwortlich, und sie, Paul und Meredith Leibovitz, hatten ihn vor dieser Krankheit nicht schützen können. Wozu waren Vater und Mutter gut, wenn sie ihr Kind davor nicht bewahren konnten?
»Hadern Sie nicht mit sich. Hadern Sie mit Gott, wenn Sie wollen. Hadern Sie mit dem Schicksal. Hadern Sie mit dem Leben, aber nicht mit sich. Sie können nichts dafür«, hatte ihnen Doktor Li, der behandelnde Onkologe, kurz nach der Diagnose in einem Gespräch geraten. Meredith hatte sich das zu Herzen genommen und sich in den folgenden Monaten von ihren anfänglichen Schuldgefühlen befreien können. Paul nicht. Er glaubte nicht an Gott, er glaubte nicht an ein Karma, es gab nichts und niemanden, den er für die Krankheit verantwortlich machen, dem er die Schuld dafür geben konnte. Nichts und niemandem außer seiner eigenen Unvollkommenheit.
Paul stand am Fenster und schaute hinaus. Es war früh am Morgen, direkt vor dem Krankenhaus lagen mehrere Tennis- und Fußballplätze, ein paar Jogger nutzten die um diese Uhrzeit noch erträglichen Temperaturen und zogen ihre Runden. Die tief hängenden, dunkelgrauen Wolken der vergangenen Tage waren verschwunden und einem blauen, wolkenlosen Himmel gewichen. Der Monsunregen hatte den Smog aus der Luft gewaschen, und die Sicht war klar wie selten in Hongkong. Er konnte deutlich den Peak erkennen, davor den schlanken IFC-Turm und die Bank of China. Zwischen den Hochhäusern in Ost-Kowloon und Hung Hom schimmerte das silbergraue Wasser des Hafens, in dem bereits Dutzende von Fähren, Schlepper und Schuten kreuzten. Auf den hochgelegenen Schnellstraßen, der Gascoigne Road und der Chatham Road South, standen die Autos schon im Stau. Er dachte an den Strand in Repulse Bay und an das Meer und wie oft er an Wochenenden mit Justin um diese Uhrzeit hinausgegangen war, wenn Meredith noch schlief, und Sandburgen gebaut hatte. Nur sie beide, Vater und Sohn, umweht von der feucht-warmen, tropischen Sommerluft, getragen von einem gegenseitigen Verständnis, das keiner Worte bedurfte. Wie Justin ihn mit Matsch einschmieren durfte und wie sie lachend zurückkehrten und die verschlafene Meredith immer etwas irritiert auf ihre gute Laune reagierte und einige Zeit und zwei Kaffees benötigte, um sie mit ihnen teilen zu können.
Er drehte sich um. Das Zimmer war winzig, kaum größer als eine Kammer, er konnte es mit zwei, drei großen Schritten durchqueren. An der rosa gestrichenen Wand stand Justins Bett, daneben das Gestell für den Tropf, ein Stuhl, ein Nachtschrank und ein ausziehbarer Sessel, auf dem Paul die Nächte verbrachte. Auf dem Nachtschrank lagen zwei Bücher, aus denen Paul oft vorlas, und ein Stapel Kassetten, die Justin bis vor einigen Tagen noch gern gehört hatte. Jetzt fehlte ihm selbst dazu die Kraft. Paul beobachtete seinen schlafenden Sohn. Seine Haut war so weiß wie die Bettwäsche, alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen, auf dem Kopf wuchs ein weicher, hellblonder Flaum. Er atmete schwach, aber ruhig.
Paul setzte sich und schloss die Augen. »Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen …« Neun Monate war es her, dass der Kinderarzt ihnen mit gedämpfter Stimme und sorgenvoller Miene die Ergebnisse der ersten Blutuntersuchung mitgeteilt hatte. Seitdem hörte er diesen Satz, er hatte von ihm Besitz ergriffen, hallte auch heute, neun Monate später noch durch seinen Kopf. Würde er ihn je wieder los werden? Würde er je wieder etwas anderes hören? »Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen …«
Warum mein Sohn?, hatte er damals den Arzt anbrüllen wollen, aber stattdessen geschwiegen und zugehört, wie der von Myeloischer Leukämie, von Hb-Werten, Knochenmarksuntersuchungen und Protokollen sprach. Warum Justin? Warum stellte Meredith sich diese Frage nicht mehr?
Erleichterung gab es nur in den kurzen Momenten, in denen Paul nachts aufschreckte und glaubte, geträumt zu haben. Für Sekunden saß er dann im Bett und hatte das Gefühl, aus einem Albtraum erwacht zu sein. Es war nicht wahr. Die Blutwerte waren normal. Justin hatte noch seinen rötlich-blonden Lockenkopf, die Haare waren ihm nicht ausgefallen. Er lag nebenan in seinem Kinderzimmer im Bett und schlief. Dann erlebte Paul für einen kurzen Augenblick eine Leichtigkeit, eine Freude, so unermesslich, ja fast töricht, wie nie zuvor in seinem Leben. Umso schlimmer war der Absturz Sekunden später.
Wo war Meredith? Warum war sie nicht bei ihnen? Sie saß im Flugzeug. Flog vermutlich gerade in 12000 Meter Höhe über Pakistan und Indien hinweg. Oder über Kasachstan und Usbekistan, je nachdem ob die Maschine aus London die nördliche oder die südliche Route genommen hatte. Eine ganz wichtige Konferenz, hatte sie gesagt. Es ging um die neue China-Strategie der Bank. Um Investitionen und Beteiligungen in Milliardenhöhe. Da könne sie als Leiterin der Hongkong-Niederlassung unmöglich fehlen. Zwei, maximal drei Tage sei sie in Europa. Bis zur kommenden Woche könnten sie Justins Zustand stabil halten, das hätten ihr die Ärzte versichert. Außerdem betäubte das Morphium Justin, er schlief praktisch den ganzen Tag, da würde er, so glaubte sie, die Abwesenheit seiner Mutter ohnehin nicht bemerken. Sie hatte ihn, Paul, angeschaut, und sie hatten sich kurz in die Augen geblickt. Zum ersten Mal nach langer Zeit. Sollte er ihr widersprechen? Sollte er ihr erklären, dass er fest davon überzeugt war, dass Justin sehr wohl spürte, ob Vater oder Mutter im Zimmer waren, ob sie bei ihm saßen, ihm die Hand hielten, über die Stirn strichen oder zu ihm sprachen, auch wenn sein Körper keine offensichtliche Reaktion mehr zeigte. Deshalb hatte er seit fast einer Woche das winzige Zimmer praktisch nicht verlassen. Deshalb saß er hier, campierte auf dem kleinen Ausziehsessel, der mindestens zehn Zentimeter zu kurz war und auf dem an Schlaf nicht zu denken war. Deshalb las er aus Büchern vor, sang Schlaf-, Wander- und Weihnachtslieder, alles, was ihm einfiel, bis ihm die Stimme versagte. Er wusste, dass Meredith ihre Entscheidung gefällt hatte und dass sie sich nicht umstimmen lassen würde, dass sie von ihm nicht einmal mehr Verständnis erwartete.
Merediths Arbeitsbelastung hatte in dem Maß zugenommen, in dem sich Justins Zustand verschlechterte. Irgendwo hatte er gelesen, dass das kein untypisches Verhalten sei bei Eltern, deren Kinder an Krebs erkranken, untypisch war nur, dass es in ihrem Fall die Frau war, die sich in die Arbeit flüchtete. Zwei Tage nach der Diagnose war sie ganz unerwartet nach Tokio geflogen. Sie pendelte fortan häufiger zwischen Peking, Shanghai und Hongkong, langen Arbeitstagen folgten Abendessen mit Kunden, die bis spät in die Nacht dauerten. Zu Beginn der Krankheit hatte sie noch um Pauls Verständnis geworben. Hatte ihm erklärt, wie schwer es ihr fiele, wie zerrissen sie sei, wie oft sie vor dem Start in den Maschinen saß und aufstehen und wieder hinauslaufen wollte, wie viel Kraft es sie kostete, diesen Impulsen nicht nachzugeben.
Seit dem Rückfall vor zwei Monaten nicht mehr. Seitdem klar war, dass es kaum Hoffnung für Justin gab, fragte sie nicht mehr und warb um nichts. Sie teilte mit. Paul hatte manchmal den Eindruck, als hätte sie ihren Sohn bereits aufgegeben, wie ein marodes Unternehmen, dessen Bilanzen sie gründlich studiert hatte, bevor sie zu dem Schluss gelangte, dass es keine Rettung gab und jede weitere Investition nichts als reine Vergeudung von Ressourcen darstellte. Ressourcen, die woanders dringender gebraucht wurden.
Auf der Kinderkrebsstation hatte Paul zwei verschiedene Arten von Paaren beobachtet. Die einen schauten sich noch in die Augen, die Krankheit ihres Kindes schmiedete sie zusammen, sie teilten ihre Angst, ihre Verzweiflung und ihre Schuldgefühle miteinander. Sie stützten sich, gaben sich Kraft oder klammerten sich aneinander. Die anderen schlichen über die Krankenhausflure, die Köpfe gesenkt, die Augen starr auf den Boden gerichtet. Sie fürchteten den Blick ihres Mannes oder ihrer Frau, weil sich darin spiegelte, was sie nicht sehen wollten: ihre eigene Furcht, ihre Wut und ihre grenzenlose Trauer. Die Krankheit trieb sie auseinander. Sie verstummten im Angesicht des Todes, sie wandten sich ab, sie zogen sich zurück, immer verzweifelter auf der Suche nach einem Ort, wo sie der Schmerz hoffentlich nicht finden würde. Zu ihnen gehörten Paul und Meredith Leibovitz.
Selbst vor drei Tagen, bei der schwierigsten aller Entscheidungen, konnten sie sich nicht mehr in die Augen schauen, saßen sie Seite an Seite, ohne einander zu berühren, wie zwei Fremde, waren nicht in der Lage, Hilfe und Kraft im anderen zu finden. Die Ärzte machten ihnen keine Hoffnungen. Der Rückfall vor sechs Wochen war ebenso unerwartet wie heftig. Die Krebszellen vermehrten sich explosionsartig. Auf die zwei Blöcke Chemotherapie reagierten sie nicht mehr. Alle medizinischen Optionen waren ausgeschöpft. Jetzt ging es nur noch darum, Justin so wenig wie möglich leiden zu lassen. Und es ging um die Frage, ob sein Leben um jeden Preis verlängert werden sollte. Möglichkeiten gäbe es. Sie sprachen von Intensivstation und künstlicher Beatmung. So wäre mit Sicherheit Zeit zu gewinnen, vielleicht eine Woche oder auch zwei. Medizinisch kein Problem.
Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, Herr und Frau Leibovitz?
Meredith schwieg. Sie hatte die Augen geschlossen und schwieg.
Die Ärzte schauten ihn an. Sie warteten. Sie warteten auf eine Entscheidung. Haben Sie noch Fragen? Sollen wir es Ihnen noch einmal erklären? Meredith schwieg, Paul schüttelte den Kopf.
Sollen wir Justin auf die Intensivstation verlegen?
Paul schüttelte wieder den Kopf.
»Nein?«, fragten die Ärzte.
»Nein!«, hörte er sich sagen. »Nein.« Er hatte entschieden. Meredith widersprach nicht.
Es muss kurz nach 14 Uhr gewesen sein, als das Herz aufhörte zu schlagen. Den exakten Zeitpunkt des Todes konnte Dr. Li später nur schätzen.
Um 13 Uhr war zuletzt eine Krankenschwester im Zimmer gewesen. Sie wollte die Suppe und den Tee, die sie eine Stunde zuvor gebracht hatte und die unberührt und erkaltet auf einem kleinen Tisch standen, wieder mitnehmen. Sie fühlte den Puls des Jungen, der schwach aber regelmäßig war. Sie prüfte den Tropf und den Katheter und ob Justin genug Morphium bekam. Paul Leibovitz saß stumm neben dem Bett und hielt die Hand seines Sohnes. Auf seinen Wunsch war das EKG-Gerät abgeschaltet worden, sodass in dem Raum, im Gegensatz zum Rest der Station, eine ungewöhnliche Stille herrschte.
Dr. Li betrat um fünf Minuten vor drei das Zimmer und glaubte zunächst, Vater und Sohn wären zusammen eingeschlafen. Paul Leibovitz war nach vorn gesunken, sein Oberkörper lag auf dem Bett, der rechte Arm ausgestreckt, die linke Hand umklammerte die zarten Finger seines Sohnes. Justins Kopf war tief im Kissen versunken und zur Seite geneigt. Erst beim zweiten Blick bemerkte Dr. Li, dass der Junge nicht mehr atmete, dass seine Augen erstarrt und weit geöffnet waren, dass der Vater nicht schlief, sondern weinte. Nicht laut, nicht anklagend, es war kein Schmerz, der herausgebrüllt wurde, wie er es hier so oft erlebte. Dieses Schluchzen war furchtbar leise, kaum zu vernehmen, es war tief nach innen gerichtet und klang deshalb umso verzweifelter.
Dr. Li hatte in den vergangenen dreißig Jahren, trotz aller Fortschritte der Medizin, viele Kinder sterben sehen. Für alle Eltern war der Tod des Kindes eine traumatische Erfahrung, aber in den meisten Fällen gab es Geschwisterkinder, die nach Aufmerksamkeit verlangten, Großeltern, die gepflegt werden wollten, Arbeit, die getan werden musste, Hypothekenverpflichtungen, auf deren monatliche Erfüllung die Banken pochten. Das Leben ging weiter, auch wenn sich das die Familien in den ersten Wochen und Monaten nicht vorstellen konnten. Einige, wenige zerbrachen an dem Verlust. Sie ließen sich von Schuldgefühlen zerfressen oder versanken im Selbstmitleid. Sie konnten die entstandene Leere nicht ertragen oder weigerten sich schlicht, ihre Kinder sterben zu lassen. Sie fanden nicht wieder zurück ins Leben. An sie musste Dr. Li denken, als er Paul Leibovitz schluchzen hörte.
I
Paul lag regungslos in seinem Bett, hielt den Atem an und lauschte. Er hörte nichts als das leise, monotone Summen der Ventilatoren. Er hob leicht den Kopf von seinem Kissen. Horchte. War das nicht der erste Vogel? Es kam von der anderen Seite des kleinen Tals, ein schwaches, vereinzeltes Zwitschern, so zaghaft, dass Paul sich wunderte, dass es auf dem Weg zu ihm nicht verstummt war. Die Laute waren ein gutes Zeichen. Sie bedeuteten, dass bald die Dämmerung anbrach, dass im Dorf der erste Hahn kräht, dem die anderen in Sekundenabständen folgen. Sie bedeuteten, dass in wenigen Minuten die Vögel auch in seinem Garten zu singen beginnen, dass er das Klappern des Geschirrs und der Töpfe seiner Nachbarn hören wird. Dass die Nacht vorüber ist. Dass er die Stimmen der Dunkelheit nicht mehr ertragen muss.
Bis zur Sonne und wieder zurück.
Du musst keine Angst haben. Ich pass auf dich auf.
Paul wartete, bis die ersten Lichtstrahlen durch die Holzrolladen fielen und die Stimmen ganz verstummten. Warum höre ich sie am Tage so selten, fragte er sich, während er das Moskitonetz zur Seite schob und aufstand. Warum schweigen sie, sobald die Vögel singen? Als wenn das Sonnenlicht ihnen ihre Kraft raubte.
Er machte sein Bett, rollte das Netz, das ihn gegen die Mücken schützte, zusammen, stellte die Ventilatoren aus, ging hinunter in die Küche, setzte im Tauchsieder Teewasser auf, ging wieder hoch ins Badezimmer und stellte die Dusche an. Das Wasser war zu warm, um wirklich zu erfrischen. Es war eine typische tropische Sommernacht gewesen, heiß und feucht, er hatte viel geschwitzt, trotz der zwei Ventilatoren, die am Fußende seines Bettes standen. Seine Nachbarn hielten ihn für verrückt, weil er sich weigerte, wenigstens im Schlafzimmer eine Klimaanlage einzubauen, er war, vom alten Teng abgesehen, der Einzige auf dem Hügel, der auf diesen Luxus freiwillig verzichtete. Früher war er oft nachts vom gekühlten ehelichen Schlafzimmer auf das Sofa im Wohnzimmer gezogen, hatte dort die Fenster weit geöffnet und die feucht-warme Luft herein gelassen. Meredith verstand das nicht, sie hasste es zu schwitzen, hasste das klebrige Gefühl auf ihrer Haut, die feuchten Sachen am Körper, »diesen Geruch«, wie sie ihn nannte und den sie verabscheute, obgleich es ihr eigener war. Heute fragte Paul sich, ob ihm das hätte eine Warnung sein sollen? Wie hatte er glauben können, mit einem Menschen glücklich zu werden, der sich selbst nicht riechen konnte?
Zu Beginn ihrer Liebe war sie nicht so empfindlich gewesen oder zumindest hatte sie sich sehr bemüht, es nicht zu zeigen. Sie hatten viele wunderschöne Abende auf Pauls kleinem Balkon im vierzehnten Stock eines Hochhauses in Happy Valley verbracht, hatten dort nach langen Tagen im Büro zu Abend gegessen, getrunken, geredet und gelacht, obgleich ihre Körper im Schweiß badeten. Er durfte sie berühren und verführen, ohne dass ihr der eigene Geruch, die feuchten Körper unangenehm waren. Später nicht mehr. Später war ihr Schlafzimmer so heruntergekühlt, dass Sex ohne Bettdecke unweigerlich zu einer Erkältung geführt hätte. Meredith bewegte sich neun Monate des Jahres praktisch ausschließlich zwischen ihrem klimatisierten Büro, gekühlten Restaurants, Einkaufszentren und Autos und ihrer klimatisierten Wohnung hin und her.
Meredith. Er wusste nicht, wann er das letzte Mal an sie gedacht hatte. Vermutlich an Justins Geburtstag vor vier Monaten. Er hatte kurz überlegt, sie anzurufen, bis ihm einfiel, dass er nicht einmal ihre Telefonnummer in London besaß. Sein Anwalt hätte sie ihm vermutlich besorgen können, aber das wäre zu viel der Mühe gewesen, nur um sich dann am Telefon nach den üblichen Höflichkeitsfloskeln wieder anzuschweigen. Warum endete jedes Gespräch zwischen ihnen in einer erdrückenden Stille, als wäre das ein Naturgesetz? Sie stritten sich nicht einmal mehr, damit hatten sie schon wenige Wochen nach Justins Tod aufgehört. Es war mehr das Gefühl einer großen Leere, eines Überdrusses aneinander, einer Gleichgültigkeit, die er nie für möglich gehalten hätte. Warum hatte ihre Leidenschaft füreinander keine Spuren hinterlassen? Bei anderen Paaren, die sich trennten, konnte er Kränkungen beobachten, Bitterkeit über enttäuschte Erwartungen, Wut, ja Hass. Er spürte nichts davon, und er hatte den Eindruck, dass es Meredith genauso ging. Als hätte es ihre Liebe nie gegeben.
Selbst als sie ihm knapp ein Jahr nach Justins Tod berichtete, dass sie in wenigen Wochen nach London ziehen werde, um, wie sie sich ausdrückte, »das Kapitel Hongkong zu vergessen«, fühlte er sich nicht gekränkt, obgleich er nicht als Teil eines Kapitels, das es zu vergessen galt, gesehen werden wollte. Er hatte ihr nur »viel Glück und alles Gute« gewünscht. Sie hatte sich höflich bedankt und ihm vor dem Mandarin Oriental Hotel die Hand gegeben, und erst Tage später war ihm die Absurdität dieses formellen Abschieds aufgefallen. Seitdem hatten sie nur noch sporadisch voneinander gehört. Da er bis vor einem halben Jahr weder ein Telefon noch einen Computer besessen hatte, war er nicht leicht zu erreichen gewesen. Er hatte einmal gelesen, dass sich die meisten Paare aus denselben Gründen trennen, aus denen sie zusammengekommen waren, und überlegte, ob das bei ihnen auch der Fall war.
Wann hatten sie begonnen, getrennte Wege zu gehen? War es in den Tagen nach der Diagnose und dem folgenden Streit darüber, wo Justin behandelt werden sollte? Ob in London, wo nach Merediths Meinung Ärzte und Behandlung mit Sicherheit kompetenter wären, oder in Hongkong, wie Paul es wünschte und wo sich die Chemotherapie durch nichts von der in Europa unterschied, wie ihnen sowohl die Onkologen am Queen Elizabeth Hospital als auch deren Kollegen in England versicherten. Meredith gab am Ende widerwillig nach, aber von dem Augenblick, in dem sich abzeichnete, dass der Krebs auch den neuesten und aggressivsten Chemikalien widerstehen würde, ließ sie keinen Zweifel daran, wem sie die Schuld daran gab und dass die Überlebenschancen im Vereinigten Königreich besser gewesen wären.
Oder hatte die Trennung viel früher begonnen, damals, als sie erfuhren, dass sie schwanger war und seine Freude darüber die ihre bei weitem übertraf? »Es gibt keinen Zweifel, Sie sind schwanger«, hatte der Gynäkologe ihnen schon im Wartezimmer gesagt, und während Pauls Augen strahlten und seine Hand die ihre suchte, schlug sie die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen. Vor Freude, Paul, bitte glaube mir, es ist nichts, nur die Freude. Diese in den folgenden Tagen oft wiederholte Versicherung ließ seine Zweifel jedoch nicht verstummen. Wünschte sie sich wirklich ein Kind? Sie arbeitete viel und mit Leidenschaft, sie war weltweit die jüngste Abteilungsleiterin ihrer Bank, ihr Aufstieg in den Vorstand der Hongkong-Niederlassung mehr als nur eine vage Hoffnung, und ein Kind wäre für ihre weitere Karriere, zumindest kurzfristig, alles andere als förderlich, das hatten der Vorgesetzte ihr und einigen Kolleginnen unmissverständlich zu verstehen gegeben. Außerdem hatte sie nie zu jenen Frauen gehört, für die Mutterschaft ein existenzieller Teil ihres Lebensplans ist. Am Ende war es nicht ihr Wunsch nach einem Kind, so erklärte sie ihm Jahre später, der den Ausschlag gegeben hatte, sondern Pauls. Er habe ihr leidgetan, weil er keine Familie besaß. Er war ein Einzelkind, seine Mutter hatte sich kurz nach seinem 21. Geburtstag das Leben genommen, sein Vater war vor einigen Jahren gestorben, Paul hatte, solange Meredith ihn kannte, nicht einmal den Namen auch nur eines entfernten Verwandten erwähnt, die wenigen, die ihm vertraut gewesen waren, wie zum Beispiel seine deutschen Großeltern in Heidelberg, waren lange tot. Meredith war das, behauptete sie, immer seltsam vorgekommen, aber es hatte zu der Aura des Rätselhaften, des Unnahbaren gehört, die ihn umgab und die sie, zumindest in den ersten Jahren, aufregend und anziehend gefunden hatte. Später war ihr seine Verschlossenheit jedoch zunehmend auf die Nerven gegangen und hatte immer häufiger zu Streit geführt. Warum kam er, nachdem er sie anfänglich so gern begleitet hatte, nur noch selten mit, wenn sie sich mit Kollegen zum Abendessen traf? Warum musste sie immer häufiger ohne ihn auf die Cocktailpartys, Empfänge und die sonntäglichen Bootsausflüge gehen, auf denen sie geschäftliche Kontakte knüpfte, Kunden aquirierte, Informationen sammelte? Die Tage und Abende, die er allein zu Haus verbrachte, waren nicht mehr Ausdruck seiner von ihr bewunderten Fähigkeit, sich selbst zu genügen, sondern nur noch Zeichen einer trostlosen Einsamkeit. Sie hatte geglaubt, erklärte sie ihm nach Justins Tod, ein Kind würde ihm guttun, ein Kind wäre eine Aufgabe.
Paul überlegte, ob sie damals, als er sich das Haus kaufte, nach Lamma gekommen war, um es sich anzuschauen. Ja, er sah sie im Garten stehen, zwischen den wuchernden, fast bis zum Dach reichenden Bougainvilleabüschen, dem meterhohen Farn, den faulenden Bananenstauden herumwandern, sah, wie sie fassungslos das seit Monaten unbewohnte Haus anstarrte, den grünen, modrigen Film, den die Feuchtigkeit auf die Fassade gelegt hatte, sah sie durch die verstaubten und von Unrat verdreckten Zimmer gehen, hörte sie mit Ekel in der Stimme sagen: »Das passt zu dir.«
Der Kauf dieses »Drecklochs« bestätigte ihre schlimmsten Befürchtungen. Er zog sich von der Welt zurück, weil er sich wohl fühlte in seinem Schmerz. Er versank in Selbstmitleid. Er ließ seinen Sohn nicht sterben, weigerte sich, dessen Tod zu akzeptieren. Und, das Unverzeihlichste von allem: Er ließ sich gehen. Dafür war dieses alte Haus auf dieser Insel, auf die kein normaler Hongkonger freiwillig zieht, der beste Beweis. Hier konnte er vor die Hunde gehen, sich zu Tode saufen, ohne dass ihn davon jemand abhielt, ja, vermutlich würde es Wochen dauern, bis überhaupt jemand sein Ableben bemerkte.
Paul schenkte sich noch etwas Tee nach und blickte über die Terrasse. In der Nacht waren eine Reihe weißer Frangipaniblüten auf die Steine gefallen. Er stand auf, sammelte sie ein, ging ins Haus und legte sie in die Schale mit den anderen Blüten. Er holte einen Besen aus der Kammer und fegte die Terrasse. Nein, dachte Paul, ich verwahrlose nicht. In manchen Dingen mochte Meredith Recht gehabt haben, ein Zusammenleben mit ihm war unmöglich geworden, da widersprach er ihr nicht, aber in diesem Punkt irrte sie. Er hatte das Haus von Grund auf renoviert und hielt es sauberer, als es irgendeine von Merediths oder seinen Wohnungen jemals gewesen war. Zweimal am Tag wischte er Staub, und die Kacheln auf dem Fußboden, jeden Teller, jeden Becher, jedes Glas, jede Gabel, jedes Messer wusch er sofort ab. Das Badezimmer war so sauber, als würde es von den Hausdamen des Peninsula Hotels gereinigt. Vor den Fenstern standen Blumenkästen, in denen Geranien, Kamelien und Rosen wuchsen. Im Kühlschrank lagen stets frisches Obst und Gemüse. Er kochte für sich selbst, aß gut und trank seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr. Eine Zeit lang hatte er geglaubt, Wein, Whiskey und vor allem Gin könnten die Stimmen in ihm zum Schweigen bringen, könnten ihn am Abend beruhigen, ihn so betäuben, dass er durchschlief. Aber was immer er trank, es machte alles nur noch schlimmer. Die Schmerzen. Die Stimmen. Die Leere.
Außerdem hatte er Angst, dass Justin ihn im betrunkenen Zustand finden könnte, falls er zurückkehrte. Diese Furcht war schwer zu erklären, das wusste er. Einmal hatte er versucht, sie David Zhang zu beschreiben, und selbst der, sein engster Vertrauter, der einzige Freund, den er je besessen hatte, konnte ihm nicht folgen.
»Justin ist tot, Paul.«
»Ich weiß, dass er tot ist, das brauchst du mir nicht zu sagen.«
»Wenn er zurückkehrt, wird es nicht der Justin sein, den du kennst, er wird eine andere Form haben«, erklärte David, der als Buddhist an den ewigen Kreislauf von Tod und Geburt glaubte.
»Ich sitze nicht zu Hause und warte, dass Justin jeden Moment durch die Tür kommt, aber …« Paul suchte nach Worten. »Ich möchte darauf vorbereitet sein.«
»Worauf?«
»Auf seine Rückkehr.«
»Von der du weißt, dass es sie nicht geben wird.«
Paul seufzte. »Von der ich weiß, dass es sie nicht geben wird«, wiederholte er. »Aber ich will sie nicht ausschließen.«
So lächerlich es klingen mochte, aber genau das war es: Er wollte eine Rückkehr von sich aus nicht ausschließen. Deshalb besaß Justin ein Zimmer in diesem Haus. Deshalb befanden sich in diesem Zimmer ein Bett und ein Ventilator, deshalb war dieses Bett immer frisch bezogen. Aus diesem Grund hing an der Garderobe immer eine Kinderjacke, stand im Flur neben Pauls Gummistiefeln ein kleineres Paar für Justin, hatte er den Türrahmen mit den Markierungen für Justins wachsenden Körper in der alten Wohnung abgebaut und hier wieder anmontiert.
»Ist das auch der Grund, warum du so selten von Lamma wegfährst?«, fragte David ohne eine Spur Ironie in der Stimme. »Damit du ihn nicht verpasst?«
»Nein, das hat andere Gründe.«
David schaute ihn an, ohne etwas zu sagen, sein Blick war Frage genug.
»Ich will nichts vergessen.« Ein Satz, den er kurz nach der Beerdigung unvorsichtigerweise zu Meredith gesagt hatte und den sie später oft als Beleg dafür sah, dass seine Trauer das »normale Maß« überschreite und »krankhafte Züge« annehme. Die Diskussion darüber, was bei der Trauer über den Tod des eigenen Kindes ein »normales Maß« und was »krankhafte Züge« waren, hatte in einem ihrer seltenen heftigen Streite geendet. Wo war die Grenze zwischen normal und krankhaft? Wer legte sie fest? Paul war der Meinung, dass dazu niemand das Recht habe. Ein Biologe hatte ihm einmal erzählt, dass manche Delphine nach dem Tod ihres Partners einfach aufhören zu essen. Oder Gänse. Sie können auf den Verlust ihres Gefährten so heftig reagieren, dass sie tagelang ohne Pause umherfliegen, nach ihm oder ihr rufen, suchen, bis sie die Orientierung verlieren und zu Tode erschöpft vom Himmel fallen.
»Genau das will ich nicht«, hatte Meredith entgegnet, »und genau das würde auch Justin nicht wollen. Paul, das Leben geht weiter.«
Er hasste diesen Satz. In ihm lag die unaussprechliche Ungerechtigkeit, die ganz und gar empörende, ungeheuerliche Banalität des Todes. Alles in Paul sträubte sich dagegen. Es gab Tage, da empfand er jeden Atemzug als Verrat an seinem Sohn. Tage, an denen ihn das Schuldgefühl des Überlebenden zu erdrücken drohte, an denen er nicht imstande war, etwas anderes zu machen als in seiner Hängematte auf der Terrasse zu liegen.
Die Angst etwas zu vergessen. Justins verschlafenes Gesicht am Morgen. Seine großen blauen Augen, die so strahlen konnten. Sein Lächeln, seine Stimme.
Bis zur Sonne und wieder zurück.
Er wollte unter allen Umständen verhindern, dass sich das Getöse der Welt auf seine Erinnerungen legte. Sie waren alles, was ihm von seinem Sohn geblieben war. Mit ihnen musste er bis zum Ende seines Lebens auskommen, und sie waren für ihn nicht nur ein unermesslich kostbares, sondern auch ein äußerst fragiles Gut. Es war kein Verlass auf sie. Erinnerungen täuschten. Erinnerungen verblassten. Erinnerungen verflüchtigten sich. Neue Eindrücke, neue Gesichter, Gerüche, Geräusche legten sich über die alten, die nach und nach an Kraft und Intensität verloren, bis sie in Vergessenheit gerieten. Selbst als Justin noch lebte, hatte Paul diesen Verlust als einen Schmerz empfunden, den er fast körperlich spürte. Wann hatte sein Sohn die ersten Worte gesprochen? Wo hatte er die allerersten Schritte gemacht? War es zu Ostern auf der Wiese des Country Clubs gewesen oder zwei Tage später beim Ausflug nach Macau auf dem Platz vor der Kathedrale? Damals hatte er geglaubt, er würde es niemals vergessen, und schon ein paar Jahre später war er im Zweifel. Dieser Verlust war nur erträglich gewesen, weil täglich neue Erinnerungen mit Justin hinzukamen und die alten ablösten. Aber jetzt? Er war angewiesen auf die, die er besaß, und ertappte sich schon manchmal dabei, wie er in sich hineinhorchte und für Momente nach Justins Stimme suchte, wie er die Augen schloss und sich konzentrieren musste, bis Justin vor ihm auftauchte.
Um das Erlöschen zu verhindern, wollte er sich, soweit es irgend ging, vor allem Neuen schützen. Vergessen wäre Verrat. Vergessen ist ein Verwandter des Todes. Deshalb war er nach Lamma gezogen, und deshalb bewegte er sich auch nur in Ausnahmefällen und sehr unwillig von der Insel fort. Lamma war ruhig. Es gab keine Autos, weniger Menschen als sonstwo in Hongkong und kaum jemanden, den er kannte. Sein Haus lag in Tai Peng, einer Siedlung auf einem Hügel über Yung Shue Wan, zehn Minuten vom Fähranleger entfernt. Es versteckte sich hinter einem mächtigen Wall aus grünem Buschwerk und einem dichten Bambushain am Ende eines schmalen Pfades.
Er hatte sich einen festen Tagesablauf verordnet. Er stand in der Morgendämmerung auf, trank unter der Markise auf der Terrasse genau eine Kanne Jasmintee, nie mehr aber auch nie weniger, machte auf dem Dach eine Stunde lang seine Tai-Chi-Übungen, ging ins Dorf, kaufte ein, aß immer im selben Restaurant am Hafen immer die gleiche Mischung aus Gemüse- und Shrimp-Dim Sum, dazu zwei gedämpfte, mit Schweinefleisch gefüllte chinesische Brötchen, trug anschließend die Einkäufe nach Hause und brach dann zu einer drei- bis vierstündigen Wanderung auf. Sein Weg führte ihn Tag für Tag an den kleinen Feldern vorbei, auf denen alte Männer und Frauen Unkraut jäteten, Erdkrumen zerhackten oder ihre Salate und Tomatenpflanzen mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprühten. Sie grüßten ihn mit einem Kopfnicken, er grüßte mit einem Kopfnicken zurück. Vor ihnen war er sicher. Nie würden sie auf die Idee verfallen, ihn anzusprechen oder ihn gar in ein Gespräch zu verwickeln. Er wanderte weiter nach Pak Kok, am Wasser in einem weiten Bogen zurück nach Yung Shue Wan, von da über die halbe Insel zum Lo-So-Shing Strand. Der war, abgesehen von manchen Wochenenden im Sommer, fast immer menschenleer. Paul schwamm exakt zwanzig Minuten. Anschließend setzte er sich eine halbe Stunde, an schönen Tagen auch länger, in den Schatten und schaute aufs Meer, jedes Mal erleichtert über die Vertrautheit des Anblicks. Oder er schloss die Augen und meditierte. Hier war nichts Unvorhersehbares zu befürchten.
Sein Rückweg führte ihn über den Kamm eines lang gestreckten Hügels, von wo er auf den schmalen East-Lamma-Channel blickte, der die Insel von Hongkong trennte. Nur selten verharrte er auf diesem Pfad eine Weile, betrachtete die großen, vollgeladenen Containerschiffe und fragte sich, was sie wohl geladen hatten und wohin ihre Reise ging. Seine einzigen Begleiter waren streunende Hunde oder eine herrenlose Katze. Den Rest des Tages verbrachte er im Garten oder auf der Dachterrasse, pflegte seine Pflanzen, kochte oder putzte das Haus.
Er las keine Tageszeitung, besaß keinen Fernseher und hörte nur morgens von sieben Uhr bis sieben Uhr dreißig Radio, den Worldservice der BBC. Ein Tag, an dem er mit keinem Menschen ein Wort wechselte, war ein guter Tag. Eine Woche, die der anderen glich, in der sich nichts ereignete, was Spuren in seinem Gedächtnis hinterlassen konnte, war eine gute Woche.
Heute jedoch, das wusste er, würde es schwieriger werden. Es war Justins dritter Todestag, und Paul hatte sich fest vorgenommen, wie jedes Jahr nach Hongkong Island zu fahren und auf den Peak zu steigen.
Es war kein guter Tag für eine Wanderung. Der zweite September ist in Hongkong nie ein guter Tag für eine Wanderung. Das Thermometer neben der Tür zeigte 36 Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Stadt schwitzte. Sie stöhnte unter der Hitze, und jeder, der es irgendwie einrichten konnte, versteckte sich in diesen Wochen in klimatisierten Räumen.
Paul holte vorsichtshalber eine dritte Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und packte sie in den Rucksack. Er trug eine graue kurze Hose und ein leichtes, kurzärmeliges Hemd; damit ihm der Schweiß nicht ins Gesicht lief und in den Augen brannte, hatte er sich ein Tuch um Kopf und Stirn gewickelt. Seinen langen, muskulösen Beinen waren die täglichen Wanderungen anzusehen, er hatte den flachen, durchtrainierten Bauch eines jungen Mannes, und trotzdem würde der Anstieg bei diesem Wetter seine ganze Kraft erfordern. Er nahm seinen Wanderstock und ging mit gemächlichen Schritten den Hügel ins Dorf hinunter. Er schwitzte, bevor er die Fähre erreichte.
Auf dem Schiff waren nur wenige Passagiere. Ein paar alte Chinesinnen fächerten sich mechanisch Luft zu. Paul stellte sich hinten an die Reling in der Hoffnung, der Fahrtwind oder eine leichte Brise auf dem Wasser würden für etwas Erleichterung sorgen. Aber die Luft war zu heiß und feucht, der Schweiß lief ihm ungehemmt den Nacken und Rücken, die Brust und die Beine hinunter, bis die Socken so nass waren, als wäre er durch Pfützen gelaufen.
Es war die Erinnerung an eine Notlüge, die ihn jedes Jahr zweimal, am Geburts- und am Todestag seines Sohnes, in die Stadt und den Berg hinauftrieb. Ein Ritual, dessen Sinn er sich selbst nicht erklären konnte und dessen Einhaltung zu einer Art Zwang geworden war. Als hätte er etwas gutzumachen.
Kurz vor seinem Tod hatte Justin ihn gefragt, ob er glaube, dass sie noch einmal gemeinsam auf den Peak klettern werden. Der höchste Berg auf Hongkong Island war eines ihrer liebsten Ausflugsziele gewesen, die Wanderung um die Spitze, der Ausblick auf die Stadt, den Hafen und das Südchinesische Meer, hatte Justin schon als Zweijährigen sehr beeindruckt. Der Peak war ein Ort, so schien es Paul, an dem sich sein Sohn sicher fühlte, eine Art Ausguck auf die Welt, den sie auf Drängen Justins zu jeder Jahreszeit aufsuchten. Im Sommer, wenn er, dank seiner Höhe, ein wenig Schutz vor der drückenden Hitze und Feuchtigkeit in der Stadt bot. Im Winter, wenn der Wind so kalt blies, dass Justin Wollmütze und Handschuhe trug und sie dort fast alleine herumwanderten, ja selbst im Frühjahr, wenn die Wolken an vielen Tagen die Spitze umhüllten und man nichts als Nebelschwaden sah. Dort oben hatten sie oft auf einer Bank gesessen, und Paul hatte seinem Sohn erklärt, warum Flugzeuge fliegen und Schiffe schwimmen, warum die großen Doppeldeckerbusse plötzlich klein wie Spielzeugautos aussehen und warum Sterne Sterne heißen und nicht Sonnen, obgleich sie doch aus sich heraus leuchten.
Würden sie beide es noch einmal gemeinsam dorthin schaffen?
»Aber sicher«, hatte Paul geantwortet, und sein Sohn hatte ein wenig den Kopf gehoben, ihn angelächelt und »wirklich?« gefragt. Sie hatten sich angeschaut, Paul hatte in die müden Augen seines Sohnes geblickt und nicht gewusst, was er weiter sagen sollte. Wollte Justin die Wahrheit wissen? Wollte er hören, nein, Justin, nein, das glaube ich nicht, dafür bist du zu schwach, und ich kann dich keine fünfhundert Meter hochtragen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir werden nie wieder gemeinsam auf dem Peak stehen und die Flugzeuge zählen und die Schiffe und davon träumen, wie Vögel durch die Luft zu gleiten und den Spaziergängern auf den Kopf zu kacken. Natürlich wollte er das nicht hören. Natürlich hätte kein Mensch bei Verstand es fertiggebracht, das einem Achtjährigen zu sagen. Warum auch? Aber was dann?
»Nicht schwindeln, Papa, sag die Wahrheit«, hatte Justin seinen Vater kurz nach der Diagnose ermahnt, als Paul in seiner Hilflosigkeit versuchte, den Zustand seines Sohnes zu verharmlosen, und etwas von einer schweren Grippe stammelte. Nicht schwindeln. Die Wahrheit. Daran hatten Meredith, die Ärzte und er sich gehalten, soweit ein Kind verstehen konnte, welche destruktive Kraft in seinem kleinen Körper wütete. Aber jetzt? Klettern wir noch einmal auf den Peak? Da ging es nicht um Leukozyten und Plastozyten, nicht um Hb-Werte und die nächste Bluttransfusion. Es war eine einfache Frage, die auf eine einfache Antwort wartete: Ja oder nein? Justin blickte seinen Vater an, seine Augen wiederholten das ungläubige: Wirklich?
»Aber sicher«, bestätigte Paul ein zweites Mal und nickte. Justin lächelte kurz und sank zurück in sein Kissen. Eine kleine Notlüge, die richtige Antwort, wer wollte daran zweifeln, und trotzdem konnte Paul sie sich nicht verzeihen. Sie trieb ihm auch heute, auf den Tag genau drei Jahre nach Justins Tod, die Tränen in die Augen. Er hatte seinen Sohn verraten. Er hatte ihn alleingelassen, indem er eine Illusion nährte, eine alberne, aberwitzige, völlig idiotische Hoffnung, anstatt die Wahrheit zu sagen und sie zu teilen und dadurch erträglicher zu machen. Ein Gefühl der Scham hatte ihn schon im Moment des Kopfnickens beschlichen, und es wurde seither nicht weniger, egal wie oft er seine Schwindelei im Geiste überdachte und rechtfertigte. Der Rest eines Zweifels blieb und mit ihm das Gefühl, in einem entscheidenden Moment feige gewesen zu sein.
II
Paul ging als Letzter und nur widerwillig von Bord. Er wollte sich mit langsamen Schritten der Stadt nähern, aber kaum hatte er den Pier verlassen, empfing ihn ein Höllenspektakel. Zwei Presslufthämmer zermarterten ein Stück Asphalt, daneben stießen laut dröhnende Busse schwarze Abgaswolken in die Luft. Hinter einem Bauzaun hörte er es so schrill quietschen, scheppern und heftig krachen, dass es ihm in den Ohren weh tat und er vor Schreck zusammenzuckte. Um ihn herum wimmelte es von Menschen, die in größter Eile hin und her hetzten, ihm dabei ständig vor die Füße liefen und ihn anrempelten, sobald er stehen blieb. Ihre Hast übte einen eigenartigen Sog auf ihn aus, als müsse er ihnen nachlaufen und mit ihnen in den tiefen U-Bahn-Schächten verschwinden. Er hatte das Gefühl, die Stadt würde ihn jeden Moment verschlingen. Unmöglich konnte er hier die Wanderung beginnen. Er flüchtete in ein Taxi und fuhr zur Endstation der Peak Tram, von dort führte ein Fußweg hinauf zur Spitze. Der Höhenunterschied betrug knapp fünfhundert Meter, eine Distanz, die er früher problemlos bewältigen konnte, an manchen Tagen sogar mit Justin auf dem Rücken.
Er nahm einen großen Schluck aus seiner Wasserflasche, setzte seinen Rucksack auf und machte sich auf den Weg. Die schmale Straße führte vorbei an May Tower und May Tower II, an Branksome und Branksome II und am Mayfair, exorbitant teuren Wohnanlagen mit 30–40stöckigen Hochhäusern, die aussahen wie gesichtslose Trabantenstädte und in denen ein Appartement trotzdem viele Millionen Hongkong Dollar kostete. Im Mayfair hatten Meredith und er zwei große Wohnungen besessen, die sie auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms 1997 für mehr als das Dreifache des ursprünglichen Preises verkaufen konnten. Von einem Teil des Gewinns hatte er sich das Haus auf Lamma gekauft, von den Zinsen, die der Rest abwarf, lebte er.
Paul bog in den Chatham Path, der von der Straße weg in eine dichte tropische Vegetation führte. Es ging jetzt steil bergauf, und er spürte die Spannung in den Waden und Füßen, in den Oberschenkeln und Knien, wie sie mit jedem Schritt seine knapp 70 Kilo nach oben wuchteten. Seit Tagen lag eine dichte Wolkendecke, grau wie Asche, über der Stadt. Am Vormittag hatte sie sich aufgelockert, jetzt schien an manchen Stellen sogar die Sonne, was den Aufstieg zu einer Wanderung durch ein heißes Dampfbad machte. Der Wald wuchs in diesem Abschnitt so dicht, dass Paul auf eine undurchdringliche grüne Wand blickte, vom Verkehr war nur noch ein fernes, gedämpftes Rauschen geblieben, statt Autos hörte er nun Vögel und Heuschrecken. Er machte eine Pause, trank die erste Literflasche Wasser aus und versuchte an nichts zu denken. Er wollte sich nicht erinnern, keine Bilder vor seinen Augen sehen, keine Gespräche mit Justin führen, das tat er oft genug, nachts, wenn er wach lag, wenn an Schlaf nicht zu denken war.
Du musst keine Angst haben. Ich pass auf dich auf.
Er wollte einfach nur da sein, trinken, atmen, einen Fuß vor den anderen setzen und seinen Sohn ganz selbstverständlich in Gedanken bei sich haben wie andere Eltern auch.
Er schaffte es in knapp zwei Stunden. Die letzten paar hundert Meter auf der Findlay Road waren ihm leichtgefallen, mit langsamen aber rhythmischen, fast federnden Schritten erreichte er sein Ziel. Bevor er auf der Lugard Road einmal im Kreis um die Spitze wanderte, wollte er in einem Café auf dem Peak einen Tee trinken und ein Stück Zitronenkuchen essen, ein Ritual, das Justin eingeführt hatte. Im Café war es entsetzlich kalt, er hasste die eisige klimatisierte Luft, es war, als hätte ihn jemand in eine Gefrierkammer gestoßen. Es dauerte immer einige Minuten, bis sich der Körper an die neue Temperatur gewöhnte.
Der Laden war ungewöhnlich leer, in einer Ecke hockte ein Paar, ein junger Mann mit Kopfhörern und ein Mädchen, das telefonierte, ein älterer Herr las in der South China Morning Post, eine Frau saß, über einen Stadtplan gebeugt, direkt hinter dem Tisch am Fenster, an dem Justin und er fast immer Pause gemacht hatten. Paul holte sich den Tee und das Stück Kuchen und setzte sich auf den Platz, mit dem ihn so viele Erinnerungen verbanden: Von hier oben hatte der Blick über die Stadt etwas Unwirkliches. Manchmal überkam ihn der Gedanke, der Moloch dort unten sei nur ein Produkt seiner Phantasie: Diese kühn in die steilen Hänge gebauten Wohnwaben, die Hochhäuser in Central und Causeway Bay, der Hafen mit seinen vielen hundert Booten, die emsig wie kleine Ameisen umherkreuzten. Um sich ihrer Existenz zu vergewissern, musste er ganz seinen Augen vertrauen. Das dicke Fensterglas machte das Bild zu einem geräusch- und geruchlosen Spektakel, wie in einem Stummfilm bewegten sich die Autos, die Schiffe, Hubschrauber und Flugzeuge. Paul dachte an seine Ankunft vor dreißig Jahren.Damals war er sicher, die Kronkolonie wäre für ihn nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Volksrepublik China. Ein, maximal zwei Jahre hatte er bleiben wollen. Peking hieß sein eigentliches Ziel, und sobald sich die politische Situation nach der Kulturrevolution beruhigt hatte, würde er weiterziehen. Er war in Hongkong hängen geblieben, zunächst nur weil die Machtkämpfe in China viel länger dauerten als erwartet, dann aus Überzeugung. Hongkong wurde, ohne dass er es recht bemerkte, zu seiner Heimat, die einzige, die er je gekannt hatte. Er mochte diese von Flüchtlingen für Flüchtlinge gebaute Stadt, in der Tag und Nacht die Hektik der Getriebenen herrschte, die Nervosität der Heimatlosen, die Angst der Verfolgten. Vor seinem Rückzug nach Lamma hatten ihn die rastlose Unruhe nicht abgestoßen, im Gegenteil, sie spiegelten einen Teil seiner eigenen Ruhelosigkeit und gaben ihm an guten Tagen das Gefühl, dazuzugehören, Teil eines Ganzen zu sein, ein Gefühl, das er in seinem Leben zuvor nicht gekannt hatte.
»Wohnen Sie hier?«
Paul war so überrascht, dass er zunächst gar nicht wusste, woher die Stimme kam. Fast wäre ihm vor Schreck ein Stück Zitronenkuchen von der Gabel gefallen.
»Oder sind Sie auf Geschäftsreise?«
Es war die Frau vom Nebentisch. Sie muss Amerikanerin sein, dachte Paul. Niemand sonst würde einen Fremden an einem öffentlichen Ort so einfach in ein Gespräch verwickeln. Wie oft hatte er sich in Flugzeugen gegen die Hallo-wo-kommen-Sie-her-Geschwätzigkeit eines amerikanischen Sitznachbarn wehren müssen.
»Nein, ich lebe hier«, antwortete Paul.
»Oh, wie interessant. Schon lange, wenn ich fragen darf?«
»Dreißig Jahre«, antwortete er knapp. Mit keinem Wort wollte er den Eindruck entstehen lassen, er wäre an einem Gespräch interessiert.
»Dreißig Jahre? Mein Gott, wie halten Sie die vielen Menschen aus?« Paul schaute zu ihr hinüber. Nach ihrem leichten, aber unüberhörbaren Akzent zu urteilen, stammte sie vermutlich aus dem Mittleren Westen. Sie war schlank, ein sportlicher Typ, trug einen hellbraunen Hosenanzug, weißes Hemd und eine Perlenkette. Ihre Hände zitterten, wenn sie den Kaffeebecher hob. Es waren zarte Hände, sehr gepflegte Hände mit langen Fingern, an denen mehrere goldene Ringe steckten, einer davon war mit kleinen Diamanten besetzt, aber selbst die im Licht funkelnden Edelsteine konnten nicht davon ablenken, dass diese Hände zitterten. Ihr Alter konnte Paul nicht schätzen. Ihr Gesicht wirkte viel jünger als ihre Hände, es war glatt und auf eine irritierende Art faltenlos, dafür hing am Hals die Haut in kleinen Säckchen herab wie bei einer älteren Frau. Sie konnte Mitte vierzig oder ebenso gut Anfang sechzig sein. Es war eines dieser gepflegten Gesichter, die möglichst wenig verraten sollen, die geübt sind im Verstecken der Wunden und Sorgen, der Spuren, die das Leben darin hinterlässt. Sie trug Sportschuhe, aber die lange Hose, die Bluse und vor allem das Jackett waren viel zu warm für diese Jahreszeit. Offensichtlich war sie an Klimaanlagen gewöhnt. Vermutlich hatte sie vom Hotel direkt ein Taxi zum Peak genommen und noch gar nicht gemerkt, wie heiß und feucht es war. Er schwieg in der Hoffnung, das Gespräch so zu beenden.
»Ihnen machen die vielen Menschen nichts aus? Oder gewöhnt man sich mit der Zeit daran?«
Er holte tief Luft. Um nicht zu unhöflich zu sein, antwortete er: »Ich wohne auf Lamma, einer kleinen Insel. Dort ist es ruhiger.«
Sie nickte, als würde das alles erklären.
»Sie sind bestimmt viel in China unterwegs, stimmt’s?«
»Früher ja. Heute weniger. Und Sie?« Er bereute die Frage sofort. Was war nur in ihn gefahren? Wie konnte er so dumm sein, ihr eine so allgemeine Frage zu stellen? Das war die Einladung, auf die sie vermutlich nur gewartet hatte. Jetzt würde sie gleich von ihren diversen Chinareisen erzählen oder von denen ihrer Freundinnen oder denen ihres Mannes. Von ihrem Besuch auf der Großen Mauer und in der Verbotenen Stadt. Von den absonderlichen Tischsitten, vom Rülpsen und Furzen und Schmatzen während der Mahlzeiten. Von den kleinen Kindern, die keine Windeln tragen, sondern durch Schlitze in ihren Hosen einfach auf die Straße scheißen. Oder von den Hochhäusern in Shanghai, den teuren Mercedes Benz und BMWs auf den Straßen, womit sie in einem kommunistischen Land nun wirklich nicht gerechnet habe. Und am Ende wird sie fragen, dachte Paul, ob es stimmt, dass Chinesen Affen bei lebendigem Leib den Kopf aufschlagen und das Hirn ausschlürfen. Aber statt zu dem befürchteten Redeschwall anzusetzen, schwieg sie und schaute Paul zum ersten Mal direkt ins Gesicht. Er zuckte zusammen. Kannten sie sich? Ihm war, als hätten sie sich schon irgendwo einmal gesehen. Ganz sicher sogar. Ihre großen blauen Augen. Der durchdringende Blick. Die Unruhe, die darin lag. Die Nervosität. Das Flackern. Die Angst. Sie waren ihm so vertraut, als wäre es gestern gewesen. Sie waren sich schon einmal begegnet. Aber wo?
»Kennen wir uns?« Seine sonst so ruhige Stimme klang plötzlich seltsam aufgeregt.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht.«
»Sie kommen mir bekannt vor. Haben Sie zufällig im Queen Elizabeth-Krankenhaus gearbeitet?«
»Nein.«
»Arbeiten Sie bei einer Bank? Kennen Sie vielleicht meine Frau, Meredith Leibovitz?«
»Nein.«
Paul überlegte. Möglicherweise hatte sie einmal in der Stadt gelebt, und sie waren sich in Justins Schule begegnet?
»Haben Sie Kinder?«
»Ja, einen Sohn.« Sie wandte ihren Blick ab und erhob sich. Als hätte sie mitten in der Bewegung die Kraft verlassen, hielt sie für einen Moment inne und fiel dann zurück auf ihren Stuhl. Sie versuchte es noch einmal, stützte sich auf den Tisch, wankte und sank zurück auf ihren Platz.
»Ist Ihnen nicht gut?«
»Nur ein wenig schwindelig«, sagte sie mit schwacher Stimme. »Der Kreislauf. Ich vertrage dieses Klima nicht so gut.«
»Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie etwas Wasser?«
»Wasser wäre gut, ja.«
Paul stand auf und ging zum Tresen. Plötzlich hörte er von hinten das Geräusch von wegrutschenden Stühlen und einen dumpfen Laut. Als er sich umdrehte, war die Frau verschwunden. Erst beim zweiten Blick sah er sie auf der Erde zwischen den Tischen liegen.
Obgleich die Ambulanz vom Matilda Hospital nur wenige Minuten benötigte, war Elizabeth Owen schon wieder bei Bewusstsein, als die Sanitäter eintrafen. Sie saß leichenblass an eine Wand gelehnt und trank etwas Wasser. Paul hockte neben ihr. Sie wollte nicht ins Krankenhaus. Unter keinen Umständen. Sie wollte ins Hotel. Dort warte ihr Mann. Sie habe niedrigen Blutdruck, schon seit Jahren, und heute Morgen lediglich vergessen, ihre Tabletten zu nehmen. Hinzu kämen die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit. Sobald sie ihre Medikamente einnehme, werde es ihr wieder besser gehen. Kein Grund, sich in die Obhut eines Krankenhauses zu begeben. Die Sanitäter packten ihre Sachen wieder zusammen, Paul holte eines der Taxen, die auf dem Peak in langen Reihen auf Kundschaft warteten.