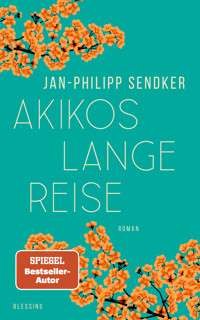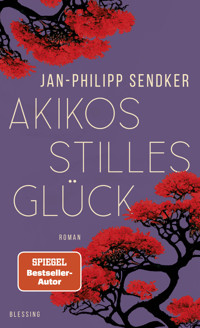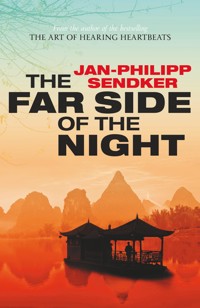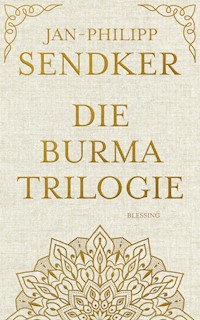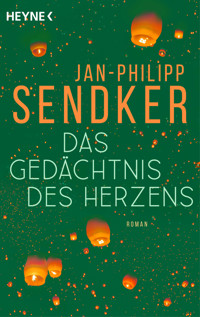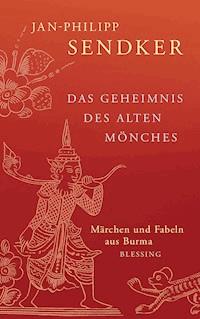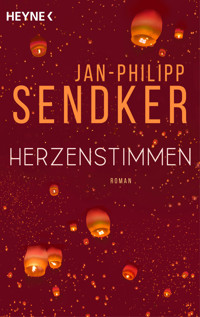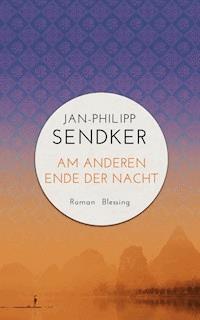
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die China-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Geschichte über die Macht der Liebe, die Angst des Verlustes und die Kraft der Menschlichkeit
Auf einer Chinareise erleben Paul und Christine einen Albtraum: Ihr vierjähriger Sohn wird entführt. Zwar gelangt David durch glückliche Umstände wieder zu ihnen, doch die Entführer geben nicht auf, sie wollen ihn zurück. Der einzig sichere Ort für die Familie ist die amerikanische Botschaft in Peking. Aber Bahnhöfe, Straßen und Flughäfen werden überwacht. Ohne Hilfe haben sie keine Chance, dorthin zu gelangen. Wer ist bereit, ihnen Unterschlupf zu gewähren und dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen? Wem können sie trauen?
Am anderen Ende der Nacht erzählt von Menschen, die nicht mehr viel zu verlieren haben und sich gerade deshalb ihre Menschlichkeit bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
JAN-PHILIPP
SENDKER
AM ANDERENENDE DER NACHT
Roman
Blessing Verlag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2016 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2016 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München,
unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock, chunking/MeiKis
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-12583-7V001www.blessing-verlag.de
Für Anna, Florentine, Theresa, Jonathan und Dorothea
PROLOG
Paul bemerkte ihn zuerst. Ein junger Mann an einer Straßenecke. Die Hände in einer leichten Windjacke vergraben, geduldig auf der Stelle verharrend, als wäre er zu früh zu einer Verabredung erschienen. Auffällig unauffällig.
Mit wachsamen Augen prüfte er jeden Wagen, der in die An Jia Lou Lu einbog.
Es war das Misstrauen in seinem Blick, das ihn verriet.
Christine hielt ihren Sohn auf dem Schoß versteckt, er lag unter einer schwarzen Decke, die nach kaltem Rauch stank. Ihre Augen geschlossen, als schliefe sie.
Paul wusste es besser.
Sie hatte nicht geglaubt, dass sie es schaffen würden. Nicht in den ersten Stunden ihrer Flucht, nicht später, als sie sich mit jedem Tag weiter von Shi entfernten. Auch heute Morgen noch nicht.
Die Ampel schaltete auf Rot, das Taxi hielt, Christine öffnete kurz die Augen, und er sah, dass sie es auch jetzt nicht glaubte. Eine Straße noch, wollte er sagen. Schau aus dem Fenster. Versichere dich selbst. Zweihundert Meter, vielleicht dreihundert, nicht mehr. Was war eine Straße, wenn man Tausende von Kilometern geflohen war?
Der Mann an der Ecke würde sie allein nicht aufhalten können.
Dann bemerkte er einen zweiten.
Und einen dritten.
Ein schwarzer Audi mit getönten Scheiben parkte unbehelligt nicht weit von der Sicherheitszone vor dem Eingang der Botschaft. Ihm fiel eine Gruppe junger Männer auf, die unter einem der Ginkobäume lungerten und Ausschau hielten.
»Nicht anhalten. Fahren Sie weiter«, befahl er dem Taxifahrer.
»Die Botschaft ist hier.«
»Ich weiß, wo die Botschaft ist. Weiter.«
Christine. Aufgeschreckt. Wie sehr die Angst ein Gesicht zeichnet, dachte Paul. Das hatte sie mit der Liebe gemein.
»Aber Sie wollten zur Botschaft.«
»Fahren Sie weiter. Weiter!«
»Wohin?«
Auch auf einfache Fragen gibt es manchmal keine Antworten. Gerade auf sie nicht.
»Wohin?«, wiederholte der Fahrer.
Zweitausend Kilometer entfernt störte ein Anruf aus der Hauptstadt ein Mittagessen.
Die Herren waren in einer Besprechung, nur im Notfall zu stören.
Kein Notfall, nein, aber von großer Dringlichkeit.
Dann müsse man sich gedulden.
Es gab einen Austausch von Unhöflichkeiten und Drohungen, dann wurde durchgestellt.
»Sie sind hier.«
»Wo?«
»In Peking. Vor der amerikanischen Botschaft.«
Ein kurzes Schweigen.
»Was sollen wir machen?«
»Hierher bringen.«
»Alle?«
»Nein. Nur den Kleinen.«
»Und die beiden anderen?«
DIE STADT
Zwei Wochen zuvor
I
Paul hatte nicht oft und nie gern getanzt in seinem Leben, und seit dem letzten Mal waren Jahre vergangen.
Aber da er zu jenen Menschen gehörte, die zu einem Kind schlecht Nein sagen konnten, am allerwenigsten zu seinem eigenen, begann er sich zu bewegen.
Er machte einen Schritt nach vorn im Takt der Musik, einen zur Seite, einen zurück. Er wippte in den Knien und drehte sich mit Schwung einmal im Kreis.
Auf seinen Schultern saß das Gewicht der Welt. So leicht, dass er nicht schwer daran trug.
David jauchzte vor Vergnügen.
Sie waren umringt von mehreren Hundert Walzer tanzenden Paaren. Manche nahmen keine Notiz von den beiden Fremden in ihrer Mitte. Andere lachten beim Anblick des groß gewachsenen Mannes mit dem Kind auf seinen Schultern, das sie alle um Kopfeslängen überragte. Sie riefen ihnen ermunternde Worte zu, winkten und klatschten in jeder Pause.
David freute sich über die Aufmerksamkeit, Paul über die Unbeschwertheit, mit der sie in Shi auf dem »Platz des Volkes« tanzten. Statt unter der drückenden Hitze Hongkongs zu leiden, genoss er mit seinem Sohn die warme Luft eines milden Herbsttages in Sichuan. Über ihnen wölbte sich ein klarer, tintenblauer Himmel. Ein heftiger Regen am Morgen hatte den Dreck aus der Luft gewaschen, was übrig blieb, hatte der Wind in den vergangenen Stunden aus der Stadt geweht.
Nach einigen Tänzen hatte sein Sohn Durst. Paul hob ihn von den Schultern, und sie gingen zu einer Reihe von Kiosken, die den Platz an einer Seite begrenzten. Die Läden verkauften Eis, Gebäck und Getränke und waren umlagert von Menschen. Aus Lautsprechern klang Hongkonger Kanto-Pop, es roch nach frischem Kaffee. Paul bestellte einen doppelten Espresso und für David eine Kugel Eis und eine Limonade. Sie setzten sich an den letzten freien Tisch auf zwei Barhocker. David wollte einen Strohhalm, Paul holte ihm einen.
»Nein, keinen gelben, einen roten.«
»Rote gibt es nicht.«
»Doch. Die Frau am Nebentisch hat einen.«
»Die Farbe des Strohhalms spielt für den Geschmack einer Limonade keine Rolle.«
»Doch, tut sie.«
»Tut sie mit Sicherheit nicht.«
»Tut sie mit Sicherheit doch. Bitte, Papa.«
Paul holte einen roten.
Sie schwiegen eine Weile und blickten über den Platz.
In der Mitte ragte eine Statue Mao Zedongs aus grau-weißem Stein in den Himmel, überüberlebensgroß. Mao hatte den rechten Arm erhoben, er winkte dem Volk oder wies ihm den Weg, so eindeutig war das nicht zu sagen. An Kopf und Schultern war der Stein auffallend hell, er war wohl erst vor Kurzem von Vogelschiss gesäubert worden.
Zu Maos Füßen hatte die Stadt große Beete angelegt, in denen rote Herbstblumen blühten. Hinter ihm wehte ein Banner: »Lang lebe der Große Vorsitzende«.
David schenkte all dem keine Beachtung. Sein Glas war leer, das Eis alle, er wollte weitertanzen.
»Gleich.«
»Wann ist gleich?«
Mit Anbruch der Dämmerung strömten mehr und mehr Menschen auf den »Platz des Volkes«: Familien, die den lauen Herbstabend genossen; Einkaufende, mit schweren Tüten beladen; junge Paare, die auf Bänken und Stühlen die Nähe des anderen suchten.
Ein alter Mann näherte sich ihnen und starrte sie unverhohlen an. Als sich ihre Blicke trafen, lachte er. Ein zahnloses, seltsames Lachen. Nicht feindlich, aber auch nicht freundlich.
Ein paar ältere Frauen gesellten sich neugierig dazu und begannen sofort, in schwerem Sichuan-Dialekt Mutmaßungen über den Fremden und das seltsame Kind anzustellen. Soweit er ihnen folgen konnte, staunten sie über Davids schwarze, lockige Haare und seine dunkelblaue Augenfarbe, die, so fanden sie einmütig, gar nicht zu seinen asiatischen Augen passten. Chinese war er mit Sicherheit nicht, aber auch kein richtiger »Gweilo«. Was dann? Japaner vielleicht? Paul unterdrückte ein Lachen und schwieg. Sie musterten ihn eindringlich und fragten, ob er der Vater oder der Großvater sei.
»Der Vater«, erwiderte Paul.
Skeptische Blicke. Vereinzeltes, ungläubiges Lachen.
Er musste ein reicher Mann sein, der sich eine junge Chinesin als Frau genommen hatte. Wo mochte sie stecken? Wahrscheinlich hatte sie ihn schon wieder verlassen. Darüber gingen, nach allem, was Paul verstand, die Meinungen weit auseinander.
David wurde ungeduldig. Er wollte tanzen.
Paul stand auf und setzte ihn sich wieder auf die Schultern.
Mitten im nächsten Walzer brach die Musik ab. Die Tanzenden hielten inne. Irritierte Blicke. Ein leises Gemurmel, das anschwoll, wieder leiser wurde, bis es ganz erlosch. Auf dem Platz breitete sich eine gespannte, unheimliche Stille aus. David beugte sich zu ihm herunter: »Was ist los, Papa?«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich suchen sie nach einer neuen Musik.«
Vor den Lautsprechern begann ein Streit. Mehrere Männer und Frauen schrien sich an, ihre aufgewühlten Stimmen drangen bis zu ihnen herüber. Auf einmal erklangen andere Töne, verstummten, der Streit wurde heftiger. Sie erklangen erneut, Paul erkannte die Melodie sofort, brauchte aber einen Moment, bis er sie zuordnen konnte.
Wacht auf, Verdammte dieser Erde.
Wann hatte er das letzte Mal »Die Internationale« gehört? Die ersten Paare tanzten wieder, andere zögerten, warteten offenbar ab, wofür sich die Mehrheit entscheiden würde. Nach und nach kamen auch sie wieder in Bewegung.
Völker, hört die Signale!
David wippte begeistert im Rhythmus der Musik, Paul hielt die Beine seines Sohnes noch etwas fester.
»Warum tanzt du nicht?«, wollte David wissen.
Paul hasste Märsche und Kampflieder. Er machte ihm zuliebe trotzdem ein paar Schritte, widerwillig und unbeholfen.
»So nicht«, tönte es enttäuscht von oben. »Richtig tanzen. Wie eben.«
Paul bemühte sich.
Es folgte »Lang lebe der Große Vorsitzende«, eine Lobpreisung Maos, die zu seinen Lebzeiten täglich überall im Land zu hören war. Der Alte neben ihnen kletterte begeistert auf einen Stuhl und begann zu singen. Seine Stimme klang wie ein Krächzen, aber den Text konnte er auswendig. Die Jugendlichen, die ein paar Meter weiter auf einer Mauer hockten, amüsierten sich und schnitten Grimassen.
Paul blieb stehen.
»Weiter, weiter«, rief sein Sohn.
»Gleich.«
»Nein, jetzt.«
Als Nächstes erklang »Der Osten ist rot«.
Der Osten ist rot, die Sonne geht auf
China hat Mao Zedong hervorgebracht
Der Vorsitzende Mao liebt das Volk,
Er führt uns,
Um das neue China aufzubauen,
Hurra, führt uns nach vorn.
Mehr und mehr jüngere Paare schlossen sich den Tanzenden und Singenden an. Selbst in den beiden Cafés standen nun die meisten der Gäste, manche auf den Stühlen.
»Lied vom roten Stern«.
Der Gesang eines vieltausendstimmigen Chores schallte laut über den Platz.
Der rote Stern leuchtet, er leuchtet mit Strahlen;
Der rote Stern flackert, er wärmt unsere Herzen.
Der rote Stern ist das Herz der Arbeiter und Bauern,
Der Ruhm der Partei erstrahlt für alle Zeiten.
Die Macht der Masse. Paul schauderte, ihm war nicht wohl. Er spürte sein Herz heftig schlagen und atmete schwer. Vielleicht hätte er den doppelten Espresso nicht trinken sollen.
David hatte aufgehört zu wippen, als spüre er das Unwohlsein. Er hielt sich mit beiden Händen am Kopf seines Vaters fest.
Zwei Männer forderten den Kioskbesitzer grob auf, den Kanto-Pop abzustellen. Als dieser sich weigerte, gingen sie zu den Lautsprechern und rissen die Kabel heraus.
Danach bauten sie sich vor den Jugendlichen auf. Ein paar Worte genügten, und die Jungen und Mädchen senkten ihre Blicke, standen gehorsam auf und stimmten in den Chor ein. Nur einer blieb demonstrativ sitzen. Er trug trotz des milden Wetters eine Lederjacke, löchrige Jeans, spitze Motorradstiefel, und sein gefärbtes Haar leuchtete in einem fast weißen Blond. Sekunden später zertrümmerte ein Faustschlag sein Nasenbein. Paul wandte sich entsetzt ab.
David wollte sofort herunter von der Schulter und in den Arm seines Vaters.
Der Alte rief ihnen aufgebracht ein paar Satzfetzen zu, andere Männer, die nicht weit entfernt standen, fügten etwas an. Paul verstand nicht genau, was sie sagten, es ging offenbar aus irgendeinem Grund um Japan. Er antwortete mit einem unbeholfenen Lächeln, was sie noch mehr in Rage brachte. Die Frauen, die eben noch neugierig das Gespräch gesucht hatten, warfen ihnen feindliche Blicke zu, die Jugendlichen nickten. Paul schaute sich nach Zhang um, der bereits über eine halbe Stunde verspätet war. Er wollte einfach nur weg.
David zitterte.
Paul nahm seinen Sohn fester in den Arm. Von Weitem sah er Zhang auf sie zukommen.
An seiner Mönchskutte klebte Spucke.
II
Das Moshan-Kloster lag nur wenige Kilometer vom »Platz des Volkes« entfernt, trotzdem benötigte ihr Taxi über eine halbe Stunde. Auf dem sechsspurigen Boulevard ging es nur im Schritttempo vorwärts, wenn überhaupt. Der Fahrer fluchte. Er wechselte fortwährend die Spur, bis Zhang ihn bat, damit aufzuhören. Sie seien nicht auf der Flucht, auch wenn es auf den ersten Blick diesen Anschein gehabt haben mochte. Sie wichen auf einen Schleichweg aus und standen wieder im Stau.
Paul ertrug die Enge im Auto und den Stillstand auf der Straße nur schwer. Er hasste es, sein Tempo nicht kontrollieren zu können, und fühlte sich eingesperrt. Noch immer hatte er den Gesang der Massen im Ohr. Die wortlose Stille im Wagen ließ den Chor noch lauter klingen. Am liebsten wäre er ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen.
Zhang saß stumm neben ihm und betrachtete ein Foto Mao Zedongs, das am Rückspiegel baumelte, darunter klebte eine weiße Plastikbüste des Großen Vorsitzenden auf dem Armaturenbrett. Paul sah ihm an, wie aufgewühlt er war. Der große Spuckefleck auf seiner Brust war noch immer nicht ganz getrocknet.
Das Taxi bog in eine Nebenstraße in der Nähe des Klosters. Sie stiegen aus, und Zhang begann auf einem kleinen Markt einzukaufen. Wie früher, dachte Paul und freute sich über diese Vertrautheit. Für einen kurzen und doch zu langen Moment hatte ihn der Anblick seines Freundes in der grauen Mönchskutte irritiert. Er hat die Uniform getauscht, war es Paul durch den Kopf geschossen.
Die eines Polizisten gegen die eines Mönchs.
Der Gedanke verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war, unangenehm berührt hatte er Paul dennoch. Er kannte Zhang seit fast dreißig Jahren. Sie waren sich auf einer der ersten Reisen Pauls nach China begegnet. Zhang war damals Streifenpolizist in Shenzhen und hatte den fremden Besucher auf einer öffentlichen Toilette vor einer neugierigen Menge schützen müssen. Mit den Jahren waren sie Freunde geworden. Kein Mensch auf der Welt, von Christine vielleicht abgesehen, war ihm vertrauter.
Vor drei Jahren hatte Zhang von einem Tag auf den anderen den Polizeidienst quittiert. Er war als junger Mann nach Shenzhen gekommen und schnell von einem einfachen Streifenpolizisten zum Inspektor bei der Mordkommission aufgestiegen. In den folgenden knapp dreißig Jahren wurde er mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit bei Beförderungen übergangen. Die offizielle Begründung dafür waren sein buddhistischer Glaube und seine Weigerung, der Kommunistischen Partei wieder beizutreten, nachdem man ihn in den achtziger Jahren während einer Säuberungsaktion gegen »spirituelle Verschmutzung« ausgeschlossen hatte. Beides hätten die Kader ihm vermutlich noch verziehen, zumal er einer der besten und fleißigsten Kommissare war. Was ihn in den Augen seiner Vorgesetzten wirklich für höhere Aufgaben diskreditierte, war seine Redlichkeit. Zhang weigerte sich beharrlich, Schutzgelder von Restaurants, Bars, Hotels, Prostituierten oder illegalen Arbeitern vom Lande zu erpressen. Sogar die Umschläge mit Bargeld, die Zigaretten, den Whiskey und all die anderen Geschenke zum chinesischen Neujahr lehnte er höflich, aber bestimmt ab.
Eine Ehrlichkeit, die in der Familie Zhang oft zu Streit geführt hatte. Das Gehalt eines Kommissars und der Lohn einer Sekretärin genügten nicht, um von den Verheißungen der neuen Zeit zu profitieren. Es reichte weder für eine Eigentumswohnung noch für ein Auto. Nicht einmal einen regelmäßigen Einkaufsbummel in einem der neuen Shoppingcenter mit den vielen ausländischen Marken konnten sie sich leisten. Das Prada-Täschchen und der Chanel-Gürtel seiner Frau waren Plagiate der billigsten Sorte gewesen.
Und bei all den jahrelangen kleinen, aber stetigen Zänkereien und Streitigkeiten – Zhang hätte nicht einmal sagen können, wann es begonnen haben mochte – hatte sich ihre Liebe davongeschlichen.
Als er nach einem Korruptionsskandal zum Leiter der Mordkommission ernannt wurde und nur wenige Monate später zurücktrat, weil er wusste, dass er mit seiner Redlichkeit nur scheitern konnte, war es seiner Frau zu viel geworden.
Sie verließ ihn kurz darauf für einen deutschen Unternehmer. Ohne ein Wort zu sagen, war sie mit dem gemeinsamen Sohn ausgezogen. Als Zhang eines Abends vom Dienst kam, fehlte die Hälfte des Hausstands. Es sah aus, als hätte sie selbst die Pfefferkörner abgezählt und den Zucker abgewogen. Nun trug sie eine echte Prada-Tasche und lebte in einem der Villenviertel am Rande Shenzhens, in das sich reiche Ausländer und noch reichere Chinesen zurückzogen.
Die Trennung nach zwanzig Jahren Ehe setzte seinem Freund zu. Paul und er verbrachten in den folgenden Wochen und Monaten viel Zeit miteinander, und eines Abends sagte ihm Zhang, dass er gekündigt habe, in seine Heimat Sichuan zurückkehren und in ein buddhistisches Kloster eintreten werde.
Paul war enttäuscht und gekränkt. Enttäuscht, weil Zhang der einzige Freund war, den er je gehabt hatte, und er ihn vermissen würde. Gekränkt, weil ihn ebendieser Freund nicht ins Vertrauen gezogen, ihn nicht um Rat oder seine Meinung gefragt hatte.
Eine Woche später begleitete Paul ihn zum Flughafen. Er wollte sich verabschieden und mit dem Gepäck helfen. Doch Zhang reiste nur mit einer knallgelben Reisetasche aus Kunstleder, die so klein war, dass er sie nicht einmal aufgeben musste. Er sei vor dreißig Jahren mit nichts nach Shenzhen gekommen und wolle mit nichts die Stadt wieder verlassen.
Seit Zhangs Abschied hatten sie sich nicht mehr gesehen, nur hin und wieder telefoniert und unregelmäßig E-Mails geschrieben. Paul hatte fest vorgehabt, ihn zu besuchen, doch irgendetwas war immer dazwischengekommen.
Nun beobachtete er Zhang und sah seinen Freund, wie er ihn in Erinnerung hatte. Wie er sich skeptisch über die Tomaten beugte, den Pak Choy sorgfältig prüfte, ein Dutzend Auberginen in die Hand nahm, um die eine richtige zu finden. Wie er am Knoblauch und dem Sichuanpfeffer roch oder mit der Verkäuferin über die Qualität des frischen Tofu diskutierte. Seine Leidenschaft fürs Kochen hatte er ganz offensichtlich auch als Mönch nicht verloren.
Wie sehr hatte er Zhang in den vergangenen Jahren vermisst. Und wie leicht war es ihm gefallen, dieses Gefühl in Hongkong zu verdrängen.
Paul ahnte: Der Abschied in ein paar Tagen würde ihm schwerfallen.
Das Kloster war umgeben von einer roten, mehrere Meter hohen Mauer und lag versteckt in einer Neubausiedlung zwischen vierzigstöckigen Hochhäusern. Zhang führte sie in den Hof. An den Dachspitzen der drei Gebetstempel, die hintereinander in der Mitte standen, hingen rote Lampions und Laternen. Aus den Tempeln zogen Weihrauchschwaden in den Abendhimmel.
Sie gingen vorbei an Bergen von Bauschutt, Paletten mit neuen Dachziegeln und Backsteinen, an Holzbalken und Gerüsten. Über den Hof rannte eine Ratte.
David klammerte sich fest an seinen Vater, das Gesicht zwischen Schulter und Hals versteckt. Nur einmal hob er den Kopf und schaute sich um.
»Ich habe Hunger«, flüsterte er.
Die Küche war ein schlichter Raum mit einem langen Tisch, ein paar Hockern, einem Arbeitstresen, Herd und Spüle. In einem offenen Schrank standen Töpfe, Pfannen und Geschirr. Im Ofen loderte ein Feuer.
Zhang legte die Einkäufe ab.
»Was hältst du von vegetarischem Mapo Tofu, Lotuswurzel in süß-saurer Soße, kurz angebratenem Gemüse und zum Abschluss ein paar Dan-Dan-Nudeln. Für deinen Sohn brate ich einen Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln.«
»Mach dir nicht solche Arbeit. Reis und ein bisschen Gemüse reichen völlig.«
Zhang schaute ihn enttäuscht an. »Was ist denn mit dir los? Du willst unser Wiedersehen mit etwas Reis und Gemüse feiern?«
»Nein. Ich will nur nicht, dass du dir so viel Mühe machst.«
»Was heißt ich? Wir kochen zusammen.«
Zhang holte Messer, Bretter und Schalen aus dem Schrank und stellte sie vor ihnen auf den Tisch.
Paul war zu überrascht, um etwas zu erwidern. Noch nie hatte er seinem Freund beim Kochen zur Hand gehen dürfen.
Früher hatte Zhang in der Küche kaum ein Wort gesprochen. Wenn Paul etwas sagte, hörte er es nicht einmal, zu tief war er versunken in einer Welt aus Gerüchen und Gewürzen, aus Kräutern, Ölen, Pasten. Paul hatte lange geglaubt, Kochen sei für ihn nur eine andere Form des Meditierens, bis Zhang ihm die Geschichte vom alten Hu erzählte. Während der Kulturrevolution hatte er mit angesehen, wie Rotgardisten den alten Mann zu Tode prügelten, weil er es gewagt hatte, seiner Suppe aus der Küche der Kommune etwas Pfeffer hinzuzufügen. Das war Beweis genug für seine »dekadente, bourgeoise« Einstellung.
Die Suppe hatte für alle gleich zu schmecken.
Seit diesem Erlebnis, so gestand ihm Zhang, war für ihn jedes aufwendig und mit Mühe gekochte Essen ein Fest. Ein kleiner, stiller Triumph des Lebens über den Tod. Der Liebe über den Hass. Und je besser es schmeckte, je mehr der Gaumen gereizt, die Nase verwöhnt und der Magen gefüllt wurde, desto süßer war dieser Triumph. Nicht eine Mahlzeit konnte er zubereiten, ohne an Hu zu denken.
Er stellte eine Schale mit Wasser auf den Tisch und legte Lotuswurzeln, Tomaten, Zucchini, Frühlingszwiebeln, Paprika, Gurken und Karotten daneben.
»Hey, Kleiner, die kannst du waschen, wenn du willst«, sagte er an David gewandt.
Zu Pauls Erstaunen kniete sich sein Sohn auf einen Stuhl und begann mit der Arbeit. Gewissenhaft tauchte er das Gemüse ins Wasser, rieb es ab und zeigte Zhang jedes Stück. Der nickte anerkennend.
Paul nahm das gewaschene Gemüse und schnitt es in dünne Scheiben. Zhang schälte Knoblauch und Zwiebeln, rührte den Pfannkuchenteig und begann auf dem Herd zu hantieren.
Kurz darauf duftete es in der Küche nach gebratenem Knoblauch und Frühlingszwiebeln, nach Sesamöl und Ingwer.
Zhang holte eine Dose Sichuanpfeffer aus einer Schublade und roch daran.
»Weißt du, wie der früher hieß?«
Paul schüttelte den Kopf.
»Barbarischer Pfeffer.«
»Weil er so scharf ist?«
»Nein. Weil er aus Amerika nach China kam.«
Zhang lächelte, und einen Augenblick lang dachte Paul, er mache Spaß.
»Es gibt nur Barbaren auf der Welt – abgesehen von uns Chinesen natürlich.«
Eine halbe Stunde später stand das Essen auf dem Tisch. Zhang hatte auch als Mönch das Kochen nicht verlernt. Die Lotuswurzeln waren weder zu hart noch zu weich. Paul wusste aus eigener Erfahrung, wie schwierig das war. Der Mapo Tofu schmeckte auch ohne Fleisch köstlich. Zhang hatte genau die richtige Schärfe hinbekommen, der Sichuanpfeffer entfaltete seine leicht betäubende Wirkung auf Zunge und Gaumen, ohne dass der Chili im Hals brannte.
Selbst David schmeckte es. Er aß einen zweiten Pfannkuchen, dann verkroch er sich in die Arme seines Vaters und schlief nach wenigen Minuten erschöpft ein.
»Wollen wir ihn in mein Bett legen?«, fragte Zhang.
Paul nickte.
Zhangs Zimmer lag auf der anderen Seite des Hofs. Es bot Platz für ein Bett, einen Stuhl und einen schmalen Schrank. Von der Decke hing eine nackte Glühlampe. Paul legte seinen Sohn aufs Bett, deckte ihn zu und löschte das Licht. Sie setzten sich auf zwei Hocker vor die Tür. Über den Hof schlurfte ein alter Mönch, der so krumm ging, dass er nur mit Mühe geradeaus schauen konnte. Er bemerkte sie nicht.
III
»Was ist los mit dir?«, hörte er die Stimme seines Freundes.
»Was soll los sein?«
Zhang drehte bedächtig den Kopf zur Seite und schaute ihn an.
»Ich habe dich vermisst«, fügte Paul ein wenig verlegen hinzu.
Zhang erwiderte nichts. Er wandte seinen Blick ab und schaute wieder in den nur von ein paar Lampions beleuchteten Hof.
Nach einer langen Pause sagte Paul: »Alles gut.«
»Das freut mich.«
Von drinnen hörte er David im Schlaf husten.
»Und bei dir?«
»Auch alles gut.«
Vielleicht hatte er, dachte Paul, doch unterschätzt, welch unterschiedliche Wendungen ihre Leben in den vergangenen drei Jahren genommen hatten.
Der Mönch und der (erneute) Familienvater.
Suchende waren sie beide.
Aber jeder in einem anderen Winkel.
Zu berichten gab es viel, Zeit hatten sie wenig. Wo beginnen? Wie in der Eile das Wichtige vom Unwichtigen trennen?
Je bedrückender er das Schweigen empfand, desto mehr wuchs die Anspannung in ihm. Bis sie sich in einem Redeschwall entlud. Bis sein Verlangen, sich seinem Freund mitzuteilen, größer war als die Furcht, über Dinge zu sprechen, von denen er lieber geschwiegen hätte.
Ohne Pause hetzte er durch die vergangenen drei Jahre.
Die Geburt Davids und die Hoffnungen, die er damit verbunden hatte.
Der Einzug Christines. Sie hatte ihre Wohnung in Hang Hau aufgegeben und war mit Josh, ihrem Sohn aus erster Ehe, und ihrer Mutter bei ihm eingezogen. Ein Wagnis, das wussten sie beide. Ihre Mutter zog zwar nach einigen Monaten in eine kleine Wohnung in Yung Shue Wan, war aber trotzdem ein permanenter Gast.
Sein Bemühen, mit ihnen ein Haus und ein Leben zu teilen, das bis dahin nur von ihm und seinem toten Sohn bewohnt worden war. Seine Versuche, sich einzufügen, den Anforderungen, das ein Leben zu fünft stellt, zu genügen.
Was eine Familie hätte werden sollen, zeigte ihm doch nur, was er nicht oder nur in einem geringen Maße besaß: Die Fähigkeit, in einer Gemeinschaft zu leben. Sich anzupassen. Nähe zu ertragen.
Wo hätte er es lernen sollen? Ohne Vorbilder. Die schönste Erinnerung an seine Kindheit und Jugend war der Tag, an dem er als Achtzehnjähriger das Elternhaus verließ.
Familienleben. Die gemeinsamen Essen. Die Blicke. Die Gespräche, bei denen oft nur Andeutungen genügten, um sich mitzuteilen. Oder zu verletzen. Das wortlose Verstehen oder auch Nichtverstehen.
Manchmal saß er dabei, hörte zu, beobachtete und fühlte sich wie ein Imitator. Ein Familienmenschdarsteller.
Er war ein Fremder im eigenen Haus.
Christine verstand es nicht.
Ein Fremder im eigenen Leben.
Das würde sie vermutlich noch weniger verstehen.
Wie einsam man unter einem gemeinsamen Dach sein konnte. Und es war sein Fehler. Sein Unvermögen, er wusste es. Was es nicht einfacher machte.
Schlimmer noch war seine Zerrissenheit, wenn es um Justin und David ging.
Nach Davids Geburt hatte er alles getan, was er sich vorgenommen hatte. Justins Kinderzimmer neu gestrichen. Das zarte Hellblau durch ein sattes Gelb ersetzt. Die Plüschtiere in einem Karton verstaut, der nun unter ihrem Bett lag. Auf seiner Seite. Die meisten Zeichnungen und Fotos von den Wänden genommen. Justins Gummistiefel und die Regenjacke aus dem Flur weggepackt.
Er hatte es nicht übers Herz gebracht, den Türrahmen mit den Markierungen für Justins wachsenden Körper zu überstreichen.
28. Februar – 128 Zentimeter. Die letzte Eintragung.
Aber nach kurzer Bedenkzeit war er einverstanden gewesen, dass Josh ihm diese Arbeit abnahm.
Davids Wachstum sollte nicht an dem seines toten Halbbruders gemessen werden.
Und trotzdem.
Die Geburt Davids hatte seine Erinnerungen nicht verblassen lassen. Eher waren sie wieder lebendiger geworden. Das erste Krabbeln. Die ersten Schritte. Die ersten Worte. Wie konnte er anders, als dabei an Justin zu denken? Und natürlich lag auf diesen Erinnerungen ein tiefschwarzer Schatten, der jede Freude so sehr mit Schmerz vermischte, bis er beides nicht mehr trennen konnte.
Schmerzfreudefreudeschmerz.
Er hatte sich geschworen, nicht zu vergleichen. Und tat es trotzdem.
Was hatte Christine erwartet? Dass er seinen verstorbenen Sohn aus seinen Erinnerungen tilgte? (Natürlich nicht, behauptete sie.) Vergessen war ein Verwandter des Todes. (Darum geht es nicht, Paul!)
Auch darüber gerieten sie häufiger in Streit.
Und trotzdem war die Liebe nicht weniger geworden. Zumindest seine nicht. Vielleicht war sogar das Gegenteil der Fall. Bei Christine war er sich manchmal nicht mehr so sicher.
Zhang hörte zu. Blickte ihn hin und wieder von der Seite an. Das Zhang-Gesicht. Zugewandt, offen, mit tiefen Falten und mehr als nur einer Spur Melancholie in den Augen.
Irgendwann gingen Paul die Worte aus, und sie konnten schweigen.
»Schwierig«, sagte Zhang leise nach einer langen Pause. »Sehr schwierig.«
Mehr an Zuspruch bedurfte es nicht.