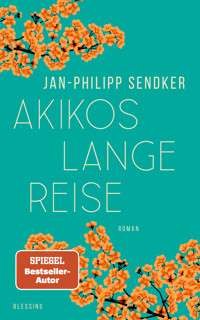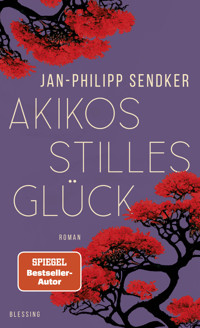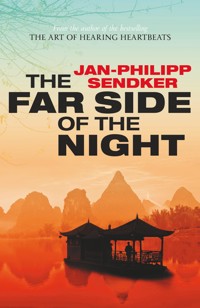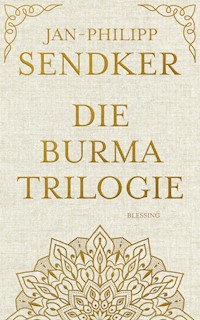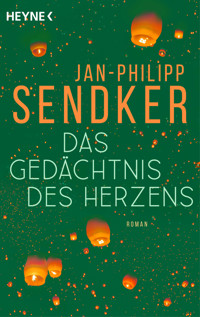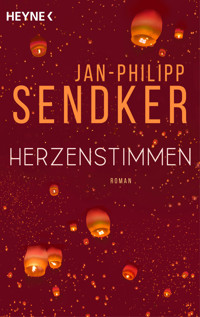9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angst ist eine Macht, die überwunden werden kann
Der 18-jährige Niri, seine Eltern und Geschwister haben eine bescheidene, aber gesicherte Existenz als Bedienstete in der Villa einer reichen Familie. Bis die Pandemie kommt, Niris ganze Familie entlassen wird und in den Abgrund tiefster Armut starrt. Der bisher brave Klosterschüler will nicht auf die Gnade einer gleichgültigen Regierung warten und begehrt angesichts der wachsenden Not gegen die Schicksalsergebenheit seines Vaters auf. An den Patrouillen vorbei schleicht er nachts durch eine abgeriegelte Stadt zurück zu der Villa, um zu holen, was die Familie zum Überleben braucht. Dort wartet seine Jugendfreundin Mary auf ihn, die ihm nicht nur Lebensmittel gibt, sondern einen größeren Plan hat, der das Leben der Stadt und der beiden für immer verändern wird.
Die universelle Geschichte zweier Liebender aus verschiedenen Welten, die lernen, was im Angesicht einer Katastrophe zählt: Mut zum Widerstand, Wille zur Veränderung und bedingungsloses Vertrauen ineinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
Der 18-jährige Niri, seine Eltern und Geschwister haben eine bescheidene, aber gesicherte Existenz als Bedienstete in der Villa einer reichen Familie. Bis die Pandemie kommt, Niris ganze Familie entlassen wird und in den Abgrund tiefster Armut starrt. Der bisher brave Klosterschüler will nicht auf die Gnade einer gleichgültigen Regierung warten und begehrt angesichts der wachsenden Not gegen die Schicksalsergebenheit seines Vaters auf. An den Patrouillen vorbei schleicht er nachts durch eine abgeriegelte Stadt zurück zu der Villa, um zu holen, was die Familie zum Überleben braucht.
Mary, Tochter des Hauses und Niris Kindheitsfreundin, entdeckt ihn, als er sich im Vorratskeller der Familie zu schaffen macht. Doch anstatt ihn zu verraten, versorgt sie ihn mit Lebensmitteln und wird zu seiner Komplizin: Bald schon geht es nicht mehr nur darum, Niris Familie vor dem Hunger zu retten – die beiden entwickeln einen größeren Plan, der das Leben der Stadt und der beiden für immer verändern wird.
DERAUTOR
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asien-Korrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des alten Mönches (2017) und Das Gedächtnis des Herzens (2019). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt.
JAN-PHILIPP
SENDKER
Die
Rebellin
und
der Dieb
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2021 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: geviert.com, Nastassja Abel
Umschlagabbildung: © Stocksy, Jean-Claude Manfredi;
© Unsplash, Jason Miller; © Getty, wundervisuals
Satz: Leingärtner, Nabburg
Herstellung: Gabriele Kutscha
ISBN 978-3-641-22766-1V001
www.blessing-verlag.de
Für
Anna, Florentine, Theresa und Jonathan
und
zum Gedenken an Kyal Sin (2001–2021)
1
Mir bleibt nicht viel Zeit, meine Geschichte zu erzählen. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, wenn wir Glück haben vielleicht einem Tag, bis sie uns finden.
Wie bin ausgerechnet ich, der stille, folgsame Niri, zu einem Dieb auf der Flucht geworden? Wie wird ein Mensch zu dem, der er ist?
Die Wahrheit ist: Ich weiß es nicht. Um meiner Schwester zu helfen, habe ich eine Grenze überschritten. Eine Grenze, von der ich zuvor nicht gedacht habe, dass ich jemals auch nur in ihre Nähe kommen würde.
Ich fühlte mich hilflos und entschloss mich zu handeln. Eine Tat führte zur nächsten, nicht, weil ich einen bestimmten Plan gehabt hätte, sondern einfach, weil wir nie stehen bleiben, weil das Leben kein Film ist, den wir anhalten oder zurückspulen können.
Ich habe nicht davon geträumt, ein Held zu sein. Was ich getan habe, hat mich in den Augen vieler Menschen zu einem gemacht, aber es war den Umständen geschuldet, und für diese Umstände konnte ich nichts.
Habe ich eine Wahl gehabt? Blicke ich zurück, mag es so scheinen. Aber in den Momenten, in denen ich mich entscheiden musste, kam es mir nicht so vor.
Ich habe mir die Freiheit genommen, in meiner Not nicht lange über die Konsequenzen meines Handelns nachzudenken. Ich habe nie geglaubt, dass ich die Welt retten kann. Höchstens ein paar Menschen vor Krankheit, Hunger und Tod.
Alles begann damit, dass meine kleine Schwester im Schlaf weinte.
Eigentlich war es kein Weinen, sondern ein schwaches, von Husten unterbrochenes Wimmern. Trotz der Hitze war sie ganz dicht an mich herangerutscht, hatte einen Arm auf meinen Bauch gelegt, ihr warmer Atem strich über meine Haut. Sie schluchzte – und ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Aber vielleicht hatte auch alles schon viel früher begonnen: auf einem Markt in China, wo jemand ein Schuppentier oder eine Fledermaus kaufte und sich dabei mit einem Virus infizierte; oder in einem Labor, wo eine Unachtsamkeit genügte, um etwas freizusetzen, das von dort um die Welt reiste, bis es vermutlich meine Tante tötete.
Möglicherweise begann alles auch noch viel früher, nämlich in dem Moment, als meine Eltern beschlossen, ihr Land zu verlassen, weil sie glaubten, in der Fremde ihr Glück zu finden. Oder zumindest weniger Unglück.
Wer weiß schon, wann und wo Geschichten ihren Anfang nehmen und wann und wo sie ihr Ende finden? Das Leben ist ein Kreislauf, sagt mein Vater. Wir werden geboren, wir sterben, wir werden wiedergeboren … Es ist sinnlos, nach Anfängen und Enden zu suchen.
Meine Schwester zitterte, als würde sie frieren.
Ich schwitzte.
Am Tage waren es fast vierzig Grad gewesen, und in unserer Hütte staute sich die Hitze wie Wasser hinter einem Damm. Die Nächte brachten nur wenig Abkühlung. Hungrige Moskitos summten um unsere Köpfe, eine Spinne kroch mir das Bein hoch, ich versuchte gar nicht erst, sie abzuschütteln, ich wollte meine Schwester nicht wecken. Wir lagen auf unserer Matte aus Bast, es musste nach Mitternacht gewesen sein, die Stimmen des Abends waren verstummt. Der alte Trinker in der Hütte nebenan rührte sich nicht mehr. Das streitsüchtige Paar gegenüber musste vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Und auch im Verschlag der Witwe mit ihren sechs Kindern und noch mehr Liebhabern herrschte endlich Ruhe.
Neben uns schliefen unsere Eltern. Ich hörte es am Schnarchen meines Vaters und an dem schweren, von gelegentlichem Husten unterbrochenen Atem meiner Mutter. Auch sie war krank. Vielleicht hatte sie sich bei ihrer Schwester angesteckt. Sie hustete jedenfalls, war fiebrig und wurde von Tag zu Tag schwächer. Es konnte Malaria sein. Eine Lungenentzündung. TBC. Oder auch der neue Virus. Wir würden es nie herausfinden, so wenig, wie wir sicher sein konnten, woran meine Tante gestorben war.
Gestern hatte es meine Mutter mit meiner Hilfe noch zur Toilette geschafft. Heute war sie gar nicht aufgestanden. Jeder ihrer Atemzüge klang nach einer großen Anstrengung.
Ich bin nicht sehr empfindlich, was Geräusche betrifft. Das Nagen von Ratten neben meinem Ohr. Das Schwirren von Insekten. Das Gezeter der Streitenden in den benachbarten Hütten. Das leise Stöhnen der Liebenden und Bedürftigen. Ich hörte es und hörte es nicht. Es ging durch mich hindurch, ohne Spuren zu hinterlassen. Mit dem Schluchzen meiner Schwester war es etwas anderes. Es tat mir fast körperlich weh. Es erinnerte mich zu sehr an das Weinen von Mayari, meiner anderen kleinen Schwester. Sie starb vor drei Jahren, ihr Wimmern hatte ähnlich geklungen in den Nächten, bevor sie nicht mehr aufwachte.
»Thida«, flüsterte ich, »was ist mit dir?« Eine dumme Frage, ich wusste ja, dass sie Hunger hatte.
Ich überlegte, ob es noch etwas Essbares in der Hütte gab. Die kleine Packung Kekse, die ich zwischen den Brettern versteckt hatte, hatte sie gestern schon bekommen. Die Bananen waren lange gegessen. Reste vom Abendessen gab es keine, weil es kein Abendessen gegeben hatte. Mittagessen auch nicht. Die einzige Mahlzeit des Tages waren eine Schale Reis gewesen und eine Mango, die wir am Morgen unter uns dreien aufgeteilt hatten. Wo mein Vater die aufgetrieben hatte, war mir ein Rätsel. Das letzte Stück Kaugummi, das manchmal gegen den Hunger half, hatte ich vorgestern gegen einen halben Becher Reis eingetauscht.
Ich strich meiner Schwester die schweißnassen Haare aus dem Gesicht, sie schaute mich aus halb geöffneten Augen an. Ihre Lippen bewegten sich, aber sie musste gar nichts sagen. Auch mein Magen war leer. Ein Loch im Bauch. Wer das nie erlebt hat, weiß nicht, wie es sich anfühlt. Den ganzen Tag über hatte ich Krämpfe gespürt. Aber ich bin achtzehn Jahre alt, ich halte das aus. Meine Schwester ist fünf.
Eine Ratte huschte durch den Raum, blieb stehen, richtete sich auf, schnupperte. Ich warf einen von Thidas Flip-Flops nach ihr. Selbst sie würde in dieser Hütte nichts Essbares finden, und ich fürchtete, sie könnte vor Hunger meine Schwester beißen.
Es war noch nicht lange her, da hatten wir nicht gewusst, was Hunger war. Mein Vater hatte fünfzehn Jahre lang als Wachmann bei Mister Benz gearbeitet, und wir hatten ein gutes Auskommen gehabt. Sein Chef hieß eigentlich anders, aber bevor er anfing, Einkaufszentren zu bauen und Reisfelder in Stadtviertel zu verwandeln, handelte er mit Autos dieser Marke. Mein Vater hatte schon damals für ihn gearbeitet, und solange ich denken kann, nannten wir ihn Mister Benz.
Mein Vater hatte als Hilfsgärtner begonnen und war bald zum Wachmann aufgestiegen. Die meiste Zeit des Tages saß er in seiner graublauen Uniform und gründlich polierten schwarzen Stiefeln auf einem Hocker in einer kleinen Hütte neben der Einfahrt. Am Morgen, wenn Mister Benz mit seinem Fahrer das Grundstück verließ, sprang er auf, schob das schwere schwarze Gittertor zur Seite, stand stramm, blickte dem Wagen nach und rührte sich erst wieder, wenn dieser im Verkehr verschwunden war. Die Szene wiederholte sich jeden Abend, wenn Mister Benz zurückkehrte, oder sobald Mrs Benz oder ihre Kinder das Grundstück verließen. Davon abgesehen, hatte mein Vater als Wachmann nicht viel zu tun. Das gesamte Grundstück war von einer mehrere Meter hohen Mauer umgeben, aus deren oberer Kante sehr spitze und sehr scharfe Scherben ragten. Darüber waren noch einmal drei Lagen Stacheldraht montiert. Früher gab es noch Überwachungskameras, deren Bilder auf einen Monitor in die Hütte meines Vaters übertragen wurden. Er verbrachte Stunden damit, von einer Kamera zur anderen zu schalten und auf die immer gleichen Schwarz-Weiß-Bilder zu starren. Als Kind leistete ich ihm dabei manchmal Gesellschaft. Da nie etwas passierte, wurde es mir bald zu langweilig. Meinem Vater nicht. Oder er zeigte es nicht. Irgendwann gingen sie kaputt und wurden nicht ersetzt.
Meine Mutter arbeitete als Köchin der Familie, ihre Schwester, meine Tante, erledigte die Einkäufe und ging ihr beim Kochen zur Hand. Ich war im letzten Jahr für den großen Garten und den Tennisplatz verantwortlich, nachdem der Gärtner entlassen worden war, weil er mit seinem Smartphone heimlich Fotos von dem Grundstück gemacht hatte.
Außerdem gehörte die Pflege des Geisterhauses zu meinen Aufgaben. Im Garten stand ein mächtiger alter Banyanbaum, in dem ein Geist wohnte, der über die Villa und das Grundstück wachte. Für ihn war vor langer Zeit ein Häuschen gebaut worden, in das ich im Namen der Familie Benz jeden Tag eine Vase mit frischen Blumen, ein kleines Glas Wasser und allerlei Opfergaben brachte. Die Benz waren zwar Christen, Mrs Benz war jedoch sehr abergläubisch. Mehrmals in der Woche kam sie zum Geisterhaus und prüfte, ob es sauber war und die Blumen frisch. Oft sah ich sie eine besonders große Pomelo oder Mango vor den Altar legen und den Geist um seinen Schutz oder einen Gefallen bitten. In den Monaten nach dem Unfall ihrer Tochter war sie jeden Tag da.
Meine Eltern, meine Tante, meine Schwester und ich wohnten zusammen in einem Bungalow neben der Einfahrt. Bungalow ist vielleicht ein etwas zu großes Wort für unser kleines Haus, aber meine Eltern nannten es so, weil es ihren Erzählungen nach das mit Abstand größte und schönste war, in dem sie je gelebt hatten. Es bestand aus zwei Zimmern. In dem einen konnten wir unsere fünf Schlafmatten nebeneinander auslegen, in dem anderen standen ein Tisch mit Fernseher, unser Altar und zwei Regale. Auf der Rückseite lag ein Raum mit Dusche und Toilette. Wände und Fußböden waren aus Beton, das Dach aus Wellblech. Während des Monsuns prasselte der Regen so heftig darauf, dass wir im Haus unser eigenes Wort nicht mehr verstanden. Unser größter Luxus war eine Klimaanlage, selbst in den heißesten und feuchtesten Nächten der Regenzeit schwitzten wir nicht.
Essen durften wir im Haus der Benz, in einem kleinen Zimmer für die Bediensteten gleich neben der Küche.
Es fehlte uns an nichts. Es ging uns gut. Es ging uns so gut, dass kaum ein Tag verstrich, an dem meine Mutter nicht einen tiefen Seufzer ausstieß und sich und uns fragte, womit wir so viel Glück verdient hätten.
Das änderte sich über Nacht.
Zunächst bekam meine Tante Fieber. Sie hustete, hatte Hals- und Kopfschmerzen. Eine Erkältung. Wir vermuteten, dass sie sich beim Einkauf auf dem Markt angesteckt hatte, und dachten uns nichts dabei. Erkältungen, auch schwere, kamen und gingen.
Aber das Fieber stieg.
Und dann kam der Virus. Oder die Nachricht von einem Virus. Oder auch nur die Angst vor einem Virus. So genau war das für uns damals nicht auseinanderzuhalten.
Auf Facebook forderte die Regierung alle Bürger auf, sich regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen, in die Armbeuge zu husten, eine Maske zu tragen, bei Fieber nicht aus dem Haus zu gehen und Abstand zueinander zu halten. Alle Grenzen zu den benachbarten Ländern wurden geschlossen.
Mrs Benz litt an Asthma, und die Familie war sehr besorgt. Das Betreten des Hauses war von nun an ausschließlich meiner Mutter gestattet. Zusätzlich zur Gesichtsmaske sollte sie Einweghandschuhe anziehen, einen Schutzkittel tragen und Plastiksäckchen über die Füße streifen. Das Grundstück durfte meine Mutter nur zum Einkaufen verlassen und der Rest unserer Familie gar nicht mehr. Sie fragten, ob wir alle gesund seien, und wir erzählten arglos vom Fieber und Husten meiner Tante. Das war vielleicht ein Fehler, doch früher oder später hätten sie es ohnehin bemerkt, vermute ich.
Mister Benz gab uns eine halbe Stunde. Meine Mutter weinte, meine Schwester auch. Meine Tante nicht. Ich glaube, sie war selbst dafür schon zu schwach.
Mein Vater und ich begannen zu packen. Das dauerte nicht lange, denn wir besaßen nicht mehr, als wir in ein paar Minuten einpacken konnten. Meine T-Shirts, die Unterwäsche, die zwei Hosen, die beiden Wickelröcke passten in eine der Plastiktüten, die uns Mrs Benz freundlicherweise von ihrem Fahrer vor die Tür hatte legen lassen. Genau neunundzwanzig Minuten später, mein Vater legt viel Wert auf Pünktlichkeit, standen wir vor dem Tor und verließen das einzige Zuhause, das meine Schwester und ich bis dahin gekannt hatten. Niemand kam, um uns zu verabschieden, aber das hatten wir auch nicht erwartet.
Ich schleppte die Tüten mit unseren Sachen, meine Mutter trug in der einen Hand unseren Altar, an der anderen hielt sie Thida, die ihren Stoffelefanten unter den Arm geklemmt hatte. Mein Vater schob das Moped mit dem kleinen Fernseher und unseren Bastmatten auf dem Gepäckträger. Meine fiebernde Tante konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten und stützte sich auf meinen Vater.
Das eigentliche Problem war, dass wir nicht wussten, wohin wir gehen sollten. Wir hatten keine Verwandten in der Stadt. Die Familie waren wir.
Meine Eltern waren vor zwanzig Jahren auf der Suche nach Arbeit ins Land gekommen. Ich wurde hier geboren, genauso wie meine beiden Schwestern. Mein Vater, so erzählte meine Mutter, hatte früher auf Baustellen gearbeitet, als Tellerwäscher in Restaurants, als Gärtner. Er hatte in einem Auto-Spa Karosserien poliert, Straßen gefegt, Müll abgeholt, als Nachtwächter Parkplätze bewacht. Meine Mutter musste sich um fremde Kinder kümmern, fremde Füße massieren und fremde Wäsche waschen. Sie hatten nie viel Geld verdient, aber immer genug, um nicht hungern zu müssen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Durch eine Empfehlung fanden sie die Anstellung bei den Benz.
Was wir nicht besaßen, waren offizielle Papiere. Keine Arbeitserlaubnis und keine Aufenthaltsgenehmigung, keinen Ausweis, keinen Reisepass, nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nichts. Wir waren »Illegale«. Offiziell gab es uns in diesem Land nicht. Deshalb wurde ich als Kind auch nicht in einer öffentlichen Schule unterrichtet, sondern von Mönchen in einem benachbarten Kloster, zusammen mit anderen »illegalen« Kindern. Deshalb konnten wir nicht in ein Krankenhaus, als meine Schwester krank wurde. Deshalb hatte mein Vater keine Anzeige erstattet, als sein erstes Moped geklaut wurde. Deshalb saß der Mann, der meiner Mutter Dinge angetan hatte, über die sie mit meinem Vater nur ein einziges Mal und dann nie wieder sprach, nicht im Gefängnis.
Zurück in das Land meiner Eltern konnten wir nicht. Die Grenzen waren geschlossen, außerdem gehörte unsere Familie zur Minderheit der Koo, und die Koo besaßen in ihrer Heimat keine Rechte, weil sie dort seit Jahrhunderten nur geduldet wurden. Es war kompliziert.
Wir liefen die Straße entlang, und meine Schwester wollte wissen, wohin wir gingen.
Die erste Nacht schliefen wir unter einer Brücke. Die zweite im Eingang einer U-Bahn. Die dritte auf einer Baustelle, auf der niemand mehr baute. Meine Tante hustete viel und röchelte und rang nach Luft, als würde sie jeden Moment ersticken. Mein Vater und ich trugen sie abwechselnd auf dem Rücken, ihren von der Krankheit erschöpften Körper zu fühlen machte mich traurig. Sie war so dünn geworden, es kam mir vor, als würde ich jeden einzelnen ihrer Knochen spüren.
Auf der Baustelle wohnten ein paar Arbeiter, die darauf achten sollten, dass niemand Werkzeuge oder Baumaterial stahl. Trotzdem fehlten jeden Morgen ein paar Säcke Beton, Kartons voller Nägel, Rollen mit Kabeln. Die Männer wollten uns zunächst fortschicken. Das Bitten meines Vaters und das Mobiltelefon meiner Tante änderten ihre Meinung. Als meine Tante zwei Tage später starb, halfen sie uns, sie in einem Loch am Bauzaun zu verscharren.
Die Tage verbrachte mein Vater mit der Suche nach einem Job. Er ging kurz nach Sonnenaufgang los und war überzeugt, mit seiner Erfahrung als Wachmann/Gärtner/Autowäscher/Straßenfeger schnell etwas zu finden. Jeden Abend kehrte er enttäuscht zurück. Niemand hatte Arbeit für ihn, alle hatten Angst. Trotz der jahrelangen Anstellung bei den Benz besaßen wir keine Ersparnisse. Mein Vater war Buddhist, persönlicher Besitz interessierte ihn nicht. Am Ende eines jeden Monats hatte er genommen, was von unserem Lohn noch übrig war, und das Geld eigenhändig zu dem benachbarten Kloster gebracht. Die bräuchten es nötiger als wir, sagte er immer.
Einen Tag nach dem Tod unserer Tante behaupteten die Arbeiter, die Polizei werde nach und nach die stillgelegten Baustellen kontrollieren und die »Illegalen« verhaften. Da wurde uns das Risiko zu groß, voneinander getrennt zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Wir packten unsere Sachen und zogen weiter.
Die Nachrichten auf Facebook klangen bedrückend. Der Präsident hatte dem Virus den »Krieg« erklärt, die Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Trotzdem breitete er sich im Land angeblich weiter aus. Versammlungen wurden verboten. Schulen und Universitäten mussten schließen, ebenso die meisten Geschäfte. Züge und Busse fuhren nur noch sehr eingeschränkt und unregelmäßig. Alle Menschen wurden dringend ermahnt, zu Hause zu bleiben. Aber wo sollten die bleiben, die kein Zuhause hatten?
Auf einem brachliegenden, von einem Bauzaun umgebenen Grundstück fanden wir eine Siedlung aus Hütten, Holzverschlägen und Bretterbuden, die von anderen »Illegalen« errichtet worden war. Plakate am Zaun kündigten an, dass auf dem Gelände einmal das Wohnviertel »Beautiful Tuscany« entstehen werde. Nach langen und schwierigen Verhandlungen gelang es meinem Vater, sein Moped und unseren Fernseher gegen eine der Hütten samt Essgeschirr, drei Töpfen und einer Pfanne einzutauschen.
Unsere neue Behausung bestand aus einem Raum mit sandigem Boden, in dem gerade mal unsere vier Schlafmatten und die Feuerstelle Platz fanden. Durch die Löcher in den Bretterwänden konnte Thida ihre Finger stecken, das Dach leckte bereits beim ersten kurzen Schauer. Die einzige Toilette in der Siedlung, eine notdürftig ausgehobene Grube mit Plastikplane drum herum, lag nicht weit entfernt. Tag und Nacht erfüllte der Gestank von Scheiße und Abfällen die Luft. Fließendes Wasser mussten wir mit Eimern und Kanistern aus einem Kanal zwei Straßenblöcke entfernt holen.
Trotzdem waren wir erleichtert: Wir hatten wieder ein Zuhause.
Meine Schwester und ich trieben uns von morgens bis abends auf dem Gelände herum und hatten nichts zu tun. Wir waren es gewohnt, Zeit miteinander zu verbringen. Im Garten der Benz hatte sie mir hin und wieder bei der Arbeit geholfen. Ich hatte ihr gezeigt, wie man Gras mit der Schere schneidet, Unkraut jätet oder einen Palmenstamm hochklettert, wie man das Geisterhaus sauber macht und Blumen und frisches Wasser hinstellt, ohne den Bewohner zu stören. Jetzt saßen wir stundenlang im Schatten der Werbewände für »Beautiful Tuscany« und spielten mit Murmeln, die sie gegen ihre Haarspangen eingetauscht hatte.
Bevor ich mein Handy verkaufen musste, hatten wir uns noch mit Videos ablenken können. Mich von meinem Telefon zu trennen war mir schwergefallen. Sechs Monate hatte ich darauf gespart. Dass ich nicht mehr telefonieren konnte, war nicht so schlimm, es gab sowieso niemanden, den ich anrufen wollte. Aber das Handy war mehr als ein Telefon, es war mein Fenster zur Welt gewesen und gleichzeitig mein Versteck. Mithilfe der kleinen weißen Knöpfe in meinem Ohr hatte ich mich zurückziehen und zum ersten Mal in meinem Leben nur das hören können, was ich auch hören wollte.
Thida und ich sollten lernen, dass das Leben in einer Siedlung (ich nenne sie so, weil ich den Ausdruck »Slum« nicht mag) der Armen und »Illegalen« nicht nur langweilig, sondern auch voller böser Überraschungen war. Nach zwei Tagen stahlen Diebe in der Nacht einen unserer Töpfe. Drei Nächte später das Mobiltelefon meiner Mutter. Die meisten Bewohner begegneten sich mit Misstrauen und Argwohn. Es gab eine Art Chef in der Siedlung, den dicken Bagura. Er hatte rote Zähne, einen weißen Bart und lange Haare und saß den ganzen Tag schwitzend und Betelnüsse kauend vor seiner Hütte. Hin und wieder kratzte er sich zwischen den Beinen und rülpste laut. Er hatte immer ein großes Taschentuch in der Hand, mit dem er sich entweder den Schweiß von der Stirn wischte oder die ständig verstopfte Nase schnäuzte, manchmal auch beides hintereinander. Zu ihm kamen die Menschen, wenn sie in ihrer Not eines der wenigen Dinge, die sie noch besaßen, verkaufen wollten, um etwas Essbares zu besorgen. Ihr Mobiltelefon zum Beispiel. Einen goldenen Ohrring. Einen Nasenstecker.
Bagura hatte eine Frau, die noch dicker war als er selbst. Außerdem zwei Söhne, Yuri und Taro, die die Verhandlungen führten und von allen gefürchtet wurden, weil sie auch die niedrigsten Preise noch drückten.
Bagura vermittelte, wenn es Streit gab. Aus mir nicht bekannten Gründen wagte es niemand, sich seinen Entscheidungen zu widersetzen. Ich mochte weder ihn noch seine Söhne und machte einen großen Bogen um sie. Es hieß, sie hätten überall ihre Spione und nichts, was in der Siedlung geschehe, bliebe lange vor ihnen geheim. Viele glaubten, Bagura habe gute Kontakte zur Polizei, deshalb würden uns die Behörden in Ruhe lassen. Dafür dankte ihm angeblich jede Familie wöchentlich mit ein paar Münzen, einer halben Tasse Reis oder Zigaretten. Ich habe meinen Vater nie gefragt, ob das stimmte und ob auch er Bagura bezahlte.
Die Siedlung wurde mit jeder Woche voller. In manchen Hütten lebten nun zwei oder sogar drei Familien, an den Rändern entstanden neue Verschläge aus Brettern, Wellblech oder Plastikplanen. Der »Krieg gegen den Virus« war in seine nächste Phase getreten, hatte die Regierung erklärt. Sie verfügte, dass die Menschen ihre Wohnungen und Häuser nur noch zum Einkaufen und in Notfällen verlassen durften und dabei mindestens eineinhalb Meter Abstand zueinander halten sollten.
Die Vorschriften zu befolgen war für uns schwierig. In der Siedlung standen die Hütten Wand an Wand, kaum ein Gang dazwischen war mehr als einen Meter breit. Und die Hütten waren gerade mal groß genug, um darin zu schlafen, wie sollten wir dort einen ganzen Tag verbringen? Von Wochen ganz zu schweigen. Aber da »Beautiful Tuscany« von einem hohen Bauzaun umgeben war, mussten wir anfangs wenig Angst vor den Behörden haben. Wir dachten, solange wir unter uns blieben, interessierte es niemanden, ob wir uns an die Regeln hielten.
Im Land waren nun alle Baustellen, Restaurants, Hotels, Pensionen, Fabriken und Geschäfte geschlossen, abgesehen von Lebensmittelläden und Drogerien. Es gab keine dreckigen Teller und Töpfe mehr, die die »Illegalen« hätten waschen können. Keine billigen T-Shirts zu nähen. Keine Hotelzimmer zu putzen, keine Wäsche zu bügeln. Die Reichen entließen ihre Kindermädchen, Köchinnen, Fahrer und Gärtner. Wer keine Verwandten hatte, flüchtete in eine der Siedlungen, die, wie Bagura erzählte, in Parks, unter Brücken, am Flussufer und am Rande des Flughafens entstanden.
Für meinen Vater waren die ärmlichen Umstände, in denen wir lebten, die Folge unseres Karmas. Wir mussten in unserem vorherigen Dasein die Gebote des Buddha grob missachtet haben, um mit so einem Schicksal bestraft zu werden. Das hatte ich auch von den Mönchen in der Klosterschule gelernt, aber es fiel mir trotzdem schwer zu verstehen, was das Karma meiner kleinen Schwester mit ihrem Hunger zu tun haben sollte. Ich konnte mir Thida nur als Thida vorstellen, und die war so lieb, großzügig und sanftmütig, dass sie immer alles teilte und nicht einmal Spinnen, vor denen sie sich ekelte, etwas zuleide tat. Sie hatte dieses Elend nicht verdient.
In jener Nacht lag ich neben ihr, hörte ihr Wimmern und überlegte, wo ich etwas zu essen für sie finden konnte. In den Wochen zuvor hatten hin und wieder Lastwagen in der Nähe der Siedlung gehalten, vom Roten Kreuz, von Kirchen, der UN oder irgendeiner internationalen Hilfsorganisation, deren Namen mir nichts sagte. Auf den Ladeflächen hatten Frauen und Männer gestanden und Pakete mit Reis, Nudeln, Mehl, Fertigsuppen und Wasserflaschen in die Menge geworfen. Die Nachricht hatte sich in Windeseile von Hütte zu Hütte verbreitet, und wer noch dazu in der Lage war, rannte so schnell er konnte hin.
Um die Lastwagen herum bildeten sich Pulks aus Menschen, die bittend und fordernd ihre Hände in die Höhe reckten, es wurde gestoßen, geschubst und geflucht. Ich kam jedes Mal zu spät. Entweder war das Essen bereits verteilt, oder die Wohltäter warfen nicht weit genug, oder aber jemand fischte das Paket, das genau auf mich zuflog, kurz vor mir aus der Luft. Mit leeren Händen kehrte ich nach Hause zurück. Was machte ich falsch? Nahm ich am falschen Ort zur falschen Zeit zu viel Rücksicht? War ich einfach noch nicht hungrig genug? Aber meine Schwester war es, und dass es mir nicht gelang, etwas für sie zu ergattern, beschämte mich. Von dieser Art der Armenspeisung würde ich kein Essen mit nach Hause bringen, außerdem war nie sicher, ob und wann der nächste Wagen kommen würde, seit Tagen war keiner mehr da gewesen.
Wo sonst konnte ich etwas gegen Thidas Hunger auftreiben? Ich dachte an den Keller im Haus der Familie Benz, dort gab es einen Vorratsraum, größer als unsere Hütte. Ich hatte meiner Mutter einige Male Reis, Nudeln, Öl oder Konservendosen von dort in die Küche gebracht.
Ich müsste stehlen. Zum Dieb werden. Konnte ich das? Als kleiner Junge hatte ich auf dem Markt bei dem netten alten Inder, der uns Kinder oft mit einer Süßigkeit verwöhnte, mal einen Zuckerrohrbonbon mitgehen lassen. Er hatte es nicht bemerkt und mir beim Abschied noch freundlich nachgewinkt. Später hatte ich ein so schlechtes Gewissen, dass ich am nächsten Tag das Geld für den Bonbon heimlich auf seinen alten Holztresen legte. Nicht die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Dieb.
Aber jetzt war es etwas anderes. Ich würde nicht für mich stehlen, sondern für meine Schwester. Die Benz hatten mehr als genug, und ich könnte ihnen das Gestohlene später, wenn die Krise vorüber war und mein Vater und ich wieder Arbeit hatten, zurückgeben. Ich würde mir die Lebensmittel sozusagen nur ausleihen.
Ich bezweifelte, dass die Benz einen neuen Wachmann hatten. Durch das Tor zu schlüpfen oder über den Stacheldraht zu klettern war trotzdem unmöglich. Doch ich kannte die Stelle hinter den Büschen nahe der Außenmauer, an der ihre beiden Hunde immer wie von Sinnen buddelten. Irgendetwas dort zog sie an, sie wühlten den Boden auf und gruben bis unter das Fundament der Mauer. Mehrmals hatte ich die Löcher wieder zuschütten müssen. Dieser Teil des Gartens grenzte an ein unbebautes, überwuchertes Grundstück, zu dem man unbeobachtet gelangen konnte. Wenn ich an der richtigen Stelle grub, dürfte es nicht lange dauern, bis ich unter der Mauer durch war. Auf der Rückseite der Villa gab es einen vergitterten Kellereingang, und ich wusste, wo Joe, der Sohn der Benz, einen Schlüssel versteckte, für den Fall, dass er nachts spät heimkam und nicht den Haupteingang benutzen wollte. Vor den Hunden würde ich keine Angst haben müssen, die kannten mich ja.
Mein Entschluss stand fest. Ich erhob mich, nahm meine Flip-Flops, stieg über meine schlafenden Eltern und schlich aus der Hütte. Wenn nichts schiefging, würde ich noch vor Sonnenaufgang zurück sein.
2
Mir war klar, dass ich ein nicht zu unterschätzendes Risiko einging. Jedem, der trotz Ausgangssperre zwischen zweiundzwanzig Uhr und sechs Uhr ohne Sondergenehmigung auf der Straße aufgegriffen wurde, drohte eine hohe Geldstrafe. Und wer nicht zahlen konnte, kam ins Gefängnis. In den besseren Gegenden der Stadt patrouillierten angeblich sogar Soldaten und schossen auf jeden Verdächtigen.
Von unserer Siedlung zum Haus der Benz war es auf direktem Weg vielleicht eine knappe Stunde zu Fuß. Aber die breiten, hell erleuchteten Boulevards und Hauptstraßen musste ich meiden, einigermaßen sicher war ich nur in den kleinen dunklen Straßen und Gassen. Die wolkenlose Nacht mit einem fast vollen Mond am Himmel machte meine Aufgabe nicht leichter.
Als Werkzeug zum Graben nahm ich ein Stück rostiges Wellblech mit, stieg durch ein Loch im Bretterzaun und schlich auf die Straße. Die Stille dort war unheimlich.
Zunächst begegnete ich außer streunenden Katzen und Hunden, die einen weiten Bogen um mich machten, niemandem. Nach einigen Minuten stand ich an der Ecke zur »Avenue der Patrioten«, einer achtspurigen Straße mit so vielen Lichtern und Laternen, dass man jede Kakerlake auf dem Asphalt sah. An manchen Tagen stauten sich hier selbst um Mitternacht die Autos, jetzt lag die Avenue so verlassen da, als wären alle Menschen aus der Stadt geflohen. Sie musste ich überqueren und mindestens fünfhundert Meter hinunterlaufen, bis ich in die nächste Gasse einbiegen konnte.
Geduckt und mit eiligen Schritten, lief ich an der Mauer eines Hotels entlang, schlich an geschlossenen Geschäften vorbei und wollte gerade quer über die Straße rennen, als ich aus der Ferne Sirenen und Motorengeräusche hörte. Ich schaute mich ängstlich um. Nirgends parkten Autos oder Garküchen, hinter denen ich mich hätte verstecken können. Der Lärm kam näher. Ich kroch unter die Sitzbank einer Bushaltestelle, legte mich flach auf die Erde und umklammerte mit beiden Händen den Metallfuß, als würde der mich schützen können. Bei dem Gedanken an die Sorgen, die ich meiner Mutter bereiten würde, wenn mich Soldaten aufgriffen, wurde mir ganz schlecht. Zwei Polizeiautos rasten mit Blaulicht an mir vorbei, gefolgt von drei-vier-fünf Lastwagen der Armee. Selbst als sie schon lange außer Sicht und die Sirenen verhallt waren, rührte ich mich nicht. Mein Körper war steif vor Angst. Ich überlegte kurz umzukehren, doch die Erinnerung an den Hunger meiner kleinen Schwester trieb mich weiter.
Erst als ich das Stadtviertel erreichte, in dem die Villa der Benz lag, fühlte ich mich sicherer. In diesen Straßen kannte ich mich gut aus, sie waren nicht zu breit und nur schwach beleuchtet. Hier parkten Autos, unter die ich im Notfall kriechen konnte. Durch das schwarze Gittertor der Benz sah ich im fahlen Licht des Mondes den Banyanbaum und das Geisterhaus und dachte wehmütig daran, wie gut wir es einmal gehabt hatten. Ich schlich weiter zu dem angrenzenden leeren Grundstück. Zwei Palmen und die Zweige der Bougainvillea, die über die Mauer ragten, markierten die Stelle, nach der ich suchte. Die Erde war weich und feucht, ein heftiger Regenschauer hatte gestern den Beginn des Monsuns angekündigt. Das Stück Blech leistete mir beim Graben gute Dienste, es half, Wurzeln zu durchtrennen und die Erde aus dem größer werdenden Loch zu schaufeln. Die untersten Steine lagen eine Armlänge unter der Erde, schwitzend grub ich weiter, und es dauerte mindestens eine halbe Stunde, bevor meine Hände auf der anderen Seite durchbrachen. Eine weitere halbe Stunde später hatte ich das Loch so weit verbreitert, dass ich hindurchkriechen konnte.
Die Villa lag im Schein von Laternen, um die Insekten schwirrten. Sie war weiß, zwei Stockwerke hoch, und von der Dachterrasse reichte der Blick weit über die Stadt bis hinunter zum Fluss. Eine weite Auffahrt führte zum überdachten, von Säulen umrahmten Haupteingang. Angeblich hatte ein amerikanischer Geschäftsmann sie sich zu Beginn des vorigen Jahrhunderts als eine kleine Version des Weißen Hauses bauen lassen.
Ich kroch an den überbordenden Hibiskussträuchern und Bambusbüschen entlang, hastete über den schon lange nicht mehr geschnittenen Rasen und verschwand im Treppeneingang des Kellers. Der Schlüssel lag hinter einem losen Stein in der Hauswand. Lautlos schloss ich auf und schlüpfte hinein. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Mit den Fingerspitzen an der Wand, tappte ich durch die Dunkelheit. Erinnerte ich mich richtig, lagen hinter den ersten beiden Türen zwei Abstellräume, gefolgt von der Waschküche, dahinter war die Vorratskammer.
Tür für Tür arbeitete ich mich vor, öffnete die vierte einen Spalt, trat rasch ein und schloss sie wieder. Ich holte einige Male tief Luft und tastete mit beiden Händen die Wand ab, bis ich den Lichtschalter fand. Was ich im Schein der Lampe sah, schien mir wie ein Traum: Bis unter die Decke stapelten sich Reissäcke, Kartons voller Nudeln, Mehl, Zucker, Salz, Flaschen mit verschiedenen Ölen, Fischsoße, Sojasoße, Gewürze, Eier, Gemüse. Ich entdeckte Nudeln und Mineralwasser aus Italien, Marmeladen aus England, Bier aus Deutschland, kistenweise Weine aus Frankreich und Australien. Die Benz hatten Vorräte angelegt, die für die Familie mehrere Jahre reichen würden.
In diesem Moment hörte ich in meinem Kopf die Stimme des Abtes: »Du sollst nicht stehlen. Der Buddha verbietet es.« Ich sah ihn vor mir sitzen: seinen kahl geschorenen Kopf, die wissenden Augen, das runde, von ersten Falten durchzogene Gesicht mit dem sanften Lächeln. Ein geduldiger Lehrer, der für vieles Verständnis hatte, aber nicht zuließ, dass einer seiner Schüler die Gebote des Buddha missachtete. Fast zehn Jahre lang war ich in der Klosterschule sein gelehriger Schüler gewesen. Niemals würde er gutheißen, was ich jetzt tat.
In Gedanken begann ich, ihm zu widersprechen: Meine kleine Schwester weint vor Hunger. Meine Mutter ist krank. Wir haben nicht genug Geld, um einen kleinen Sack, ja nicht einmal einen Becher Reis zu kaufen. Von Medikamenten ganz zu schweigen. Es gibt keine Arbeit für mich oder meinen Vater, sei sie noch so dreckig und schlecht bezahlt. Ich würde den Rasen der Reichen mit einer Nagelschere schneiden, bis ich Blasen an den Fingern hätte. Ich würde mit bloßen Händen ihre Toiletten putzen, wenn sie mich ließen.
Zögernd wuchtete ich einen Zehn-Kilo-Sack Reis aus dem Regal. Eine Flasche Öl. Zwei Packungen Eier. Nudeln. Erst jetzt fiel mir ein, dass ich gar nicht wusste, wie ich all das tragen sollte. Auf einmal hörte ich Geräusche. Eine Tür knarrte. Mit vorsichtigen Schritten kam jemand die Treppe heruntergeschlichen. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen, hielt die Luft an, suchte in der Kammer nach einem Versteck. Die Geräusche kamen näher, um zu fliehen, selbst um das Licht auszumachen, war es zu spät.
Ich saß in der Falle.
Jemand drückte von außen ganz langsam die Klinke herunter und öffnete die Tür.
Vor mir stand Mary.
Sie neigte den Kopf leicht zur Seite, wie sie es schon als Kind immer getan hatte. »Was machst du hier?« Sie klang neugierig, nicht überrascht.
Sofort bekam ich Herzklopfen. Wie früher. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Vier lange Jahre hatten wir kein Wort mehr miteinander gewechselt. Vier Jahre hatte ich ihre Stimme höchstens einmal aus der Ferne gehört und nicht geglaubt, dass wir uns je wieder so nah gegenüberstehen würden.
»Ich habe dich von meinem Fenster aus beobachtet. Wie bist du über die Mauer gekommen?« Sie humpelte in den Raum und schloss die Tür. Ihren roten, mit Blumen bestickten Bademantel hatte sie mit einem Doppelknoten zugebunden, ihre langen schwarzen Haare hochgesteckt.
»Nicht über die Mauer, drunter durch.«
Sie betrachtete meine dreckverschmierten Arme und Hände und zog anerkennend die Augenbrauen hoch. »Nicht schlecht. Aber du hättest dich ein bisschen sauber machen sollen. Du hinterlässt überall Spuren.« Sie deutete auf den Schmutz an der Leiter und den Regalen, die ich berührt hatte.
Ich schwieg beschämt. Mein Aussehen war mir unangenehm. Der Schmutz an meinem Körper, dem T-Shirt, dem Longi stammte nicht nur vom Graben, ich hatte mich seit Wochen nicht richtig waschen oder duschen oder wenigstens die Zähne putzen können. Vermutlich stank ich fürchterlich.
»Wie hast du die Tür aufbekommen?«
»Ich weiß, wo dein Bruder den Schlüssel versteckt.«
»Du hast Glück gehabt. Mein Vater lässt gerade eine Alarmanlage einbauen. In ein paar Tagen hätte das Heulen der Sirenen die ganze Nachbarschaft geweckt.«
»Warum sitzt du mitten in der Nacht am Fenster?«
»Weil mir langweilig ist. Weil ich nicht schlafen kann, warum sonst? Hattest du keine Angst, erschossen zu werden? Ich dachte, es herrscht eine strenge Ausgangssperre.«
»Ich glaube nicht, dass sie auf jeden schießen, der nachts auf der Straße unterwegs ist.«
»Oh doch. Bei uns im Viertel gibt es eine Einbruchsserie. Hast du auf Facebook nichts darüber gelesen? Viele Häuser sind leer, weil die Leute vor dem Virus in ihre Ferienhäuser ans Meer geflohen sind. Gestern hat die Polizei einen Taxifahrer erschossen, der mitten in der Nacht die ›Avenue der Patrioten‹ entlanglief. Sie hielten ihn für einen Plünderer. Du hast Glück gehabt. Wie ist es da draußen?«
»Unheimlich.«
Sie musterte mich. »Du bist ganz schön mutig.«
Die Bewunderung in ihrer Stimme tat mir gut. Aber vielleicht bildete ich sie mir auch nur ein.
Mary und ich waren fast gleich alt. Sie war vor einigen Wochen achtzehn geworden, ich bereits vor ein paar Monaten. Als Kinder hatten wir viel Zeit miteinander verbracht. Selbst als wir zur Schule kamen, sie auf eine Privatschule, wohin sie ein Fahrer brachte und abholte, ich auf die Klosterschule, änderte sich daran nichts. Jeden Nachmittag stand ich am Tor und wartete geduldig auf ihre Rückkehr. Sobald sie mich sah, sprang Mary aus dem Wagen und rannte zu mir. Sie kam, anders als ihr Bruder, fast jeden Tag zu uns in den Bungalow. Ich half ihr bei den ersten Rechenaufgaben, sie mir beim Lesen und Schreiben.
Wie Bruder und Schwester seien wir gewesen, hatten meine Eltern einmal mit einem Anflug von Wehmut gesagt.
Ich erinnerte aber auch noch, wie Mary plötzlich kaum noch Zeit für mich hatte. Wie sie von Woche zu Woche weniger mit mir sprach. Wie ihre Mutter von mir verlangte, sie nicht mehr Narong, sondern Mary zu nennen, weil das in der Schule alle taten. Ich erinnerte, wie sie mir aus dem Wagen verstohlen zuwinkte, statt auszusteigen. Wie ich nach der Schule vergeblich am Tor auf sie wartete – und wie furchtbar weh das tat. Wie verlassen von ihr ich mich fühlte. Es gab niemanden, der mir erklärte, was geschehen war, ich blieb allein mit der Frage, was ich verbrochen hatte, um diese Strafe zu verdienen. Kein Mensch, dachte ich, verliert seine beste Freundin ohne Grund.
An den Nachmittagen schlich ich um die Villa, in der Hoffnung, sie möge nach den Schularbeiten, der Klavierstunde oder was immer sie da drinnen tat, herauskommen und mit mir spielen. Oder wenigstens einen Blick aus dem Fenster werfen. Aus der Ferne beobachtete ich sie beim Tennisspielen mit ihrem Bruder, der nun Joe statt Yakumo hieß, und war glücklich, wenn er nach mir rief, damit ich für sie in die Büsche kroch und die Bälle holte. So war ich wenigstens in ihrer Nähe. Ich wollte sie fragen, was ich falsch gemacht hatte, doch es ergab sich keine Gelegenheit mehr, mit ihr allein zu sein.
Eines Tages gab mir meine Mutter einen Brief von ihr. Ich erinnere genau, dass ich mich damit in eine weit abgelegene Ecke des Gartens zurückzog und ihn mit vor Aufregung zitternden Fingern öffnete. Er war vier eng beschriebene, mit Blumen verzierte Seiten lang.
Mary wollte wissen, was ich machte. Wie es mir ging. Sie schrieb von den trostlosen Nachmittagen, die sie allein auf ihrem Zimmer verbrachte, und wie sehr sie mich vermisste. In langen, komplizierten Sätzen fragte sie mich, ob es mir ähnlich gehe, und entschuldigte sich, dass sie mich so oft ignorierte. Sie tat das nicht freiwillig. Ihre Eltern hatten sie schon zu Schulbeginn ermahnt, weniger mit mir zu spielen, und es ihr später ganz verboten. Es sei Zeit, neue Freunde zu finden, sagten sie. Wir seien bald zwölf Jahre alt und keine kleinen Kinder mehr, die Zeit des Spielens sei vorbei.
Am Ende schlug sie vor, dass wir uns einmal heimlich treffen. Früher hatten wir ein Versteck gehabt, eine Höhle, selbst gebaut aus Zweigen, Ästen, Stöcken, vertrockneten Palmenblättern. Sie lag direkt an der Mauer im hintersten Winkel des Grundstücks, wohin sich selbst die Hunde selten verirrten.
Ich wartete einen halben Nachmittag, und gerade als ich gehen wollte, hörte ich ein Rascheln im Gebüsch. Als wir uns sahen, wussten wir beide, dass es nicht bei diesem einmaligen geheimen Treffen bleiben würde.
Dem ersten Wiedersehen folgte ein zweites und ein drittes, und bald wartete ich wieder jeden Tag auf sie. Oft vergeblich, das machte aber nichts, umso mehr freute ich mich, wenn sie plötzlich vor mir stand. Ich hatte nichts anderes zu tun, und wenn ich sie zwei- oder dreimal in der Woche sah, genügte mir das. Ihre Nachmittage waren gefüllt mit Klavierunterricht, Reitstunden, Tennisunterricht, Hausaufgaben, Besuchen von Großeltern, Tanten und Cousinen, es war nicht leicht für sie, sich heimlich davonzustehlen.
Wenn wir uns trafen, hatte sie etwas zu essen und zu trinken dabei, wir lagen in unserem Versteck, und sie erzählte von der Schule, von den Lehrerinnen und Mitschülerinnen. Sie klagte über ihre Eltern, die bei Tisch nach dem Gebet für den Rest der Mahlzeit schwiegen, über ihren Bruder, der sie entweder ärgerte oder ignorierte, über die quälend langweiligen Gottesdienste am Sonntag.
War ihre Mutter nicht zu Hause, hatten wir mehr Zeit, und sie brachte für mich Bücher und für sich einen Zeichenblock und Stifte mit. Mary liebte es zu malen. Mit wenigen Strichen zauberte sie eine Blume, eine Palme, einen Käfer auf das Papier. Entweder zeichnete sie frei aus dem Kopf, oder ich holte eine Blüte, einen Zweig, einen toten Schmetterling als Vorlage für sie aus dem Garten. Manchmal saß sie mit dem Stift in der Hand so versunken vor mir, dass sie alles um sich herum vergaß.
Das waren Momente, in denen ich sie beneidete.
Wir verbrachten die Stunden ohne viele Worte. Wir lagen nebeneinander, malten, lasen oder schauten Kopf an Kopf einfach nur durch ein Loch im Dach in den Himmel. In der Gegenwart des anderen war die Welt rund. Mehr brauchten wir nicht.
Eine Woche vor ihrem vierzehnten Geburtstag entdeckte die Familie das Versteck. Ihr Bruder hatte zufällig gesehen, wie sie sich mit einem Picknickkorb aus dem Haus schlich, und war ihr bis zu unserer Höhle gefolgt. Mary hatte ihn angefleht, den Eltern nichts zu verraten, doch Joe hatte beim Abendessen alles erzählt. Am nächsten Morgen bestellte Mister Benz meinen Vater in sein Büro. Er forderte ihn auf, unverzüglich dafür zu sorgen, dass der Kontakt zwischen mir und seiner Tochter zukünftig unterblieb. Sollte ich gegen diese Anordnung auch nur ein einziges Mal verstoßen, müsste sich die Familie, so leid es ihnen nach all den Jahren auch täte, nach einem anderen Wachmann und einer anderen Köchin umschauen.
Mein Vater sprach so ernst zu mir wie nie zuvor. Ich musste ihm fest versprechen, Mary in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Das Schicksal unserer Familie hing von mir ab.
Acht Tage später sah ich Mary fü