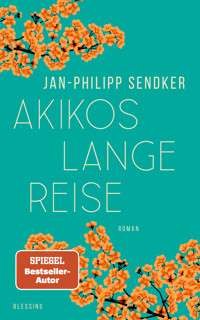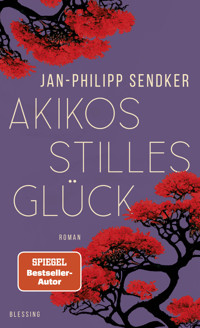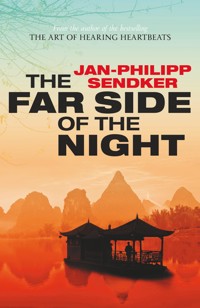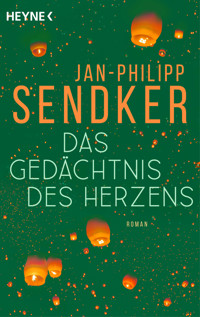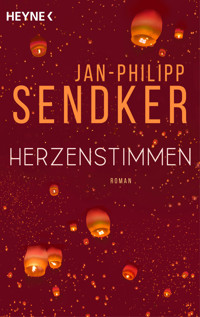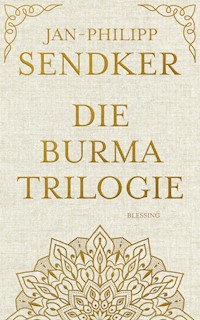
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief ihres Vaters an eine unbekannte Frau hat Julia Win, eine erfolgreiche New Yorker Rechtsanwältin, nach Kalaw, ein malerisches, in den Bergen Burmas verstecktes Dorf geführt. Doch statt den vermissten Vater trifft Julia hier auf ihren Bruder, von dem sie nichts wusste, und stößt auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändert - und Burma wird für Julia zu einem Ort, an dem sie sich selbst, den Frieden und schließlich die große Liebe findet.
In Das Herzenhören, Herzenstimmen und Das Gedächtnis des Herzens erzählt Jan-Philipp Sendker die epische Geschichte einer jungen Frau, die lernt, dass man nicht mit den Augen sieht, Entfernungen nicht mit Schritten überwindet und Schmetterlinge an ihrem Flügelschlag erkennen kann. Die Burma-Trilogie versammelt diese Romane zum ersten Mal in einem Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Die dreiteilige, epische Geschichte einer jungen Frau, die auf der Suche nach ihrem Vater einen Bruder, die große Liebe und schließlich sich selbst findet.
Auf der Suche nach ihrem vermissten Vater reist Julia Win, eine erfolgreiche New Yorker Rechtsanwältin, nach Kalaw, ein malerisches, in den Bergen Burmas verstecktes Dorf. Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief ihres Vaters an eine unbekannte Frau hat sie an diesen magischen Ort geführt. Das Licht, die Gerüche, und vor allem die Menschen sind ihr vollkommen fremd, doch hofft sie, hier Hinweise auf ihren Vater zu finden. Stattdessen trifft sie auf ihren Halbbruder U Ba, von dem sie bisher nichts gewusst hat, und stößt auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändern wird.
Zehn Jahre später erreicht Julia ein rätselhafter Brief U Bas und eine fremde, innere Stimme beginnt zu ihr zu sprechen. Bald erkennt sie, dass sie noch einmal zurück muss, um dem Geheimnis dieser Stimme auf den Grund zu gehen und die Quelle ihres persönlichen Glücks wiederzuentdecken.
Über U Ba lernt Julia Thar Thar kennen, einen jungen buddhistischen Mönch mit einer traumatischen Vergangenheit – der Anfang einer großen Liebe, die jedoch im Wirbel politischer Ereignisse zu zerbrechen droht …
DERAUTOR
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent des stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des alten Mönches (2017), Das Gedächtnis des Herzens (2019) und Die Rebellin und der Dieb (2021). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 3 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.
JAN-PHILIPP
SENDKER
DIE
BURMA
TRILOGIE
BLESSING
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2022 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: geviert.com, Christian Otto
Umschlagabbildung: © Shutterstock.com
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28943-0V001
www.blessing-verlag.de
Für
Anna, Florentine, Theresa und Jonathan
und
zum Gedenken an Vivien Wong
(1969–2000)
Inhalt
Das Herzenhören
Auszüge aus U Bas Tagebuch
Dezember 1996 – Januar 2000
Herzenstimmen
Auszüge aus U Bas Tagebuch
Dezember 2006 – Januar 2007
Das Gedächtnis des Herzens
Nachwort
DAS HERZENHÖREN
ERSTER TEIL
1
Seine Augen waren mir als Erstes aufgefallen. Sie lagen tief in ihren Höhlen, und es war, als könne er den Blick nicht von mir lassen. Alle Gäste des Teehauses starrten mich mehr oder weniger unverhohlen an, aber er war der aufdringlichste. Als wäre ich ein exotisches Wesen, eines, das er zum ersten Mal sieht. Sein Alter konnte ich schlecht schätzen. Sein Gesicht war voller Falten, sechzig war er mit Sicherheit, vielleicht schon siebzig. Er trug ein vergilbtes weißes Hemd, einen grünen Longy und Gummisandalen. Ich versuchte ihn zu ignorieren und blickte mich im Teehaus um, einer Bretterbude mit ein paar Tischen und Hockern, die auf der trockenen, staubigen Erde standen. An einer Wand hingen alte Kalenderblätter, die junge Frauen zeigten. Ihre Gewänder reichten bis auf den Boden, und mit ihren langärmeligen Blusen, den hochgeschlossenen Kragen und ihren ernsten Gesichtern erinnerten sie mich an alte, handkolorierte Fotos von Töchtern aus gutem Hause um die Jahrhundertwende, wie man sie auf Flohmärkten in New York finden konnte. An der Wand gegenüber befand sich eine Vitrine mit Keksen und Reiskuchen, auf denen sich Dutzende von Fliegen niedergelassen hatten. Daneben stand ein Gaskocher mit einem verrußten Kessel, in dem das Wasser für den Tee kochte. In einer Ecke stapelten sich Holzkisten mit orangefarbener Limonade. Ich hatte noch nie in einer so erbärmlichen Hütte gesessen.
Es war brütend heiß, der Schweiß lief mir die Schläfen und den Hals hinab, meine Jeans klebte auf der Haut. Plötzlich stand der Alte auf und kam auf mich zu.
»Entschuldigen Sie vielmals, junge Frau, dass ich Sie so einfach anspreche«, sagte er und setzte sich zu mir. »Es ist sehr unhöflich, ich weiß, zumal wir uns nicht kennen oder zumindest Sie mich nicht kennen, nicht einmal flüchtig. Ich heiße U Ba und habe schon viel von Ihnen gehört, was aber mein Verhalten, ich gebe es zu, auch nicht höflicher macht. Ich vermute, es ist Ihnen unangenehm, in einem Teehaus, an einem fremden Ort, in einem fremden Land von einem Ihnen unbekannten Mann angesprochen zu werden, und ich habe dafür mehr als Verständnis, aber ich möchte, oder sollte ich ehrlicher sein und sagen, ich muss Sie etwas fragen. Ich habe auf diese Gelegenheit zu lange gewartet, als dass ich nun, da Sie da sind, schweigend vor Ihnen sitzen könnte.
Vier Jahre habe ich gewartet, um genau zu sein, und oft bin ich am Nachmittag auf und ab gegangen, dort, an der staubigen Hauptstraße, wo der Bus ankommt, der die wenigen Touristen bringt, die sich in unseren Ort verirren. Manchmal, wenn sich die Gelegenheit ergab, bin ich an den seltenen Tagen, an denen eine Maschine aus der Hauptstadt landet, zu unserem kleinen Flughafen gefahren und habe, vergeblich, Ausschau nach Ihnen gehalten.
Sie haben sich Zeit gelassen.
Nicht, dass ich Ihnen das vorwerfen möchte, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich bin ein älterer Mann, der nicht weiß, wie viele Jahre ihm noch gegeben sind. In unserem Land altern die Menschen schnell und sterben früh. Mein Leben neigt sich langsam, und ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die für Sie bestimmt ist.
Sie lächeln. Sie halten mich für übergeschnappt, für ein wenig verrückt oder zumindest sehr verschroben? Dazu haben Sie jedes Recht. Nur bitte, bitte, wenden Sie sich nicht ab. Das alles mag rätselhaft und sonderbar für Sie klingen, und ich gestehe ein, dass mein Äußeres nicht dazu angetan ist, Ihr Vertrauen zu erwecken. Ich wünschte, ich hätte strahlend weiße Zähne wie Sie und nicht diese braunen Stummel im Mund, die nicht einmal mehr zum Kauen richtig taugen, diese Trümmer eines Gebisses. Meine Haut ist welk und schlaff und hängt von meinen Armen, als hätte ich sie dort zum Trocknen abgelegt. Man sagt, ich stinke aus dem Mund, meine Füße sind schmutzig und zerschunden vom jahrzehntelangen Laufen in billigen Sandalen, mein Hemd, das einmal weiß war, hätte eigentlich schon vor Jahren in den Müll gehört. Glauben Sie mir, ich bin ein reinlicher Mensch, aber Sie sehen, in welchem Zustand sich unser Land befindet. Beschämend. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber ich kann es nicht ändern, und es hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet, zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Lassen Sie sich nicht von meiner äußeren Erscheinung in die Irre führen. Verwechseln Sie meinen Gleichmut nicht mit Desinteresse oder Resignation. Nichts läge mir ferner, meine Liebe.
Ich schweife ab, und ich sehe in Ihren Augen, dass ich Ihre Geduld strapaziere. Bitte, sehen Sie es mir nach, und wenden Sie sich nicht ab. Es wartet doch niemand auf Sie, habe ich recht? Sie sind allein gekommen, so wie ich es erwartet hatte. Geben Sie mir ein paar Minuten Ihrer Zeit. Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia.
Sie staunen? Ihre wunderschönen braunen Augen werden noch größer, und zum ersten Mal schauen Sie mich wirklich an. Sie sind erschrocken. Sie fragen sich, woher ich Ihren Namen weiß, da wir uns doch noch nie gesehen haben und Sie zum ersten Mal in unserem Land zu Gast sind? Kann es Zufall sein? Sie überlegen, ob ich vielleicht irgendwo ein Schild mit Ihrem Namen an Ihrer Jacke oder Ihrem kleinen Rucksack gesehen habe? Nein, habe ich nicht, glauben Sie mir. Ich kenne Ihren Namen, so wie ich den Tag und die Stunde Ihrer Geburt kenne, ich weiß um die kleine Jule, die nichts mehr liebte, als von ihrem Vater Geschichten erzählt zu bekommen, und ich könnte Ihnen hier und jetzt Jules Lieblingsmärchen erzählen. Die Geschichte vom Prinzen, der Prinzessin und dem Krokodil.
Julia Win. Geboren am 28. August 1968 in New York City. Mutter Amerikanerin. Vater Burmese. Ihr Familienname ist Teil meiner Geschichte, Teil meines Lebens, seit ich vor fünfundfünfzig Jahren aus dem Schoß meiner Mutter kroch, und in den vergangenen vier Jahren gab es keinen Tag, an dem ich nicht an Sie gedacht hätte. Ich werde Ihnen alles später erklären, aber lassen Sie mich zuerst meine Frage stellen: Glauben Sie an die Liebe?
Sie lachen. Wie schön Sie sind. Ich meine es ernst. Glauben Sie an die Liebe, Julia?
Selbstverständlich spreche ich nicht von dem Ausbruch an Leidenschaft, von dem wir meinen, er wird unser Leben lang nicht enden, der uns Dinge tun und sagen lässt, die wir später bereuen, der uns glauben machen will, dass wir ohne einen bestimmten Menschen nicht leben können, der uns vor Angst erzittern lässt bei dem Gedanken, wir könnten diesen Menschen wieder verlieren. Dieses Gefühl, das uns ärmer und nicht reicher macht, weil wir besitzen wollen, was wir nicht besitzen können, weil wir festhalten wollen, was wir nicht festhalten können. Ich meine auch nicht die körperliche Begierde und nicht die Eigenliebe, diesen Parasiten, der sich so gern als selbstlose Liebe tarnt.
Ich spreche von der Liebe, die Blinde zu Sehenden macht. Von der Liebe, die stärker ist als die Angst. Ich spreche von der Liebe, die dem Leben einen Sinn einhaucht, die nicht den Gesetzen des Verfalls gehorcht, die uns wachsen lässt und keine Grenzen kennt. Ich spreche vom Triumph des Menschen über die Eigensucht und den Tod.
Sie schütteln den Kopf? Daran glauben Sie nicht? Oh, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche? Das überrascht mich nicht, mir erging es ähnlich, bevor ich Ihren Vater traf. Warten Sie ab, Sie werden verstehen, was ich meine, sobald ich Ihnen die Geschichte erzählt habe, die ich seit vier Jahren für Sie mit mir herumtrage. Nur um ein wenig Geduld muss ich Sie bitten. Es ist spät geworden, und Sie sind sicherlich müde von der langen Reise. Ich für meinen Teil muss mit meinen Kräften haushalten und bitte um Ihr Verständnis, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Wenn es Ihnen genehm ist, sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit an diesem Tisch in diesem Teehaus wieder. Hier traf ich, wenn ich das noch erwähnen darf, Ihren Vater, und um ganz ehrlich zu sein, dort, auf Ihrem Schemel, hockte er und begann zu erzählen, und ich saß hier, auf diesem Platz, staunend, ja, ich gebe zu, ungläubig und verwirrt. Ich hatte noch nie einen Menschen so erzählen hören. Können Worte Flügel haben? Können sie wie Schmetterlinge durch die Luft gleiten? Können sie uns mitreißen, davontragen in eine andere Welt? Können sie uns erbeben lassen wie die Naturgewalten, die die Erde erschüttern? Können sie die letzten geheimen Kammern unserer Seele öffnen? Ich weiß nicht, ob Worte allein es vermögen, aber zusammen mit der menschlichen Stimme können sie es, Julia, und Ihr Vater hatte an diesem Tag eine Stimme, wie wir sie vielleicht nur einmal im Leben haben. Er erzählte nicht, er sang, und obwohl er flüsterte, gab es in diesem Teehaus keinen Menschen, dem nicht die Tränen kamen, allein vom Klang seiner Stimme. Aus seinen Sätzen wurde bald eine Geschichte und aus der Geschichte ein Leben, das seine Kraft entfaltete und seine Magie. Was ich hörte, machte mich zu einem Gläubigen, wie Ihren Vater.
›Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube.‹ Das sind die Worte Ihres Vaters.«
U Ba schaute mich an und erhob sich. Er legte die Hände vor der Brust aneinander, ohne sie zu falten, machte die Andeutung einer Verneigung und verließ mit ein paar schnellen, leichtfüßigen Schritten das Teehaus.
Ich blickte ihm nach, bis er im Gewühl der Straße verschwunden war.
Nein, wollte ich ihm hinterherrufen, nein, ich glaube an keine Kraft, die Blinde zu Sehenden macht. Ich glaube nicht an Wunder und nicht an Magie. Das Leben ist kurz, zu kurz, um Zeit mit solchen Hoffnungen zu verschwenden. Ich genieße es, wie es ist, anstatt mir Illusionen zu machen. Ob ich an die Liebe glaube? Was für eine Frage. Als wäre die Liebe eine Religion, an die man glaubt oder nicht. Als Achtzehnjährige habe ich von dem Prinzen geträumt, der kommt und mich rettet und befreit, und als er kam, musste ich lernen, dass es Prinzen nur im Märchen gibt und dass die Liebe blind macht und nicht sehend. Nein, wollte ich dem Alten hinterherrufen, ich glaube an keine Kraft, die stärker ist als die Angst, ich glaube nicht an einen Triumph über den Tod. Nein. Nein.
Stattdessen hockte ich auf meinem Hocker, zusammengesunken und eingefallen. Ich hörte noch immer seine Stimme, sie war weich und melodisch, in ihrer Sanftheit der meines Vaters nicht unähnlich. Seine Worte hallten in meinem Kopf wie ein Echo, das kein Ende nehmen will.
Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia, Julia, Julia …
Glauben Sie an die Liebe, an die Liebe …
Die Worte Ihres Vaters, Ihres Vaters …
Ich hatte Kopfschmerzen und fühlte mich erschöpft. Als wäre ich aus einem Albtraum erwacht, der nicht aufhörte, mich zu quälen. Um mich herum summten Fliegen, setzten sich auf meine Haare, meine Stirn und meine Hände. Mir fehlte die Kraft, sie zu verscheuchen. Vor mir lagen drei trockene Kekse, auf dem Tisch klebte brauner Zucker.
Ich wollte einen Schluck von meinem Tee trinken. Er war kalt, und meine Hand zitterte. Die Finger umklammerten das Glas, es glitt mir aus der Hand, langsam, wie in Zeitlupe konnte ich sehen, dass es rutschte, so kräftig ich auch drückte. Das Geräusch des zersplitternden Glases auf dem Fußboden. Die Blicke der anderen Gäste. Als hätte ich eine Schrankwand mit Gläsern umgestoßen. Warum hatte ich diesem Fremden so lange zugehört? Ich hätte ihn bitten können zu schweigen. Ich hätte ihm klar und unmissverständlich sagen müssen, er solle mich in Ruhe lassen. Ich hätte aufstehen können. Irgendetwas hielt mich. Ich hatte mich abwenden wollen, da sagte er: Julia, Julia Win. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich bei der Erwähnung meines Namens je so erschrecken würde. Mein Herz raste. Woher wusste er meinen Namen? Was wusste er noch von mir? Kannte er meinen Vater? Wann hatte er ihn zuletzt gesehen? Weiß er womöglich, ob mein Vater noch am Leben ist, wo er steckt?
2
Der Kellner wollte mein Geld nicht.
»Sie sind eine Freundin von U Ba. Seine Freunde sind unsere Gäste«, sagte er und verneigte sich.
Ich holte dennoch einen Geldschein aus meiner Hosentasche. Er war dreckig und abgegriffen, ich ekelte mich und schob ihn unter den Teller mit den Keksen. Der Kellner räumte das Geschirr ab, ohne den Schein zu berühren. Ich deutete auf das Geld, er lächelte nur.
War es ihm zu wenig, zu schmutzig oder nicht gut genug? Ich legte eine größere und saubere Note auf den Tisch. Er verbeugte sich, lächelte wieder und rührte sie nicht an.
Draußen war es noch heißer. Die Hitze lähmte mich, ich stand vor dem Teehaus, unfähig, einen Schritt zu tun. Die Sonne brannte auf meiner Haut, und das grelle Licht stach in den Augen. Ich setzte meine Baseballmütze auf und zog sie tief ins Gesicht.
Die Straße war voller Menschen, gleichzeitig herrschte eine seltsame Stille. Irgendetwas fehlte, und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was es war. Es gab kaum motorisierte Fahrzeuge. Die Menschen gingen zu Fuß oder waren mit dem Fahrrad unterwegs. An einer Kreuzung parkten drei Pferdekutschen und ein Ochsenkarren. Die wenigen Autos, die es zu sehen gab, waren alte japanische Pick-up-Trucks, zerbeult und verrostet, voll beladen mit großen Bastkörben und Säcken, an denen sich junge Männer festgeklammert hielten.
Die Straße war gesäumt von flachen, einstöckigen Holzbuden mit Wellblechdächern, wie ich sie aus dem Fernsehen von Slums in Afrika oder Südamerika kannte. Es waren Geschäfte, Kaufhäuser auf zehn Quadratmetern, die alles anboten von Reis, Erdnüssen, Mehl und Haarshampoo bis zu Coca-Cola und Bier. Die Ware lag wild durcheinander, es gab keine Ordnung oder aber eine, die mir fremd war.
Jeder zweite Laden schien ein Teehaus zu sein, die Gäste hockten auf kleinen Holzschemeln davor. Um den Kopf hatten sie sich rote und grüne Frotteehandtücher gewickelt, ein Kopfschmuck, der ihnen so selbstverständlich war wie mir meine dunkelblaue New-York-Yankee-Baseballmütze. Anstelle von Hosen trugen die Männer Gewänder, die wie Wickelröcke aussahen, und sie rauchten lange dunkelgrüne Zigarillos.
Vor mir standen ein paar Frauen. Sie hatten sich gelbe Paste auf Wangen, Stirn und Nase geschmiert und sahen aus wie Indianerinnen auf dem Kriegspfad, und jede paffte einen dieser stinkenden grünen Stummel.
Ich überragte sie alle um mindestens einen Kopf, auch die Männer. Sie waren schlank, ohne dabei hager zu wirken, und sie bewegten sich mit der Eleganz und Leichtigkeit, die ich an meinem Vater immer bewundert hatte. Dagegen fühlte ich mich fett und schwerfällig mit meinen sechzig Kilo und meiner Größe von 1,76.
Am schlimmsten waren ihre Blicke.
Sie wichen mir nicht aus, sie schauten mir direkt ins Gesicht und in die Augen und lächelten. Es war kein Lächeln, das ich kannte.
Wie bedrohlich ein Lachen sein kann.
Andere grüßten mit einem Kopfnicken. Kannten sie mich? Hatten sie alle, wie U Ba, auf meine Ankunft gewartet? Ich wollte sie nicht sehen. Ich wusste nicht, wie ich ihren Gruß erwidern sollte, und lief so schnell ich konnte die Hauptstraße hinunter, den Blick auf ein imaginäres Ziel in der Ferne gerichtet.
Ich sehnte mich nach New York, nach dem Krach und dem Verkehr. Nach den ernsten und abweisenden Gesichtern der Passanten, die aneinander vorbeilaufen, ohne einander zu beachten. Selbst nach dem Gestank der übervollen Mülltonnen an einem schwülen, stickigen Sommerabend sehnte ich mich. Nach irgendetwas Vertrautem, etwas, an dem ich mich festhalten konnte, das Schutz versprach. Ich wollte zurück an einen Ort, an dem ich mich zu bewegen und zu verhalten wusste.
Etwa hundert Meter weiter gabelte sich der Weg. Ich hatte vergessen, wo mein Hotel lag. Ich blickte mich um, suchte nach einem Hinweis, einem Schild vielleicht oder einem Detail am Straßenrand, einem Busch, einem Baum, einem Haus, an das ich mich vom Hinweg erinnerte und das mir die Richtung weisen könnte. Ich sah nur monströse lilafarbene Bougainvilleabüsche, die höher waren als die Hütten, die sich dahinter verbargen, sah vertrocknete Felder, staubige Bürgersteige und Schlaglöcher, so tief, dass sie Basketbälle verschlingen könnten. Wohin ich blickte, es sah alles gleich aus, fremd und unheimlich.
Sollte ich, Julia Win aus New York, der in Manhattan jede Straße, jede Avenue vertraut ist, sollte ich mich in diesem Kaff mit seinen drei Längs- und vier Querstraßen verlaufen haben? Wo waren mein Gedächtnis, mein Sinn für Orte, meine Souveränität, mit denen ich mich in San Francisco, Paris und London zurechtgefunden hatte? Wie konnte ich so leicht die Orientierung verlieren? Ein Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit kroch in mir hoch, wie ich es in New York noch nie empfunden hatte.
»Miss Win, Miss Win«, rief jemand.
Ich wagte kaum, mich umzudrehen, und blickte über die Schulter zurück. Hinter mir stand ein junger Mann, den ich nicht kannte. Er erinnerte mich an den Pagen im Hotel. Oder den Kellner im Teehaus. An den Kofferträger am Flughafen in Rangoon, an den Taxifahrer. Sie sahen alle gleich aus, mit ihren schwarzen Haaren, den tiefbraunen Augen, ihrer dunklen Haut und diesem unheimlichen Lächeln.
»Suchen Sie etwas, Miss Win? Kann ich Ihnen helfen?«
»Nein danke«, sagte ich, die dem Fremden misstraute und nicht auf seine Hilfe angewiesen sein wollte.
»Ja, mein Hotel, den Weg«, sagte ich, die sich nach nichts mehr sehnte als nach einem Versteck, und sei es das erst heute Morgen bezogene Hotelzimmer.
»Hier rechts den Berg hinauf, dann sehen Sie es. Keine fünf Minuten«, erklärte er.
»Danke.«
»Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit bei uns. Willkommen in Kalaw«, sagte er und ging weiter.
Im Hotel ging ich grußlos an der lächelnden Empfangsdame vorbei, stieg die schwere Holztreppe hinauf in den ersten Stock und sank auf mein Bett. Ich war erschöpft wie selten zuvor in meinem Leben.
Mehr als zweiundsiebzig Stunden war ich von New York nach Rangoon unterwegs gewesen. Anschließend hatte ich eine Nacht und einen halben Tag in einem alten Bus verbracht mit Menschen, die stanken und nichts am Leib trugen als schmutzige Röcke, verlumpte T-Shirts und zerschlissene Plastiksandalen. Mit Hühnern und quiekenden Ferkeln. Zwanzig Stunden Fahrt über Wege, die mit Straßen nichts gemein hatten. Ausgetrocknete Flussbetten waren das. Nur um von der Hauptstadt in diesen entlegenen Winkel zu gelangen. Warum?
Was machte ich in diesem Nest in den Bergen Burmas? Ich hatte hier nichts verloren und hoffte doch, etwas zu finden. Ich war auf der Suche, ohne wirklich zu wissen, wonach.
Ich musste geschlafen haben. Die Sonne war verschwunden, draußen dämmerte es, und mein Zimmer lag im Halbdunkel. Mein Koffer stand unausgepackt auf dem anderen Bett. Ich blickte durch den Raum, meine Augen wanderten hin und her, als müsste ich mich vergewissern, wo ich war. Über mir unter der mindestens vier Meter hohen Decke hing ein alter Holzventilator. Das Zimmer war groß, und die spartanische Einrichtung hatte etwas Klösterliches. Neben der Tür ein schlichter Schrank, vor dem Fenster ein Tisch mit einem Stuhl, zwischen den Betten ein kleiner Nachttisch. Die Wände waren weiß gekalkt, keine Bilder oder Spiegel, die alten Holzdielen des Fußbodens blank poliert. Einziger Luxus war ein koreanischer Minikühlschrank. Er war kaputt. Durch die offenen Fenster wehte kühlere Abendluft, die gelben Vorhänge bewegten sich im Wind, langsam und behäbig.
In der Abenddämmerung, mit ein paar Stunden Abstand, erschien mir die Begegnung mit dem alten Mann noch absurder und rätselhafter als am Mittag. Die Erinnerung daran war verschwommen und unklar. Bilder spukten mir durch den Kopf, Bilder, die ich nicht deuten konnte und die keinen Sinn ergaben. Ich versuchte mich zu erinnern. U Ba hatte weißes, volles, aber ganz kurz geschnittenes Haar und um den Mund ein Lächeln, von dem ich nicht wusste, was es bedeutete. War es höhnisch, spöttisch? Mitleidig?
Was wollte er von mir?
Geld! Was sonst. Er hat nicht danach gefragt, aber die Bemerkungen über seine Zähne und sein Hemd waren ein Hinweis, ich habe ihn wohl verstanden. Meinen Namen kann er vom Hotel bekommen haben, wahrscheinlich arbeitete er mit dem Empfang zusammen. Ein Trickbetrüger, der mich neugierig machen, mich beeindrucken wollte, um mir dann seine Künste als Wahrsager, Astrologe oder Handleser anzubieten. Ich glaube an nichts davon. Wenn der wüsste, wie er seine Zeit vergeudet.
Hat er mir etwas über meinen Vater verraten, was mich veranlassen könnte zu glauben, dass er ihn wirklich kennt? »Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube«, soll er zu ihm gesagt haben. Nie hätte mein Vater so einen Satz auch nur gedacht, geschweige denn ausgesprochen. Mit Sicherheit nicht einem Fremden gegenüber. Oder täuschte ich mich? War es nicht eher eine lächerliche Anmaßung meinerseits, zu denken, ich wüsste, was mein Vater gedacht oder gefühlt hat? Wie vertraut war er mir?
Wäre er sonst verschwunden, einfach so, ohne einen Brief zum Abschied? Hätte er seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter zurückgelassen ohne Erklärung, ohne Nachricht?
Seine Spur verliert sich in Bangkok, sagt die Polizei. Er könnte in Thailand beraubt und ermordet worden sein.
Oder wurde er am Golf von Siam Opfer eines Unfalls? Wollte er nur einmal zwei Wochen völlig ungestört sein, ist weiter an die Küste gefahren und beim Schwimmen ertrunken? Das ist die Version unserer Familie, die offizielle zumindest.
Die Mordkommission vermutete, dass er ein Doppelleben führte. Sie wollten meiner Mutter nicht glauben, dass sie nichts über die ersten zwanzig Jahre im Leben meines Vaters wusste. Sie hielten das für so ausgeschlossen, dass sie meine Mutter zunächst verdächtigten, bei seinem Verschwinden eine Rolle zu spielen, entweder als seine Komplizin oder als Täterin. Erst als feststand, dass es keine hoch dotierte Lebensversicherung gab und niemand von seinem möglichen Tod finanziell profitieren würde, lag auch nicht mehr der Schatten eines Verdachts auf ihr. Verbarg sich hinter dem Geheimnis der ersten zwanzig Lebensjahre meines Vaters eine Seite, die wir, seine Familie, nicht kannten? War er ein heimlicher Homosexueller? Ein Kinderschänder, der seine Lust in den Bordellen Bangkoks befriedigte?
Wollte ich das wirklich wissen? Wollte ich mein Bild von ihm, das des treuen Ehemanns, des erfolgreichen Anwalts, des guten und starken Vaters, der für seine Kinder da war, wenn sie ihn brauchten, wollte ich das befleckt sehen? Du sollst dir kein Bildnis machen. Als ob wir ohne leben könnten. Wie viel Wahrheit vertrage ich?
Was hat mich bis ans andere Ende der Welt getrieben? Nicht die Trauer, diese Phase ist vorüber. Vier Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe getrauert, aber ich merkte bald, dass der banale Satz stimmt: Das Leben geht weiter. Auch ohne ihn. Meine Freunde behaupteten, ich sei über die Sache, wie sie es nannten, schnell hinweggekommen.
Es ist auch nicht die Sorge, die mich suchen lässt. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass mein Vater noch am Leben ist oder, sollte ich mich täuschen, dass er mich braucht oder ich etwas für ihn tun könnte.
Es ist die Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Die Frage, warum er verschollen ist und ob sein Verschwinden mir etwas über ihn verrät, was ich nicht weiß. Kannte ich ihn so gut, wie ich glaube, oder war unser Verhältnis, unsere Nähe, eine Illusion? Diese Zweifel sind schlimmer als die Angst vor der Wahrheit. Sie werfen einen Schatten auf meine Kindheit, auf meine Vergangenheit, und ich beginne, meinen Erinnerungen zu misstrauen. Und sie sind das Einzige, was mir geblieben ist. Wer war der Mann, der mich großgezogen hat? Mit wem habe ich über zwanzig Jahre meines Lebens zusammengelebt? Wer war mein Vater wirklich?
3
Die letzte Erinnerung an ihn liegt vier Jahre zurück.
Es war der Morgen nach meinem Abschlussexamen. Ich schlief bei meinen Eltern im Haus meiner Kindheit in der 64. Straße auf der Ostseite Manhattans. Sie hatten mir ein Bett im ehemaligen Kinderzimmer bereitet, das nun als Gästezimmer diente. Wir hatten am Abend zuvor mein Examen gefeiert. Ich hätte auch zu mir gehen können, meine Wohnung auf der 2. Avenue liegt keine zehn Minuten vom Haus meiner Eltern entfernt, aber es war spät geworden, nach Mitternacht, und ich spürte den Champagner und den Rotwein. Wir hatten einen besonders schönen Abend gehabt, mein Bruder war aus San Francisco gekommen, mein Vater, der niemals Alkohol trank und Feste verabscheute, war ausgelassen wie selten, und ich hatte Sehnsucht nach meiner Familie bekommen, nach meinem alten Zimmer, den Gerüchen und Geräuschen meiner Kindheit. Einmal noch geweckt werden vom Geklapper des Geschirrs, wenn mein Vater, wie jeden Morgen kurz nach sechs, die Spülmaschine ausräumt und den Tisch deckt. Einmal noch den Geruch von frischem Kaffee und den aufgebackenen Zimtschnecken in der Nase spüren, die wir als Kinder so gerne aßen. Im Halbschlaf hören, wie er die Haustür öffnet, hinaustritt, die New York Times aufhebt und wieder hereinkommt, horchen, wie die schwere alte Holztür ins Schloss fällt und die dicke Zeitung mit einem schmatzenden Geräusch auf dem Küchentisch landet. Meine Universitätsjahre waren vorbei, etwas ging zu Ende, unwiderruflich. Ich wollte es festhalten, und sei es nur für eine Nacht und einen Morgen. Den Tag beginnen im Schutz der Rituale meiner Kindheit. Die Geborgenheit genießen. Einmal noch.
Als hätte ich etwas geahnt.
Mein Vater weckte mich früh. Durch die hellen Holzjalousien fiel dämmriges Licht, es muss kurz vor Sonnenaufgang gewesen sein. Er stand vor meinem Bett, trug seinen altmodischen grauen Mantel und einen braunen Borsalino. Als kleines Mädchen habe ich ihn so ins Büro gehen sehen. Damals stand ich jeden Morgen am Fenster, manchmal weinend, weil ich nicht wollte, dass er fortging, und winkte ihm hinterher. Selbst später, als sein Fahrer in der großen schwarzen Limousine auf ihn wartete und er nur die drei Schritte über den Bürgersteig gehen musste, trug er Mantel und Hut. In all den Jahren veränderte er seine Bürokleidung nicht, kaufte nur in regelmäßigen Abständen neue Mäntel und Hüte, ausschließlich Borsalinos; sechs besaß er davon, zwei schwarze, zwei braune und zwei dunkelblaue. Als er die Mäntel selbst bei den konservativsten Herrenausstattern in New York nicht mehr fand, ließ er sie sich maßschneidern.
Der Borsalino war sein Talisman. Seinen ersten italienischen Hut hatte er für sein erstes Vorstellungsgespräch gekauft. Er bekam die Stelle. Damals hatte er mit dem Hut sicher Stil und Geschmack bewiesen, doch mit den Jahren wirkte es altmodisch, dann spleenig, und schließlich sah er aus wie ein Komparse aus einem Film über die Fünfzigerjahre. Als Teenager schämte ich mich für seinen Aufzug, weil mein Vater so vollkommen altmodisch aussah und die Mütter meiner Freundinnen mit einer Verbeugung begrüßte. Die anderen Kinder kicherten und lachten, wenn er mich gelegentlich von der Schule abholte. Dann tat er mir leid, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ihm das weniger wehtat als mir. Er trug niemals Sportschuhe, Jeans oder Sweatshirts und verachtete die legere amerikanische Art der Bekleidung. Sie ziele auf die niederen Instinkte des Menschen, und dazu gehöre die Bequemlichkeit, sagte er.
Mein Vater stand vor dem Bett und flüsterte meinen Namen. Er müsse zu einem Termin nach Boston und könne noch nicht genau sagen, wann er zurückkomme. Vermutlich erst in ein paar Tagen. Das war ungewöhnlich, denn seine Terminplanung funktionierte so zuverlässig wie das Laufwerk seiner Armbanduhr, außerdem flog er häufig nach Boston, aber nie über Nacht. Ich war zu müde, um mich zu wundern. Er gab mir einen Kuss auf die Stirn und sagte: »Ich liebe dich, mein Kleines. Vergiss das nie. Hörst du?«
Ich nickte im Halbschlaf.
»Ich liebe dich. Pass gut auf dich auf.«
Ich drehte mich um, drückte mein Gesicht in das Kissen und schlief weiter. Seither ist er verschwunden. Spurlos.
Der erste Hinweis, dass etwas nicht stimmte, kam morgens kurz nach zehn. Ich hatte lange geschlafen und war gerade erst in die Küche gekommen. Mein Bruder war schon wieder auf dem Weg nach San Francisco, meine Mutter wartete mit dem Frühstück auf mich. Sie saß im Wintergarten vor einer Tasse Kaffee und blätterte in der Vogue. Wir trugen beide noch unsere Morgenmäntel, auf dem Tisch lagen warme Zimtschnecken, und es gab frische Bagel, geräucherten Lachs, Honig und Erdbeermarmelade. Ich saß auf meinem alten Platz, den Rücken an die Wand gelehnt, Füße auf der Stuhlkante, die Beine angewinkelt und fest umschlungen. Ich nippte an meinem Orangensaft und erzählte meiner Mutter von meinen Plänen für den Sommer. Das Telefon klingelte. Es war Susan, die Sekretärin meines Vaters. Ob er krank sei, wollte sie wissen. Sein Zehn-Uhr-Termin, weiß Gott kein unwichtiger, warte auf ihn. Von Boston wusste sie nichts.
Meine Mutter war die weniger Beunruhigte, vermutlich, weil sie keinen Hollywood-Mogul samt Anwälten vor sich sitzen hatte. Irgendetwas Kurzfristiges musste dazwischengekommen sein, die beiden Frauen waren sich einig. Er hatte es nicht geschafft anzurufen, war jetzt in einer Sitzung und würde sich bestimmt, da hatten sie keine Zweifel, in den nächsten Stunden melden.
Meine Mutter und ich frühstückten in Ruhe zu Ende. Meinen Vater erwähnten wir mit keinem Wort. Später gingen wir gemeinsam zur Kosmetikbehandlung, anschließend durch den Central Park zu Bergdorf and Goodman. Es war einer dieser warmen Frühsommertage, an denen es noch nicht zu feucht und zu heiß ist. Selten ist New York schöner. Im Park roch es nach frisch gemähtem Gras, auf der Sheep Meadow lagen Menschen in der Sonne, und ein paar Jungs spielten mit nackten Oberkörpern Frisbee. Vor uns liefen zwei ältere Männer Hand in Hand auf Rollschuhen. Am liebsten wäre ich stehen geblieben, hätte die Augen geschlossen und die Welt umarmt. An solchen Tagen hatte ich das Gefühl, das Leben sei nichts anderes als eine Ansammlung von Möglichkeiten, die nur darauf warteten, von mir genutzt zu werden.
Meine Mutter zog mich weiter.
Sie kaufte mir bei Bergdorf and Goodman ein gelbes, geblümtes Sommerkleid und lud mich danach zum Tee ins Plaza ein. Ich mochte das Hotel nicht; dieses französische Renaissanceimitat war mir zu verspielt, zu kitschig, aber ich hatte es längst aufgegeben, mit meiner Mutter woanders Tee trinken zu wollen. Sie liebte die Lobby mit dem vergoldeten Stuck an den hohen Decken und Wänden, den Säulen, so verschnörkelt und verziert, als wären sie aus Zuckerguss. Sie genoss die prätentiöse Art der Kellner und die Weise, wie der französische Maître sie mit »Bonjour, Madame Win« begrüßte. Wir saßen zwischen zwei Palmen neben einem kleinen Buffet mit Kuchen, Pralinen und Eis. Zwei Stehgeiger spielten Wiener Walzer.
Meine Mutter bestellte Kaviarblinis und zwei Gläser Champagner.
»Gibt es noch etwas zu feiern?«, fragte ich.
»Dein Examen, mein Schatz.«
Wir probierten unsere Blinis. Sie waren zu salzig, der Champagner zu warm. Meine Mutter gab dem Kellner ein Zeichen.
»Lass es, Mama«, protestierte ich. »Es ist doch in Ordnung.«
»Nicht einmal das«, sagte sie zu mir in einem milden Ton, als verstünde ich davon nichts. »Wenn es das wenigstens wäre.«
Den Ober wies sie zurecht, und unter mehrfacher Entschuldigung nahm er unsere Bestellung wieder mit. Ihre Stimme konnte so kühl und scharf klingen. Früher hatte ich mich davor gefürchtet, heute war es mir nur unangenehm.
»Wenn ich Kaviarblinis esse, möchte ich, dass sie mehr sind als nur in Ordnung. Und lauwarmer Champagner ist eine Zumutung.« Sie schaute mich an. »Du hättest sie gegessen, nicht wahr?«
Ich nickte.
»Dein Vater auch. In manchen Dingen seid ihr euch sehr ähnlich.«
»Wie meinst du das?«, fragte ich. Es klang nicht wie ein Kompliment.
»Ist es eure Bescheidenheit, eure Passivität oder eure Scheu vor Konflikten, die ich nicht verstehen kann? Warum sollte ich mich nicht beschweren, wenn ich etwas von ungenügender Qualität bekomme?«
»Es ist mir lästig.«
»Ist es Schüchternheit oder Arroganz?«, fuhr sie fort, als hätte sie mich nicht gehört.
»Was soll das mit Arroganz zu tun haben?«
»Ihr wollt euch nicht mit dem Kellner abgeben«, sagte sie, und in ihrer Stimme lag eine Wut, die ich mir nicht erklären konnte. Mit salzigen Blinis und lauwarmem Champagner hatte sie nichts zu tun. »Er ist es nicht wert. Das nenne ich Arroganz.«
»Nein, es ist mir einfach nicht so wichtig«, sagte ich. Das war nur die halbe Wahrheit, aber ich hatte keine Lust auf eine lange Diskussion. Mir war es peinlich, mich zu beschweren, egal, ob im Restaurant, in einem Hotel oder beim Einkaufen. Aber es machte mir mehr aus, als ich zugab. Es kränkte mich, und im Nachhinein ärgerte ich mich oft über meine Nachgiebigkeit. Bei meinem Vater war das anders. Sein Schweigen in solchen Situationen war echt. Ihm war es wirklich nicht wichtig. Wenn ihm jemand unhöflich begegnete oder ihn schlecht behandelte, empfand er das nicht als sein Problem, sondern als das des anderen. Er lächelte, wenn sich jemand in einer Schlange vor ihn drängte. Er zählte nie sein Wechselgeld, meine Mutter jeden Cent. Ich beneidete ihn um seine Gelassenheit. Meine Mutter verstand ihn nicht. Sie war streng mit sich und mit anderen. Mein Vater nur mit sich.
»Wie kann es dir nicht so wichtig sein, ob du gut behandelt wirst, ob du bekommst, was dir zusteht? Das begreife ich nicht.«
»Können wir es nicht dabei belassen?«, sagte ich, mehr bittend als fordernd. Um sie abzulenken, fügte ich hinzu:
»Machst du dir Sorgen um Papa?«
Sie lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein. Sollte ich?«
Heute frage ich mich, ob die Gelassenheit meiner Mutter nicht gespielt war. Wir verloren kein Wort über den geplatzten Termin. Sie erkundigte sich nicht im Büro, ob er sich gemeldet hatte. Warum war sie sich so sicher, dass ihm nichts zugestoßen war? Interessierte es sie nicht? Oder hatte sie schon seit Jahren geahnt, dass dieser Moment einmal kommen würde? Ihre Ruhe, ihre Ausgelassenheit an diesem Tag hatten etwas von der Erleichterung eines Menschen, der eine Katastrophe kommen sieht, weiß, dass er ihr nicht entfliehen kann, und am Ende froh ist, wenn es endlich passiert.
Wenige Wochen später saß Francesco Lauria, Leiter der Sonderkommission, die nach meinem Vater fahndete, bei uns in der Küche. Der New Yorker Polizeipräsident hatte ihn zu Beginn der Ermittlungen meiner Mutter als einen seiner besten Fahnder vorgestellt. Seither war er unser ständiger Hausgast. Er war jung, Mitte dreißig, schlank, muskulös und sehr eitel. Seine schwarzen Haare lagen so präzise, als würde er sie jeden Morgen nachschneiden. Er trug elegante Anzüge und italienische Krawatten. Das Auffallendste war seine Sprache. Er war eloquent und charmant und wählte seine Worte ähnlich sorgfältig wie ein guter Rechtsanwalt vor Gericht. In den ersten Tagen, die mein Bruder, meine Mutter und ich mehr oder weniger neben dem Telefon verbrachten, rief er häufig noch gegen Mitternacht aus dem Präsidium an. Er tröstete uns, erzählte von der hohen Aufklärungsquote bei Entführungen und von Fällen, in denen der Mann nach zwei oder drei Wochen plötzlich unversehrt wieder vor der Tür stand. Mein Vater war für ihn eine Karrierechance, und er war fest entschlossen, sie zu nutzen. »Einflussreicher Wall-Street-Rechtsanwalt spurlos verschwunden«, schrieb die New York Times und zitierte Lauria gleich mehrmals auf der Titelseite des Lokalteils. In den folgenden Tagen waren die Zeitungen voller Spekulationen. War es Mord, die Rache eines Mandanten? Eine spektakuläre Entführung? Hatte Hollywood etwas damit zu tun?
Was die Polizei in den ersten zwei Wochen ermittelte, machte den Fall nur noch rätselhafter. Mein Vater war am Tag seines Verschwindens tatsächlich frühmorgens zum JFK-Flughafen gefahren, aber nicht nach Boston geflogen, sondern nach Los Angeles. Er hatte das Ticket am Flughafen gekauft und kein Gepäck aufgegeben. Von Los Angeles flog er weiter mit United Airlines, Flug 888, First Class, nach Hongkong. Ein Steward erinnerte sich an ihn, weil er keinen Champagner trank und auch keine Zeitung las, sondern ein Buch mit Gedichten von Pablo Neruda. Er beschrieb ihn als sehr ruhig und ausgesprochen höflich; er habe wenig gegessen und kaum geschlafen, sich keinen Film angesehen und die meiste Zeit gelesen.
In Hongkong verbrachte mein Vater eine Nacht im Peninsula, Zimmer 218, bestellte beim Roomservice ein Curryhuhn und Mineralwasser und verließ nach Aussagen des Personals sein Zimmer nicht. Am nächsten Tag flog er mit Cathay Pacific 615 nach Bangkok und übernachtete im Mandarin Oriental. Offensichtlich gab er sich keine Mühe, seine Spur zu verwischen; er wohnte in denselben Hotels, die er auch auf Geschäftsreisen benutzte, und zahlte alle Rechnungen mit Kreditkarte. Als habe er gewusst, dass, zumindest für die Ermittler, seine Reise hier enden würde. Vier Wochen später fand ein Bauarbeiter seinen Pass in der Nähe des Bangkoker Flughafens.
Vieles deutete darauf hin, dass er Thailand nicht wieder verlassen hatte. Die Polizei prüfte alle Passagierlisten der Flüge ab Bangkok, sein Name tauchte nirgendwo auf. Lauria vermutete zeitweilig, dass er sich in Thailand einen falschen Pass besorgt hatte und unter anderem Namen weitergeflogen sei. Mehrere Thai-Air-Stewardessen glaubten, ihn gesehen zu haben. Eine angeblich auf einem Flug nach London, eine andere auf dem Weg nach Paris und eine dritte in einer Maschine nach Phnom Penh. Alle Nachforschungen ergaben nicht das Geringste.
Die Beziehung zwischen Lauria und meiner Mutter hatte sich im Laufe der Ermittlungen immer mehr verschlechtert. Zu Beginn war er voller Sympathie für die Familie des Opfers, besonders für die Ehefrau, »der das Leid ins Gesicht geschrieben steht«, wie er es Reportern gegenüber ausdrückte. Wenn er anrief, klang seine Stimme so freundlich, warm und vertraut wie die unseres Hausarztes. Doch das Mitgefühl verwandelte sich allmählich in Misstrauen, weil er nicht verstand, dass wir so viele Fragen über die Vergangenheit meines Vaters nicht beantworten konnten. In seinen Augen behinderten wir die Ermittlungen. Wie kann es möglich sein, dass eine Frau nicht weiß, wo ihr Mann geboren wurde? Nicht das Datum, nicht einmal das Jahr des Geburtstages kennt. Namen der Schwiegereltern? Meine Mutter hatte den Kopf geschüttelt. Geschwister? Jugendfreunde?
Nach Angaben der Einwanderungsbehörde war mein Vater 1942 mit einem Studentenvisum von Burma in die USA gekommen. Er hatte in New York Jura studiert und wurde 1959 amerikanischer Staatsbürger. Als Geburtsort hatte er Rangoon angegeben, die Hauptstadt der ehemaligen britischen Kolonie. Nachforschungen des FBI und der amerikanischen Botschaft in Rangoon ergaben keinerlei Hinweise. Win ist ein geläufiger Nachname in Burma, und niemand schien die Familie meines Vaters zu kennen.
Lauria nahm einen Schluck von seinem schwarzen Kaffee.
»Es tut mir leid, Mrs. Win, wir kommen nicht weiter«, sagte er, und ich erkannte am Ton, dass er uns die Schuld oder zumindest einen Teil der Schuld gab. »Ich möchte Ihnen noch einmal ein paar Fragen stellen. Hinter jedem Detail, jedem noch so unbedeutend erscheinenden Hinweis kann eine Spur stecken, die uns weiterhilft.«
Er holte einen Kugelschreiber und einen Notizblock aus der Tasche.
»Ist Ihnen in den Wochen vor dem Verschwinden Ihres Mannes etwas aufgefallen? Andere Gewohnheiten? Hat er Namen erwähnt, die Ihnen unbekannt waren?«
»Das haben Sie mich schon einmal gefragt«, antwortete meine Mutter gereizt. Sie gab sich keine Mühe, ihren Unmut zu verbergen.
»Ich weiß. Vielleicht ist Ihnen in den vergangenen Wochen noch etwas eingefallen. Manchmal hilft ein gewisser Abstand.«
»Mein Mann hat mehr meditiert als früher. Nicht nur, wie üblich, eine Dreiviertelstunde am Morgen, sondern auch abends nach dem Essen. Aber das sagte ich Ihnen bereits.«
»War er angespannter oder unruhiger?«
»Nein, im Gegenteil.«
»Fröhlicher?«, fragte Lauria erstaunt.
»Mein Vater war kein fröhlicher Mensch, nicht in dem Sinne«, mischte ich mich in das Gespräch ein. »Er war ruhig, oft sehr still, und in der Zeit vor seinem Verschwinden ruhte er noch mehr in sich als sonst.«
»Er hat besonders viel Musik gehört in den letzten Wochen, stundenlang vor dem Einschlafen«, fügte meine Mutter hinzu. »Er brauchte ja nicht viel Schlaf, vier, fünf Stunden pro Nacht, mehr nicht.«
»Hörte er etwas Bestimmtes?«
»Meistens seine Lieblingskomponisten: Bach, Mozart, Beethoven, Puccini-Opern, vor allem La Bohème.«
Lauria schrieb ein paar Sätze in seinen Block. »Mir ist aufgefallen, dass sowohl sein Büro als auch sein Arbeits- und Schlafzimmer ungewöhnlich aufgeräumt waren. Leere Schreibtische, die Korrespondenzen erledigt, nicht einmal ein halb gelesenes Buch lag auf dem Nachttisch.«
Meine Mutter nickte. »So war er.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Lauria.
»Penibel und ordentlich, sehr organisiert und weit vorausplanend. Aber was sagt Ihnen das?«
Lauria schwieg. »Wir vermuten«, sagte er nach einer langen Pause, »dass die Gründe für das rätselhafte Verschwinden Ihres Mannes in den ersten zwanzig Jahren seines Lebens zu suchen sind, und ohne Ihre Unterstützung werden wir uns weiter im Kreis drehen.«
»Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß«, unterbrach ihn meine Mutter. »Mein Mann hat über diese Zeit nicht gesprochen, mit niemanden.«
»Sie haben einen Menschen geheiratet, den Sie nicht kannten und von dem Sie nichts wussten?«, fragte Lauria. Seine Stimme klang nicht mehr vorwurfsvoll oder anklagend, sie war kalt und zynisch.
»Ich wusste, was ich wissen musste«, antwortete meine Mutter in einem scharfen Ton, der das Gespräch beenden sollte. »Ich liebte ihn. Mehr interessierte mich nicht.«
Lauria stand auf. Er nahm Kugelschreiber und Notizblock vom Tisch und steckte sie ein. Er konnte meine Mutter nicht verstehen, selbst wenn er gewollt hätte. Er gehörte zu den Menschen, die ein Nein als Antwort nicht gelten lassen, vermutlich in seiner Ehe ebenso wenig wie in seinem Beruf. Er ahnte nicht, dass meine Mutter und er in dieser Hinsicht eigentlich Seelenverwandte waren, und so konnte er auch nicht ermessen, wie schwierig es für sie gewesen war, mit dem Schweigen meines Vaters zu leben.
Lauria blickte uns an, als wolle er etwas sagen, ließ es dann aber.
Er ging zur Tür. »Ich rufe Sie an, wenn wir etwas Neues wissen«, sagte er.
»Danke«, sagte meine Mutter kühl.
Als Lauria gegangen war, setzte sie sich auf seinen Stuhl. Sie schwieg. Die Stille wurde mit jedem Atemzug bedrückender. Worüber schwiegen wir? Sagte meine Mutter die Wahrheit? War sie die Komplizin meines Vaters? Unser Schweigen lastete auf meinen Schultern und meinem Magen, und ich spürte, wie es in den Händen anfing zu kribbeln, als traktiere mich jemand mit Nadeln. Das Gefühl kroch die Arme hoch und in die Brust, und ich wusste, wenn es meinen Kopf erreicht, werde ich ohnmächtig. Ich wollte etwas sagen. Nicht ein Wort konnte ich herauspressen.
Es war meine Mutter, die mich erlöste. Sie stand auf, kam zu mir und nahm mich in den Arm. Ich spürte, dass sie geweint hatte.
»Dein Vater hat mich nicht erst an dem Tag verlassen, an dem er verschwand.«
4
Gibt es Augenblicke, in denen ein Leben eine neue Wendung nimmt? In der die Welt, wie wir sie kennen, aufhört zu existieren? Die uns von einem Herzschlag zum anderen in einen anderen Menschen verwandelt? Der Moment, in dem der geliebte Mensch gesteht, dass er jemand anderen liebt und uns verlässt? Der Tag, an dem wir Vater oder Mutter oder unseren besten Freund beerdigen? Die Sekunde, in der uns der Arzt mitteilt, dass in unserem Kopf ein Tumor wächst?
Oder sind es immer nur Endpunkte langer Entwicklungen, die wir hätten kommen sehen können, hätten wir die Warnzeichen ernst genommen, anstatt sie zu ignorieren? Verändern sie unser Leben wirklich grundsätzlich, oder sind es nur Phasen der Trauer oder des Aufruhrs, nach denen wir weiterleben mit denselben Gewohnheiten, denselben Vorlieben und Abneigungen, denselben Ängsten und Zwängen, nur vielleicht in anderen Kleidern?
Und wenn es diese Wendepunkte gibt, sind wir uns ihrer bewusst in jenen Augenblicken, oder erkennen wir den Bruch erst viel später, in der Rückschau?
Fragen, die mich bisher nicht interessiert hatten und auf die ich keine Antwort wusste. Das Verschwinden meines Vaters war jedenfalls kein solches Erlebnis. Ich liebte ihn, ich vermisste ihn, aber ich glaube nicht, dass in den vergangenen vier Jahren mein Leben anders verlaufen wäre, ich eine wichtige Entscheidung anders getroffen hätte, wäre er noch bei uns. Bis vor einer Woche dachte ich so. Es war kurz nach acht Uhr und schon dunkel, als ich abends aus dem Büro nach Hause kam und mich der Doorman aus dem Fahrstuhl zurückrief. Draußen regnete es heftig, meine Schuhe waren nass, ich fror und wollte in meine Wohnung.
»Was gibt’s?«, fragte ich ungeduldig.
»Post für Sie«, sagte er und verschwand in einem Lagerraum.
Ich blickte durch die große Glasfront der Lobby auf die Straße. Die roten Rücklichter der Autos glänzten auf dem nassen Asphalt. Ich freute mich auf eine warme Dusche und einen heißen Tee. Der Doorman gab mir eine Tüte mit einem braunen Paket von der Größe eines Schuhkartons. Ich klemmte es unter den Arm und fuhr in meine Wohnung in den vierunddreißigsten Stock.
Eine kleine Wohnung. Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer mit offener Küche, ich hatte sie sparsam, aber mit ausgesuchten Möbeln eingerichtet. Ein langer Holztisch, vier Metallstühle, ein Sessel vor dem Fenster, die Stereoanlage auf dem Fußboden, an den weißen Wänden zwei Bilder von Basquiat, meinem Lieblingsmaler. Ich mochte die Wohnung vor allem wegen ihres Blickes. Die Fensterfront reichte von der Decke bis zum Parkettfußboden, und an klaren Tagen lag Manhattans Skyline vor mir. Der Blick aus dem Fenster war ein Gemälde, ein geniales Kunstwerk, das lebte und als Beweis jede Nacht seine Formen und Farben veränderte.
An manchen Abenden stand ich auf meinem kleinen Balkon und träumte. Dann blickte ich auf Manhattan mit einem Gefühl, als hätte ich es erschaffen, streckte die Arme aus und stellte mir vor, ich könnte fliegen. Es war meine Stadt.
Ich hörte den Anrufbeantworter ab, acht Nachrichten, alle geschäftlich. Auf dem Tisch lag ein Haufen Post, Rechnungen und Werbebriefe. Es roch nach Putzmitteln, und ich öffnete die Balkontür. Es regnete noch immer, und die Wolken hingen so tief, dass ich kaum das andere Ufer des East River sehen konnte. Unter mir stauten sich die Autos auf der zweiten Avenue und der Queensboro Bridge, das Hupen drang bis hinauf in den vierunddreißigsten Stock.
Nach dem Duschen holte ich das Paket aus der Tüte. Ich erkannte die Schrift meiner Mutter sofort. Sie schickte mir gelegentlich Karten mit Grüßen oder Zeitungsausschnitte, von denen sie annahm, dass sich mich interessierten, oder fand, dass sie mich interessieren sollten. Sie verabscheute Anrufbeantworter, und das war ihre Art, Nachrichten zu hinterlassen. Ein Paket hatte sie mir lange nicht mehr geschickt; sonderbar, zumal wir für morgen zum Essen verabredet waren. Ich öffnete es und fand einen Stapel alter Fotos, Dokumente und Unterlagen meines Vaters, dazu ein paar Zeilen von ihr.
Julia, ich entdeckte diesen Karton beim Ausmotten auf dem Dachboden. Er war hinter die alte chinesische Kommode gefallen. Vielleicht interessieren Dich die Sachen. Dazu habe ich das letzte Foto von uns vieren gelegt. Ich brauche nichts mehr davon. Freu mich auf Samstag,
Deine Judith
Ich breitete den kleinen Stapel auf dem Tisch aus. Obendrauf lag das Familienfoto, entstanden am Tag meines Examens. Ich stehe strahlend zwischen meinen Eltern und habe mich bei ihnen eingehakt. Mein Bruder steht hinter mir und hat seine Hände auf meine Schultern gelegt. Meine Mutter lacht stolz in die Kamera. Auch mein Vater lächelt. Wie Fotos lügen können. Die perfekte, glückliche Familie, nichts deutet darauf hin, dass dies unser letztes gemeinsames Bild ist, oder schlimmer noch, dass einer von uns hinter dem Rücken der anderen schon lange seinen Abschied geplant hat. Ich hatte mir dieses Bild nach Vaters Verschwinden häufig und lange angeschaut, als könnte ich darin Antworten auf meine Fragen finden, als gäbe es irgendwo ein Detail, einen versteckten Hinweis, der das Rätsel lösen würde. Ich habe sein Gesicht mit einer Lupe studiert, vor allem seine Augen, die so strahlen konnten, die es ihm unmöglich machten, Freude zu verbergen. Auf dem Bild sind die Augen leer, er sieht abwesend aus, als hätte er sich bereits davongestohlen.
Darunter lagen zwei abgelaufene Reisepässe, seine amerikanische Einbürgerungsurkunde und ein paar alte, engzeilig voll geschriebene Terminkalender. Boston. Washington. Los Angeles. Miami. London. Hongkong. Paris. Es gab Jahre, da umrundete mein Vater die Welt gleich mehrmals. Er war in seiner Kanzlei zu einem der acht Teilhaber aufgestiegen und hatte sich als Rechtsanwalt früh auf die Unterhaltungsindustrie spezialisiert. Er beriet Hollywood-Studios bei Filmverträgen, Übernahmen und Zusammenschlüssen. Zudem gehörten einige der großen Stars zu seinen Klienten.
Ich habe nie wirklich verstanden, warum er in seinem Beruf so erfolgreich war. Er arbeitete viel, aber strahlte dabei keinerlei persönlichen Ehrgeiz aus, er war weder eitel, noch versuchte er, am Ruhm seiner Klienten teilzuhaben. Sein Name tauchte nie in den Klatschspalten auf, er besuchte keine Partys, nicht einmal die opulenten Wohltätigkeitsbälle, die meine Mutter und ihre Freundinnen organisierten. Das für Einwanderer so typische Bedürfnis, irgendwo dazugehören zu wollen, war ihm fremd. Er war ein Einzelgänger und das Gegenteil von dem Bild, das man sich von einem Showbiz-Staranwalt macht. Vielleicht war es genau das, was Vertrauen einflößte und ihn zu einem begehrten Verhandlungspartner machte. Die Ruhe und Gelassenheit, das Unprätentiöse, diese immer etwas weltfremde, abwesende Art, unbeeindruckt von Geld oder Ruhm. Hinzu kamen zwei außergewöhnliche Fähigkeiten, so ausgeprägt, dass sie seinen Partnern und seinen wenigen Freunden manchmal unheimlich waren: Er besaß ein fast fotografisches Gedächtnis und eine unglaubliche Menschenkenntnis. Mein Vater überflog Bilanzen und Vertragsentwürfe und kannte sie auswendig, er zitierte aus Memos und Briefwechseln, die Jahre zurücklagen. Am Beginn von Gesprächen schloss er häufig die Augen und konzentrierte sich auf die Stimmen seiner Gegenüber. Als versinke er in einer Oper. Nach wenigen Sätzen wusste er um ihr Befinden, spürte, ob sie sich ihrer Sache sicher waren, ob sie die Wahrheit sagten oder pokerten. Es klappte nicht immer, aber oft. Früher sei er darin unfehlbar gewesen, behauptete er. Es sei erlernbar, aber wer es ihm wann und wo beigebracht hatte, wollte er mir nicht verraten, sosehr ich auch bettelte.
Nicht einmal in meinem Leben habe ich ihn anlügen können. Nicht wirklich.
Der älteste Kalender stammte aus dem Jahr 1960. Ich blätterte ihn durch, nichts als geschäftliche Termine, fremde Namen, Orte und Uhrzeiten. In der Mitte lag ein Zettel, ich erkannte die Handschrift meines Vaters sofort.
How much does a man live, after all?
Does he live a thousand days, or one only?
For a week, or for several centuries?
How long does a man spend dying?
What does it mean to say »for ever«?
Pablo Neruda
Ganz hinten steckte ein blauer Briefumschlag aus dünnem Luftpostpapier, säuberlich zu einem kleinen Rechteck zusammengefaltet. Ich nahm ihn heraus und öffnete ihn. Auf dem Kuvert stand eine Adresse:
Mi Mi
38, Circular Road
Kalaw, Shan State
Burma
Ich zögerte. Barg dieser unscheinbare, hauchdünne blaue Bogen Papier den Schlüssel zum Geheimnis meines Vaters? Gab es zum ersten Mal seit seinem Verschwinden die Möglichkeit, mehr herauszufinden?
Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es wirklich wollte. Welche Rolle spielte die Wahrheit heute, vier Jahre später, noch? Meine Mutter hatte mit dem Rätsel Frieden geschlossen, und ihr ging es vermutlich besser als während ihrer Ehe. Mein Bruder lebte in Kalifornien und war dabei, eine Familie zu gründen. Er hatte kein besonders gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt und ihn bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr erwähnt. Ich konzentrierte meine Kraft auf meinen Beruf und machte Karriere als Anwältin. Mein Terminkalender für die kommenden Monate war voll. Ich arbeitete an zwei großen Fällen und hatte keine Zeit, nicht einmal für einen Freund. Wir hatten uns mit unserer Version der Ereignisse eingerichtet und lebten nicht schlecht damit. Ich hatte im Augenblick weder die Energie noch das Interesse, mich mit alten Geschichten zu beschäftigen. Wozu auch? Mir ging es gut.
Ich nahm den Brief und ging zum Gasherd. Ich könnte ihn verbrennen, die Flammen würden das leichte Papier in wenigen Sekunden in Asche verwandeln. Ich stellte den Herd an, hörte das Gas rauschen, das Klicken des automatischen Anzünders, die Flamme. Ich hielt den Umschlag nahe ans Feuer. Eine Bewegung, und unsere Familie hätte ihren Frieden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich vor dem Herd stand, ich erinnere mich nur, dass mir plötzlich die Tränen kamen. Sie liefen mir die Wangen hinab, ich wusste nicht, warum ich weinte, aber die Trauer wurde größer und größer, und irgendwann fand ich mich auf meinem Bett wieder, weinend und schluchzend wie ein Kind.
Die Uhr an meinem Bett zeigte 5.20 Uhr, als ich aufwachte. Ich spürte das Weinen noch in meinem Körper, erinnerte mich ein paar Atemzüge lang nicht an den Anlass und hoffte, das alles sei ein Traum gewesen. Dann fiel mein Blick auf den Brief. Ich stand auf und zog mich aus, duschte, warf einen Bademantel über, steckte ein gefrorenes Croissant in die Mikrowelle und machte mir einen Milchkaffee. Am Tisch entfaltete ich behutsam den Brief. Als könnte er in meinen Fingern zerplatzen wie eine Seifenblase.
New York, 24. April 1955
Geliebte Mi Mi,
fünftausendachthundertundvierundsechzig Tage sind vergangen, seit ich zum letzten Mal Dein Herz habe schlagen hören. Weißt Du eigentlich, wie viele Stunden das sind? Wie viele Minuten? Weißt Du, wie arm ein Vogel ist, der nicht singen kann, eine Blume, die nicht blüht? Wie elend ein Fisch zugrunde geht, wenn man ihm das Wasser nimmt?
Es ist schwer, Dir einen Brief zu schreiben, Mi Mi. So viele habe ich geschrieben und dann nicht abgeschickt. Was kann ich Dir berichten, was Du nicht schon wüsstest? Als ob wir Tinte und Papier, Buchstaben und Wörter bräuchten, um zu wissen, wie es uns geht. Du bist bei mir gewesen, jede der 140 736 Stunden, ja, so viele waren es bereits, und Du wirst bei mir sein, bis wir uns wiedersehen. (Verzeih mir, wenn ich das Selbstverständliche ausspreche, nur dieses eine Mal.) Ich werde zurückkehren, wenn die Zeit gekommen ist. Wie flach und leer die schönsten Worte klingen können. Wie trist und trostlos muss das Leben sein für Menschen, die Worte brauchen, um sich zu verständigen, die sich berühren, sehen oder hören müssen, um einander nah zu sein. Die sich ihre Liebe beweisen oder auch nur bestätigen müssen, um sich ihrer sicher zu sein. Ich merke, auch diese Zeilen werden nicht auf den Weg zu Dir gehen. Du hast längst gespürt, was ich Dir schreiben wollte, und so sind diese Briefe in Wahrheit an mich gerichtet, nur Versuche, die Sehnsucht zu besänftigen.
Hier brach der Brief ab. Ich las ihn ein zweites und ein drittes Mal, faltete ihn und steckte ihn zurück in den Umschlag. Ich schaute auf die Uhr. Es war Samstagmorgen, kurz nach sieben. Es hatte aufgehört zu regnen, die Wolken hatten einem tiefblauen Himmel Platz gemacht, unter dem Manhattan langsam erwachte. Über dem East River ging die Sonne auf, sie schien in mein Wohnzimmer und tauchte alles in ein warmes, rötliches Licht. Es würde ein kalter, schöner Tag werden.
Ich holte einen Zettel und wollte mir Notizen machen, die Situation analysieren, eine Strategie entwerfen, so wie ich es im Büro tat. Das Papier blieb weiß.
Ich hatte den Zeitpunkt der Entscheidung verpasst. Sie war gefallen, auch wenn ich nicht wusste, wer sie für mich getroffen hatte.
Die Nummer von United Airlines kannte ich auswendig. Der nächste Flug nach Rangoon ging am Sonntag über Hongkong und Bangkok. Dort müsste ich mir ein Visum besorgen und könnte dann am Mittwoch mit Thai Air weiter nach Burma.
»Und der Rückflug?«
Ich überlegte kurz.
»Bleibt offen.«
5
Meine Mutter wartete bereits. Wir waren um halb zwei bei Sant Ambroeus auf der Madison Avenue zum Mittagessen verabredet. Es war zwanzig nach eins, und sie saß, wie fast jeden Sonnabend, auf ihrem Platz ganz hinten, auf der mit rotem Samt gepolsterten Bank, von wo aus sie das kleine Lokal und die Cappuccinobar im vorderen Raum überblicken konnte, in der Hand ein fast leeres Glas Weißwein. Seit der Eröffnung dieses italienischen Restaurants vor zwölf Jahren gehörten meine Mutter und ihre Freundinnen zu den Stammgästen. Sie mochten die leicht blasierten Kellner in ihren schwarzen Smokings und vor allem Paolo, den Inhaber, der sie jedes Mal mit großer Geste und Handkuss begrüßte, als hätten sie sich Jahre nicht gesehen. Oft aßen sie bei ihm zwei- oder dreimal in der Woche, planten ihre Wohltätigkeitsbälle für den Winter, schimpften über den Verkehr in den Hamptons im Sommer.
Meine Mutter hatte schon bestellt; es gehörte zu unseren Ritualen, dass sie bei Sant Ambroeus für mich aussuchte. Vor ihr stand ein Teller mit drei Scheiben Tomaten und frischem Büffelmozzarella. Auf mich wartete ein kleiner Salat.
Sie erzählte von dem Wohltätigkeitsball des Tierschutzvereins, dessen Schirmherrin sie war, und von Francis-Bacon-Bildern, die sie im MoMA gesehen hatte und schrecklich fand. Ich nickte, ohne ihr wirklich zuzuhören.
Ich war nervös. Wie würde sie auf meine Pläne reagieren?
»Ich verreise am Montag«, sagte ich. Meine Stimme klang noch zaghafter, als ich es befürchtet hatte.
»Wohin?«, fragte sie.
»Nach Burma.«
»Mach dich nicht lächerlich«, sagte sie, ohne von ihrem Mozzarella aufzublicken.
Es waren solche Sätze, mit denen sie mich seit meiner Kindheit zum Schweigen bringen konnte. Ich trank einen Schluck von meinem Mineralwasser und betrachtete meine Mutter. Sie hatte ihr graues Haar wieder dunkelblond färben und kurz schneiden lassen. Die kurzen Haare machten sie jünger, aber auch strenger. Ihre spitze Nase war in den vergangenen Jahren noch spitzer geworden, ihre Oberlippe war fast verschwunden, und die sich mehr und mehr nach unten neigenden Mundwinkel gaben ihrem Gesicht etwas Bitteres. Ihre blauen Augen hatten den Glanz verloren, den ich aus meiner Kindheit erinnerte. War es das Alter, oder sieht so eine Frau aus, die nicht geliebt worden ist? Oder nicht so, wie sie es gebraucht oder gewollt hätte?
Wusste sie von Mi Mi und hat es uns Kindern verheimlicht? Sollte ich ihr von dem Brief erzählen?
Sie aß ein Stück Tomate mit Käse und schaute mich an. Ich konnte ihren Blick nicht deuten und wich ihm aus.
»Wie lange bleibst du weg?«
»Ich weiß es noch nicht.«
»Und dein Job? Was ist mit den Verhandlungen in Washington, von denen du mir erzählt hast?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht können sie zwei Wochen warten.«
»Du bist verrückt. Du riskierst deine Karriere. Wofür?«
Die Frage hatte ich erwartet und befürchtet. Ich wusste keine Antwort. Der Brief an Mi Mi war vierzig Jahre alt. Ich glaubte nicht, dass er wirklich etwas mit dem Verschwinden meines Vaters zu tun hatte. Ich wusste nicht, wer Mi Mi war, wo sie war, welche Rolle sie im Leben meines Vaters gespielt hatte und ob sie noch lebte. Ich hatte einen Namen und eine alte Adresse in einem Dorf, von dem ich mir nicht einmal sicher war, wo es lag. Ich bin kein Mensch, der leichtfertig seinen Gefühlen folgt, ich vertraue meinem Intellekt mehr als meinen Instinkten.