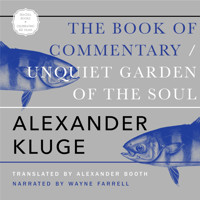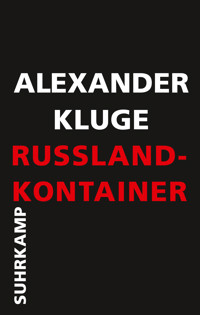36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Unsere Lebensläufe sind die Häuser, aus deren Fenstern wir Menschen die Welt deuten: ein Gefäß der Erfahrung für das literarisch Erzählbare.« Alexander Kluge Mit diesem Fünften Buch gelangt Alexander Kluges großes Erzählprojekt zu seinem Abschluß. In vier voraufgegangenen Bänden, der zweibändigen »Chronik der Gefühle« und den einbändigen Geschichtensammlungen »Die Lücke, die der Teufel läßt« sowie »Tür an Tür mit einem anderen Leben«, wurden seit dem Jahr 2000 die über sechs Jahrzehnte hinweg entstandenen Geschichten des Autors in großformatigen Bänden versammelt. Alle Geschichten, die darin nicht enthalten waren, werden diesem Eckband seines Lebenswerks nun auf neue Weise eingeschrieben: konzentriert und endgültig. Darüber hinaus aber führt »«Das fünfte Buch mit einer großen Gruppe »Neuer Lebensläufe« auf den Beginn von Kluges Laufbahn als Erzähler zurück. Seine »Lebensläufe« erschienen 1962, vor genau 50 Jahren. Und wieder nutzt dieser Erzähler sein bewährtes Gefäß: den »Lebenslauf« als das Gefäß aller Erfahrung – für Abgründe der Vernunft, für Brückenköpfe zu offenen Horizonten, für die realistisch-antirealistische Doppelnatur des Menschen und den inneren Partisanen in jedem von uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alexander Kluge
Das fünfte Buch
Neue Lebensläufe
402 Geschichten
Suhrkamp
Mitarbeiter Thomas Combrink
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
INHALT
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7→
1 Die Lebensläufer und ihre Lebensgeschichten 9 →
1 Die Fliege im Pernod-Glas 13 →
Die Fliege im Pernod-Glas 13 – Blumen in der Stadt 13 – »Er hat die herzlosen Augen eines über alles Geliebten« 15 – Die geheime Geschichte seines Glücks 16 – Zwei Träumerinnen stiften Verwirrung am Freitag abend 17 – Fräulein Clärli 19 – Das Mädchen von Hordorf 20 – Der erste Zeuge 21 – Der zweite Zeuge 21 – Das verlorene Kind 22 – Für die Zukunft ihrer Krabbe tätig 24 – In ihrem Kleiderschrank klebte ein Bild 25 – Stärkung mit zeitversetzter Wirkung 27 – Das Glück des dicken Bonaparte 28 – Wie Zorn sich wandelt 28 – Eine Kette von Vorfahren 30 – Mein Urgroßvater mütterlicherseits 31 – Shoddy 35 – Ein flotter Geist in einem unsicheren Körper 35 – Einen Moment lang hat es den Anschein, daß in der Nähe von Manchester ein neuer Menschentyp entsteht 37 – Eine frühe Ahnung von Faschismus 39 – Das platonische Ideal der Einheit von Zeit und Konzentration bei der Arbeit (Marx, Das Kapital, 12. Kapitel, Anmerkung 80) 40 – Auf Tuchfühlung 40 – Ein Lebenslauf in verdichteter Zeit 41 – Die englische Prägung 42 – Sturz eines Hochbegabten 44 – Eiliger Moment 45 – Ein von allen geliebtes Erstgeborenes 46 – Kalte Ente Freitag abend 46 – Keine Freiheit für den Hirtenhund 47 – »Eine Schweizer Stiftung soll über mein Liebstes wachen« 48
2 Uralte Freunde der Kernkraft 49 →
Uralte Freunde der Kernkraft 49 – Witzlaffs Katastrophentheorie 50 – Empfindliche Abkömmlinge aus ferner Zeit 51 – Kosmische Musik 52 – Es entlastet, wenn die Last nicht auf dem Einzelnen liegt 52 – Kommunizierende Tunnelwände 53 – Sie waren froh, in der Not beieinander zu sein / Lob der Kommunikation 54 – Bilder aus dem Zentrum des Geschehens 54 – Begriff der Arbeit in der Notzentrale 55 – »Eine Metropole von 37 Millionen Menschen« 56 – Ein Bürgermeister von Tokio 57 – Evakuierung einer Metropole 58 – Eine sich vergesellschaftende Rotte von Robotern 59 – Ein Metallbrand ist besonders schwer zu löschen 60 – Zufluchtsort einer künftigen Menschheit 61 – Erdbeben mit der Folge einer flutartigen Empörung in der Antike 63 – Der Stolz des Ortes ist die Schule 64 – Müde, ohne gearbeitet zu haben 65 – Absinken des Aktualitätswerts 66 – Besuch der Kanzlerin 67
3 Der Lebenslauf einer fixen Idee 69 →
Der Schreiner von Athen 69 – Besser wenn es keine Regierung gibt, die Verträge unterschreibt 69 – Der Lebenslauf einer fixen Idee 71 – Ein unbezahlbares Motiv 71 – Der letzte Listenreiche gibt die Hoffnung auf 74 – Wiedergutmachung für Alarichs Taten 75 – Szenario der griechischen Bahnen 76 – Zerfledderung von Lorbeerkränzen 79 – Koloniebildung im 21. Jahrhundert 80 – »Griechenland in permanenter Revolution« 80 – Der griechische Exodus 81 – Ein Lebewesen, weder osmanisch noch griechisch 82 Goethe und die Griechenfreiheit 83 – Eine Geschichte um Leidenschaft und Lebenspraxis aus dem griechischen Befreiungskampf 85 – Indikative Bewertung 88 – Das »gewaltsame Auge« 88 – In großer Ferne zum 5. Jahrhundert v. Chr. 90
4 Die unsichtbare Schrift 96 →
Wartezeit 96 – Erst später verstand ich, worum es sich handelte 96 – Entschluß eines aufgeregten Julitages 98 – Nebeneinanderschaltung 99 – Allmähliche Beladung des Hirns durch Schrift 100 – »Die Lebensbahn des Zwerchfells« 101 – Lebensläufe der Libido 102 – »Leiden kann nur der Einzelne« 104 – Der Erzählraum (und das Darüberhinaus) 106 – Besuch in der Zukunft 107 – Welche Sprache wird in 200 Millionen Jahren gesprochen? 109 – Die Niedermetzelung des 2. Nassauischen Infanterieregiments Nr. 88 112 – Sie weinte bitterlich, als sie hörte, daß es für Eltern keine Verkehrsverbindung zur Front gibt 114 – Die unsichtbare Schrift 116 – Erinnerung, ein rebellischer Vogel 116 – Ein Erforscher von Lebensgeschichten 118 – Die Ärzte der Charité sahen keine Möglichkeit, den energischen Lebenskämpfer abzuwimmeln 119 – Ein Geschichtsfaden 120 – Ausradierte Jahre 121 – Körpergröße und Bedeutungswandel 122 – Septemberkinder 1990 123 – Glückliche Nachreife 124 – Reinschrift des Lebens 125 – Auf dem Weg zur Unentbehrlichkeit 126 – Ein Clan aus Niger sucht seine Lebensläufe zu verbessern 126 – »Ein Leben namens Gucki« 127 – Sieben Generationen begründen eine Region 127 – Die letzte Bastion 128 – Übriggeblieben aus der vorigen Welt 129 – »Mancher Fabriken befliß man sich da, und manches Gewerbes« 129 – Lieschen hat sofort gesehen, daß Hermann nicht umzustimmen ist 131 – »Damit sich Acker an Acker schließt« 131 – Goethes Kunstgriffe 132 – Zwangsentwurzelte Evakuierte 133 – »Kommt ihr doch als ein veränderter Mensch« 133 – Begegnung auf der Flucht 135 – Kleist und seine Schwester 136 – Kleists Lebensplan 136 – Ein Fragment wird verbrannt 137 – Wie Goethe eine Minderjährige belauerte 138 – Eine apokryphe Oper Rossinis (Libretto von Goethe) 139 – Zwischen Körper und Kopf nichts als Musik 140 – Nahe Begegnung zwischen Karl May und Lord Curzon 143 – Prägung eines Charakters durch intime Erlebnisse und einen Sturz vom Pferd 145 – »Im Banne der merkwürdigen Gewalt, welche der Orient auf uns alle ausübt« 145 – Das Blut des Geliebten 147 – Wie ich Thomas Manns Villa umschlich 150 – Eine Romanskizze von Klaus Mann zu einem Stoff seines Vaters 151 – Ein Entwurf von Thomas Mann über Goethe während der Belagerung von Mainz 153 – Hegels unehelicher Sohn 154 – Jeden Morgen liest Hegel Zeitung 157 – Wie der Zufall in einer Winternacht Generationen an Nachfahren zustande brachte 158
2 Passagen aus der ideologischen Antike: Arbeit / Eigensinn 161 →
1 »Sag mir, wo die Arbeit ist, wo ist sie geblieben?« 163 →
Aus den Augen, aus dem Sinn 163 – Rückverwandlung von Soldaten in einfache Arbeiter 163 – Gefügeartige Arbeit 164 – Ein grauer Montag 164 – Röntgenblick auf die »unsichtbare Hand« 165 – Bauernaufstand des Geistes in der Mathematik 165 – Begegnung mit dem Glück in globalisierter Welt 166 – Zungenlust, Empathie und impartial spectator 167 – Moderne Anlagen, Prunkstücke »toter Arbeit«, momentan ohne Eigentümer 168 – Entstehung von Energien aus Trennung und Leid 169 – Lebenszeit gegen Geld 170 – Einfacher Handgriff 171 – »Sag mir, wo die Arbeit ist, wo ist sie geblieben?« 171
2 HAMMER, ZANGE, HEBEL. Gewaltsamkeit als Arbeitseigenschaft 173 →
BEHUTSAMKEIT, SICH-MÜHE-GEBEN, KRAFT- UND FEINGRIFFE 174 – Verinnerlichung von Arbeitseigenschaften 176 – AUFRECHTER GANG, GLEICHGEWICHT, SICH-TRENNEN-KÖNNEN, NACH-HAUSE-KOMMEN 177 Die Fingerspitzen, der Klammergriff 178 – Robo sapiens. Internet. Rückfall auf »einfache Lebenszeit« 178 – HEBAMMENKUNST 179
3 Selbstregulierung als Natureigenschaft 180 →
Das zänkische Gehirn 182 – Eiszeit 183 – Zelle 183 – Ungehorsam 184 – Brüderlichkeit 184 – Selbstregulierung als Ordnung 185 – Spezifische Störbarkeit 185
4 DIE ZERBROCHENE GABEL. Warum stehen Menschen neben ihrer Geschichte? 188 →
Kriegsgewinnler 1918 188 – Loss of history 189 – Abbruch der Erfahrung 190 – Ein Anschein von Kooperation 191 – Eine Strömung von Kooperation ganz am Sockel 192 – Als Monteverdis Bote im Autowerk 192 – Wandernde Klänge gehorchen keinen Eigentumsgrenzen 193 – Insolvenz im Motiv 194 – Die zerbrochene Gabel 194 – »Tote Arbeit« 195 – Industrieruine, liegengeblieben auf dem Weg der Investoren 195 – Erwachsenenbildung für die Finanzindustrie 196 – Ein Absacker-Gespräch 196 – Die Ausdrucksweise Großer Theorie und das einfache Leben 198 – Eine merkwürdige Wortwahl von Karl Marx 199 – Hermetische und assoziative Kräfte 200 – Rückkehr zur »unabhängigen Bodenbearbeitung« 201 – Eine Dissertation mit unzureichenden Quellenangaben 201 – Alleinstellungsmerkmal 202
5 »Da kannst Du essen, Du eigensinniges Kind!« 205 →
Das eigensinnige Kind 205 – »Antirealismus des Gefühls« 206 – Unabweisbarkeit im Eigensinn der Arbeitskraft 207 – »Sinnlich sein heißt leiden«. »Schöpferische Zerstörung« im individuellen Lebenslauf 208 – Patrioten ihrer Kinderzeit 209 – Spielerischer Umgang im Amt 210 – Filmszene aus der Arbeitswelt 211 – »Heile, heile Mäusespeck / In hundert Jahrn ist alles weg« 214 – Der digitale Peters 214 – Ein Film über den »Gesamtarbeiter« 216
3 Wer sich traut, reißt die Kälte vom Pferd 223 →
Menschenfeindliche Kälte / Die »gescheiterte Hoffnung« 227 →
Menschenfeindliche Kälte 227 – Stroh im Eis 227 – »Die gescheiterte Hoffnung« 230 – Eisblaue Augen 231 – Wiederherstellung von Hoffnung für den Ruhm Rußlands im Norden 233 – »Derjenige dagegen hat das Recht auf seiner Seite, welcher den Anderen nur als Einzelnen, abgelöst von dem Gemeinwesen, zu fassen wußte« 234 – Der Vorwand für Jeschows Entmachtung 235 – Aller Macht entkleidet 236 – Körperwut 238 – Fehlen der Vernichtungswut bei Hirschartigen 239 – Kommentar: Organisierte Kälte, verdichtete Gleichgültigkeit 243 – Shuttle-Diplomaten (Schnappschuß) 252 – Auf dem Dach der Welt 252 – Holbrookes Ende 254 – Tausch eines unlösbaren Problems gegen ein lösbares 255 – Spitzbergen wird zugeteilt 256 – Tauschwert von überflüssig viel Raum 257 – Ein Treibstoff namens Gier 258 – Eissturm an der Front vor Moskau 259 – 21999 v. Chr. 259 – Eindruck von Undurchdringlichkeit 260 – Die Macht der »Zeit« 260 – Die Nordpolarstellung 261 – Der Rüstungsminister versäumt den Abflug nach Nordgrönland 262 – Beuys auf der Krim 263 – Der Tod des Aufklärers Malesherbes 264 – Eine letzte Frontfahrt 264 – Das Steinherz 266 – Warten am letzten Tag im Advent 268 – Unerwartete Bekehrung eines Heiden270
4 Die Küche des Glücks 273 →
1 Die Prinzessin von Clèves 277 →
1 Ein Roman der poetischen Aufklärung ... 277 – 2 Amour propre oder die Eigenliebe ... 279 – 3 Über einige Begriffe und Szenen des Romans 280 – 4 Eine Vorratssammlung moderner Fragen und Romanstoffe zum Begriff der passion von Niklas Luhmann 286 – 5 Einzelheiten einer Intrige 291 – 6 Wandernde Schicksale. Eine Moritat ... 292 – 7 Wie würde man heute den Roman Die Prinzessin von Clèves weiterschreiben? Wäre das im 21. Jahrhundert möglich? 294 – 8 Arbeitszeitmesser A. Trube zu Liebe, Macht und dem Unterschied von Zeitabläufen im 17. und 21. Jahrhundert 297 – 9 Intelligenz und Sprache der Mathematik im Vergleich zu der von Liebesromanen 299 – 10 »Ort und Zeit ohne Grund ist Gewalt« (Aristoteles) 301 – 11 Neo-Stoizismus 302 – 12 Ableitung der Vernunft (raison) aus dem Wort Arraisonnement 303
2 Was macht der Liebe Mut? 305 →
Eine Bemerkung von Richard Sennett 305 – Was sind Derivate? 305 – Eine Beobachtung von Niklas Luhmann, die auf Richard Sennetts Bemerkung antwortet 307 – Ein libidinöser Grund für Sachlichkeit 308 – Figaros Loyalität 309 – Eros und Thanatos 311 – Nature of Love 312 – Im Schattenreich der Libido 315 – Die Lüge eines Kindes 315 – Die Hoden der Aale 317
3 Die Gärten der Gefühle 320 →
Die Wahlverwandtschaften. Parklandschaft mit vier Liebenden 320 – Die wunderlichen Nachbarskinder 324 – W. Benjamin, die Sterne und die Revolution 326 – Teestunde mit Akademikern 332
4 Das Labyrinth als Grube 335 →
Sir Arthur Evans in Knossos 335 – Der schönste Schatz der Evolution 336 – Die »ursprüngliche Akkumulation der zärtlichen Kraft« 337 – Steine des Labyrinths als Erinnerungsstücke 338 – Ein Frauenopfer in der Antike 339 – Ein Frauenopfer 1944 340 – Mord in der Hochzeitsnacht 341 – Die Schönheit in der Stimme der Nachtigall 342 – Die Metamorphosen des Ovid 342 – Nichts ist einfach Routine 345 – Wird der Minotauros mit einem ganz anderen Konstrukt des Daedalus verwechselt? 345 – »Daß es zu bösen Häusern hinausgehen muß, sieht man von Anfang an« 348 – Kollektive erotische Grundströmung als Ursache vermehrter Zeugung in einer Pariser Nacht 348 – Das Labyrinth als Grube 349
5 Die Küche des Glücks 351 →
5 Das Rumoren der verschluckten Welt 369
1 Absturz aus der Wirklichkeit 371 →
Tödlicher Zusammenstoß zweier Rennpferde 371 – Macht über den Mächtigen 373 – Absturz aus der Wirklichkeit 374 – Einer der letzten Einzelkämpfer 375 – Die Inflation regnet sich ein 376 – November 1923 377 – Die Concierges von Paris 379 – Ein Vorschlag aus Alexandria 380 – Das sibirische Meer 380 – Wie leicht bricht einer durch den dünnen Firnis der Realität 383 – Der Söldner 386 – Ein Kämpfer aus Ungarn 390 – Kleinheit der Fragmente, aus denen sich der Verlauf des Sprengstoffattentats ermitteln läßt 391 – Die Stelle zwischen zwei Institutionen, an der die Schuld ungenau wird 392 – Sturz nach einem Tag mit zu vielen Eindrücken 393 – Vor ihrem Alter graulte sie sich 395 – Die ersten 36 Stunden mit einem lachhaften Verwaltungszwerg 396 – Der Abbrecher 397 – Ihre Ankunft sollte durch ein Essen würdig begangen werden 397 – Nebelfahrt 398 – Künstlerische Installation, die nicht auf den kindlichen Instinkt geeicht ist, vor Abgründen innezuhalten 399 – Das Tier wollte uns nicht rammen 399 – Eulenspiegel in der Pferdehaut 400 – Wirklichkeit als eine zweite Haut 400
2 Das Rumoren der verschluckten Welt 402 →
Ausgründen nach oben / Luftmeere der Gesellschaft 402 – Schätze der Tiefsee 403 – Suche nach Menschengold 403 – Seltenes Leben ohne Verwertungsaspekt 403 – Lange Zyklen der Wiederkehr ewiger Farne 404 – Unerwartete Chance durch das Virus 404 – Im Marianengraben können die Atome bis in alle Ewigkeit kühlen 404 – Das unheimliche Potential, welches in der Erdkruste schlummert 405 – Hotel am Abgrund 406 – Eine junge Assistentin befragt Talcott Parsons in Heidelberg 406 – In den Jahren der Verwirrung 409 – Matschmasse 411 – Sich entzündender Konfliktpunkt, der 2030 gefährlich werden kann 412 – Porträt einer Seelenstörung 412 – Schmerzfreier Tod 413 – Ein fernes Blinkzeichen von Thomas Robert Malthus 413 – Industrielles Schlachten im 21. Jahrhundert 414 – Eine Lawine an Uneinigkeit 414 – Subjektiv-Objektiv 415 – Die unendliche Habsucht der Subjektivität 415 – Die neue Gier 416 – Die fossile Spur des unabhängigen Gedankens 417 – Getrenntes Paar 418 – Die Stärke unsichtbarer Bilder 418 – Seitlich des Bildes 419 – Der Topos, mit dem jede Welteroberung beginnt 420 – Ein unverzeihlicher Verlust 420 – Der Leichnam Karls des Kühnen 421 – Einsamer nie als im November 421 – Der Nachträgliche 422 – Ein Team alteingesessener Delphine 423 – Das unsichtbare Bild der Sintflut 424
3 Die Revolution ist ein Lebewesen voller Überraschungen 426 →
Grüne Hügel von Chengde 426 – Wetterwechsel im Sinne Maos 426 – Die Revolution ist ein Lebewesen voller Überraschungen 427 – Deng staunt, wie rasch die Leute den komplizierten Kapitalismus lernen 429 – Was ist ein »Bauer der Bedürfnisse«? 430 – Tze-fei begegnet einem Vers von Freiligrath 431 – Zwei Fernbeobachter der Revolution im Nahen Osten 433 – Provinzen zahlen für große Städte Steuern 435 – Verbindung zwischen zwei Zentren der Revolte 436 – Können utopische Besitzansprüche Zauberkraft entfalten? 437 – Anfang der saudischen Konterrevolution 438 – Das Prinzip Sulla 438 – Neuer Eintrag im Handbuch 439 – Lebenslauf von Reformen 439 – Wörtlich übersetzt heißt Revolution »Umwälzung«, »Wegwälzen« 439 – Aufstand, Revolution, Sezession 440 – Der Streit, ob Revolutionen Kreise bilden oder Spiralen. Oder sind sie Hyperbeln? Heben sie ab? 441 – Condorcet stürzt sich in die Wogen der Revolution 444 – La grande peur 445 – Übermut des Gedankens / Kalender der NEUEN ZEIT 446 – Eine äußerste Form der Ungleichheit: ein Zeitkorsett 446 – Anwendung des im Metermaß enthaltenen Metrums auf die Uhrzeit 449 – Hinweis auf die griechische Revolution von 1821 aus Anlaß des Flugverbots über Libyen im März 2011 450 – Gefahren der Philantropie 451 – Ein Grenzkonflikt 453 – Mitbringsel der Militärberater 453 – Nachrichten bedürfen eines Interesses auf der Seite ihrer Empfänger 455 – Ebensoviel Profiteure der Revolution wie Revolutionäre / Eine Revolution übersteht auch dies 456 – Was heißt Provinz in der Revolution? 461 – Umsturz des Umsturzes 462 – »Muth des Dichters« 463 – Begegnung im Turm / Ein Sansculotte war der Dichter nicht 463 – Wie ein Land durch verspätete Revolution unter die Räuber kam 464 – Ein getreuer Beobachter von Portugals Entwicklung 466 – Ein Sturz aus großer Fallhöhe 468 – Schillers Kontext 469
4 Die vergrabenen Hirne am Rhein 471 →
Die vergrabenen Hirne am Rhein 471 – Der Strom der Gene am Rhein 472 – Sprachvermittelter Neugeist 473 – Die mächtige Stimme der Erde, als sie noch mit dem Riesen Ymir identisch war 474 – Keimruhe in kalter Zeit 474 – Unwirtlicher Harz 475 – Irrfahrt von Tugenden und Lastern im Endkampf 475 – Tod eines Oberbürgermeisters von Leipzig 478 – Ein Sinnspruch der Pythagoreerin Theano 479 – Die Stummheit der Weber im Menschenstrom von 1945 479 – Schleefs emotionale Haltung 481 – Was er erzählt, hat die Zeit überrannt, wie er es erzählt, bleibt aktuell 481 – Der letzte Stenograph des Führers 482 – Ein Philologe als Opferlamm 482 – Lebensläufe, die durch das Jahr 1945 durchkreuzt werden 486 – Kommentar 488 – Porträt einer Individualistin 488 – Philologen im neuen China 489 – Wenig Unglück gibt es in der Welt, auf das sich Kortis Vorsicht nicht erstreckt 490 – »Ein ganz junger und begeisterungsfähiger Mensch«. Jetzt, 77 Jahre alt geworden, gelangt er an sein Ende 491 – Ein Versöhnungskind 494 – Gustav Fehn: »Bürger in Uniform« 497 – Schon winkt ein neues Leben 498 – Absturz aus einer »Unwirklichkeit« in eine andere 498 – Die Rückholung der Männer 499 – Ein Fall von Nationbuilding in der Familie 500 – »Anpassung und Widerstand«. Formulierung eines Textes aus dem Geiste der Entspannung 502 – Eine neugierige Zuhörerin Sarrazins, welche die Nachrichten des Ammianus Marcellinus über Anatolien im Original kennt 505 – Tote am falschen Ort 506 – Reise zu den Sternen 508 – Wiederkehr der Götter 510 – Die Sibylle »mit dem rasenden Mund« 513 – Die Menschen mit zwei Köpfen 514 – Wie zwei Hirnchirurgen in Gegenwart eines Deuters den Sitz der Götter auf der rechten Hirnseite ihrer Patienten entdeckten 515 – Die kurze Ära des Bewußtseins 517 – Die assyrische Springflut 518 – Die Entstehung des SELBST aus der Hinterlist 518 – Hoffnung, im Urwald auf eine frühe Stufe der Menschheit zu treffen 519 – Ende des Lebens 519
5 Kant und der ROTE MANN 520 →
Bei Betrachtung eines Kleinkinds im Jahre 1908 521 – »Ein Mensch ist des anderen Spiegel« 522 – Eine zähe Haut 522 – Die Anti-Scheuklappe für Artilleristen 523 – Antikonzentrationsgesetz in der Natur 524 – Raubwanderung 525 – Obergrenze der Raublust 526 – Goethe und die natürliche Zuchtwahl 526 – Zivilisation als Vogelscheuche 527 – Die Anfänge des Skeletts lagen offenbar im Mund 527 – Stufen des Lebens 528 – Erzählen in Zehn-Jahres-Abschnitten 528 – Erzählen in 100-Jahres-Abschnitten 529 – Wie überträgt sich ein Wissen in der Kunst? 530 – Aristoteles über die Genese der dramatischen Gattungen 531 – Ein aufgefundener Text Arno Schmidts über die Poetik des Aristoteles 532 – Lord Elgin und die Marbles 535 – Zwei Experten erfinden einen neuen Tuschkasten des Eigentums 536 – Wir sammeln Rohstoffe für die Rüstung des Reiches 538 – Eigentum, das bleibt 539 – Urtümliche Assoziation der Materie 539 – Die unendliche Vielfalt der Punkte am Himmel 540 – Im Weltraum gelangt die Erde nie zweimal an denselben Punkt 541 – Urform des Eigentums 541 – Kant und der ROTE MANN 542
Nachweise und Hinweise 545 →
Danksagung 550 →
Vorwort
Das Rumoren der verschluckten Welt, die Unverwüstlichkeit von menschlicher Arbeit und von love politics, der Kältestrom, die unsichtbare Schrift der Vorfahren – das sind die Themen. DAS FÜNFTE BUCH heißt dieser Band, weil er im Dialog mit den vorangegangenen vier Bänden meiner Erzählungen steht. Wie in meinem ersten Buch, das ich 1962 veröffentlichte, geht es um LEBENSLÄUFE. Die Geschichten sind teils erfunden, teils nicht erfunden.
Alexander Kluge
Abb.: Von der letzten Flottenexpedition, die das Zeitalter der Aufklärung vor der Französischen Revolution aussandte, stammt diese Zeichnung eines inzwischen ausgestorbenen Riesenkänguruhs (vergleiche seitlich die Baumhöhe). Das ist ein Bild aus dem Reich der Antipoden zum Jahre 1789.
Man sieht das kluge Auge des Tiers, das doch für seine Nachkommenschaft nicht garantieren konnte. In der Bauchfalte das kostbare Versteck für das Frischgeborene, das mit dem Muttertier durch die Wüste hüpft.
1
Die Lebensläufer und ihre Lebensgeschichten
Im ersten Impuls wollte meine Großmutter väterlicherseits, Hedwig Kluge, im August 1914 auf die Nachricht, daß ihr Erstgeborener Otto gefallen sei, den Zug besteigen, nach Belgien reisen und dafür sorgen, daß man den Toten ordentlich begräbt. Als sie hörte, daß es für Eltern keine Verkehrsverbindung zur Front gibt, weinte sie bitterlich.
###
Ein Arbeiter in Frankfurt am Main hatte sein Leben in ein und demselben Betrieb verbracht. Diese Fabrik wurde insolvent. Der Arbeiter besuchte eine Ärztin. Er hatte heftige Magenschmerzen, nicht erst seit Schließung des Betriebs. Die Ärztin verschrieb ihm Tabletten. Ich habe die Tage meines Lebens hingegeben, sagte der Arbeiter, und als Gegenleistung erhalte ich diese Tabletten. Damit bin ich nicht einverstanden.
###
In seinem Hochhausturm saß im August 2011 einer derERFAHRENEN DOMPTEURE DES KAPITALS. Er hatte nur Augen für den Bildschirm seines Rechners. Der DAX signalisierte (als fast senkrechten Absturz) binnen vier Minuten einen Verlust von vier Prozentpunkten. Eine Theorie für die Vorgänge besaß der Praktiker nicht. Gern hätte der Mann sich praktisch verhalten: Nüsse knacken, einen Apfel schälen, Mineralwasser eingießen – einen Kontakt zu irgendeiner Tätigkeit wollte er haben und nicht auf den Bildschirm starren und warten.
###
Im Jahre 1800 entwarf Heinrich von Kleist einenVERBINDLICHEN LEBENSPLAN. Den Plan wollte er dann mit irgendeiner Handlung besiegeln (ein Papier mit Blut unterzeichnen, den Plan einer geliebten Person zuschwören). Tatsächlich aber liefen die Tendenzen in Kleists lebhaftem Gemüt strahlenförmig auseinander. Der Versuch der linearen Konzentration zerriß ihn. Er brach das Studium ab und gelangte bis Würzburg.
###
Der Neuschnee auf dem Ätna, der rasch schmilzt, unmittelbar an der schwarzen Lavazone, wäre, berichtet Tom Tykwer, das Motiv für den Anfang eines Films mit dem Titel »Die Pranke der Natur«, in dem es um das unheimliche Potential geht, welches in der Erdkruste schlummert.
###
Dr. Sigi Maurer schlägt vor, die in Fukushima zum Abbau anstehenden maroden, kontaminierten Materiebrocken dorthin zu bringen, wo das Erdbeben seinen Ausgang genommen hatte. In die Tiefen desMARIANENGRABENSsolle man denABRAUMschütten. Dort könnten die Teile bis in alle Ewigkeit abkühlen.
###
Meine Voreltern aus dem Südharz haben sich nicht träumen lassen, mit welch fremden Genen sie heute in ihren Nachkommen zusammenleben würden. Diese Linie hatte keine Ahnung davon, daß sie später mit meinen Vorfahren aus dem Eulengebirge verknüpft sein würde. Nichts ahnten die Vorfahren vom Eulengebirge und die vom Südharz von den Zuflüssen aus Mittelengland und der Mark Brandenburg. Alle diese Charaktere scheinen unvereinbar. Daß solche Gegensätzlichkeiten keinen Bürgerkrieg in den Seelen und Körpern hervorrufen, sondern sich in jedem Pulsschlag, in jedem Herzschlag, in uns von Minute zu Minute einigen, ist das Abbild einer generösen und toleranten, das Menschenrecht erweiternden Verfassung, in der die Generationen leben.
Nicht nur Menschen haben Lebensläufe, sondern auch die Dinge: die Kleider, die Arbeit, die Gewohnheiten und die Erwartungen. Für Menschen sind Lebensläufe die Behausung, wenn draußen Krise herrscht. Alle Lebensläufe gemeinsam bilden eine unsichtbare Schrift. Nie leben sie allein. Sie existieren in Gruppen, Generationen, Staaten, Netzen. Sie lieben Umwege und Auswege. Lebensläufe sind verknüpfte Tiere.
###
1
Die Fliege im Pernod-Glas
Die Fliege im Pernod-Glas
Sie scheint unbeweglich. Mit dem Gummi meines Bleistifts hole ich sie aus der grünen Flüssigkeit und lege sie auf dem Korbgeflecht ab. Ich nehme an, daß sie tot ist. Das Tier aber, nach einigen Sekunden, bewegt sich heftig. In der nächsten Minute ist die Fliege, die kurzlebige, aus meinen Augen verschwunden. Offenbar flugfähig. Sie schien nicht »betrunken«. Ein zähes Tier, das meine Achtung besitzt. Sie hat in der Zeit unserer Begegnung viele Jahre (ihrer Zeitrechnung) verlebt. Sollte sie je Nachkommen haben, wird ihr Stamm mich überleben. Er existiert seit 18 Millionen Jahren. Kleinflieger dieser Art haben durch ihre günstige Haltung zu den Zufällen der Welt ein fast ewiges Leben.
Blumen in der Stadt
Der Mann, ein in Jeans verpackter Körper, durchflutet von Kreislauf. Mit ruhigem Gesicht geht er durch den Tag. Nervosität ist ihm fremd. In erster Linie ist er jung. Unruhig dagegen die junge Frau, die sich neben ihm bewegt. Offenbar will sie etwas erhalten, was er noch nicht zu geben bereit ist: Dauerhaftigkeit. Jetzt setzen sich die beiden auf die Stühle des italienischen Gartenrestaurants. Frühlingstag.
Ihr Hemd ist so gefertigt, daß eine der Schultern stets freiliegt. Der Mann, der Ordnung liebt, auch in der Frage, ob eine Situation intim und verfänglich oder auf ein gemeinsames Mittagessen in der Sonne gerichtet ist, schiebt das Kleidungsstück über die nackte Schulter. Weil es dafür geschneidert ist, fällt es daraufhin von der anderen Schulter herab und bietet dort dem Blick die Nacktheit. Das schafft Unruhe.
Der Tag muß für die junge Frau anstrengend sein. Sie setzt sechs bis acht Ausdrücke in ihr Gesicht, Blicke von unterschiedlicher Stärke; dann muß sie plötzlich gähnen, rettet sich mit dem verräterischen Mund an seine Brust. Stirnrunzeln und Lächeln. Sie kommentiert ein Gespräch, das gar nicht stattfindet, mit ihrer Miene. Der Mann hat seine Gesichtszüge nicht bewegt.
Wenn sie in dieser Weise den ganzen Tag miteinander turteln, meint der Journalist Douglas von Pyrmont, der das prominente Paar beobachtet, ist bei plötzlich auftretender wirklicher Intimität, zum Beispiel wenn sie allein sind am Abend, keine Energie mehr übrig. Was wollen sie dann noch miteinander tun? Sie haben die tägliche Portion Zauber durch kleine Schlucke und Schubse der Annäherung (schon wieder küßt er sie rasch auf den Mund) den Tag über verbraucht.
Der Mann faßt mit seiner breiten Hand an ihr Ohr, zieht daran, faßt in die Kuhle hinter dem Ohr, zeigt souverän seinen Besitz. Dann knetet er ihr Genick, durch das lange Haar hindurchfassend. Ob sie das schätzt, ist ihrem Gesichtsausdruck nicht zu entnehmen. Der wechselt zwischen unterschiedlichen Ausdrücken, ihr Blick sucht den seinen und dann seinen Mund. Von Pyrmont glaubt aber, daß der Ausdruckswechsel eine Art Pausenzeichen darstellt. Er hat die Wechsel des Mienenspiels auf ihrem Gesicht durchgezählt: 19 in der Minute. Man könnte die verschiedenen Mienenspiele auch für einen Ausdruck halten, so von Pyrmont.
Der Mann fährt ihr von unten mit der Hand in den Ärmel, der den Oberarm bedeckt, über dem wieder die nackte Schulter glänzt. Sie nähert, wohl um ihn abzulenken, ihre Mundpartie seinem Mund. Vielleicht ist das ihre Art, die lästige Krabbelhand des Partners aus ihrem Ärmel zu schütteln. Schon vorüber der Kuß. Schon vorbei die Szene. Beide sitzen einen Moment passiv, wissen nicht weiter. Es muß aber weitergehen, und sie haben noch einiges im Repertoire. Ein Spiel wie dieses ist ihr tägliches Geschäft. Zu dieser Mittagszeit sind sie zu träge, es anzuwenden. Die Vorstellung stockt. Sie achten auch nicht auf den Beobachter, während sie doch wissen, daß sie beobachtet werden.
Ihre Jugend, die Gesundheit, spult sich in zwei Temperamenten als einheitlicher Automat ab. Froh sind sie, daß sie leben, geben nicht sich selbst hin, wohl aber einen ganzen Tag ihres reichdurchfluteten Lebens. Das schenken sie einander, ohne beantworten zu können, ob der Andere es so haben will.
Seine Hand (die einzige Unruhe, die er verbreitet) drückt jetzt ihre Hand in Richtung ihres Schoßes, halb unter dem Tisch. Sie wehrt das ab, indem sie ihm ins volle Haar greift, seinen Kopf umfaßt. Da läßt er den Vorstoß sein. Bereiten sich diese zwei Menschen, fragt sich von Pyrmont, der nicht wagt, ein Foto zu machen, jedoch entschlossen ist, in seinem Boulevardblatt über die beiden zu schreiben, auf eine längere Beziehung oder auf einen einzelnen Abend und Tag vor? Was haben sie für gemeinsame Interessen?
Das ist nicht zu erkennen. Sowenig wie einem hellen Morgen ein Wille unterstellt werden kann. Diese zwei Menschen sind ein Stück Natur wie ein Tag, eine Wiese, sie spinnen an keinem Roman. In gewissem Sinn, so notiert von Pyrmont, sind sie BLUMEN IN DER STADT.
»Er hat die herzlosen Augen eines über alles Geliebten«
Ich komme vom Trösten meiner besten Freundin Gesine. Inzwischen bin ich mir sicher, daß sie sich nicht umbringen wird. Überstanden ist nichts. Ich sah selbst zu, wie er sie abkanzelte und die Wohnungstür hinter sich zuschlug. Er besitzt die Delikatesse, daß er noch heute bei ihr wohnt, da er die Kosten für ein Hotelzimmer scheut. Von ihrer Wohnung geht er seinen Geschäften nach, besucht seine neue Geliebte, eine verheiratete Frau, derentwegen er Gesine zurückstufte.
Bei meinen Trostworten (meist nehme ich sie nur stumm in die Arme und bringe sie ins Bett) muß ich darauf achten, ihre Hoffnungen nicht zu nähren, daß er in irgendeiner phantastischen Gestalt zu ihr zurückkehrt. Ich habe seinen Blick gesehen. Gesine hat keine Chance. Niemand in der Welt hat die Möglichkeit, von ihm etwas zu erhalten, was er nicht will. Und er ist satt. Gutgenährt von der Zuwendung der Frauen, an deren Tribut er seit seiner Kindheit gewöhnt ist.
Genaugenommen sind es nicht die Augen, sondern der Blick, der die Gnadenlosigkeit dokumentiert. Die Augen selbst scheinen eher ausdruckslos, etwas stumpf. Der Blick hat gerade wegen seines Mangels an Ausdruck jene »negative« Qualität, die erschüttert. Mir ist schleierhaft, was Gesine je von diesem verwöhnten Jungen wollte. Schon bei der Werbung, in der ersten Stunde (ich war dabei und ging dann unglücklicherweise vorzeitig nach Hause), war er voller Sattheit, sein Blick ein »Verhandlungsblick«. Deshalb glaubte ich fest: »Das muß man gar nicht erst ignorieren.« Nur sah Gesine etwas anderes. Sie sah in seinem fleckigen Gesicht wie in einem Spiegel, was sie empfand.
Ich habe immer gedacht, daß Mütter, die ihre Söhne lieben, in ihnen einen zärtlichen Keim anlegen. Den ernten dann die Menschen, die diesen Jungmännern später begegnen. Statt dessen macht sich in solchen Fällen ein genügsames Patriziertum breit, die Seßhaftigkeit einer Kette männlicher Ahnen, die nur greifen und um nichts bitten. Söhne, die nicht um die Zuneigung ihrer Mütter kämpfen müssen, so mein Eindruck, entfalten in ihrem Innern Monstren. Ich will nicht verallgemeinern und tue es doch. Der Zorn auf Gesines Okkupator löst mir die Zunge für generelle Behauptungen:
###
»Er hat die herzlosen Augen /
eines über alles Geliebten.«
Die geheime Geschichte seines Glücks
Als er nach dem Krieg Filme mit Kirk Douglas sah, die von den Kriegszügen der Wikinger handelten, und von der Herkunft dieses Hauptdarstellers aus einem Clan weißrussischer Juden hörte, fühlte sich der ehemalige Oberleutnant Ferdy Bachmüller in seiner Tat bestätigt. Obwohl er nicht zuständig war, hatte er aus einer in der Nähe des Bataillons zusammengetriebenen Gruppe von Juden einen Mann mit herausstechend blauen Augen ausgesondert. Den Mann hatte er mit Papieren der Division versorgt und als Hilfswilligen (Hiwi) in den Küchentroß seiner Truppe eingereiht. Während der Rückzüge war der Mann eines Tages verschwunden.
Bachmüller war einem momentanen Einfall gefolgt, als er den Mann der inkompetenten Wachmannschaft abtrotzte. Immerhin war er so rassistisch beeinflußt, daß er sogenannte »starke« blaue Augen, die er nur von Postkarten, Buchabbildungen und aus Filmen kannte, sowie eine »kampfstarke«, mit dem Brustkorb aufwärts gerichtete, »germanische« Körperhaltung für etwas Wertvolles hielt (obwohl er selbst keine Zucht künftiger Geschlechter betrieb). Als Frau hätte ihn ein Blick aus solchen Augen entzückt. Er hielt hinreichend Distanz zu dem geretteten Hünen, zu dem er sich hingezogen fühlte.
Daß er später in der Nähe von Uelzen kampflos in britische Gefangenschaft geriet und bereits zwei Wochen später mit gültigen Entlassungspapieren nach Hause gelangte, ja daß ihn wie eine Fee in den Jahren des Vormarsches und der Rückzüge offensichtlich zwei blaue Augen in zahllosen gefährlichen Momenten gerettet hatten, das nahm er als gewiß an, auch in der Zeit, in welcher der Hiwi nach dem Glückswechsel der deutschen Kriegsmacht körperlich das Weite gesucht hatte: »und schlug sich seitwärts in die Büsche«, rezitierte Bachmüller. Er beschäftigte sich viel mit der »rätselhaften« Natur seines Fundstücks. »Seine Stirn geheimnisvoll, die Nase außerordentlich schön und der Mund, obschon zu sehr geschlossen und obwohl er manchmal mit den Lippen nach der Seite zuckte, immer reizend genug.« Oft hatte Bachmüller die Küchenabteilung inspiziert, was er vor Übernahme des Fremden selten getan hatte: zwei Feldküchen, mehrere Panjewagen, auf denen die Vorräte geladen waren, ähnlich einem Zigeunerzug, der dem Bataillon folgte. Nur um den jungen, blonden Mann unauffällig anzublicken. Mit behaupteter, gegriffener Befehlsgewalt, die keiner Nachprüfung standgehalten hätte, hatte er ihn (in der Währung der Machtverhältnisse gerechnet, sagen wir, für 30 Thaler) freigekauft, wenn es auch auf dieser Ebene keine Münzen, die einer behalten kann, und keine Gegenseitigkeit gibt. Die läppische SS-Wache hatte für die Auslieferung ihres Gefangenen an die Soldatentruppe praktisch nichts erhalten außer der Möglichkeit, weiterzumachen.
Wenn der glückliche Bachmüller, der nach 1949 eine Fabrik für Heftpflaster erfolgreich eröffnet hatte, den Film SPARTAKUS sah – und das tat er zwölfmal –, meinte er zu spüren, daß in der Welt inzwischen Nachkommen seines Weißrussen leben müßten. Vielleicht in Australien oder in den USA. Vermutlich arbeitete ein Nachfahre des Geretteten als Söldner oder als Schiffseigner im Kongo. So erlebte Bachmüller beim Anschauen des Films ein Stück »weite Welt«, nahm Eindrücke wahr, die er bei keinem der Eroberungszüge der Wehrmacht je empfunden hatte. Er war König großer Romane, ja in einem gewissen Sinne doch mit diesen blauen Augen (Härte, Macht und Untreue signalisierend) verknüpft. Dem Gefangenen enger verbunden als gedacht, wenn er als Erzeuger von dessen Geschlechterfolge ohne seine Tat nicht hinwegzudenken war. So war, bei aller Differenz zur Gleichgeschlechtlichkeit, die unbedingt zu vermeiden war, eine virtuelle erotische Berührung zu verzeichnen, befremdlich und befriedigend für Bachmüller, besser als jeder ihm bekannte ausgeführte Geschlechtsverkehr, der in diesem Falle, wie er sich sagte, seinerzeit von strengen Strafen bedroht gewesen wäre. Es war kein körperlicher, es lag ein geistiger Genuß in jenem Einfall (und Augeneindruck der blauen Augen des Verhafteten); das war etwas Bleibendes, weil spirituell. Und ich kann versichern, so Bachmüller, es war ein spontaner Entschluß, kein moralischer.
Er schwor bei sich selbst, während des Kinobesuchs des Films SPARTAKUS, bei dem er in seiner Einbildung Kirk Douglas durch das Bild des von ihm gezeugten Weißrussen ersetzte, einen heiligen Eid, daß er künftig nie irgendwelcher Zeitgeschichte vertrauen, niemandem die geheime Geschichte seines Glücks erzählen und immer in der Hoffnung der unmittelbaren göttlichen Hilfen leben und sterben wolle, die aus dem Mut folgt, in dem man die Stimme seines Herzens (voller Vorurteile und doch in frischer Ahnung) hört.
Zwei Träumerinnen stiften Verwirrung am Freitag abend
Die Ermittler im Dezernat für Entführungsfälle, zuständig für das Rhein-Main-Gebiet bis nach Wiesbaden hin, hatten sich schon auf einen geselligen Freitag abend vorbereitet. Da wurden sie alarmiert. Im Städtischen Klinikum Frankfurt-Hoechst war ein Neugeborenes gestohlen worden. Frenzi F. hatte, als Schwester verkleidet, der Wöchnerin Z. das Kind abgenommen, das (nach dem Willen der Mutter) später einmal den Namen Zinat tragen sollte. Unter dem Vorwand, das Neugeborene werde für eine Untersuchung gebraucht, hatte sie das Kind übernommen und war dann nicht wiedergekehrt. Das geschah wenige Stunden nach der Geburt. Die Auskünfte der Wöchnerin blieben verwirrt.
Die Ermittler veranlaßten eine sofortige Suche im Umfeld des Klinikums mit Hubschraubern, die von Wiesbaden-Erbenheim heranbeordert waren. Es gab kleine Waldstücke. Die erfahrenen Polizisten hofften, Hinweise auf den Fluchtweg zu finden. Sie fertigten Zeichnungen an, auf welchen die möglichen Bewegungen einer Frau mit Baby vom Klinikum in Richtung Stadt oder aber in die Wildnis aufgeführt waren. Irgendein Ziel mußte die Täterin haben.
Die junge Frau hatte alle getäuscht: die, welche ihr fremd waren, und auch die Person, mit der sie zusammenlebte. Sie hatte einen aggressiven Täterwillen und doch kein Glück gehabt.
Nach einer künstlichen Befruchtung hatte die 28jährige Frenzi F. eine Fehlgeburt erlitten, ihrer Lebensgefährtin dann aber eine zweite Schwangerschaft vorgetäuscht. Unbedingt wollten die beiden Frauen ihre Zweisamkeit mit einem gemeinsam aufzuziehenden Kind krönen. Die beiden Frauen lebten in einem Vorort von Frankfurt am Main.
Die Dämmerung fiel herein. Mit starken Scheinwerfern leuchteten die Helikopter nach unten, sie fokussierten punktuelle Orte. Über Rundfunk und in der Abendpresse war zu öffentlicher Aufmerksamkeit aufgerufen worden.
Dann kam gegen 21 Uhr der befreiende Hinweis. Nachbarn der beiden Lebensgefährtinnen hatten Verdacht geschöpft. Wie kam ein Kleinkind in deren Wohnung? Küche und eines der Zimmer waren von den Nachbarwohnungen aus einzusehen. Sie meldeten ihre Beobachtung der Polizei.
Die Täterin, erzählte gegen Mitternacht einer der Ermittler in seiner Stammrunde in Sachsenhausen (die Sache war infolge der Veröffentlichungen kein Dienstgeheimnis mehr), hatte um jeden Preis in den Augen ihrer Partnerin als Gewinnerin dastehen wollen. Strahlend hatte sie das kleine Lebewesen, das noch nicht wissen konnte, daß es Zinat heißen würde, aber um sein Bein ein Erkennungsband trug, auf dem dieser Name und eine Zahl eingetragen waren, der Freundin vorgezeigt. Unter der Vorgabe, sie käme soeben aus dem Klinikum. Es war eine abenteuerliche Geschichte, wie die Wehen sie in der U-Bahn attackiert hätten und sie gerade noch den Kreißsaal erreichte. Und die Ärzte hätten ihr das Kind gleich mitgegeben? Frenzis Lebensgefährtin stellte zwar Fragen, war aber zu aufgeregt, auf die Antwort zu warten. Momentweise schien sie irritiert über das, was ihre Gefährtin behauptete.
Wird man sie als Mittäterin belangen? fragte ein Reporter der Lokalzeitung. Dann müßte man ihr, meinte der erfahrene Ermittler, ein Tatwissen nachweisen. Ob das nicht offensichtlich vorliege? Sie unterschätzen die Verwirrung in solchen Situationen, antwortete der Ermittler. Die ganze Partnerschaft der zwei Frauen, meinte er, sei nicht durch Realismus charakterisiert. Zwei Träumerinnen? Träumerinnen, denen an ihrer Beziehung lag.
Fräulein Clärli
Inserat vom 30. April 1945 im Anzeigenteil der Neuen Zürcher Zeitung:
»Ich suche jene Skifahrerin in blauer Skibluse, die mit einer Freundin am Ostersamstag im Zug 16.18 Uhr ab Küblis nach Davos Dorf fuhr und die ich am Ostermontag auf dem Weissfluhjoch wiedertraf und mit ihr redete.
Ich bin: jener Skifahrer in grauer Skihose und grauer Windbluse, der Ihnen am Ostersamstag schräg gegenübersaß.
Leider waren alle Anstrengungen, Ihre Adresse ausfindig zu machen, umsonst, so daß mir nur noch dieser Weg offensteht. Ich bitte Sie deshalb höflich um Angabe Ihrer Adresse unter Chiffre V 6696 an die Annoncenabteilung der Neuen Zürcher Zeitung.«
Der Inserent, bei dem sich die junge Schweizerin interessiert meldete, war ein Roué aus Flandern. Zu einer Eheanbahnung kam es gar nicht, sondern nur beim Kennenlernen zu einem flüchtigen Beischlaf. Danach entwich der Liebhaber, der sich so suchbereit gezeigt hatte, nach Frankreich; er glaubte, daß er dort für den Wiederaufbau gebraucht würde. Im Augenblick in dem er das Inserat aufgegeben hatte, war er aufrichtig der Meinung gewesen, sein Leben hinge von dieser schicksalhaften Begegnung in der Eisenbahn ab. Er besaß eine lebhafte Einbildungskraft, kannte sich wenig. Auch war er in der Schweiz nicht zu Hause. Die junge Frau aber, vom Rechtsbeistand des flüchtigen Kindsvaters beleidigend als »Tretmine« bezeichnet, gebar einen Sohn. Sie verteidigte die illegitime Geburt. Wortlos, vaterlos und in Not, brachte sie das Kind voran. Dieser Sohn war später der Begründer des Eheberatungsunternehmens Matrimonia & Co. in Zürich. Von ihm stammten zwei Töchter und ein Sohn, die alle, auch weil sie eng zusammenhielten, in Princeton studierten und in New York später Stellungen in der Finanzwirtschaft einnahmen. Deren Kinder wurden Popmusiker; auch sie gruppierten sich eng zueinander. Sie pendelten als Schweiz-Amerikaner zwischen den Kontinenten und verweigerten sich gemeinsam den Ansprüchen der Eltern, die aus ihnen GELDMENSCHEN machen wollten. Diese Forderung beantworteten sie mit Trotz. Die GREISIN CLÄRLI, 85jährig, die in ihrer immer noch einfachen Wohnung in Zürich lebte, lud diese Nachkommen in das Hotel Baur au Lac nach Zürich ein. Sie hatte ihren Leuten nichts abverlangt, deren Anfänge sie doch gesetzt hatte, nichts hatte sie je als Dank oder Geschenk angenommen. Jetzt äußerte sie sich in ihrer Tischrede. Sie habe dem ursprünglichen Täuscher und Betrüger längst verziehen, dem eifrigen Inserenten, der sie so intensiv gesucht und dann so rasch verlassen hatte, Ursache der Existenz aller der hier Anwesenden und ihres Anhangs. Im Gegenteil: Sie sei dem Ungetreuen, dem Übertreiber dankbar, wenn sie auf ihre tüchtigen und offenbar vielfältig interessierten Kinder und Kindeskinder blicke. »Die Causa des Verbrechers ist nicht hinwegzudenken, ohne daß dieser Erfolg entfiele«, so hat es Max Frisch formuliert. Ein Schuft habe etwas Gutes zustande gebracht, ergänzte sie, allein durch ein Element, das er selbst nicht beherrschte: durch seinen Eifer, mit dem er mich suchte. Wenn sie wählen könne, sagte sie unter Beifall, so würde sie nochmals diese Augen wählen und das übrige, DEN MANN ALS GANZES, abwählen. Männer, fuhr sie fort, seien ein Lügengeschlecht. Aber die Energie, welche die Lügen in Bewegung hält, sei unentbehrlich für den Fortschritt.
Über die seltsame Familienfeier berichtete die NZZ in einer Kurznotiz, weil der Ausgangspunkt der Affäre ein Inserat in dieser mehr als 200 Jahre alten Zeitung gewesen war. Die Notiz wiederum veranlaßte einen Nachfahren des jungen Belgiers, der am 30. April 1945 inseriert hatte, zu einer Zuschrift. Auf diese Weise lernten sich, sehr spät, Halbcousins, Demicousinen und Halbgeschwister kennen, ohne daß diese »zufällige Begegnung«, so äußerten sie sich, ihnen ein besonderes Erlebnis eingebracht hätte. Es fehlte hier der Druck eines Irrtums oder einer Illusion, welche die Zufälligkeiten Purzelbäume schlagen läßt.
Das Mädchen von Hordorf
Ihre Nachrichten holt meine Schwester selten aus der Zeitung. Gern wollte sie mir bei der Recherche helfen. Sie kannte in Halberstadt eine ehemalige Schulkameradin, die sich in diesen Tagen im Bezirkskrankenhaus in Behandlung befand. Mit ihr telefonierte sie. Diese Frau ging los und sprach mit den Schwestern und Ärzten. In dieser Art der Nachrichtenbeschaffung besitzen die Ereignisse noch die Kontur, welche das Stadtgespräch und das intensive Reden in der Krankenanstalt ihnen gibt. Es sind lebendige Nachrichten.
Zunächst hieß es, das zehnjährige Mädchen, das in der Unglücksnacht von Hordorf eingeliefert worden war, sei nun doch gestorben. Später ergab die Erkundigung, daß es noch lebte. Der Chirurg hielt es in den Armen. Das Krankenhaus war stolz auf die dramatische Operation, die das zertrümmerte Kind bereits am Sonntag mittag wieder zusammengefügt hatte. Das Mädchen hatte die Mutter, die Schwester, den Bruder, den Stiefvater und die Großmutter verloren, als der Personenzug, ein Nachtzug, von dem gewalttätigen Güterzug, beladen mit 1400 Tonnen Kalk, auf der eingleisigen Strecke zuschanden gefahren worden war. Alle diese Bezugspersonen mütterlicherseits waren tot. Die Familie besaß ein Grundstück im Ort Langenstein. Es war notwendig gewesen (auf Grund der Nachrichtenlage war der Tod aller Eigentümer bekannt), den Besitz unter Bewachung zu stellen, weil Plünderungen befürchtet wurden, wie die Schulkameradin meiner Schwester erzählte. Der leibliche Vater der Zehnjährigen wurde noch gesucht. Es fehlte für die Suche an konkreten Hinweisen, weil das schwerverletzte Kind nicht antwortete.
Ein einsames Kind, sagte die Bekannte meiner Schwester. Lange telefonierten sie darüber, was aus dem Kind werden sollte. Man konnte ein so schwer verletztes Lebewesen ja nicht übergangslos in ein Heim einweisen. Nach Heilung konnte man es auch nicht »nach Hause« entlassen, in ein Totenhaus, selbst dann nicht, wenn täglich eine Fürsorgerin (und ergänzend eine Schwester des Krankenhauses) nach ihr sah. Das Kind war schulpflichtig, aber es war vorauszusehen, daß es zunächst in der Schule begleitet werden mußte.
Der erste Zeuge
Nur 100 Meter von dem Unglücksort entfernt, an dem bei der Station Hordorf auf eingleisiger Strecke ein Güterzug mit einem Schienenbus zusammenstieß (zahlreiche Tote und Verletzte), befand sich der Königssaal der Zeugen Jehovas. Der großzügige Raum wurde für die erste Versorgung der Opfer und als Einsatzzentrale der Retter und der Polizei (bald auch der besuchenden Politiker) zur Verfügung gestellt. Der Hausmeister dieser Versammlungsstätte der Gläubigen war erster Zeuge des Geschehens am Katastrophenplatz gewesen, als dieser noch stumm dalag. In den Trümmern (den Nachhall des Zusammenstoßes hatte der Mann noch im Ohr) war kein Laut zu hören, als seien alle tot. Auch wenn Gott die Seinen umhüllt, nimmt er ihnen doch nicht die Wahrnehmung und die Erinnerung. Das Hausmeisterehepaar des Königssaales der Zeugen Jehovas, immer noch verwirrt vom Eindruck jener Nacht, nahm das Angebot einer psychologischen Betreuung durch einen Traumatologen aus dem Ameos-Klinikum St. Salvator in Halberstadt an. Der Experte kommt dreimal wöchentlich herausgefahren nach Hordorf.
Der zweite Zeuge
Der KFZ-Meister hörte einen gewaltigen Krach. Er hatte seiner Frau, die von der Arbeit kam, die Haustür geöffnet. Später meinte er einen Blitz wahrgenommen zu haben. Er nahm das Fahrrad und fuhr zum Bahnhof. Die Stätte des Zugunglücks lag in völliger Stille. Das war es, was den Zeugen so erschreckte.
Der Personentriebwagen aus Richtung Magdeburg war durch den Güterzug aus dem Gleis gedrückt und umgeworfen worden. Jetzt bildeten die Seitenfenster das »Dach«. Der reparaturerfahrene Mann stieg das havarierte Schienenfahrzeug hinauf, bewegte sich mit den Füßen auf den Fenstern und suchte nach einer Möglichkeit, eines dieser Fenster zu öffnen. Er sah unten durcheinanderliegende Gegenstände und Insassen.
Noch immer herrschte die furchteinflößende Stille. Der KFZ-Meister bemerkte einen anderen Zeugen, der bereits vor ihm hiergewesen war. Sie verständigten sich, daß einer von ihnen die Bahnschranke an der Straße, 200 Meter vor dem Bahnhofsgebäude, öffnen solle. Ohne daß die Herkunft der Nachricht feststellbar war, hieß es, Rettungskräfte seien unterwegs. Deren Fahrzeuge mußten einen Weg zur Unglücksstätte finden, daher das Öffnen der Bahnschranke. Die beiden Zeugen suchten nach einem Anhaltspunkt, wie sie sich auf diesem Gelände betätigen könnten.
Der KFZ-Meister wandte sich wieder dem Triebwagen zu und suchte nach einer Eindringstelle. Werkzeug führte er nicht mit sich. Inzwischen lief der Lokomotivführer des Güterzuges heran, den die Schubkraft seiner Waggons 500 Meter über die Unglückstelle hinausgetrieben hatte. Erste Stimmen und das Geräusch lebendiger Menschen. Es hatte den Anschein, daß hinter dem Glas des Triebwagens Hände winkten.
Das verlorene Kind
Aus der Zeit der beschleunigten Zwangskollektivierung im Süden der Sowjetunion wird berichtet, daß im Dorf Prokownaja ein sogenannter Mittelbauer (also nicht zur Dorfarmut zählend, aber auch kein Kulake) seine Abgaben nicht zahlen konnte. Er besaß ein Pferd, eine Kuh, ein Jungrind, fünf Schafe, einige Schweine und eine Scheune. Der Dorfsowjet führte in dem Familienbetrieb eine Beschlagnahme durch. Der Bauer reagierte darauf, indem er eines seiner Schweine ohne Erlaubnis abstach, einen kleinen Teil des Fleisches für die Familie bewahrte, den Hauptteil auf den Markt in die Stadt trug und gegen Brot tauschte. Es erschienen OGPU-Funktionäre auf dem Besitz des Bauern. Sie machten Inventur und beschlagnahmten alles. Der Bauer selbst, dessen Frau und der ältere Sohn, zwei minderjährige Töchter und das Jüngste im Säuglingsalter wurden für die Nacht in der Dorfkirche eingesperrt und am Morgen zum Bahnhof getrieben und in Viehwaggons gesteckt. Endlich fuhr der Zug ab.
In der Nähe der Stadt Charkow hielt der Zug an. Ein Wächter ließ die beiden Töchter heraus, Milch für das Kleinkind zu ergattern. In einer Bauernhütte bekamen sie Lebensmittel und Milch. Als sie zu den Bahngleisen zurückkamen, war der Zug weg.
Die beiden Mädchen wanderten über das Land. Auf einem Markt, von einem Milizionär verfolgt (vielleicht weil sie geklaut hatten), wurden die beiden voneinander getrennt. Porfiria, das jüngere Mädchen, wurde von einer Bauernfamilie aufgenommen.
An dieser Stelle der Geschichte rechnete deren Erzähler, der aus dem Gedächtnis berichtete, mit einer gewissen Erschütterung seines Publikums. Vor allem der Moment bewegte das Herz, in welchem die Mädchen mit Beute zur Bahnlinie zurückkehrten, die Familie wiederzusehen trachteten, der Zug aber bereits weitergefahren war. Das war der Punkt, an dem der Berichterstatter seine wirksame Volte einbrachte: Gar nichts von dem Geschehen sei in das spätere Leben dieses Mädchens sichtbar eingegangen. Bald war sie, als wäre alles vergessen, unterstützt von der neuen Familie, die den Findling aufgenommen hatte, zu einer bewährten Arbeitskraft, ja zu einer Sportlerin auf Bezirksebene geworden. Lernbegierig sei sie gewesen, eine junge Pionierin. Sie war es gewohnt, Motor- und Segelflugzeuge zu fliegen, zeigte Leistung im Stabhochsprung, im Schießen, im 600-Meter-Mannschaftslauf.
Abb.: Porfiria als »Nachthexe«.
Sie war willig und setzte ihren guten Willen in für andere akzeptabler Weise, also kooperativ, ein.
Bald war Krieg. Sie gehörte zum 110. Fliegerregiment, den sogenannten »Nachthexen«. In sehr einfachen einmotorigen Maschinen aus Holz, ehemaligen Sportflugzeugen, ausgerüstet mit einem Sortiment Handgranaten und einer Wurfbombe, flog sie in den Nächten über die Dörfer und die Biwaks hin, in denen der faschistische Panzerfeind seinen Schlaf suchte. Die Störflüge dieser Frauen zersägten die Nerven der jungen Feinde am Boden, die stets, wenn das Motorengeräusch aussetzte und die Maschine sich über ihnen im Gleitflug befand, mit dem Augenblick der »Bombardierung« rechnen mußten, bei der die geringe Wirkung der abgeworfenen Kampfmittel nie ausschließen konnte, daß sie tödliche Folgen hätten.
Und nach dem Krieg? Studierte das inzwischen erwachsene Mädchen Ingenieurswissenschaften. Die Familie, die sie jetzt gründete, lebte in der Zeit Chruschtschows am Fuße des Uralgebirges. Dort gab es organisierte Wohneinheiten, deren Tür man verschließen konnte, die Grundform von Eigentum. Die Frau zeigte keine Sehnsucht nach ihren ursprünglichen Angehörigen, forschte auch nicht nach ihnen, fuhr der Erzähler fort, die sie doch an jenem Tag in der Nähe der Stadt Charkow so fassungslos entbehrt hatte. Sie sprach nicht einmal davon.
###
Was hätte sie auch sagen sollen?Nicht wahr? Wer hätte ihr zugehört?Wenn sie erzählte, dann war das von den Kämpfen 1941, vom Marsch bis Berlin, der folgte.Und innerlich?Wo soll dieses »INNERLICH« sein? Es war ja die ganze Person, die Porfirias Leben führte.###
Hätte aber in der Zeit Chruschtschows oder in einer späteren Zeit (diese Vermutung ließ der Berichterstatter zu) jemand versucht, eines von Porfirias Kindern zwangszurekrutieren, wäre sie dem äußerst wirksam entgegengetreten. Ja, erwiderte einer der Zuhörer, das müssen wir annehmen. Die Wirklichkeit heilt jede Wunde. Aber sie löscht keine Eindrücke. Porfiria wäre vorbereitet gewesen. Sie hat sich die ganze Zeit auf einen solchen Fall vorbereitet, ergänzte der Erzähler.
Für die Zukunft ihrer Krabbe tätig
Schon seit dem Morgen zog eine junge Mutter ihren Sohn, der auf einem Schlitten lag, im Kreis um das Schloßhotel herum. Ihr lag daran, wie sie sagte, daß das Kind an der frischen Luft wäre. Das Söhnchen lag längs auf dem Schlitten, den Kopf zwischen den Vorderkufen, gefährlich nah am Boden, der unter dem Schlitten vorüberzog. Die Mutter hatte den Eindruck, als träume das Kind. Sie schuftete. Die Augen nehmen so nah an der Schneeoberfläche ein Geflirre wahr, Unterschiede des Lichts und der Körnigkeit, unbestimmte Zeichen von Fußeindrücken, rasch vorüber, Oberfläche. Das Unbestimmbare schien im Kopf des Jungen eine Art Reizung auszulösen, dachte sich die Frau, die das Gefährt voranzog. Das Kind, sonst zappelig, war überaus ruhig, konzentriert und atmete. Daß das, was die Augen sehen, keinen Sinn hat, läßt den Atem fließen. Das ist ja der Zweck der Übung, sagte die junge Frau: den Lungenumsatz anregen. In der Stadt wäre das unmöglich. Manfred wäre nämlich nicht »spazierengegangen«; er galt als »gehfaul«. Sie hoffte, auf diese Weise die empfindlichen Lungenbläschen des Kindes »abzuhärten«, gegen die beständige Neigung anzuarbeiten, sich zu erkälten.
Einmal forderte sie Manfred auf, sich umgekehrt auf dem Schlitten zu plazieren, damit sein Kopf nicht wenige Zentimeter über dem wechselnden Boden hinge und sich die Nase aufschlüge. Vielleicht auch als Abwechslung. Der Junge kam der Aufforderung nach. Die neue Position bewährte sich nicht. Er mußte die Knie anziehen, und der Kopf hing nun nach hinten über die Schlittengrenze hinaus, ohne den Schutz der Kufen. Dafür bist du schon zu groß, sagte die junge Mutter anerkennend. Jetzt hatte sie schon zweieinhalb Stunden lang Kreise geschlagen, in Kilometern gerechnet eine beachtliche Strecke.
In ihrem Kleiderschrank klebte ein Bild
Sie hing sehr an ihrer Schwester Andrea. Nur ein Jahr Altersunterschied. Sie heiratete einen Erfolgsmenschen bürgerlicher Herkunft. Die Ehe kostete sie ihren Namen und 16 Jahre ihres Lebens. Gerda stammte aus preußischem Adelshause. Vier Generäle, ein Regierungschef unter ihren Vorfahren.
Später gestand sie sich ein, daß sie ihren Mann geliebt hatte. Sie »verfriemelte« also, wenn sie ihn entbehrte, blühte auf in seiner Gegenwart. Sie brauche ihn »wie die Luft zum Leben«, sagte sie, auch wenn sie ihn innerlich mißbillige. Aber was bedeutet dann innerlich? Gerdas Abhängigkeit änderte sich nicht, als er sie enttäuschte. Sie waren ein merkwürdiges Paar, denn auch er hinterließ ihr Zeichen, daß er sich zu ihr oder wenigstens zu einzelnen Eigenschaften von ihr hingezogen fühlte. In ihren Kleiderschrank hatte sie ein Bild aus Shakespeares Romeo und Julia geklebt. Ein Jüngling erklomm die Balustrade eines Fensters. Unterschrift: »Zur Liebe bin ich geboren.« Das hatte ihr Mann ihr geschenkt. Sie ließ das Bild dort hängen (wo es keiner sah), auch wenn dieser »Gefährte vieler Jahre« von einer Krankheit namens »Sinneswandel« ergriffen war. Er lebte den Rest seiner Jahre mit einer JÜNGEREN ANDEREN.
Als nun seine Beerdigung organisiert war, die neue Familie (er hatte noch zwei Kinder mit der anderen gezeugt) und die ältere in ihrer hierarchischen Ordnung dem Eingang der Aussegnungshalle zustrebten, wollte Gerda ihren drei Söhnen, die jetzt erwachsene Riesen waren, je einen Trauerstrauß reichen, erstanden in einem der Blumenläden, die dem Friedhof attachiert waren: Jeder sollte dem leiblichen Vater ein solches Gebinde ins ausgehobene Grab hinabwerfen. Die Söhne weigerten sich. Andrea, die Schwester, kritisierte Gerda hitzig. Diese wollte aber doch nur, daß der Romeo, der unverbrüchlich als ein Teil der Seele des Toten ihr gehörte, eine Art zärtliche Nahrung, eine Henkersmahlzeit von den Seinen erhielte. Seine Söhne sind nicht mehr die seinen, antwortete Andrea. Dabei wollten die Söhne mit ihrer Weigerung, die Sträuße entgegenzunehmen, nur sagen, daß sie selbst etwas aussuchen wollten, das sie dem toten Vater hinabwerfen könnten. Sie wollten nicht von der Mutter, deren beharrliche Zuwendung zu dem verräterischen Vater sie mißbilligten, mit Trauerinstrumenten versorgt sein.
Andreas Kritik blieb grundsätzlicher. Sie hätte es gern gesehen, daß die Schwester ihren angestammten Namen wieder annähme. Die Hoffnung, daß der verlorene Liebesgefährte doch noch zur Schwester zurückkehren würde, hatte sich offensichtlich durch dessen Tod zerschlagen. Der Tote lag aufgebahrt. Entgegen der üblichen Sitte war der Sarg nicht verschlossen. Sein (von den Bestattern geschminktes) Gesicht lockte Gerda, die sich nicht einmal mehr als Witwe bezeichnen konnte, aber sich nach dem Geliebten sehnte (den sie sich wie den Mann vorstellte, der einst um sie geworben hatte, nicht aber als geschminkte Leiche), ihre Gedanken schweifen zu lassen. Etwas in diesem Antlitz, dessen gegenwärtiges Aussehen sie im Kopf korrigierte und in ihrem Gemüt, suchte sich mit der Erinnerung zu vereinigen, die sie besaß. Wie Geier wachte die Familienpolizei darüber, daß sie sich nicht gehenließ. Sie sollte eine gleichgültige Miene zur Schau tragen, sich am Nachmittag auf der Feier nicht betrinken, sich zu angemessener Zeit verabschieden und nach Hause fahren. Von außen betrachtet gehorchte sie. Insgeheim wußte sie, daß sie dem Clan nicht genügen konnte.
Stärkung mit zeitversetzter Wirkung
Damit ich nicht vom Fleische fiele, ordnete meine Mutter an, daß ich nach meinem ersten Geburtstag jeden Tag um 11 Uhr früh eine Tasse Kalbsbrühe erhielte. Mit Knochen aus der Fleischerei Steinrück. Das war für die Geburtsjahrgänge 1929 bis 1932 in der oberen bürgerlichen Mittelschicht eine übliche Praxis. Die Kinder sollten sich später auszeichnen. Man rüstete die Kinder mit Höhensonne, Lebertran und einer solchen Fleischbrühe zu einer besonderen Widerstandsfähigkeit aus, die sich schon zehn Jahre später in der Notzeit und nochmals im hohen Alter für eine ganze Rotte ehemaliger Kinder jener Zeit positiv auswirkte.
Abb.: »Jeden Tag um 11 Uhr früh eine Tasse Kalbsbrühe.«
Das Glück des dicken Bonaparte
Ein Schauspieler, der von Haus aus ein Kindergesicht und schmale Schultern hat, wird als Napoleon kostümiert, und von Szene zu Szene wird sein Gewand mit mehr Kissen ausgestopft, so daß er dicker und dicker wird. Stets wird er zu einer Waage geführt. Sein Gewicht wird im Moniteur publiziert: »Die Gesundheit des Kaisers war nie besser.« Sobald er in seinem Kostümwanst nicht mehr sitzen kann (und auch kaum zu gehen vermag), tanzen seine Gardesoldaten, die Bärenmützen, im Reigen um ihn herum, wie man es einst zu Revolutionsfesten um die Säule der Freiheit tat. Diese 1968 entworfene Filmsequenz von Stanley Kubrick war als Vorlage gedacht für eine Komposition von John Cage für Kinderpiano. Das sollte bei der Premiere von Kubricks großem Napoleon-Film als Vorfilm dienen.
Wie Zorn sich wandelt
Das Eulengebirge erhebt sich abrupt und imposant aus der schlesischen Tiefebene. Ein Regiment Dragoner ritt am 5. Juni 1844 in sechs Kolonnen mit Nachschubwagen in das Gebirge ein. Die Truppe hatte den Auftrag, einen Aufruhr der Weber niederzuschlagen und durch ihre Präsenz die Ortspolizei zu verstärken. Am Abend dieses Tages kam die Truppe ramponiert aus den Bergen zurück. Schon rückte Verstärkung heran, welche Geschütze mit sich führte. Diese neue Truppe schlug am 6. Juni 1844 den Weberaufstand nieder.
Das Eulengebirge ist in jener Epoche dicht besiedelt. Es besteht ein Überschuß an Arbeitskräften. Schon 1793 und 1798 hatte es Aufstände gegeben. Sie richteten sich gegen Fabrikanten und Zwischenhändler, sogenannte Verleger, die Rohstoffe anlieferten, sie gegen Lohn bearbeiten ließen, dann lagerten und weiterverkauften.1 Weder die Unternehmer und Verleger noch die Weber besitzen die Mittel, moderne Webstühle aus England zu kaufen. Sie sind in der Konkurrenz unterlegen. Kein Übergang von Qualität zu Massenproduktion, keine Kinderarbeit oder Ausdehnung der Arbeitszeiten in die Nacht hilft. Ein Teil des Lohnes wird in Form von Rohstoffen gezahlt, die neue schlecht entlohnte Arbeit ermöglichen. Hierdurch entsteht eine Verschuldung.
In Europas Hauptstädten wurden der Aufstand und seine blutige Niederschlagung zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Im Eulengebirge selbst dagegen verformte sich der Zorn, der nicht nur die Weber ergriffen hatte und die am Aufstand Beteiligten, sondern auch die Zeugen des Geschehens, die nicht am Aufruhr beteiligte Bevölkerung. Zorn oder Wut wandelten sich in eine subversive, jedoch vorsichtige Haltung. Wollte man überleben, kam es darauf an, die aufrührerische Gesinnung zu verbergen. Dieses äußere Verhalten wirkt jedoch auf das Innere zurück, und die Glückssuche findet neue Wege. Auf den Gütern Wüstewaltersdorf und Hausdorf, die den Siedlungen der Weber benachbart sind, rückten die abhängig Arbeitenden näher zu den Eigentümern des Landguts hin, bemüht um Schutz. Obwohl nach 1807 als frei erklärt, lebten sie tatsächlich im Status von Leibeigenen. Verheißungsvoll blieb der Wegzug, der Weg in die Städte, wenn doch Widerstand vor Ort, vor aller Augen demonstriert, hoffnungslos war. Mein Großvater mütterlicherseits ist der Sohn von August Wilhelm Hausdorf, geboren und arbeitend auf Gut Hausdorf; er ist nach diesem Landgut benannt. Er wählt den Militärdienst. Er ist 26 Jahre alt, als er der Niederschlagung des Weberaufstands zusieht. Gerade ist er aus dem Militärdienst entlassen. Stünde er auf seiten der Aufständischen, wäre er qualifiziert zum Rädelsführer, wie es der Reservist Moritz Jäger in Gerhart Hauptmanns Drama Die Weber ist. Statt dessen meldet er sich freiwillig zur Landwehrreserve, die 1848 in Berlin die Revolution bekämpft. Zum Lohn erhält er eine Schankkonzession in Berlin-Köpenick. An den strategischen Eckpunkten der Stadt Berlin liegen diese Kneipen, die von Unteroffizieren geführt werden, die als loyal gelten. Solche Treue kann auch aus umgemünzter Aggression, aus innerem Zorn bestehen und intensiviert dann die Zuarbeit.
Für meinen Großvater mütterlicherseits, den Sohn des militärfromm gewordenen zornigen Vaters, war charakteristisch, daß er nicht lügen konnte, ja wenn er nur schwindelte, etwas verbarg oder übertrieb, mußte er grinsen. Das hat meine Mutter von ihm geerbt. Es ist das Zeichen dafür, daß der Clan ursprünglich einmal nicht die wahren Gefühle und Solidaritäten nach außen zeigte und jetzt dauerhaft die Fähigkeit verloren hat, die Unwahrheit zu sagen.
Abb.: Alfred Hausdorf, Vater meiner Mutter. Aus der Linie der Hausdorfs, die aus dem Eulengebirge kommen.
Eine Kette von Vorfahren
1715 ist einer geboren, der nächste 1742, ein dritter Vorfahr 1818, dann eine Geburt im Jahre 1864 – das ist schon mein Großvater mütterlicherseits. Jeder von diesen Männern ist charakterisiert durch eine Anfälligkeit der Schleimhäute in Lunge und Nase, viermal jährlich. Mein Großvater ist an einem solchen Katarrh am 21. Februar 1936 gestorben. Auch haben sie alle einen Einriß im rechten Daumennagel. Ein genetischer Defekt verhindert die gleichmäßige Versorgung der durchscheinenden Keratinplatte, der Einriß ist geringer als der Bruchteil eines Millimeters.
Das Kind, das ein Jahr nach 1715 über einen Holzboden krabbelt, bewegt sich zur gleichen Zeit, in der Karl XII