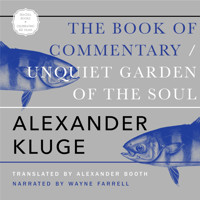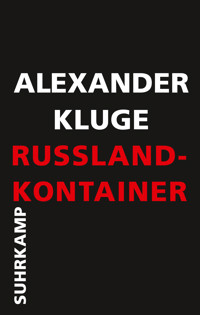27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum Anlass seines 90. Geburtstags erscheinend, ist dies vielleicht das persönlichste Buch von Alexander Kluge. Das Buch der Kommentare folgt dem spielerischen Geschwisterkind Zirkus. Kommentar auf dem Fuße, bietet diesem zugleich aber die Stirn, führt den Leser mit bitterem Ernst hinein in den »unruhigen Garten der Seele«.
Ausgangspunkt der Erzählung ist der düstere Advent 2020. Wir erleben eine Karambolage zweier Lebenswelten: Ein Virus drängt sich in unser Leben ein und stellt an unsere Gewohnheiten und unsere Intelligenz hartnäckige Fragen – vertraute Fragen und doch in ganz neuer Beleuchtung: Wie verlässlich sind die obersten Führungsetagen unserer Welt? Wie zerbrechlich ist der Mensch? Was ist ein »Selbst«, ein »Ego« und ein »Ich«? Wie erzählt man von der Nähe? Und welche Rolle spielt dabei die Orientierung: DER KOMMENTAR?
»Kommentare sind kein lineares Narrativ. Sie sind Bergwerke, Katakomben, Brunnen, die stollenartig in die Tiefe graben. Es reizt mich, diese besondere Form der Narration neu zu erproben.« Mit dieser programmatischen Ausdeutung des Begriffs »Kommentar« führt Kluges neues Buch weit zurück in die antike Bibliothek von Alexandria und in die mittelalterliche Scholastik, inspiriert durch die kürzlich erschienene Geschichte der Philosophie von Jürgen Habermas. Zugleich schlägt der Autor, 1932 geboren, den Bogen über die Knotenpunkte des »Langen Jahrhunderts«, das vor seiner Geburt begann und 2022 nicht enden wird. Erzählerisch erfassen die Kommentare unsere unruhige Gegenwart und berühren die Konturen der Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Alexander Kluge
Das Buch der Kommentare
Unruhiger Garten der Seele
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-76965-2
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Drei Geschichten als Vorwort
Vielleicht hat ein Teil der Sinneswahrnehmung ihren Sitz gar nicht im Kopf der jungen Frau, sondern zwischen ihr und den Kindern, die längst an einem fremden Ort sitzen und lernen
Im Badezimmer war der Boden nass. Die Füße auf der nassen Fläche, das Zeichen der Kinder, die eben noch in dieser Nässe patschten. Fußabdrücke, schon verschwommen. Die Mutter, berührt von diesen Spuren der Anwesenheit ihrer Lieben (inzwischen sollten sie schon im Klassenraum angelangt sein), wischte diese »Dokumente von Lebendigkeit« (mit Bedauern, aber der Ordentlichkeit hingegeben) mit Lappen und Schrubber, bis der Boden wieder trocken war. Noch eine Zeitlang bewahrte sie die Tapp-Spuren der Füße auf nassen Fliesen in ihrem Sinn. Dann verblasste auch diese Spur. Sie hätte den Vorfall Dritten nicht mitteilen können. Wie beschreibt man Patschfüße? Man muss die »Lust an der Nässe unter den Füßen von Kindern« mit in die Worte des Berichts kleiden. Worte sind oft arm, wenn sie die menschlichen Sinneseindrücke direkt wiedergeben sollen. Worte tun sich schwer in der Kombination von exaktem Nerveneindruck (Moment) und Empathie, die ihren Sitz nicht in den Nerven, sondern in der Vorgeschichte und in innerer Verbundenheit hat (Dauer). Erst beides zusammen enthält »moderne Sinnlichkeit«.
Sirenenton, der mir als Neunzigjährigem immer noch in die Knochen geht
Weil es in der Feuerwehr-Dienstvorschrift der Gemeindeverwaltung so noch aus den Jahren vor 1945 vorgesehen ist, ertönt einmal in der Woche ein Probealarm auf allen Schulhöfen der Stadt. Der Sirenenton ruft Schüler und Lehrer auf den Schulhof. Sie verharren dort kurze Zeit und rücken dann wieder in die Klassenzimmer ein. Erprobt wird erst in zweiter Linie der Gehorsam, das reibungslose Verlassen des Schulgebäudes bei Gefahr. In erster Linie geht es darum, die Funktion dieser öffentlichen Warnanlagen, der Sirenen, zu erproben.
Diese Sitte wurde erst vor elf Jahren aufgegeben. Seither werden die Sirenen nur noch intern inspiziert. Sie werden nicht mehr betätigt und erprobt. Niemand kann sicher sein, dass sie in einem Ernstfall, zum Beispiel bei einem Fliegerangriff auf die Stadt, ihre Kassandra-Stimme wirksam erheben. Was würde die auf dem Schulhof versammelte, alarmierte Schar im Falle einer tatsächlichen Gefahr unternehmen? Das hängt von der Gefahr ab. Eine Gas- oder Brandkatastrophe in der Nähe? Ein Kriegsausbruch? Es bleibt für heutige Schüler und Lehrer als Übungsfall zunächst unanschaulich. Im Fall einer Pandemie wäre der Sirenenton unbrauchbar. Und wenn sich die Erde auftut, der Boden bebt? Das ist unwahrscheinlich in Opladen.
Kommentare sind Brunnen
Kommentare sind kein lineares Narrativ. Sie berichten vertikal. Sie sind Bergwerke, Katakomben. Mit Verblüffung habe ich im Band 1 des Werkes Auch eine Geschichte der Philosophie von Jürgen Habermas die Hinweise auf die Tradition der Glossatoren in Bologna gelesen. In die antiken Rechtssammlungen, deren wichtigster Kodex aus der Zeit des Kaisers Justinian überliefert ist, tragen sie Erläuterungen, Anmerkungen, Hinweise ein. An diese Glossen knüpfen später, bei Gründung der ersten Universitäten in der Hochscholastik, die Kommentatoren an. Die Arbeitsform der Kommentierung liegt näher bei der Idee des Sammelns als bei der Idee des Gestaltens. Sie steht der Poetik der Sammlungen der Brüder Grimm näher als der dramatischen oder der novellistischen Form.
Es reizt mich, diese besondere Form der Narration neu zu erproben. Peter Schäfer hat uns gezeigt, wie solche Kommentierung bei Auslegung des Talmuds der FORTSCHREIBUNG PERMANENT SICH FORTSETZENDER TEXTE dient. Es geht um Ausdrucksweisen kooperierender Öffentlichkeit, auch solcher Öffentlichkeit, die heterogene Zeiten überbrückt. Nicht zuletzt der Respekt vor dem Prinzip der FRAGMENTIERUNG, der Respekt vor dem Besonderen und der Einzelheit (und deren Verteidigung gegen das bloß allgemein Verfügende), spricht dafür, so etwas immer erneut zu versuchen. Die Aufforderung dazu gehört zu den Linien der Frankfurter Kritischen Theorie. Die Beobachtung unserer »zerrissenen Realität« erteilt die Erlaubnis zu unvollständiger Nachricht. Das Wort »Versuch« erhält frischen Elan. Um mit den großen algorithmischen Ungetümen der Big Five im Silicon Valley Augenhöhe zu wahren, sind alle bescheidenen Mittel recht. Das Formprinzip des Kommentars war immer schon Arbeitsform der poetischen Kritik.
STATION 1Die Herausforderung, die vom düsteren Advent 2020 ausgeht
Abb. 1:»Heiligabend 2020«.
Abb. 2:»Ein blassblauer Planet«. Falschfarben.
Blick auf einen seltsamen Dämon, der in keinem Sagenbuch der Antike verzeichnet ist
Das aus der Lungenzelle soeben ausgebrochene Virus zeigte im Elektronenmikroskop ein wüstes Aussehen. Die Virologin sah verblüfft auf das ungestüme Bild. Das Wesen selbst hatte bei seiner Abenteuerfahrt, aber auch bei seinen vielen Teilungen, zahlreiche Fehler in der Weitergabe seines genetischen Codes begangen. Und so hatte das RNA-Stück (man kann nicht sagen »das Tier«), dieses Ding oder »diese Architektur« oder »dieser Alien« oder »diese Mutation«, ein merkwürdiges Aussehen. Fetzen von Zellmaterial der Wirtszelle rings um den früher geometrisch eleganten Körper geschlungen, Eindruck eines Tigermauls, um das herum Reste eines geschlagenen Schafes sich bewegten – so wollte es die Virologin bezeichnen, die einzige Zeugin dieses Moments. An der Stelle der fehlenden Moleküle, die das Virus abgeworfen oder verloren hatte, waren fremde Moleküle in die Hülle buckelartig aufgenommen. Die Proteinhülle hatte sich ausgebuchtet. Kaum noch Ähnlichkeit mit dem Wesen, das ursprünglich in den menschlichen Kreislauf eingewandert war und das noch den Abbildungen in den Lehrbüchern einigermaßen entsprochen hatte.
Von jetzt an waren noch weitere Mutationen im Taktschlag von unter einer Milliardstel Sekunde zu erwarten, die zu unerwarteten Fraktionen von einigen Millionen Individuen binnen kurzer Menschenzeit führen konnten. Das alles sah die Virologin – es war die Abendstunde vor Heiligabend – in ihrem Elektronenmikroskop nicht als Einzelheit, sondern in der Schwemme der inzwischen durch Teilung aus den ursprünglichen Eindringlingen entstandenen Milliardenschwärme. Ein jedes mit zerfetztem Gewebe, fremdem und eigenem, um sich herum, dazwischen die schützende proteinträchtige Haut des Virus, die durch nichts zu besiegen ist außer von kräftiger Seife.
Eigenartiger Sitz einer uns fremden Intelligenz
Viren, sagte die Virologin – und wies zugleich darauf hin, dass der Ausdruck Virus immer, auch im schärfsten Elektronenmikroskop, eine Menge von einigen Millionen, Milliarden oder auch Billionen von Exemplaren, einen Klumpen, bezeichnet –, sind zur Vergesellschaftung verurteilt. Ein einzelnes Individuum seiner Art lebt nicht lange. Seit Jahrmillionen, wie gesagt: als Pulk, sind sie »intelligent«. Obwohl wir von keinem Virenhaufen sagen könnten, dass er irgendeinen »Verstand« hätte, einen »Willen« oder ein »Motiv«. Blindlings mutieren die Viren, wenn sie sich teilen. Sie verkleben hinter sich ihren Arbeitsplatz. Ja, fügte die Forscherin hinzu, man kann nicht einmal genau sagen, wo die Stellen liegen, die in diesen winzigen »Körpern« das Leben enthalten. Winzlinge. Und schließlich entscheidet die Reaktion der Umwelt, in die sie hineingeraten, in der sie Mutationen vollführen – absichtslos, irrtümlich, aus unbändiger Bereitschaft, Fehler zu machen –, über Misserfolg oder Erfolg der Vermehrung: über ihre Vernichtung oder ihr Überleben in gigantischer Größenordnung. Eine Generation ist mit der anderen nicht identisch, steht aber in einem Fortsetzungszusammenhang, so dass man, so die Formulierung der Virologin, von einem kontinuierlichen Faden von bis zu 3,5 Milliarden Jahren Länge reden kann. Man kann sagen: Das sind Zufallsketten. Aber es sind Ketten …
Herausforderung an unsere Landesverteidigung
Die (vorübergehende) Unzähmbarkeit des Virus wirft uns Menschen auf uns selbst zurück. Wir zählen unsere Waffen. Wir verändern unsere Gewohnheiten. »In Abschottung aus Einsicht«. Wir sind lernfähig.
Unsere Bundeswehr ordnet Soldaten ab zum Schutz von Altersheimen. Gegen den Gegner können sie mit ihrer Ausbildung und ihrer Bewaffnung wenig ausrichten. Sie stellen sich geschickt an, gelegentlich auch unbeholfen. Wie »ungelernte Hilfskräfte«. Dem Gegner sind sie mit ihrer Schießkunst unterlegen.
Ein zentrales Problem, so die Virologin Karin Mölling, ist die Lebensweise in Metropolen. Zu den Bedingungen der Krise zählen die Verkehrsströme auf dem Planeten, ein Luxus, der zum Begriff »Kriegszustand« nicht passt. Pandemien erfordern eine dezentrale Lebensweise. Für den Fall eines kriegerischen Konflikts, vielleicht unter Einsatz von Atomwaffen oder bisher unbekanntem Kriegsgerät, existieren keine Pläne für die Räumung von Metropolen.
Unentschiedenes Wetter vor und um Weihnachten in Mitteleuropa
Mitte Dezember bewirkt die aufkommende Westströmung des Wetters allmählich einen Wärmeausbruch. Horizonte und Himmel werden feucht über Deutschland. Wir, die wir im November die Wintersachen hervorgeholt und uns winterlich eingekleidet haben, schwitzen am ganzen Körper und stinken in den Achselhöhlen.
Dieses Zögern der Winterzeit im Advent, als käme etwas Überraschendes auf uns zu, führt zu Beklemmungen im Gemüt. Es entsteht eine Zeit der Erwartung entschiedener Kälte. Solche Kälte, die aber meist erst im Januar auftritt, kann in Tagen oder Wochen kalkuliert werden, eine solche artikulierte Wetterperiode endet also mit Gewissheit. Die schlaffe, unentschiedene Witterung Mitte Dezember (vom 24. bis zum 31. Dezember) macht dagegen den Eindruck, sie werde nie enden. Sie legt sich aufs Gemüt wie eine »Schlammperiode des Geistes«. Schlamm ist kein Element. Er ist nicht fest, nicht endlich, nicht hart, nicht unterschieden und nicht entschieden.
Desorientierung unseres Hundes zu Heiligabend
Mein Hund sitzt in Wartestellung. Er erwartet einen Bissen, ein Stück vom »Tisch der Herren«. An sich hat er seine Abendmahlzeit bereits hinter sich: Nassfutter aus Huhn mit Distelöl und Kalb aus der Dose (Mischfutter für Hunde bis zu einer Größe von vier Dezimeter). Das ist jedoch different zu dem, »was von der Herren Tische fällt«. Das Letztere hat den Reiz der Überraschung für den Hund, des Unerwarteten, des Hoheitlichen. Oft bemerke ich, dass der Hund unser Verhalten als einen Irrtum ansieht. Der Irrtum besteht darin, dass er nicht als Mensch, Mitglied der Menschengesellschaft, der er doch ist, von uns wahrgenommen wird. Die Anteilnahme als Familienangehöriger erlebt er nur, wenn es ihm schlecht geht, er seine Pfote verletzt hat. Sonst wird ihm die Teilhabe vorenthalten. Er sitzt nicht auf einem Stuhl mit am Tisch. All das beruht auf Missverständnis.
Demzufolge erhält er zu Heiligabend nur ein winziges Stück von den Tellern, von denen die Erwachsenen essen. Nervös sitzt er unter dem Tisch, sichtlich enttäuscht, ja gedemütigt. Für ihn hält dieses Weihnachtsfest, durch das Virus beschädigt und beschränkt, nur Irritationen bereit. Personen anwesend, die er nicht kennt. Ein Brocken Rindfleisch, und er wäre mit Jesus versöhnt. Er kennt keinen Hund mit Nachnamen Christus. Man nimmt den Geruch vom Hintern ab als Hund. Ein Geisteswesen von vor mehr als 2000 Jahren hat keinen Geruch irgendwelcher Art.
Die Ausräumung überflüssiger Feiertage in einer Situation des Deutschen Reiches, welche die Anspannung aller Kräfte erfordert / Vertrauliche Informationen direkt aus einer Teestunde des Führers
Im Restaurant Horcher gestern legte Ministerialrat Berndt aus dem Reichspropagandaministerium – er gehört dort zum engsten Stabe von Goebbels – die Gedanken des Führers dar zum Weihnachtsfest 1942. Sobald irgendwie Zeit sei, habe der Führer in einer Teestunde gesagt, werde sich die Reichsführung der Kirchenfrage zuwenden. Dem Unfug der kirchlichen Feiertage (vor allem deren Häufung zum Jahreswechsel) müsse ein Ende gemacht werden. Bismarck habe mit seiner Wendung gegen die Machenschaften des Vatikans auf Reichsgebiet nur halbe Arbeit geleistet. Da erstarrt die Front im Osten zu Eis. Der Feind bedroht unsere Stellung in Nordafrika. Und im Reich werden die dringlichsten Notmaßnahmen, die entschiedensten Aufgaben aufgehalten durch eine Kette von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. Jedes Mal zieht sich der Angriffsgeist, der Front und Heimat verbindet, quasi in mittelalterliche Höhlen zurück. Soeben sei dem Führer mitgeteilt worden – bei dem Bericht sei Hitler, während er dem Tee zusprach und an Keksen knabberte, heftig aufgebraust –, dass Großbetriebe während der Weihnachtstage völlig pausierten. Nur ein Notdienst sei vorgesehen. Statt Notwehr in einem alles entscheidenden Krieg Tage der sentimentalen Innigkeit. Überhaupt lehne der Führer die Verehrung eines seinerzeit verurteilten Schwächlings und Bußpredigers, eines Opfers der römischen Justiz, ab.
Spielt es dabei eine Rolle, dass Jesus Jude war?
Nach Auffassung des Führers sei Jesus kein Jude gewesen.
Wohl möglich sei es, so Berndt, dass ein höherer römischer Offizier eventuell gallischer oder germanischer Abkunft, in den Orient versetzt, dort die aramäische oder auch kurdische Maria geschwängert habe. Der Punkt sei: kein Jammerton über 2000 Jahre hinweg wegen eines einzelnen Opfertodes! Diese Auffassung des Führers sei der Kirchenführung mitgeteilt worden: ohne Ergebnis oder dortige Reaktion. Ein solches Aufräumen gegenüber mittelalterlicher Kirchenmacht werde auch, so der Führer, Auswirkung auf die »Opernwelt der Zukunft« haben. Auch dort könnten nicht beliebig viele Soprane in den Schlussakten sterben und ein Gejammer über solchen Opfertod die Aufmerksamkeit des Publikums blockieren, die doch für das aktuelle Zeitgeschehen und die Hinwendung darauf gebraucht werde. Der Führer wiederholt: Seit Bußtag und Allerseelen im November (die er schon während der Kriegszeit auf einen Sonntag verlegt habe) reihe sich eine ununterbrochene Kette unnötiger Ausfalltage aus kirchlichem Grunde aneinander. Berndt zählte auf: vier Adventssonntage, drei Feiertage. Zähle denn der Führer die Sonntage gleich mit? Selbstverständlich, antwortete Ministerialrat Berndt. Der Führer sei über die schiere Häufung von Samstagen und Sonntagen im Jahr entsetzt gewesen. Rückfrage: Könnte man denn in einem Krisenjahr wie diesem das Weihnachtsfest nicht ganz absagen? Oder es auf einen späteren Zeitpunkt nach dem Friedensschluss vertagen? Durch Gesetz im Reichstag oder durch Sonderbefehl des Führers? Oder durch ministerielle Rechtsverordnung?
Berndt wollte über die Frage der Form, mit der die kirchliche Sperrung von »Kriegszeit« künftig ausgeräumt werden sollte, hier am Tisch nicht sprechen. Die Kellner trugen den zweiten Gang auf, füllten Getränke nach. Wie leicht konnte sich unter ihnen ein fremdländischer Agent oder ein Schwätzer befinden, der die Informationen weitertrug.
Es gehe, wechselte Berndt die Gesprächsrichtung, um die Auseinandersetzung mit dem Christentum überhaupt. Da, wo Christentum sei, müsste nationalsozialistische Überzeugung hin. Dieser innere Kampf, bei dem die Jugend gegen eine überalterte Generation Altgläubiger antritt, sei der wesentliche Inhalt einer erneuten »Nacht der langen Messer«, einer zweiten nationalsozialistischen Revolution, auf die das Deutsche Reich seit 1934 warte. Es gehöre aber in jedem Fall eine gründliche »Kalenderrevolution« zum Programm, und somit sei »die Freizeichnung der realen Zeit des Jahreswechsels für den Kampfeinsatz« ein Bestandteil des Programms. Selbstverständlich müsse man für bestimmte Regionen im süddeutschen Raum Rücksicht walten lassen, wie sie ja auch bei der Weißmehlzuteilung für Wien mit Rücksicht auf die dortigen Lebensgewohnheiten und Vorurteile Praxis geworden sei. In jedem Fall gelte es aber, mit der Verherrlichung des an sich schwachen Jesus aufzuhören, noch dazu eines Kindes. »Mit seiner späteren jämmerlichen Fleischwunde im Unterbauch«, die von keinem Militärarzt der Gegenwart als »Heimatschuss« anerkannt würde. Seltsam daran sei, dass sich die Feiertage in der Winterszeit so sehr häuften, und zwar immer dann, wenn der anfängliche Kälteeinbruch im November von einem schlappen Feuchtwetter abgelöst werde, das zu nichts gut sei als zur Verbreitung von Grippeviren.
Der Taxifahrer auf der Suche nach der philosophischen Republik
Meine Frau wollte mit dem bärtigen Mann an der Tür keinen Kontakt haben. Sie traute ihm nicht. Sie schickte mich einen Stock tiefer, wo der Mann wartete. Der bärtige Mann bot an, eine Corona-Maske aufzusetzen. Ich stand da, gestützt auf das Geländer der Treppe.
Es zeigte sich, dass es sich um einen Taxifahrer handelte, der mich früher einmal gefahren hatte. Er hatte sich die Adresse gemerkt. In den Händen hielt er ein schwarz eingebundenes Buch von Sloterdijk, das von Himmeln handelte. Mit Kuli hatte der Fahrer auf einzelnen Seiten seine Eindrücke und Kommentierungen in das Buch hineingeschrieben. Erlebnisse, wie er sagte. Er zeigte mir die Seiten vor. Ein später Nachkomme der GLOSSATOREN aus dem 12. Jahrhundert.
Wie könne er, fragte er, eine Runde von Gleichgesinnten finden, um über seine Anmerkungen, seine »Glossen« zum Buch des Philosophen zu sprechen? In der Stadt München weiß ich auf Anhieb keinen Rat, wohin ich ihn verweisen könnte. Im Athen der Antike, aus den Vorstädten kommend, hätte mein Besucher im Auslauf der Achsenzeit sicher Gefährten getroffen, vielleicht einen ÖFFENTLICHEN FRAGER wie Sokrates. Vielleicht gibt es auch heute in den Institutionen der Erwachsenenbildung längst einen Kreis, der sich philosophisch intern verständigt und in den der Bärtige mit seinen Skripten aufgenommen werden könnte. Er könnte seine Glossen vorlesen, und es entstünde eine Debatte.
Dagegen wäre eine Suche nach ADÄQUATEN KONTAKTEN AUF DEN ZENTRALEN PLÄTZEN DER STADT, auf dem Stachus, auf dem Lenbachplatz oder an anderen zentralen Verkehrsplätzen, sicher vergebens, da auf keinem eine AGORA oder ein Ort für eine philosophische Auseinandersetzung existiert.
Auch für mich zerfällt der denkerische Kontakt. Habermas heute früh in Starnberg am Telefon: aufgeregt, abgelenkt, unterbrochen durch ein Telefonat auf seinem zweiten Apparat. Wir hatten ein Telefonat für heute, Donnerstag, verabredet. Das Gespräch müsse, in nervösem Ton vorgebracht, auf Samstagvormittag verlegt werden. Eben gerade ruft ihn nämlich sein Verleger an. Seit gestern, sagt der Philosoph, sind für mich »unerwartete Komplikationen aufgetreten«. Es erweist sich, dass er für eine französische Publikation bis morgen Vormittag drei bis vier Seiten zu seinem Buch Auch eine Geschichte der Philosophie verfassen muss. Der Text muss auch noch übersetzt werden. Das nimmt ihn ganz gefangen.
Rückerinnerung an einen Moment vor 53 Jahren, in dem weite Horizonte offen schienen
Im Dezember 1968 – nach dem wendungsreichen, revolutionsträchtigen Spätherbst an der Frankfurter Karl-Marx-Universität (inzwischen wieder in Johann Wolfgang Goethe-Universität zurückgetauft), einschließlich der Besetzung des Seminars für Soziologie in der Myliusstraße – zog sich ein kleiner Kreis der SDS-Genossen über Silvester aufs Land zurück. Sie bezogen ein Gehöft in Nordhessen und studierten dort in Wohngemeinschaft unter Anleitung von Hans-Jürgen Krahl die drei gewaltigen Kritiken von Immanuel Kant. Die Genossen suchten nach so viel Rede und Gegenrede, Aktivität, auch Faustkämpfen mit Polizeikräften, die sich mit Schilden schützten, also Adrenalin-Schwemmen, soliden Boden unter den »geistigen Füßen«. Die Zeit eilte voran.
Enden die Ämter der Engel mit Abschluss des Jüngsten Gerichts oder enden nur die Ämter einiger höherer Engel?
Im Verhältnis der Engel untereinander gibt es den Unterschied zwischen ihrer Natur und der Gnade, in der sie in Beziehung zu Gott stehen. Gesetzt den Fall, es erweist sich im Moment des Jüngsten Gerichts, dass alle bisherige Arbeit der »Boten«, also der beamteten Engel, mit dem Urteil des Jüngsten Gerichts überflüssig würde, wären dann die Engel vernichtet? Wären sie dann, so fragt der Scholastiker im 12. Jahrhundert, der sich Anonymus nennt und vermutlich aus Oxford nach Paris zugereist ist, verschwunden? Oder wären sie im Untergrund tätig? Wären sie in eine besondere Seligkeit versetzt? Auf einem Alterssitz? Oder was Anderes wäre mit ihnen geschehen? Thomas von Aquin antwortet auf diese Fragestellung: Dies alles wird nicht geschehen, und die Engel werden auch im Ereignis des Jüngsten Gerichts nicht vernichtet werden. Die Ausübung ihrer Ämter wird dagegen ein Ende finden.
In Begleitkommentaren zu dieser Auseinandersetzung findet man den Hinweis darauf, dass die Engel im Moment des Jüngsten Gerichts dafür zuständig sein werden, die Toten und die Lebenden vor dem Gericht vollständig zu versammeln. Einige der hinfälligsten Kreaturen tragen sie auf ihrem Rücken. Mit solcher Last beladen, können sie ihre Flügel nicht gebrauchen. Sie trotten also wie Lastesel dahin. Zuverlässig aber, »wie durch Zauber«, gewährleisten sie die VOLLSTÄNDIGKEIT DER VERSAMMLUNG ALLER TOTEN UND LEBENDEN.
Jüngst hat Giorgio Agamben diese Fragen neu aufgeworfen. Er neigt zu einem lateinisch-skeptischen Ton. Fast könnte einer denken, dass er eher an die Wiederauferstehung maritimer Seegötter glaubt, mittelmeerischer Zauberwesen. Die Überlieferungen über Engel aber kommen aus dem Orient und vom Nil.
Was können die Engel?
PURGARE (»Läutern«)
ILLUMINARE (»Erleuchten«, im himmlischen Sinne »Sprechen«)
PERFICERE (»Vervollkommnen«, Helfen, Retten)
Die langdauernde Vorgeschichte der Schöpfung als scholastische Zeitgestalt der Aeternitas (Ewigkeit)
Im Midrasch ist überliefert, dass »2000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde« (immer gerechnet in Gotteszeit, also in einem Zeitraum von mehr als 14,7 Milliarden Jahren kosmischer Zeit) Gott sieben Dinge erschaffen hat:
Die Tora
Den Thron
Das Paradies
Die Hölle
Den himmlischen Tempel
Den Namen des Messias
Und die Stimme: »Kehret zurück, Menschenkinder«
In den folgenden 2000 Jahren (wiederum ist die Umrechnung von Gotteszeit in kosmische Zeit oder solche der Evolution notwendig) hat Gott sich mit der Tora beraten und ANDERE WELTEN geschaffen (weshalb die Parallelwelten der Stringtheorie nicht nur mathematisch, sondern auch theologisch begründet existieren). Außerdem hat er mit den Buchstaben des Alphabets gestritten. Welche der Buchstaben wird die Schöpfung bewirken? Danach erst Schöpfung und Anfang der Welt.
Beispiel für eine einschneidende Schulerfahrung als Bildung im formellen Sinne, also von Bildungswirkung für das ganze Leben
Etwa 600 Meter entfernt von den Steintreppen, über die ich sieben Jahre zuvor meinen ersten Schulbesuch abstattete, wurde am 6. Februar 1945 das Gelände des Hauptbahnhofs von Gotha breitflächig bombardiert. Die Planvorgaben für die Bombenabwürfe der alliierten Geschwader bewegten sich systematisch auf Mitteldeutschland zu, systematisch einerseits im geografischen Sinn, andererseits vernichtungsspezifisch mit Blick auf die Verkehrswege, Verkehrsknotenpunkte und Schlüsselindustrien.
Nach Voralarm für den Kreis Gotha an diesem Tage wurde eine Schulklasse in den Luftschutzkeller eines Versicherungsgebäudes in der Bahnhofstraße geführt. Sie richtete sich in den Kellern unter Aufsicht ihrer Lehrer ein. Eine Stunde später waren diese Schüler tot. Die Druckwellen der Sprengbomben hatten ihre Lungen zerfetzt. Alles Elfjährige.
Zwei der Schüler – einer berichtete davon in seinen Erinnerungen, Sigrid Damm hielt den Bericht in ihrem Buch Im Kreis treibt die Zeit fest – hatten sich schon während des Einzugs in den Luftschutzkeller des Versicherungsgebäudes, also schon während des Voralarms, der aus drei fauchenden, langgezogenen Sirenentönen bestand, unerlaubterweise von der Klasse entfernt. Möglicherweise auf der Suche nach Gegenständen in fremden Kellern. So durchstreiften sie die Keller der Nachbarhäuser. Auch konnte es sein, dass sie »unanständige Spiele« planten (Betasten des nackten Körpers). Das war in Nebenräumen oder auf Abstellflächen dieser fremden Keller leicht möglich. Ein Tunnel und Mauerdurchbrüche führten von einem der Unterbauten der hohen Gebäude in Bahnhofsnähe zum nächsten. Das Gebäude über den beiden der Aufsicht abtrünnigen Elfjährigen stürzte während des Bombenangriffs über ihnen zusammen. Sie entkamen durch weitere Keller und gelangten ins Freie. Die Region um den Hauptbahnhof lag unter einer Wolke aus Staub in Trümmern. Anzeichen von Bränden.
Die Sanitäter und Feuerwehrleute, welche die äußerlich unversehrten Körper der toten Schulklasse auf dem Trottoir der Straße aufgereiht hatten, kannten die Namen dieser toten Schüler nicht. Die beiden Elfjährigen, die sich ohne Erlaubnis entfernt hatten und dadurch gerettet waren, hatten nach ihren Kameraden gesucht. Sie wurden jetzt, auch von aus der Schule herangeeilten weiteren Lehrkräften, eingeteilt, die toten Schüler zu identifizieren. Es wurden Handzettel mit den Namen der Toten angefertigt und mit Drahtstücken und Bindfäden in Höhe ihrer Fußknöchel befestigt. Das war bei den kurzen Strümpfen der Jungen einfacher als bei den Wollstrümpfen der Schülerinnen, welche die Haut bis zu den Oberschenkeln hinauf bedeckten.
In den publizierten Studien des Bildungsforschers Wolfgang Edelstein, meines Freundes, wird Unterrichtserteilung grundsätzlich unterschieden nach BILDUNG IM FORMELLEN SINNE und BILDUNG IM MATERIELLEN SINNE. Bildung im materiellen Sinne bezieht sich auf Stoff in Fertigkeit und Wissen, der dem Gebrauch im Leben dient. Bildung im formellen Sinne dagegen entwickelt Geschicklichkeiten des Geistes, die Fähigkeit, Horizonte zu erkennen und Zentren zu bilden und überhaupt Unterscheidungen zu treffen, ganz unabhängig von dem im »formellen Sinn« erlebten Bildungsprozess.
Einer der beiden aus dem Inferno geretteten Elfjährigen, Hans von Frankenberg, nannte später den Vormittag des 6. Februar 1945 und insbesondere die Stunde, in der er, von seinen Lehrern angewiesen, die Namensschilder (auf Pappe und Papier) an den Gliedern seiner Schulkameraden befestigten musste, den »intensivsten Unterricht seines Lebens«. Edelstein bezeichnet den literarischen Bericht dieses ehemaligen Schülers, den er so wie ich nur aus der Erzählung von Sigrid Damm kennt, als ein »Paradebeispiel für Bildung im formellen Sinn«. Das Bildungserlebnis, urteilt er, bezeichnet ein Lernen fürs ganze Leben. Und zwar Lernen an einem Stoff, der diesem Leben an sich fern ist, sich vielleicht nur einmal im Leben ereignet oder überhaupt nie Realität wird. So entfaltet sich im Lateinunterricht eine allseitige Fähigkeit des genauen Unterscheidens im Schüler, auch wenn später niemand im Leben lateinisch mit ihm spricht. Als einschneidend und als »Lernprozess« (ohne dass er einen Hinweis auf die Anwendung seiner gewonnenen Erfahrung geben könnte) bezeichnete von Frankenberg den »noch in seinen Knochen steckenden Schreck über das Selbsterlebte«, die bis dahin unerlebten Sekunden des Bombardements, der einstürzenden Gebäude, der Entrealisierung aller seiner Gewohnheiten. Diese Art der Wahrnehmung sei nicht erloschen gewesen, sondern in Nerven, Körper und Geist allmählich wieder erwacht, während er weisungsgemäß Namenskarten gefertigt und – ebenfalls als eine Tätigkeit, die er bis dahin nie ausgeübt hatte – diese Kärtchen an den Gliedern von Kameraden und Kameradinnen befestigt habe, die noch kurze Zeit zuvor mit ihm eine Schulklasse gebildet hatten, ja durch das laufende Schuljahr mit ihm eng und quasi körperlich verbunden gewesen waren. Momentweise konnten sie zwischen sich als Geretteten und den ordnungsgemäß aufgereihten, am Außenkörper unverletzten und durch Lungenriss Getöteten kaum unterscheiden. Keine seiner Erfahrungen, gleich ob in der Schule oder ob im Leben, sei ähnlich »dicht« und »obskur« gewesen, schrieb von Frankenberg, wie diese Unterrichtsstunde an jenem Tag, »an dem eigentlich keine Schule stattfand«.
»Grundform des Erzählens«
Die Grundform des Erzählens ist für mich das Blatt des Rezeptblocks, auf dem mein Vater, ein Arzt, vor einem »gemütlichen Bowleabend« sich in fünf bis sechs schwer leserlichen Worten die Geschichten aufschrieb, die er dann als frisch improvisiert am Abend den Gästen unterbreiten wollte. Dass mein Vater sich so viel Mühe gab, sich auf ein Erzählen vorzubereiten, rührt mich bis heute. Es genügte ihm dafür ein Stichwort, quasi eine »Intonation«. Er war sich sicher, dass sich dann beim Erzählen eine Tonlage einstellt, ohne langes Suchen.