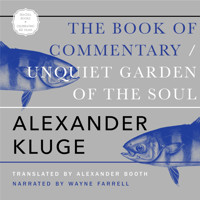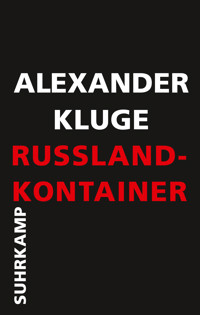43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von verzauberten Dingen, Hochöfen der Seele und der Musik der Gedanken Der große Menschenaffe verteidigt das ihm Liebste gegen eine Welt von Teufeln. Wer und was aber ist dieses offenbar undomestizierbare Tier? Liegt es vielleicht in uns selbst? Öffnet sich hier ein Boden, auf dem wir uns zu selbstsicher bewegen? Für Alexander Kluge stellt sich damit erneut die Frage nach erschließbaren Räumen in uns Menschen und in unserer Millionen Jahre alten Vergangenheit. Diesen Raum durchmisst er in dreizehn Stationen unter wechselnden Perspektiven, doch immer in konkreten Geschichten. So geht es um »Reparaturerfahrung« als essenzielle Lebenspraxis ebenso wie um die genealogische Erinnerung an Vater und Mutter. Zu einer Chronik des Zusammenhangs gehören aber nicht nur Personen, sondern auch Dinge mitsamt der in ihnen aufbewahrten menschlichen Arbeit. Sind solche Dinge nicht selbst oft »verzauberte Menschen« und bergen Romane? Schließlich die Kunst als »große Oper« im Leben und auf der Bühne. Sie bietet die direkteste Darstellung von Leidenschaft mit ihren elementaren Wurzeln in der Realität: im Terror, im Glück und in stillgestellten Bürgerkriegen des Gefühls aus ältester Zeit. Gute Theorie in konkrete Geschichten aufzulösen, das ist Alexander Kluges lebenslänglicher Ansatz. In der Konsistenz von Gedanken liegt für ihn Musik, und so setzt er mit diesem Buch gegen die vor fünfzehn Jahren erschienene Chronik der Gefühle nun den Kontrapunkt einer Chronik des Zusammenhangs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 938
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der große Menschenaffe verteidigt das ihm Liebste gegen eine Welt von Teufeln. Wer und was aber ist dieses offenbar undomestizierbare Tier? Liegt es vielleicht in uns selbst? Öffnet sich hier ein Boden, auf dem wir uns zu selbstsicher bewegen? Für Alexander Kluge stellt sich damit erneut die Frage nach erschließbaren Räumen in uns Menschen und in unserer Millionen Jahre alten Vergangenheit. Diesen Raum durchmisst er in zwölf Stationen unter wechselnden Perspektiven, doch immer in konkreten Geschichten. So geht es um »Reparaturerfahrung« als essenzielle Lebenspraxis ebenso wie um die genealogische Erinnerung an Vater und Mutter. Zu einer Chronik des Zusammenhangs gehören aber nicht nur Personen, sondern auch Dinge mitsamt der in ihnen aufbewahrten menschlichen Arbeit. Sind solche Dinge nicht selbst oft »verzauberte Menschen« und bergen Romane? Oder nehmen wir die Kunst als »große Oper« im Leben und auf der Bühne. Sie bietet die direkteste Darstellung von Leidenschaft mit ihren elementaren Wurzeln in der Realität: im Terror, im Glück und in stillgestellten Bürgerkriegen des Gefühls aus ältester Zeit.
Gute Theorie in konkrete Geschichten aufzulösen, das ist Alexander Kluges lebenslänglicher Ansatz. In der Konsistenz von Gedanken liegt für ihn Musik, und so setzt er mit diesem Buch gegen die vor fünfzehn Jahren erschienene Chronik der Gefühle nun den Kontrapunkt einer Chronik des Zusammenhangs.
Alexander Kluge, geboren 1932 in Halberstadt, ist Jurist und Filmemacher; als sein wichtigstes Werk aber sieht er seine Bücher. »Wenn ich im Jahre 2015 schreibe, liegen die kommenden fünfzehn Jahre unseres Jahrhunderts schon vor meinen Augen. Insgesamt ergibt sich damit, da ich 1932 geboren wurde, eine Chronik über rund hundert Jahre.« Für sein Werk erhielt er viele Preise, darunter den Georg-Büchner-Preis, den Theodor-W.-Adorno-Preis und zuletzt, 2014, den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf.
Zuletzt erschienen
Nachricht von ruhigen Momenten. Mit 60 Bildern von Gerhard Richter, 2013
»Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter«. 48 Geschichten für Fritz Bauer, 2013
Alexander Kluge
Kongs große Stunde
Chronik des Zusammenhangs
Mitarbeit
Thomas Combrink
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Der Verlag weist darauf hin, daß dieses Buch farbige Abbildungen enthält, deren Lesbarkeit auf Geräten, die keine Farbwiedergabe erlauben, eingeschränkt ist.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: Archiv Kairos Film
Inhaltsübersicht
1 Es geht nichts über Reparaturerfahrung
2 Wilde Verläßlichkeit
3 »Stimme der Liebsten, widerhallt mir im Herzen«
4 Totenbuch für etwas, das ich liebe
5 Arztgeschichten
6 Falten auf Kongs Nase, unverwechselbar wie Fingerabdrücke
7 Unverwüstlichkeit des Politischen
8 »Hochöfen der Seele«. Ein Opernführer
9 Die Brüder Mann und der bürgerliche Charakter. Schiffbrüche und Bankrotte.Ein Mensch, aus Trümmern gegossen
10 Schwester Vernunft. Brüderchen Freundschaft. Arno Schmidt und das Zwerchfell der Krokodile
11 »Ich«
12 Chronik von Pangäa bis heute
Bildnachweise
Texthinweis des Autors
Danksagung
Wieder einmal hatte sich die Menschheit übernommen. Sie hatten den Großaffen in das Schiffsinnere verpackt, in der Hoffnung, sie könnten ihn nach New York überführen, wo sie ihn im Zirkus oder auf einem Großgelände ausstellen wollten. Sobald es in der Lichterstadt ankäme, wäre das Tier ein Vermögen wert, noch aber lag Wasser dazwischen. Der Kapitän fürchtete sich. Noch war alles ruhig. Die zwei Bordkapellen spielten. Der Mann hatte ein schlechtes Gewissen. Eisberge zogen an den Salons des Dampfers vorüber. Es schien kalt dort unter den Eisstümpfen. Als hätten sie Wurzeln, haben die Eisberge Eisränder, die in die Tiefe ragen – und wenn der Kapitän sein Schiff nicht hütet, schlitzen diese Unterwassermesser aus Eis den Blechkasten auf, der dann bitterlich zum Meeresgrund hinabsinkt. Wie kann der Kapitän seiner Angst Herr werden? Eine scheußliche Lage, und die Nacht kommt erst noch …!
Das war die Stunde von Kongs großer Macht. Wie einfach, dieses Schiff zu zerdeppern. Für eine Naturgewalt wie diese war das Schiff nicht gebaut. Draußen Blitze und Sturm. Im Schiffsrumpf in dieser Stunde die riesenhafte Natur. Im Heck zerspringen die Gläser.
Abb. 1: Berggorillakind.
1Es geht nichts über Reparaturerfahrung
Zahn ohne Raum
In meinem Mund hielt sich, eingezwängt zwischen einem der mittleren Schneidezähne unten und dem Eckzahn, lange Zeit ein weiterer Schneidezahn auf schmalem Hals, von den beiden umgebenden Bruderzähnen stark bedrängt. Deren Wurzeln drückten auf die Wurzeln des Stiefzahns. Bald wackelte dieses überzählige Mitglied in meinem Gebiß. Ein Zahnarzt urteilte: »Herausnehmen mit Wurzel, eine Brücke legen und abwarten, was weiter passiert.« Ich sah mich damals bald zahnlos. Ich war nicht bereit, eine permanente Improvisation im Mund, meinem verschließbaren Schatz, der auch die Sprache beherbergt, hinzunehmen. Ich geriet an einen jungen Reformer der Zahnheilkunde. Er kam aus einer US-Schule der Zahnmedizin. Seine Eltern hatten in Deutsch-Südwestafrika einst Farmen besessen. Jetzt waren die Zähne Prominenter in der bayerischen Hauptstadt das Ackerland dieses Arztes. Er war Chirurg.
Unter Narkose (er war chirurgisch ausgebildet) schnitt er das Zahnfleisch um den schwachen Stamm in der Tiefe auf, reinigte gründlich den Knochen, transplantierte Gaumengewebe, das den schmalen Stengel hielt. Er war ein Radikaler mit Maß, voll von gezähmter Aggression. So überlebte mein Zahn in seiner Kolonne. Zwanzig Jahre später, als er, stets eingeengt durch seine beiden Nachbarn, erneut wackelte, fixierte dieser Reformarzt den Zahn, ähnlich, wie man es bei schiefstehenden Kirchtürmen tut, mit einer Betonstütze. Jetzt stand der Zahn für weitere Jahre festgezurrt. Bei den jährlichen Inspektionen im Anschluß an die Zahnsteinbeseitigung im ganzen Mundraum freute er sich über den INTAKTEN UNTERPRIVILEGIERTEN wie über einen gutangelegten Garten, weil, sagte er, ohne diese Rettungsaktion das ganze Gebiß Zug um Zug zugrunde gegangen wäre. »Ich repariere immer vom schwächsten Glied her.« Dies seine These.
Es geht nichts über Reparaturerfahrung
Ein Kollege aus der Gegend von Eisleben berichtet: Mit Schwäche bin ich zur Welt gekommen. Das hat mir dann das Leben gerettet. Mein Rückgrat macht Knicke. Das soll schon vor der Geburt angelegt gewesen sein. Nicht, daß man es sofort sieht. Ich gehe aufrecht (aus Übung). Jeder Militärarzt, dem ich später vorgestellt wurde, hat dann bestätigt, daß ich mit diesem Zick-Zack-Kreuz nicht länger als täglich etwa zwei Kilometer marschieren könnte. Das hätte die Truppe im Rußlandkrieg aufgehalten. Also wurde ich 1942 eingeteilt in den Werkschutz der Buna-Werke, Spezialist für Zäune und Tore.
Dann die Löscheinsätze. Statt die Fremdarbeiter zu überwachen, setzten wir sie aktiv ein. Tagangriff. Hochmütig rücken die Geschwader, deren Jägerstaffeln über ihnen, vom West- und Südhorizont auf uns zu. Was sie demolieren, haben wir in den Nachmittagsstunden besichtigt und sortiert. In der Nacht haben wir wie die Teufel die Schäden eingegrenzt und repariert. Die Produktion war nie wirklich unterbrochen. Es gibt in der Not keine Arbeitsteilung. Wir Wächter haben die Pistolen abgelegt, sind inzwischen Lösch- und Wiederaufbauspezialisten.
So war ich mit 30 Jahren fast Ingenieur. Nicht der Bezeichnung nach, aber ältere Ingenieure des Werks sprachen mit mir wie mit ihresgleichen. »Schließen Sie die Pinne an den fahrbaren Generator.« Das habe ich dann ausgeführt. Der Eifer der anderen überträgt sich, vermischt sich mit meinem. Längst sind wir in einem neuen Gesellschaftssystem.
Die Russen hatten die Maschinen, die sie für wertvoll hielten (sie konnten das, weil sie Militärs waren, nicht immer beurteilen), auf Bahntransport in Richtung Smolensk–Moskau gebracht. Dort rosteten sie dann seitlich der Strecke, wenn die Güterzüge wegen anderer Transporte von höherer Dringlichkeit abgeladen werden mußten. Wir aber durften den Rest, der bei uns vor Ort blieb, wieder zum Funktionieren bringen, neu strukturieren, das, was uns fehlte, mit Hausmitteln hinzubauen. Auch diesen Neuanfang nannten wir Reparatur (im Gegensatz zum Abtransport der Maschinen, der Reparationen hieß). Ich wurde zur Arbeiter- und Bauernfakultät Halle abkommandiert, trug bald auch wirklich den Titel Ingenieur. Die Improvisation hielt an.
Verschleiß. Inzwischen rächten sich etwa zwanzig Jahre Improvisation, ein Rachestrahl der Objekte. Kein Winter ohne Produktionseinbrüche. Wir aber regelten das. Die Bezeichnungen wechselten. Man sprach nicht mehr von Reparieren, sondern von Regelung. Das kam aus der Computersprache. Computer selbst hatten wir nicht.
Im kalten Winter 1962 dann Katastrophe auf Katastrophe. Wie Flocken vom Himmel die Schäden und ihre Meldungen. Die letzteren sollten wir gar nicht mehr nach oben geben. Sie verwirrten die Statistik, hieß es. Ich war dem allen gewachsen. Nicht körperlich, sondern vom Kopf her, der für alles, was ich selbst wegen meines Handicaps nicht heben, ablaufen oder technisch anschließen konnte, einen Ausweg fand. Die Kollegen vom BESONDEREN EINSATZDIENST (statt Regelung und Reparatur hieß es jetzt Einsatz) sahen mir die Mehrbelastung nach, die durch meine Schwächen auf sie entfiel, weil meine Klugheit die NORMERFÜLLUNG und die damit verbundenen saftigen Erfolgsprämien für das Kollektiv gewährleistete (anschließend gerecht und individuell aufgeteilt, ein schönes Weihnachtszubrot). Der Reparaturfähigkeit, wie sie für unsere Republik charakteristisch war, liegen Konsensfähigkeit und Kooperationserfahrung zugrunde, die von oben nicht bestellt und nicht gebremst werden können.
Was sich dann nicht reparieren ließ, war die Demokratische Republik selbst. Zu komplex und vom Produktionssektor, in dem wir Erfahrung hatten, nicht zu steuern. Wir wurden sukzessive verraten. Erst von den Faschisten (zu denen wir selbst gehörten), die ihre Aussichten überschätzten und keines ihrer Versprechen auf den Enderfolg hielten. Was wir im Krieg in der Produktion vollbrachten (und wir waren Zauberer), war nachträglich nichts wert. Dann von unserem eigenen Staat, der Arbeiter-und-Bauern-Republik, die uns den letzten Tropfen Schweiß abverlangte (mir eher Hirnmasse), aber den Wert davon nur hortete oder in Form von Planungswerten verspekulierte, dann aber sich gegen den Westen nicht halten konnte (vom Brudervolk nicht gestützt). Schließlich, nach Neuformierung unseres Volkes, hat uns der Westen betrogen. Alles an sich genommen, ohne Reparaturchance. Jetzt wurde unser dauerreparierter Industriesektor abgewickelt. Kein Wort über die stillen Reserven in den Betrieben, die verborgenen Vorräte, von uns sorgsam angelegt und gegen alle Kontrollen von oben verteidigt. Keine korrekte Einschätzung unserer kollegialen, improvisatorischen Fähigkeiten, aus denen doch der Wert der Republik und ihrer Betriebe in Wahrheit bestand. Wir wurden als Kostgänger, als überflüssig, abgeschrieben, in die Warteschleife versetzt, in die Freizeit entlassen.
Tatsächlich wird Reparaturenergie auf dem Weltmarkt nicht gehandelt. Im Gegenteil: Was beschädigt ist, was ein gewisses Alter erreicht, wird neu beschafft. Zur Freude der Konjunktur. Kostbar ist die Lücke, der Bedarf, der Sog nach neuen Lieferungen, nicht die Instandsetzung. Zu spät kamen wir auf die Idee, unsere Begabung (und die Reste an Material und Gerät) nach Osten zu verlagern. Das Comecon (mit seinen Planzahlen, seinem Schriftverkehr, seinen Verboten und Genehmigungen) löste sich nicht rasch genug auf. Manche Werft, manches Kombinat, vor allem unsere Schwerreifenproduktion für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge hätten sich retten lassen auf der Austauschschiene von Betrieb zu Betrieb in der Linie nach Archangelsk oder Rostow.
So kann man uns Experten nicht abfertigen, so viel will ich sagen. Noch immer repariere ich die Zäune, die unser stillgelegtes Betriebsgelände umgeben, das ein Investor erworben, aber nicht neu bebaut hat, auch wenn solches Volkseigentum uns, dem Volk, nicht mehr gehört. Es stand auch vorher uns, dem Volk, nur dem Namen nach zur Verfügung. Das läßt sich nicht nachregeln. 50 Jahre Einsatz für die Katz! Es trifft mich mit 67 in einem empfindlichen Alter. Statt Rente Neubeginn. Das heißt nicht, daß ich und die Kollegen, mit denen ich Verbindung halte, sich geschlagen geben. Auch Hoffnungen lassen sich instand setzen. Es geht nichts über Reparaturerfahrung.
Der Unterschied zwischen Reparieren und Heilen
In sehr alter Zeit. Etwa 1000 v. Chr. Er war in Lebensgefahr, das wußte er. Er konnte nicht aus dem Haus gehen und versuchen, in der Nacht zu entkommen. Die Reiter des Fürsten hätten ihn eingeholt. Am Bett des fiebernden Prinzen konnte er wenig tun. Ihm war klar, daß der Fürst nicht dulden würde, daß ihm dieses Kind starb. Hauptsächlich war der Arzt mit der Abwehr zudringlicher Rivalen beschäftigt, deren Tinkturen und Vorschläge für eine Operation den Prinzen mit Gewißheit umgebracht hätten.
Ihm selbst, dem berühmten Mann, blieb nichts übrig, als zu warten. Durch nichts konnte der Arzt im Fall der Seuche, um die es sich handelte, den Zustand des Kindes vor der Erkrankung wiederherstellen. Das Kind wäre, wenn es überlebte, ein anderes Kind, und seine Haut trüge Spuren. Helfen könnten nur die Kräfte in diesem Kind selbst. Seine Sache war es – unter Einsatz seines Lebens –, dem Jungen Zeit zu verschaffen. Keine Besuche. Keine Störung, weil etwa die Eltern nachsehen wollten, wie es dem Kinde ging. Keine Störung durch Zugluft oder eilfertige Diener. Nur Zeit hilft. Um sie zu verlängern, dienten der Schwamm mit Essig und etwas Nahrung zum Lutschen. Daß der Prinz inzwischen die Lippen öffnete, wenn etwas Leckeres kam, erfüllte den Arzt mit Hoffnung. Im Palast war er der einzige, der genügend ärztliches Wissen besaß, um zu beurteilen, was alles nicht getan werden sollte.
Justierung einer Kinderseele
Ich weiß nichts Genaues. Doch bin ich immer noch unruhig und gelte als manchmal hysterisch. Ich war Erstgeborener. Eine Zeitlang waren meine Eltern vernarrt darin, einen Sohn zu haben. Jeden Tag wurde ich gewogen. Eine fremde Person, Usurpatorin aus Schlanstedt in unserem Haus, ein sogenanntes Dienstmädchen, schob sich zwischen mich und meine Eltern. Nach oben zu den Eltern hin dienerte sie, zu mir hin war sie träge, leichtfertig und boshaft. Wenn ich schrie, hat sie mich in der Besenkammer abgestellt. Das weiß ich nicht aus Erinnerung, sondern weil es später aufgedeckt und erzählt wurde. Hätte diese Person nicht außerdem sich Geld aus der Küchenkasse angeeignet, wäre sie nicht entlassen worden.
Das junge Ehepaar, meine Eltern, war nach drei Jahren Ehe noch ganz atemlos. Sie waren mit sich und ihren Auftritten in der Stadt beschäftigt. Meine Mutter galt als Attribut positiver Stimmung für jede Veranstaltung. Anderntags für sie langes Ausschlafen, Zurechtmachen für den nächsten Auftritt. Mein Vater, beschäftigt mit den Patienten, hatte nach anfänglichem Interesse – und bei gleichbleibendem Stolz beim Vorzeigen des Erstgeborenen vor Gästen – keine Zeit, sich näher um mich zu kümmern. Ich kotzte viel, weinte jämmerlich, klagte über die schlechte Behandlung durch das Dienstmädchen, das Leni hieß, hatte durch gleichbleibenden Quengelton aber jeden Kredit bei den Eltern eingebüßt. Eher durch die Gewichtsabnahme, welche die Waage registrierte, als durch mein Jammern bemerkten sie den Verfall meiner Person. Sie waren beunruhigt.
Wie gesagt, die tyrannische Leni wurde wegen des Griffs in die Kasse entlassen. An ihre Stelle trat DIE NEUE, Magda Stolzheise aus dem Westendorf. Sie hatte fest vor, im Haus meiner Eltern in der Kaiserstraße ihr Glück zu machen. Arbeitete sie in einem angesehenen Haushalt, gab ihr das eine Chance, wenn sie nach dem Mann suchte, dem sie sich für ihr Leben anvertrauen wollte.
Hauptaufgabe war es, mich, den Erstgeborenen, der Zeichen einer Fehlentwicklung zeigte, zu justieren. Magda hatte dafür nichts als ihre Intuition zur Verfügung. Keine Geschwister, die sie schon aufgezogen hätte, keine Diensterfahrung in anderen Häusern. Es war ihre erste Stellung. Wie sie später berichtete, war ich »unausgeglichen«. Wenn man in der Zugluft herumrennt und dann wieder in Lethargie versinkt und sich nicht bewegt, fängt man sich im kalten Wind, der vom Harz herabweht, eine Erkältung ein. Sie führt zur Mittelohrentzündung. In den Zeiten zwischen den Krankheiten: mürrisch, rebellisch, dränglerisch (zu den Eltern vorgelassen zu werden, um irgendwelche Klagen zu formulieren, routinemäßig). Währenddessen vertiefter Protest im Darmtrakt, Hautausschläge, die dem Willen nicht unterliegen. Magda gelangte, wie sie später sagte, zu dem Eindruck, daß dem verheerenden Zustand keine gegenwärtige Ursache, auch keine Bosheit, zugrunde läge. Nicht die widerspenstige Aufführung (Auftritte, die schon Lenis Geduld erschöpft hatten) sei die Wurzel, sondern eine grundlegende Verwirrung der Inneneinrichtung dieses Erstgeborenen. Sie sorgte dafür, daß ich in ihrer Nähe blieb. Sie drang nicht auf mich ein. Sie suchte Gewohnheiten zu züchten. Sie erzählte viel, während sie in der Küche hantierte oder an Gardinen reparierte. Es lag ihr daran, meine Neugierde zu füttern, damit ich Interessen entwickelte, über die ich meine Verwirrungen vergäße. Durch das Hantieren und Erzählen machte sie aus einem Rachegeist ein spielendes Kind. Das war eine Sache von etwa drei Monaten. Durch den Erfolg, daß ich wieder geduldig aß und das Verzehrte bei mir behielt, so daß die Grammgewichte auf der Waage zunahmen, hatte Magda rasch das Vertrauen meiner Mutter gewonnen.
Magda verschaffte mir neuen, privilegierten Zugang zu den Eltern. Nichts konnte bei meiner Mutter auf Dauer eine Aufmerksamkeit bewirken, wenn es ihrem Lusthaushalt entgegengesetzt war. Quengeln und schlechte Nachrichten machten sie nervös. Jetzt gab es positive Nachrichten bei jeder dieser Vorführungen vor den Eltern. Wir, meine Eltern und ich, kamen uns erneut näher. Wie in der Glanzzeit, als der Kronprinz ein frisches Ereignis war.
Nach einem Jahr war ich durch das Naturtalent Magdas instand gesetzt. Eingepolt mit mir selbst, der bereits ausgebrochene Bürgerkrieg in mir stillgestellt. Wie bei einer Endemie glimmte der Grundhader. Er kann noch heute ausbrechen und mich ins Chaos stürzen. Die Neue, Magda Stolzheise, war eine der Frauen, denen ich meine Steuerungsfähigkeit verdanke.
Keine Justierung mit leichter Hand beim eigenen Kind
Für ihr einziges Kind, das sie in einer Wohnung neben dem Kasernenkomplex des Infanterieregiments Nr. 12 in Quedlinburg aufzog, konnte Magda nichts von ihrer Erfahrung, die sie mit meiner »Instandsetzung« gewonnen hatte, anwenden. Offenbar war sie befangen. Es war die eigene Tochter. Ihr Wunsch, daß ihr dieses Menschenkind besonders gut gelänge, die Idole, die sie mit ihm verband, waren ihr so wichtig, daß sie sich zwischen das Kind und sie stellten. Zugleich blieben diese Wünsche vielgestaltig und unbestimmt. Die vielen Richtigkeiten verzettelten sich. Auch war der Alltag ihrer Ehe bis zum Kriegsausbruch eigentümlich grau und anders, als sie es sich in den langen Jahren der Verlobung vorgestellt hatte, in denen ihr Mann, der Hans Bügelsack hieß, um sie geworben hatte. Von der Wohnung zur Kaserne, in der ihr Mann als Stabsfeldwebel Dienst tat, waren es zwei Minuten, sie konnte ihn fragen, wenn sie einen Rat brauchte. Sie fragte nicht. Streß lenkte sie in den ersten Monaten stark vom eigenen Kind ab. Ihre Fahrlässigkeiten wurden, als sie ihr Versagen bemerkte, zu Schuldgefühlen, die sie bei meiner Erziehung nicht gehabt hatte. Auch diese stellten sich zwischen sie und die Tochter. So wirkt ein Überschwang an gutem Willen sich schädlich aus, und eine Zeitversetzung im Einsatz dieses guten Willens um etwa fünf Monate (er kommt dann zu spät, das Kind ist nicht mehr empfänglich, die Prägung mißglückt) ist nochmals schädlich. Bis zu ihrem Tod in den achtziger Jahren häufige »Reformversuche«, beiderseitiges Aufeinanderzugehen von Mutter und Tochter (aber nicht zur gleichen Zeit). Die politischen Regime wechselten. Eingekästelt in der DDR: Alle Hoffnungshorizonte, die Magda aus den dreißiger Jahren in sich aufspannte, fanden kein Echo in den Propagandaleitlinien der demi-sozialistischen Administration des Landes. Vielleicht wäre aus ihr eine BAUKÜNSTLERIN EINER NEUEN WELT zu gewinnen gewesen, wäre das neue Regime in irgendeiner Einzelrichtung konsequent geblieben, gemessen an Magdas Glücksanspruch, RADIKAL. Dann hätte sie ihr eigenes Kind, das Karin hieß, inzwischen erwachsen, Magdas gefallenem Mann ähnlicher als ihr, auf ein solches FLOSS DER GEMEINSAMEN AUSSICHTEN retten und mit ihm die Gewässer einer ZUKUNFT, DIE ZU UNS PASST, befahren können. Zuviel Anforderungen an die Instandsetzung, ohne daß Material zur Verfügung gestanden hätte. Dabei war sie lebenslänglich bereit, sich unsägliche Mühe zu geben.
Mein barbarischer Bruder
Einmal noch hat Magda ihre »Instandsetzungskunst«, die sie an mir als Übungsobjekt entwickelt hatte, einsetzen können. Den russischen Stadtkommandanten von Halberstadt, dessen Haushalt sie führte, hatte sie bei dessen Versetzung in die Garnison Burg bei Magdeburg begleitet. Schöne große Villa am Stadtrand. In den träge dahinfließenden Tagen des Besatzungslebens viel luxurierende Zeit. Nicht, weil es vom Obersten oder dessen Frau belohnt oder auch nur beachtet worden wäre, auch nicht, weil sie dem russischen Kind mehr zugewandt war als Kindern überhaupt, aus reinem Überschuß ihrer Präsenz erzog sie seine Gewohnheiten so, daß später aus diesem Kind ein russischer Ingenieursminister in einem der Ministerien in Moskau wurde. Magda war längst tot. Die Laufbahn machte den jungen Mann zum Oligarchen. So gut sprach Magda Russisch, daß sie ihm Geschichten erzählt hatte, die sein Hirn umtriebig machten.
Aus dem Barbarenkind – die Familie stammte von den Südabhängen des Ural, die Eltern waren nicht gewohnt, sich nennenswert um ihren jungen Trabanten zu kümmern – machte sie eine neuerungssüchtige, interessierte »Westseele«. Ich lernte diesen Ziehbruder – physisch ist er mit mir ja nicht verwandt – in St. Moritz kennen. Ich erkannte ihn an der Gestik. Ein Stück der Seele Magda Bügelsacks, geborener Stolzheise, war in diesem Manne geronnen. Schweizer empfanden den Mann als unrussisch, so daß die These von R. Smetz zutrifft, daß es statt einer Prägung durch feste Klassen und Bestimmtheiten verschieden elaborierte Charaktere gibt, welche ihrerseits die Gene so formen, daß diese zu ihnen passen. Es sind Maßverhältnisse, behauptet Smetz, die sich von Mensch zu Mensch wie bei einer Kontamination übertragen und das allseitige Begehren stiften, das die Städter charakterisiert. Smetz nennt diesen Charakter QUECKSILBER. Ich selber, obwohl verblüfft, daß ich den Bruder unter zahllosen Fremden in der Bar des »Palace« sogleich erkannte, halte Smetzens Thesen für übertrieben. Quellenangaben finden sich in dessen Werk fast nirgends. Vermutlich gibt es dafür keine Quellen.
Rettung eines Kindes, das Bomben werfen wollte, fordert Reparatur der Kommunikationswege
In der Dämmerstunde des 24. Dezembers 2014, eine Flugminute nördlich von Bethlehem, zur gleichen Tageszeit, in der im Jahre 323 nach Alexander des Großen Tod Maria, die Frau Josefs, in einer Grotte niederkam, Lichterscheinungen in dieser Höhle ließen eine Zeitenwende ahnen, explodierte mit rabiater Helligkeit eine Einzelheit der Technik im Kampfbomber eines jordanischen Leutnants. Der junge Mann entstammte einer noblen Offiziersfamilie. Das gelähmte Flugzeug, an sich ein vom Mann nicht beherrschbares, selbsttätiges, jetzt aber wirr gewordenes Geschoß, bewegte sich schräg in Richtung zur Erde hin, hielt sich noch einige Meilen in der Luft und tauchte dann in einen See ein. Der Pilot, zuletzt mit Kabine herausgeschleudert aus dem Wrack, war zunächst dankbar, daß Retter am Ufer ihn mit Stangen aus dem Wasser holten, bis er erkannte, daß er in die Hände des Kalifats gefallen war.
Die Familie des Piloten, das Königshaus von Jordanien und maßgebliche Behörden dieses Landes machten sich daran, den Piloten aus seiner Gefangenschaft zurückzuholen. In den Vorgefechten zu seiner Rettung, informellen Kontakten, die über die Türkei nach Syrien geknüpft wurden, ging es zunächst um Reputationsfragen. Die IS-Propaganda schien daran interessiert, ihre Behauptung zu befestigen, das jordanische Kampfflugzeug sei, als es einen Stützpunkt in der Nähe von Aleppo mit Bomben belegen wollte, durch Abwehrraketen abgeschossen worden. Das hätte die Islamisten aufgewertet, denn bis dahin galt die Auffassung, sie besäßen keine Flugabwehrwaffen. Umgekehrt wurde von seiten der Allianz, vor allem von Vertretern des Pentagon, auf den Eindruck hingewirkt, ein technischer Defekt habe zur Notlandung des Kampfjets geführt. Im Umkreis des jordanischen Königshauses, das der Familie, aus welcher der wagemutige Leutnant stammte, eng verbunden war, hielt man ein solches Geplänkel für einen Schachzug, geeignet zur Befreiung des Gefangenen: Man erkenne an, daß der Gottesstaat die Fähigkeit besitze, Flugzeuge abzuschießen, Zug um Zug gegen die Freilassung des Piloten als der einzigen Person, die glaubhaft den Absturz der Maschine wegen eines technischen Defekts bestätigen könne. Dies erfordere die Freilassung deshalb, weil seine Aussage als die eines Gefangenen die Welt nicht überzeugen würde. Dieser erste Kontakt zwischen Rettern und dem IS führte zu keinem Ergebnis.
Ein zweiter Verhandlungskanal zur Gegenseite wurde über den Jemen vermittelt. Es wurde von jordanischer Seite vorgetragen, der Leutnant sei keine »Geisel«, er sei als »Gast« im gegnerischen Lager zu betrachten. Das Gastrecht, eine panarabisch generell anerkannte Norm, enthielt Regeln, die eine gesichtwahrende Entlassung des Gefangenen durch die Militanten ermöglichte, mochte eine solche Volte auch einem westlichen Beobachter als abwegig erscheinen, daß nämlich ein Bombardierer als Gast des Landes etikettiert würde, auf das er seine Bomben hatte abwerfen wollen.
In einem weiteren Zug boten die Jordanier einen Gefangenenaustausch im Verhältnis 1 (der Leutnant) zu 12 (aus dem Irak nach Jordanien überführte IS-Kämpfer, darunter eine legendäre Selbstmordattentäterin, die kurz vor ihrer Tat überwältigt worden war) an. Der Gottesstaat antwortete diesmal wiederum über einen Kontakt in der Türkei. Nur der Verzicht auf jede weitere Beteiligung Jordaniens an Luftangriffen werde zur Freilassung führen. Das jordanische Königshaus vermochte nur ein Einschlafen der »Flugtätigkeit über Syrien« anzubieten. Hierauf keine Antwort.
Es ging nunmehr darum, in Eile ein Vertrauensverhältnis zwischen den Verhandlern herzustellen. Die Mehrzahl der Verhandlungskanäle, auch solche in den Golfstaaten, waren zerstört. Eilig machte man sich an die Reparatur des Vertrauens, damit doch letztendlich ein Weg erkennbar würde, auf dem der junge jordanische Offizier gerettet werden könne. Es erwies sich, daß der Leutnant in jener Abendstunde eigenmächtig zu seinem Einsatz aufgestiegen war. Der Überraschungsangriff einer jordanischen Sturmtruppe, falls man den Verwahrungsort des Gefangenen in Erfahrung hätte bringen können (ein Vorschlag, der von amerikanischer und saudiarabischer Seite eingebracht wurde), hätte im Gegensatz zu der Linie gestanden, Vertrauen wieder instand zu setzen und so doch noch einen Handel zu ermöglichen. Einige Tage lang war nichts in dieser Sache prinzipiell, alles in Jordanien war auf die Rettung des Leutnants gestimmt.
Kuba, Paradies für Reparaturen
Die Republik Kuba rührt mich an, weil das Prinzip des Weltmarkts: etwas in Gebrauch zu nehmen und, wenn es nicht mehr funktioniert, wegzuwerfen, hier aus Mangel nicht gilt. ES WIRD REPARIERT. Die schönsten Autokarossen der sechziger Jahre, nirgends sonst mehr produziert, sind in Havanna zu finden. Sechsmal wurde in ein solches Fahrzeug ein neuer Motor eingebaut. Die Kunst, so etwas gebrauchsfähig zu erhalten, ist ein handwerkliches Glanzstück, eine Kunst aus frühbürgerlichen Werkstätten. Dieses Reparieren steht an der Stelle von Revolutionieren. Mit letzterem begann der Aufstand Fidel Castros. Er hat eine große Reihe revolutionärer Konzepte, auch solche der Chinesen, zumindest theoretisch in seinen Akademien erprobt.
Dann mußte er aus Not Irrtümern folgen. Mit der Zuckerwirtschaft, die er vorantrieb, einer Monokultur, verletzte er die Regeln des revolutionären bürgerlichen Fortschritts, der auf einer diversifizierenden Produktionsweise beruht: Hort für Kooperation und Manufaktur. Das entfernte die Republik von »einem die menschlichen Wesenskräfte allseitig entwickelnden Sozialismus«. Zuletzt nur noch erfolgreiche Gegenwehr gegen die Rückkehr der Emigranten.
Aber als Zusatz die obengenannte Expertenschaft der Reparateure! Sie sind Patrioten der OFFENHALTUNG VON MÖGLICHKEITEN, DIE LOKAL NICHT WEITERZUTREIBEN WAREN. Als Seitenprodukt der SOLIDARISCHEN INTERNATIONALE ist auf Kuba ein Medizinalwesen entstanden: ein Exportgut sondergleichen. Die Ärzte und Ärztinnen halfen kürzlich bei der Ebola-Epidemie in vier afrikanischen Staaten aus.
REPARIEREN
HEILEN
WUNDER EREIGNEN SICH, UMSTÄNDE WENDEN SICH
INS REINE SCHREIBEN
REVOLUTIONIEREN
REVIDIEREN
AUSBESSERN
PROBLEME EINFRIEREN, KONSERVIEREN
JUSTIEREN
AUFSAMMELN
Einmauerung des Kriegs auf Zeit
Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges waren große Landschaften in Mitteleuropa gründlich verwüstet. Die Seelen der Menschen, die dem Krieg ausgeliefert waren, aber auch derer, die den Krieg führten, hatten Schaden genommen. Es war nicht sicher, daß ein Landfrieden, eine bürgerliche Zivilisation in den Städten, eine gottgefällige Landesverwaltung in diesen Regionen je wieder so hergestellt werden könnten, wie sie vor 1618 bestanden hatten.
Es war aber in der Peripherie des Desasters, gerade in Personen und in Kabinetten, die nicht unmittelbar von den Kämpfen betroffen waren, eine Empfänglichkeit entstanden für eine Strömung, die nicht im Zentrum des Elends, aber an seinen Rändern eine Art gravitativen Druck ausübte, ein ideelles Gebilde, eine Stimmung, eine Sehnsucht nach Frieden. An diesem Idol mußten sich die Ruhmgierigen orientieren. Der Respekt aller anderen und der Gehorsam der Untertanen hingen davon ab, daß diese Umwertung der Werte von Beamten und Herrschern beachtet wurde. An der Stelle von Kriegsruhm stand künftig der Ruhm als Friedensbringer.
So versammelten sich in den Städten Münster und Osnabrück Verhandler, die fünf Jahre lang in 16 Sprachen mit 109 Delegationen einen Friedensschluß erörterten. So wie Kriegsunternehmer auf eigene Kosten in Erwartung von Beute den Krieg geführt hatten, waren jetzt, ebenfalls auf eigene Rechnung, Friedensunternehmer tätig in Hoffnung auf spätere Belohnung oder ein Amt. Es handelte sich um Kontrakte, die zugleich (und abhängig voneinander) den achtzigjährigen Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien und die vier Kriege beenden sollten, aus denen sich der sogenannte Dreißigjährige Krieg tatsächlich zusammensetzt.
Die Abgesandten der Republik Venedig, selbst nicht Kriegspartei, hielten ihre norditalienischen Erfahrungen im Verhandeln feil. Sprache und Stil der französischen Diplomaten waren der Sprache und dem Stil der Schweden entgegengesetzt. Das führte zu überraschenden Lernprozessen. Graf Trauttmannsdorff verhandelte für den Wiener Hof. Seine Hauptwaffe war die Drohung mit Abreise. 17 Räte sprachen für den Kurfürsten von Sachsen. Sie trugen bei mit der Kenntnis des Friedens von Prag, der nicht hielt. Die für ihre Intriganz bekannten bayerischen Räte brachten Durchbrüche zustande, wenn die Verhandlung stockte. Motor der Verhandlung waren vier miteinander unvereinbare Prinzipien:
restitutio (Wiederherstellung alten Rechts)
clausula rebus sic stantibus (Einfrieren von Konflikten)
dissimulatio (Verstellung, Maskerade, Heuchelei, Irreführung)
Herstellung eines neuen Vertrauens
Die vier Methoden kamen (in allerlei rhetorischer und verfahrenstechnischer Kostümierung) abwechselnd oder gleichzeitig zur Anwendung. In der Eile der Widersprüche aber fanden sich Lösungen.
Hinzu trat, daß die Veranstalter den Gegenstand ihrer Verhandlung, die jeweiligen Gelände, die Bevölkerungen und deren konkrete Glaubensverhältnisse kaum kannten. Oft wurden Boten ausgesandt, die Einzelheiten erkunden sollten. Viele dieser Boten kehrten erst mit Nachrichten zurück, als der betreffende Verhandlungspunkt gelöst war. Es mag widersinnig klingen: Auch die gemeinsame Unkenntnis trug zum Friedensschluß bei. Es war, als ziehe eine Wolke über das Reich, ein für das Abregnen nicht geeigneter Aggregatzustand des guten Willens, erzeugt von den Menschen in der Nähe der Not als geschichtlicher Atem, von den Verhandlern in Münster und Osnabrück nur eingeatmet und umgesetzt. Die Atemlosen in den Zentren der Verwüstung trugen am wenigsten zu diesem Phänomen bei, weil ihre Phantasie sich ein glückliches Ende am wenigsten vorstellen konnte.
Die Artikel der Friedensverträge kamen zustande durch
Verstecken ungeklärter Fragen,
Erfindung des Normaljahrs (nämlich desjenigen der dreißig Jahre, bei dem die verhandelnden Parteien im Schnitt am wenigsten Beute zurückzugeben hatten), Zumachen,der Verhandlung einen Termin setzen.
Die Verträge waren Flickwerk. Die Exekution einzelner Bestimmungen dauerte, wegen ihrer Unklarheit, Jahrzehnte. Aber der Friedensschluß, die EINMAUERUNG DES KRIEGES AUF ZEIT, entfaltete ein Eigenleben. Für ein halbes Jahrhundert konnte kein Fürst, ohne genaue Rechtfertigung, die für alle Öffentlichkeit verständlich war, einen Krieg beginnen. Die Söldnerheere waren entlassen. Bis zum Wiener Kongreß von 1815, der den Westfälischen Frieden seinem Protokoll nach zu imitieren versuchte, blieb ein glücklicher Riß in der Fatalität der Zeitgeschichte: eine Ecke für glückliche Hunde unter dem Tisch der Geschichte.
Die Nacht der Ingenieure im CERN
Als die gewaltigen Magnete so kurz nach der Premiere der neugestarteten Anlage zusammenbrachen (aus Gründen, die den Berechnungen der Ingenieure widersprachen, weil der Zusammenhang der Faktoren soviel stärker war als die einzelnen Probleme, die sie vorher so sorgfältig untersucht hatten), gerieten alle Chefs unter Schock. Keine Führung mehr für mehrere Stunden. Um 23 Uhr Notabschaltung überall. Die Initiativen gingen vom Mittelbau aus, von den aktiven Ingenieuren.
Schon um ein Uhr nachts, also zwei Stunden nach dem Unglück, machten sich diese Unterführer an die Reparaturen, den Neuaufbau. Keine Suche nach Schuldigen. Selbsthilfe. So sehr war schon in den Schadensfall eingegriffen worden – allein dadurch, daß der Zusammenbruch der Technik sich nicht mit der Implosion des Selbstbewußtseins dieser Macher verband, sie blieben hochgestimmt, noch im Drall der Fertigstellungsphase des gigantischen Projekts der GRÖSSTEN MASCHINE DER WELT –, daß inzwischen eine Dokumentation des Schadens gegenüber den Versicherungen nicht mehr möglich war. War der Schaden durch Eingriff im letzten Moment oder infolge von Aktionen unmittelbar nach der Havarie verursacht?
Keiner der Ingenieure sah einen Sinn darin, langwierige Gerichtsverfahren bei unklarer Beweislage mit Versicherern und Rückversicherern zu führen, wenn sie doch Könner genug waren, den Schaden selbst zu beheben. Bis drei Uhr nachts stand der Entschluß unter den Reparateuren fest, ohne Weisung, ohne Abstimmung mit den Chefs, ja ohne viel Kommunikation mit der Instandsetzung zu beginnen. Das bauen wir aus eigenen Kräften wieder neu zusammen, so wie wir es ohne fremde Hilfe entwickelt haben. Übermüdet, mit entzündeten Augen, getrieben von Adrenalinschüben, gingen sie noch in der Nacht ans Werk.
Sie hatten die Geschäftsleitung überrannt. Sie schufen vollendete Tatsachen. Die Planungen der Neukonstruktion waren in einer Skizze niedergelegt. Die Kühlung der Magnete, welche die Wände für die machtvollen Elementarteilchen in den Tunneln bildeten, mußte um mehrere Potenzen verstärkt werden. Schon war die Arbeit in vollem Gange. Die Reparatur wurde auf den Zeitraum von einem Jahr geschätzt.
Als Aushilfe am Samstag im mondänen Geschäft
Die Bedienung im Juwelen- und Uhrmachergeschäft in St. Moritz, am Samstagmorgen allein im Laden, war unbrauchbar. Keine Kenntnis vom Uhrenverkauf oder von Reparaturen. Auch unkundig, was die Goldwaren und kostbaren Modelluhren betraf. Keine konnte sie wirksam beschreiben. Der Ladenbesitzer war für das Wochenende zu einer Militärübung abberufen. Die Verkäuferin stakte auf hohen Schuhen durch den Laden, durchschnittliche, unattraktive Kleidung, breit angemalte Fingernägel. Lässiges Make-up und ungepflegtes Haar. Sie äußerte keine entschiedenen Sätze. »Kommen Sie vielleicht in einer der nächsten Wochen wieder.« Und: »Vielleicht haben wir das, was Sie wünschen, am Montag, vielleicht aber auch nicht.« »Ich könnte einmal nachsehen.« Sie machte sich aber nicht auf, nachzuforschen. Die meisten Kunden, die sie abwimmelte, fragten nicht weiter und gingen. Einigen, die insistierten, antwortete sie patzig.
Wieviel kostet diese Tissot-Uhr? »Wenn es nicht draufsteht, weiß ich es auch nicht.« Haben Sie diesen Goldring auch in Platin? »Das weiß ich nicht.« Sie hatte keine Schulung für das Verkaufsgespräch erhalten. Eine Naturbegabung für das Ladengeschäft mit kostbaren Gütern war sie nicht. Könnte man diese Uhr hier reparieren? »Weiß ich nicht.« Der Reparateur war wie der Ladenbesitzer auf einer militärischen Übung.
So legte sich der Streit, der zur Trennung hätte führen können
Der Ehestreit entwickelte sich nachmittags. Es war Samstag. Die Aussicht, daß übermorgen, Montag, der Alltag neu beginnt: öde. Ein Wort ergab das andere. Erst ging es um Kritik an der Unordnung im Bad, später, gegen 18 Uhr, lohender, feuriger Disput, erste Verletzungen.
Sie saßen ein jeder in seinem Zimmer. Einmal ging sie davon, als käme sie nie wieder. Sie hatte ein paar Sachen in eine Tasche gepackt und zog ab. Zermürbt, aber auch störrisch und beleidigt, inzwischen hungrig, unversorgt, blieb der Mann zurück. Auf Handyanruf hörte sie nicht. So unterließ er auch das. Vielleicht besuchte sie eine Freundin. Eventuell aber ging sie fremd, ließ sich von einem Fremden aufhetzen.
Dann kam sie gegen 22 Uhr zurück. Er blieb mürrisch, verletzt. Alles ungünstig für eine Versöhnung. Also verließ sie die Wohnung erneut.
Spät in der Nacht zeigte sich, daß im Kellergeschoß ihrer Ehe noch eine elektrische Leitung intakt geblieben war (oder ein Tunnel). Ihm fielen Bilder in die Hand von einer Reise vor acht Jahren. Sie wiederum, aufgrund eines Erinnerungsblitzes, war schon auf dem Weg zur Wohnung. Sie dachte, sie müßte noch etwas holen. Auf der Treppe des Mietshauses trafen sie aufeinander. Er auf dem Marsch, die Stadt nach ihr abzuklappern. Sie auf versuchsweiser Heimkehr. Irgend etwas war übrig, das nicht verstimmt war. So legte sich der Streit, der zur Trennung hätte führen können, noch bevor die Morgenröte des Sonntags anbrach. Übernächtigt schliefen sie nebeneinander ein. Die Sachen lagen herum, unordentlich verstreut in der Eile.
Die Wiedervereinigten
Etwa sechs Wochen nach dem Fall der Mauer reiste Rosemarie Zülcke von Halle mit ihren drei Kindern und Gepäck in den Westen. Flughafen Tegel, dann Bahn. Zwei Tage vor Heiligabend stand sie in Mannheim vor der Wohnungstür ihres Mannes, der sich – ein Jungarzt – in den Westen abgesetzt hatte. Die zurückgelassene Familie hatte unter Befragungen und Schikanen der in ihrem Endstadium agierenden Behörden zu leiden. Beide Eheleute Zülcke wußten von der Zerrüttung ihrer Ehe. Rosemarie verstand die nichtvereinbarte Absetzbewegung ihres Mannes als Scheidung. Das Setzen einer Grenze zwischen ihm und der Familie war einfacher als Trennung durch den Scheidungsrichter. Sie mochte das aber nicht für endgültig halten. Nachdem sie doch beide die Kinder zustande gebracht und halbwegs aufgezogen hatten. Das noch einvernehmlich. Sie schob seinen Trennungswunsch auf die Tristheit des DDR-Alltags, das Ungestüm der Karrieresucht ihres Mannes, den streberischen Zug, den sie kannte. Aber er hatte auch andere, abenteuerlustige Züge, die sie als anziehend empfand. Vielleicht ging noch alles gut.
Sogleich nachdem sie in die Wohnung eingedrungen war, entsetztes Gesicht ihres Mannes. Sie sah, daß er nicht allein lebte. Na, so war sie nicht abzufeiern. Sie beschlagnahmte quasi wie eine fremde Besatzungsmacht eines der Zimmer und einen Teil des Bades, belegte diese Räume mit Gepäck und den Kindern. Die Praxis ihres Mannes lag auf demselben Stockwerk gegenüber. Die fremde Frau forderte sie auf, sich dorthin zu begeben. Sie tat so, als hielte sie diese Person für eine Sprechstundenhilfe.
Der Mann zunächst hilflos. Dann pampig. Er mußte lernen, daß Rosemarie im Streite wuchs. Vor den Kindern konnte er sie nicht aus der Wohnung weisen. Damit waren seine Einflußmöglichkeiten auf die Situation erschöpft. Rosemarie erwarb ein Weihnachtsbäumchen im Zentrum der Stadt, kaufte mit dem BEGRÜSSUNGSGELD und dem UMGETAUSCHTEN eine Notration an Nahrungsmitteln, um unabhängig zu sein bei der Besetzung des Quartiers. Sie schimpfte nicht, hatte sich attraktiv gemacht, schuf Gemütlichkeit im Haus, ließ sich weder betatschen noch aufreizen, noch in ihrer Präsenz erschüttern. Sie war »erzieherisch« tätig. Der Mann schämte sich. In diesem Zustand war mit ihm nichts Positives anzufangen. Sie hatte den Eindruck, daß sein neues Leben im Westen noch keinem klaren Plan entsprach. In den Weihnachtstagen dachte er um. Offenbar Streitgespräch drüben in der Praxis mit seiner Neuen, der er wohl Unzureichendes von seiner Familie im Osten berichtet hatte. Rosemarie hielt die Bindung nicht für solide. Die Kinder halfen. Wie sollte der Mann, konfrontiert mit den besten Augenblicken seines früheren Lebens, mitten in den Weihnachtstagen, bei einem Trennungsentschluß bleiben, der zurücklag und sich auf eine ganz andere gesellschaftliche Lage bezogen hatte? Am Stephanstag zog die fremde Frau, die abgehalfterte Geliebte, die sich Hoffnungen gemacht, aber nicht damit gerechnet hatte, um ein Haar Bigamistin zu werden, aus der Praxis aus. Mit einem gewissen Lärm, noch nicht einverstanden, wechselte die Rivalin in ein Hotel. Später verließ sie die Stadt.
Rosemarie zeigte sich von ihrer bezauberndsten Seite. Nur keine Schuldgefühle verursachen! So weit kannte sie das Temperament ihres abtrünnigen Mannes, daß er einem neuen Abenteuer mit ihr, einer lustvollen Perspektive nicht widerstehen konnte. Noch vor Silvester lagen sie zusammen im Bett. Die Kinder besuchten ein Kino.
Ich, seine Frau, bin der Gorilla
Mein Mann ist die weiße Frau in meiner Hand. Was für ein Zwerg im Gemüt! Er glaubt zwanghaft, selbst nicht älter zu werden, wenn er mich austauscht gegen eine energisch Jüngere, die Nana heißt. Eine Zugelaufene. Ich hätte vorsichtiger sein müssen.
Seit seinem 50. Geburtstag ist sein Sinn ihm verwirrt. Der Rest war Gelegenheit. Ich hätte ihn nicht sechs Wochen lang im Haus allein lassen dürfen. Meine China-Reise war dringlich. Wesentlicher aber wäre gewesen, daß ich die Meinen zusammengehalten hätte. Ein Augenblick der Schwäche, als ich mich entschied, zu reisen.
Ich hatte Nana, ich nenne sie »die Kleine«, als Au-pair ihm anvertraut. Als ich zurückkehrte, war sie die Chefin im Hause. Gerade, daß er mich nicht aufgefordert hat, sofort auszuziehen. Die Scheidungsklage hat er eingereicht. Begründung soll folgen. Er hat keine wirksamen Gründe, und ich werde die besseren Anwälte haben. Das bringt seinem Vermögen Schaden. Es ändert nichts daran, daß er mich verläßt. Vermögen habe ich selbst genug. Die Remonstrationen beider Kinder, sie sind ja fast Erwachsene, bewirken nichts. Ich redete mit ihm, als die Intrigantin, die ihn beschäftigt hält, einen Moment außer Haus war. Die Grenze für eine Bindung, sagte ich, liegt bei einem Mann bei der Hälfte seines Alters plus 8 Jahre. Du bist 51 Jahre alt. Somit liegt das Limit, bevor Du Dich lächerlich und im Alter unglücklich machst, bei 25 1/2 plus 8 Jahren. Sie müßte also etwa 33 Jahre alt sein. Sie ist 18. Du wirst an ihr sterben.
Das war der falsche Ton. Ich sah es an seiner Miene. Ich war erregt. Er hat das Zimmer verlassen. Ich muß mich fassen und werde lange Zeit brauchen, um ihn seinem Glück zuzuführen. Diese Kapriolen einer kleinen Seele, die ich so zärtlich liebe!
Für den Hausgebrauch – ich bin mächtig, robust, selbstbewußt, genügsam, urwalderfahren – würde mir genügen, daß ich als BEWEIS UNSERER EWIGEN ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT die Kinder habe. Ich habe gelebt und geliebt, das genügt. Einen Besitzstand, der nicht zu retten ist, muß ich nicht halten (wir sind gleichaltrig, keine Waffengleichheit des Alters bei Mann und Frau). Meine Spätzin, mein Geliebter, war nie mein Besitz, eher ein Streifschuß, eine Wunde, an die ich mich gewöhnte. »Er hat mich getroffen, also bin ich.«
Wir beide haben das Fiasko nicht verschuldet. Gemeinsames Gut ist, daß wir 30 Jahre miteinander zugebracht haben. Mein charakterlicher Winzling, mein Herrscher und Idol, Kaiser meiner Seele (altmodisch gesprochen, so denke ich keineswegs, aber ohne ihn will ich nicht leben), ich hielte es nicht aus, wenn ihn seine »neue Liebe« umbrächte. Dieser Manager, dessen Zeiten kontingentiert sind! Nach Arbeitsende wird er das eigensinnige junge Ding verwöhnen wollen. Er wird es ausführen, bei Laune halten müssen. Ich unterschätze meine Gegenspielerin nicht, die unsere Tochter sein könnte. Vielleicht sucht sie ihn zu schonen, sich in den Fugen seines Zeitbudgets, in den Pausen, die das Geschäft ihm läßt, einzupassen. (Es wird ihr nicht bekommen, sie hat nicht meine unbändige Kraft, sie ist kein Tier.)
Er aber, so, wie ihn seine Phantasie angetrieben hat, sich eine Junge auszusuchen, wird den PROPELLER SEINER SEELE gewaltig überhitzen. In den Augen Dritter wird er sehen wollen, daß er ein starker Unterhalter, eine jugendlich-männliche (und keineswegs väterliche) Gestalt sei, die in diesen Roman eingeht. Der verächtliche Blick eines Rivalen, der sich um »die Kleine« bemüht, kann ihn töten. Nichts macht so steuerungsunfähig wie der Zweifel an der eigenen Kraft. Mir wäre das fremd, da ich nichts will oder brauche als diesen Mann, den ich nicht halten kann.
Postskriptum
Inzwischen habe ich – mit der balladesken Verve jenes Schrankenwärters vor 100 Jahren, der unter Einsatz seines Lebens, als ein Schnellzug heranrast, den Hebel der Weiche herumriß – das Schicksal sich wenden lassen. Hybris ist dabei. Aber was ist eine eventuelle Selbstüberschätzung gegen ein offensichtliches Unheil. Steffi, meine beste Freundin, zehn Jahre jünger als ich, ist eingesprungen. Nicht daß sie wußte, was geschehen sollte. Nicht, daß der SPERLING MEINER SEELE, DER KURZATMER, den ich liebe, überhaupt bemerkt hätte, wie ihm geschieht. Häßlich die Schlußszene mit dem Au-pair, das den Putsch gewagt hatte.
Beim Scheidungsverfahren müssen wir es belassen. Mein Schützling wird übersiedeln in Steffis Haus. Der Kontakt mit den Kindern wird in Steffis großem Haushalt und in meinem leichtfallen. Bei der Auseinandersetzung im Prozeß werde ich ihm ein gewaltiges Vermögen abnehmen. Wenn er einst vor der Zahlungsunfähigkeit steht, was ich vermute, weil mein Spatz ohne mich noch nie gute Entscheidungen traf, werde ich ihn mit meinem und seinem Geld unerwartet auslösen. Rettung für Steffi und die Kinder gleich mit. Ich halte mich für einen politischen Geist, der weiß, was er will. Was sich nicht halten läßt, will ich auch nicht haben. Opportunistin bin ich nicht. Und, wie gesagt, Herrin meiner Gefühle auch nicht. Meine Liebe ist eine Naturgewalt.
Wie eine Trümmerfrau ihren Mann reparierte
Die Listen waren noch dieselben, nach denen die Frauen der Stadt im Vorjahr zum Kriegsdienst an der Rüstungsfront eingezogen worden waren. Die gleiche Verwaltung, zum Teil andere Leute. So wurden diese Frauen jetzt von der provisorischen neuen Stadtverwaltung benachrichtigt und eingeteilt zur Trümmerbeseitigung und Bearbeitung von Backsteinen, die, saubergeklopft, aufgetürmt, dem Neuaufbau des von Bomben verstümmelten Zentrums dienen sollten. Noch hatten die neuen Leiter der politischen Geschicke, begleitet und fachlich angeleitet von ehemaligen Führungskräften, die in die zweite und dritte Reihe gerückt waren, einen Schuß von Selbstgewißheit nicht verloren. Es war Trägheit des Gemüts im Schwange: Das ganze Maß der Zerstörung und der Handlungsunfähigkeit war noch nicht verstanden. Das Stadttheater, dessen Vorderfassade von zwei Bomben eingerissen war – ja, behauptete der Firmenchef des örtlichen Bauunternehmens, das haben wir mit einem Budget von 100 000 Reichsmark in zwei Monaten wieder instand gesetzt. Dem stand entgegen, daß der Mann Parteimitglied gewesen war und niemand sich traute, dem Ehemaligen einen öffentlichen Auftrag zu geben. Die Backsteine für solchen Wiederaufbau, auch was andere Objekte in der Stadt betrifft, lagen schon geschichtet auf den Flächen, die von Trümmern geräumt waren. Loren und Schienen, alles aus dem Industriewerk ausgeliehen, dem Rüstungszentrum, das jetzt stillag.
In weitem Umkreis schufteten die Frauenbataillone, schleppten und schippten. Sie gingen die Trümmerberge an, so wie die dalagen, sortierten den nicht mehr verwertbaren Schutt, trennten ihn von dem Stoff, aus dem noch etwas gemacht werden konnte, fuhren das völlig Unbrauchbare mit den Loren an den Rand der Stadt, stapelten Vorräte an noch zu bearbeitenden Backsteinen, daneben eine Halde von Eisenteilen. In die schlechteste, verbrauchbare Kleidung gehüllt. Gegen den Dreck und Staub waren die Haare, so gut es ging, durch Kopftücher geschützt. Unter diesen Frauen Gerti Pratsche. Eine Wolke von Eifer umgibt die Frauen. Auch wenn sie recht erschöpft sind in diesen Wochen. Kleine Zeichen spontaner gegenseitiger Hilfe. Sie reagieren aufeinander beim Zuwerfen der Steine. Sie nehmen Rücksicht darauf, daß die Schippen einander nicht in die Quere kommen. Irgendeine Schaltung im Körper, die das bewirkt. Einer Tasse Kaffee ähnlich, die doch unerreichbar ist (oder einem Quentchen, einer Geruchsprobe davon). Die Wirkung wird aber durch einzelne, ganz schwache Moleküle hergestellt, die entweder der Körper oder das Gehirn absondert, oder aber durch eine Art von gegenseitiger Anregung in der Gruppe, einer Art »Besoffenheit durch Arbeit«, tatsächlich dadurch, daß sie einander nahe sind. Das möbelt Muskeln und Sinne kurzzeitig auf. Die Erschöpfung tritt nach Schluß der Schicht ein, auf dem Nachhauseweg, wenn Gerti für einen Moment mit sich allein ist.
Jetzt muß Gerti aber noch die drei Jungs versorgen. Vieles ist durch den Ältesten vorbereitet, als sie nach Hause kommt, längst nicht das Wichtigste. Sie sieht jetzt nach der Mansarde, in die sich ihr Mann eingeschlossen hat. Er hat sich verbarrikadiert, seit der Entlassung aus der Gefangenschaft ist das so. Er wäscht sich nicht. Er zieht die Kriegsklamotten nicht aus. Sein Körper stinkt. Er läßt Gerti nicht an sich heran. Er will sich nicht nackt zeigen. Sie darf ihn nicht waschen.
Nachts liegt er auf dem Holzboden des Raums, wie »auf freiem Feld«. Das weiche Bett hält er nicht aus. Er wälzt sich dann unruhig, legt sich wieder auf den harten Boden. Er kann die Gewohnheiten des Kriegs nicht ablegen wie einen Mantel. Deshalb behält er auch den Soldatenmantel an, obwohl es heiß und sommerlich ist. Es liegt ein Abgrund zwischen seinen Lumpen, die ihn als Soldaten ausweisen, und den intakten Zivilanzügen, die im Schrank hängen (von früher her). Durch keine Reden ist er dazu zu bringen, einen davon anzuziehen. Er will sie schonen, sagt er. Er will die guten Stücke nicht verdrecken. Ja, also die Sachen sind zu schade. Zu schade, um von einem Krieger aus einem verlorenen Krieg getragen zu werden.
Sie rüttelt an der Mansardentür. Er soll merken, daß sie da ist. Er läßt sich Nahrungsmittel vor die Tür des Zimmers legen. Nimmt sie später herein, wenn seine Frau nicht mehr vor der Tür steht. Das ist der Kontakt. Sie ruft ihn an. Keine Antwort. Das ist der Lohn dafür, daß sie die Familienfront während seiner langen Abwesenheiten intakt hielt. Gern würde sie von der Herrschaft, die ihr zugewachsen ist, etwas an ihn abgeben. Die drei Jungs würden das nicht zulassen. Sie lehnen den Heimkehrer, den schlappen Mann, ab, den sie mit dem früheren Vater, an den sie sich erinnern, nicht verwechseln (den früheren, den sie zu kennen und zu lieben glauben, wollen sie zurückhaben, nicht das Kleingeld, das aus dem Kampf zurückkam).
Schon eigenartig, ihr verdächtig, wie er zuletzt zweimal auf Fronturlaub bei ihr eintraf. Verdreht. Kam gar nicht wirklich zu Hause an. Wollte gleich wieder zu seiner Einheit zurück ins Gewohnte. Saß angestrengt und passiv in der Runde. Was ist das für eine Ehe! Die war in einer Woche Urlaub nicht wieder in Fahrt zu bringen. Erst auf dem Bahnsteig, mit Gepäck und Tornister fertig zur Abreise: eine winzige Lockerung im Gesicht, einige Worte, etwas über das hinaus, was auf einer Postkarte geschrieben sein könnte. Kurze Berührung der Münder (nach mehreren Versuchen, die Schnauzen zueinanderzubringen, sie, die hilfsbereite Aktivistin), um den Urlauberzug herum Gerenne der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV). Endlich lagen die Lippen aufeinander. Sie hatte den Eindruck, daß dies erst gelang, als ihr Mann gewiß war, daß gleich darauf der Pfiff zur Abfahrt des Zuges ertönen würde, der Kuß also zu keinen Weiterungen führen konnte. Eigentlich war der Mann, dachte sie, jetzt erst angekommen.
Zurück zum Tagewerk, zum Wiederaufbau. Von früh auf Schicht, dann Versorgung, zusätzlich Organisieren von Lebensmitteln. Ein Eimer Zucker pro Haushalt ist abzuholen im Gaswerk. Die Jungens helfen, wie sie können, inzwischen sind zwei zum Schülereinsatz auf den Gütern im Landkreis zwangsrekrutiert, bleibt nur der Jüngste für den Haushalt.
Einmal ist sie von außen mit einer Leiter bis zum Fenster des Gefängnisses geklettert, in dem sich ihr Mann verschanzt hat. Durchs Fenster haben sie einander angesehen. Sie hat gewinkt, ehe sie wieder herabstieg. Er regungslos. So kann das nicht weitergehen, hat sie ihm stumm zugerufen. Im Kopf hat sie einen Zauberspruch, Abkömmling eines Fluches und eines Segens, eine Mischung, die Situation war nicht normal. Worte nur im Kopf, die der andere nicht hören kann, vielleicht aus ihrer Miene abliest (oder aus ihrer Haltung auf der Leiter, die ja Vorsicht, Balance ausdrückt, während ihr Gesichtsausdruck die unhörbaren Zurufe verstärkt). Wenigstens war das ein direkter Kontakt.
Das nächste Mal legte sie einen Zettel mit Nachrichten und einem Gruß zu den Lebensmitteln vor die Tür. Ein anderes Mal, auf Zetteln notiert, einen Wunsch, er solle ihr für die Suche nach einem Werkzeug im Keller, das sie nicht fand, einen Hinweis geben. Diesmal schob er ein Papier mit einer Antwort unter der Tür durch. Mit den Kindern konnte sie über das Unglück, den Scherbenhaufen an Ehe, nicht sprechen, aber mit den Kolleginnen, die, während sie klopften und schichteten, ihre Pausen machten, sprach sie viel.
Es konnte sein, daß der Mann sich schämte, daß er verrückt war oder daß ihm die Anpassung ans eigene Haus (also die sogenannte Heimkehr) nicht gelang. Eine aus der Trümmerbrigade, die im Beruf Lehrerin war, sagte: Scham ist ein »Absturz des Ich-Gefühls. Einer glaubt, er müsse in den Boden versinken«. Das blieben für Gerti Worte. Befand sich ihr Mann noch auf einer der Rückzugsstraßen? War er noch gar nicht angekommen? Oder, fragte sie sich, war er so erleichtert, endlich zu Hause angelangt zu sein, daß er zutiefst niedersank, durch den Boden hindurchstürzte und von dort unten erst wieder auftauchen mußte? Sie war entschlossen, seine Gestörtheit positiv zu bewerten. Günstig für die Aufnahme dieses Mannes als Fünfter in ihre Vierer-Republik. Brückenbau. Was heißt »Brücke« bei totaler Niedergeschlagenheit? Sicher nichts, das ein Geländer hat.
Die Besatzungsmacht wechselte. Wo GIs patrouilliert hatten in ihren Jeeps, liefen britische Soldaten zu Fuß ihre Streifen. Stattlich geschichtete Blöcke in Längsrichtung. Mit Hämmern und Klopfern gesäuberte Backsteine. Nebenprodukt: Pfade und Wege durchs zertrümmerte Gelände. Die Bauunternehmer (die noch vor Wochen geprahlt hatten, wie rasch die Stadt wieder aufgebaut sein würde, stünden nur erst Materialien, Pläne und Bauaufträge bereit) sind verhaftet oder in andere Orte abgewandert. Inzwischen ist das Maß des Zusammenbruchs verinnerlicht. Nichts mehr vom Übermut, »das Unmögliche ist nur eine Frage der Organisation«. Die Erregung des Krieges braucht ein Dreivierteljahr, um im Innern abzuebben und nicht nur den Gegenstand zu wechseln.
Inzwischen setzt sich Gertis Mann abends schon mit an den Tisch. Er hat Werkzeug zusammengesammelt. Er zeigt: Er wäre arbeitswillig, wenn ihm einer sagen könnte, welche Art von Tätigkeit in diesem Chaos einen Sinn hätte. Gerti geht sparsam um mit ihren Worten. Auch mit den Gesten und Zeichen. Sie deutet erneut an, daß sie gern etwas von ihrer Autorität abgeben würde (alle gehorchen ihr in der Familie und in der Nachbarschaft). Die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, das sieht sie, haben sich umgekehrt. Eine Balance, nicht die Wiederkehr der früheren Verhältnisse strebt sie an. Eine Formel muß her fürs Weiterleben.
Sie hat einen weiteren guten Einfall: eine Liste mit Reparaturen, die sie von ihm erwartet. Die instand gesetzten Gegenstände (eine Tür, ein Gartenzaun, der Lichtanschluß in der Waschküche) helfen, ihren Mann zu reparieren. Kleine Erfolge im Werte eines Zaubertranks, einer Droge. Aus gesammelten Zigarettenkippen der Besatzungsmacht drehte sie Zigaretten. Sie liegen in einer leeren Zigarrenkiste in seiner Griffnähe. Ihr Jüngster, den sie am leichtesten zu lenken weiß, war unterwegs im Umfeld der Besatzungsmacht. Dosen mit Vorräten, britisch verpackt. Das sieht auf der Kommode stattlich aus. So lockte sie die Seele ihres Mannes ans Tageslicht. Ein Lebewesen, stumpf geworden durch Enttäuschung, aber verführbar. Wie vor einem Fuchsloch saß sie wochenlang und wartete, ob aus dem Bau etwas Überraschendes herauskommt. Es schien ihr, daß sie, vorausgesetzt die leichte Lockerung dieses versteinerten Charakters hielte an, der einmal ihr Bräutigam, ihr geschätzter Berufsoffizier gewesen war (die Operettenmelodien dazu hatte sie im Ohr) – daß aus solcher Militärpuppe ein neues, überraschend interessantes Tier entstünde, etwas, das neu instand gesetzt zu haben sich nachträglich lohnt. Die Erwartung belebte sie. Gegen den Protest aller Muskeln und Sehnen, ausgemergelt auf der Hautoberfläche, begann sie jetzt, sich zu pflegen, für den Abend schön zu machen. Im Winter, keine Trümmerfrau arbeitete mehr in der verschneiten Stadtwelt, kam ihr Mann zu ihr ins Bett zurück. Zuletzt war er da gewesen (ein anderer), als sie beide den Jüngsten zeugten.
Lese- und Filmlinks zu »Es geht nichts über Reparaturerfahrung«
→ Ein lebendiges Verhältnis zur Arbeit, Chronik der Gefühle, Band I, S. 35 | → Das Prinzip Überraschung, Das Bohren harter Bretter, S. 122 | → »Ich bette meinen Kopf auf Schrauben, bis alle Brücken auseinanderfetzen«, 30. April 1945, S. 249 | → Ein einfacher Handgriff, Das fünfte Buch, S. 171 | → HEBAMMENKUNST, Das fünfte Buch, S. 179 | → Die Bombenentschärfer im Keller, Die Patriotin, Timecode: 11.40 | → Helge Schneider bei der Reparatur des Hubble-Teleskops, in: Die Seele braucht Vitamin C. Helge Schneiders neueste Abenteuerreisen, News & Stories, 13. 9. 2009 | → Was hält freiwillige Taten zusammen?, Chronik der Gefühle, Band I, S. 921 | → Die wunderlichen Nachbarskinder, Das Labyrinth der zärtlichen Kraft, S. 323 | → Arbeit/Glücksarbeit, Geschichten vom Kino, S. 497 | → Fackel der Freiheit, Chronik der Gefühle, Band I, S. 142 | → Rückkehr zur »unabhängigen Bodenbearbeitung«, Das fünfte Buch, S. 201 | → Kann man ohne Hoffnung irgend etwas finden?, Chronik der Gefühle, Band I, S. 110 | → Für die Zukunft ihrer Krabbe tätig, Das fünfte Buch, S. 24 | → Lebenszeit gegen Geld, Das fünfte Buch, S. 170 | → Begegnung mit dem Glück in globalisierter Welt, Das fünfte Buch, S. 166 | → Lob der Plumpheit, Chronik der Gefühle, Band I, S. 442 | → Die näheren Umstände der moralischen Kraft, Chronik der Gefühle, Band I, S. 434 | → Zustöpseln eines Kinderhirns, Chronik der Gefühle, Band II, S. 17 | → Willi Scarpinski der Heizer, Chronik der Gefühle, Band II, S. 269 | → Ein Messer im Herz des Friedens. 1618 bis 1648: alle bastelten an der Aufheizung des Konflikts, Ten to Eleven, 23. 3. 2015 | → Der coolste Ort im Universum, News & Stories, 1. 3. 2009 | → Mit allen Sinnen sannen wir auf Rettung,Chronik der Gefühle, Band II, S. 25 | → Glück, Lohn der Tugend, Chronik der Gefühle, Band I, S. 917 | → Interview mit einem Vertreter des Schrottverbandes, Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, Timecode: 30 .53.
2Wilde Verläßlichkeit
Abb. 2: Handfläche eines Gorillas.
Zeitgestalt von Gorillatieren
Bei seinem Gastaufenthalt in Wien (der Philosoph war zu einem Forschungsprojekt für drei Wochen an die dortige Universität eingeladen) besuchte Oskar Negt den Tierpark Schönbrunn. Ein Menschenaffe, der auf einem Schild vor dem Gatter als Berggorilla aus dem Osten Afrikas bezeichnet war, wandte dem Publikum, als Negt eintraf, den Rücken zu. Negt, aus Ostpreußen gebürtig, nervenstark und duldsam von Natur und Bildung, wartete etwas mehr als eine Stunde darauf, daß das Tier seine Stellung änderte, so daß er es von vorn hätte betrachten können. Der Großaffe zeigte während dieser Wartezeit nichts als seinen Rücken, auf dem eine imposante Schicht grauer Haare einen Streifen durch das sonst grauschwarze Fell zog. Nicht einmal, daß er den Kopf zur Seite wandte. So verhielt er sich, berichtete der Zoowärter, schon den ganzen Tag. Und Negt zweifelte daran, daß das Tier seine Position in der Nacht, in der kein Publikum mehr vorhanden wäre, ändern würde.
Architekten der Emotion
Ich habe Gorillas, diese gewaltigen Pflanzenfresser, bei der Kinderaufzucht beobachtet. Das sagte jene Frau, die ein Leben mit Gorillas verbracht hatte und dann von Wilderern ermordet wurde. Ein nachmittäglicher Spaß zwischen den kraftstrotzenden Großtieren und den damit verglichen winzigen Jungen dauerte mit sparsamen Bewegungen und viel eingeschobener Ruhezeit gut zwei Stunden. Sie verwenden viel Zeit für die Aufzucht. Bis zum Abstillen vier Jahre. Ein Lebensvorrat an Solidarität, investiert in eine einzelne Generation, der für hundert Clans menschlicher Vorfahren ausgereicht hätte.
Untauglichkeit von Gorillas für Zirkus und Dressur
Juri Eduardowitsch, einer der Dompteure aus der Zirkusfamilie Durow, dem Rußland so zahlreiche Sensationen verdankt, hat 1925 versucht, einen auf dem Weltmarkt angekauften Gorilla für eine Zirkusnummer zu dressieren. Das Tier, das sich trotz seiner Größe wegen seiner eingeknickten Haltung lediglich in Augenhöhe mit dem Zirkusmann befand, schien in nichts imposant. Zudem blickte das Tier weg, wenn Durow seine »Augen zu fesseln« suchte, von Pupille zu Pupille, weil er gewohnt war, hypnotische Ströme auf Hunde und Löwen zu übertragen – das war seine Spezialität. Auch sonst fehlte dem Geschöpf das Verständnis für den AUSSTELLUNGSWERT. Ein Tier muß etwas machen, was das Publikum überrascht. Der Primate saß im feinen Holzmehl der Manege und rührte sich nicht bis zur nächsten Mahlzeit. Nicht einmal, daß er sich in dem attraktiven, weichen Bodenbelag gesuhlt hätte.
Durow prüfte, ob man den Großaffen mit Ketten an einer Säule befestigen könnte, um dem Publikum zu suggerieren, daß von diesem Tier eine Gefahr ausginge. Dafür aber hätte es wenigstens mit den Zähnen fletschen müssen. Es saß bräsig da und wirkte nur auf dem Plakat, das Durow hatte vorbereiten lassen, bißkräftig und groß genug, um für ein tausendköpfiges Publikum eine Sensation darzustellen. Durows Schwester versuchte es mit einer Pferdenummer. Sie war eine erfahrene Eisbärjägerin und gastierte mit einer Nummer von sechzehn weißen Bären. Der Affe ließ sich auf den Rücken des stabilen Schimmels hieven, klammerte sich aber in einer verunglückten Haltung an dessen Hals. So ließ er sich im Kreise durch die Manege treiben. Eine Nummer ergab das nicht. Das war auch durch Tusch-Signale der Zirkuskapelle keinem Höhepunkt zuzuführen. Das Tier war für einen hohen Devisenbetrag eingekauft worden. Das Budget war in der Fünf-Jahres-Planung für das sowjetische Zirkuswesen aufgeführt; es mußte etwas geschehen, das einen volkswirtschaftlichen Gegenwert für die Kosten der Anschaffung erbrachte.
Längst waren Bilderbogen in Umlauf gebracht, die Episoden aus dem Leben von Gorillas im Urwald und bei Berührung mit Menschen dramatisierten. Dem real existierenden Lebewesen in Moskau war keine markante Aktion dieser Art zu entlocken. Wenn das Tier eine Karotte aß, ging das in einem Zeitmaß vor sich, das die Geduld eines jeden Publikums überfordert hätte. So saß der Gorilla schließlich neben dem Eingang zur Kasse, neben ihm plaziert ein Braunbär an der Kette. Man mußte darauf achten, daß der Affe nicht in der Zugluft saß. In jedem Eingang eines öffentlichen Gebäudes in Moskau, also auch im Zirkus, gibt es Zugluft, weil es an Doppeltüren und Drehtüren fehlt. Die Tiere aus Afrika bekommen leicht Lungenentzündung, hieß es. Die Veterinärärzte der Armee, die der Zirkus um Rat fragte, kannten sich mit Affen wenig aus.
»Man muß Kong stets mit Sie anreden!«
Der Roman von Delos W. Lovelace von 1932 nennt King Kong ein GOTT-TIER. Wie würde man die Greifglieder bezeichnen, in denen sich die weiße Frau einrichtete? Pfoten, Pratzen oder Hände? Die Benennung durch einen abergläubischen Eingeborenenstamm ist nicht maßgebend, meinte der Webkommentator Fitz Gerald 7.Bot. Handelt es sich überhaupt um ein Tier? Oder um einen Parallelmenschen?
Bekenntnis
Ich, bekennender Altweltaffennachfolger, Abkömmling von Trockennasenaffen, die den Gorillas vorangingen, wie alle Menschen, Sohn einer Mutter, die im vertraulichen Umgang »Äffchen« genannt wurde, jedoch eher in Anspielung auf Effi Briest als nach ihrem Vornamen Alice, hoffe lebhaft, daß mir Hochmut fehlt gegenüber allen unseren Gefährten der Evolution. Demütig verbunden bin ich mit der gewaltigen Kette von Künstlern von Ovid über Mandelstam bis in unsere Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob die Meister mich erkennen, wenn ich auf sie treffe.
Wären die ENTHUSIASTISCHEN ACHTZEHNTAUSEND