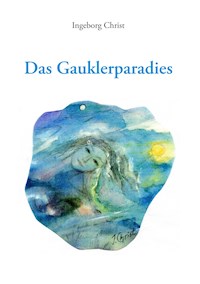
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Gauklerparadies ist unsere Welt, sowie auch die all jener, die sich am Ende vielleicht irgendwo wiedersehen: Menschen aller Völker und verschiedener Religionen, Menschen aller Art. Das Buch: Ist es Glaube, Hoffnung, eine Überlebens-Philosophie aus der ewig währenden Sehnsucht nach Liebe und Frieden? Egal! Die Begegnungen in jenem anderen Paradies bringen aus der Distanz heraus mannigfaltige Diskussionen über das Erdenleben mit sich. Namhafte Menschen mit Welterfahrung und Wissen beurteilen das Weltgeschehen mit wachem Geist und mit Herz. Es wird beurteilt, gespöttelt und gemahnt. Auch die Sehnsucht spielt mit nach dem Leben auf einer schönen blauen Erde – oder einer zurückgelassenen Liebe; denn sie lebt in der Seele. Ein Buch, über das sich nachdenken lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Autorin Ingeborg Christ:
1940 in der Eifel geboren, lebte vorwiegend in Köln und Lindau am Bodensee.
Ihre Texte wurden über Jahre in Literaturzeitschriften, Gemeinschaftsbänden und Anthologien veröffentlicht, wie in Stuttgart, Wien, Salzburg und Köln, sowie in Bombay/Indien, und in Jahresbänden der „Frankfurter Bibliothek“.
Als Einzelbände erschienen:
* „Die kleinen Träume vom Glück“ / 2010 Kurzgeschichten mit Gedichten und Malerei ISBN 978-3-8391-7411-1
* „September-Rose“ /2011 Roman ISBN 978-3-8423-9834-4
* „Die Zeit, die wir haben /2012 Gedichte ISBN 978-3-8448-3029-3
* „Mio piccolo Mondo“ / 2012 Meine kleine Welt Roman ISBN 978-3-8448-9629-9
* „Baikal-Liebe und mongolischer Wind“ / 2014 Roman ISBN 978-3-7357-6588-8
* „Das andere Leben“ / 2015 Geschichten ISBN 978-3-7392-8092-9
Exposé:
Das Gauklerparadies
ist unsere Welt, sowie auch die all jener, die sich am Ende vielleicht irgendwo wiedersehen: Menschen aller Völker und verschiedener Religionen, Menschen aller Art.
Das Buch: Ist es Glaube, Hoffnung, eine Überlebens-Philosophie aus der ewig währenden Sehnsucht nach Liebe und Frieden? Egal!
Die Begegnungen in jenem anderen Paradies bringen aus der Distanz heraus mannigfaltige Diskussionen über das Erdenleben mit sich. Namhafte Menschen mit Welterfahrung und Wissen beurteilen das Weltgeschehen mit wachem Geist und mit Herz. Es wird beurteilt, gespöttelt und gemahnt.
Auch die Sehnsucht spielt mit nach dem Leben auf einer schönen blauen Erde - oder einer zurückgelassenen Liebe; denn sie lebt in der Seele.
Ein Buch, über das sich nachdenken lässt.
~
Es gibt ein Land
der Lebenden
und ein Land
der Toten
und die Brücke
zwischen ihnen
ist die Liebe
Thornton Wilder
*
Ich stelle mir das Sterben vor
so wie ein großes helles Tor
durch das wir einmal gehen werden.
Dahinter liegt der Quell des Lichts
oder das Meer, vielleicht auch nichts.
Vielleicht ein Park mit grünen Bänken?
Doch eh nicht jemand wiederkehrt
und mich eines Besseren lehrt
möcht ich mir so den Himmel denken.
Reinhard Mey
Das Gauklerparadies in den Kapiteln:
Einmal mit den Vögeln fliegen
Der erste Frost
Nichts und Amen?
Mariann’s Mission
Das neue Kleid
Ein paradiesischer Garten
Im großen Forum
Die Gesellschaft
Diskussionen zum Weltgeschehen
Resümee beim russischen Schach
Sehnsucht im Abendrot
Ein Kranz aus Lotusblüten
Julia
Pako
La-le-lu
Ein Tänzchen in Ehren
Das Mani sakla
Mascha’s sibirjakische Seele
Indio-Träume leben weiter
Flieg Maya, flieg!
Paradies-Geplänkel
Im Land der Tiere
Tantems Rückkehr
Un aura amorosa
Gipfel-Prognosen
Eine kleine weiße Taube
Rosengeflüster
Das Leben
Der Baum
Mit Blatt und Blüten stand schon fertig der Baum
in der ersten Sonne des Frühlings
„Soll ich…?“ blies der Frühfrost aus einem eisigen Raum.
„Mein Liebster, bitte sei lind“,
baten die Knospen
„bis wir zu Blüten geworden sind!“
Sie wurden zu Blüten
als die Nachtigall sang.
„Soll ich …?“ rief der Wind
und schüttelte sie lang.
„Nein, lass lieber Wind,
warte noch bis wir Früchte sind!“
Des Baumes Früchte reiften
süß in der Sommerglut.
„Soll ich …?“ fragte der Wind
und setzte an zum Zug.
„Nein, scher dich fort!“ rief stolz der Baum
in seinem schwellenden Gut.
Als er sich sonnte in Purpur
in Siena, Ocker und Rubin
kam wieder der Wind: „Bist du bereit?“
„Aber nein! Sieh doch mein Kleid!“
„So komm! Es ist geblüht und geerntet,
und es gibt nicht nur Zeiten der Herrlichkeit!“
Der Baum:
Auszug aus einem norwegischen Gedicht von Björnstjern Björnson aus den Jahren um 1850. Ins Deutsche übertragen von Christian Morgenstern.
1994 umgeformt in die heutige Sprache und ergänzt von Ingeborg Christ
Inhaltsverzeichnis
Einmal mit den Vögeln fliegen …
Der erste Frost
Nichts und Amen?
Mariann’s Mission
Das neue Kleid
Ein paradiesischer Garten
Im großen Forum
Die Gesellschaft
Diskussionen zum Weltgeschehen - Frieden, Freiheit und Recht -
Resümee beim russischen Schach
Sehnsucht im Abendrot
Ein Kranz aus Lotusblüten
Julia
Pako
La-le-lu
Ein Tänzchen in Ehren
Das Mani sakla
Mascha, die sibirjakische Seele
Indioträume leben weiter
Flieg, Maya, flieg!
Paradies-Geplänkel
Im Land der Tiere
Tantems Rückkehr
Un‘ aura amorosa“
Gipfel-Prognosen
Eine kleine weiße Taube
Rosengeflüster
Einmal mit den Vögeln fliegen …
Es lag nicht nur daran,
dass der Hibiskus draußen an der Mauer leise die roten Schleier seiner letzten Blüten schloss, und auch nicht daran, dass die weißen Sommer-Segel auf dem See lautlos zusammenklappten wie sterbende Schwäne; dass kein Duft mehr von den Rosen ausging, die die still gewordenen Terrassen umrankten, auf denen Lachen und Leben verstummt war; oder daran, dass die Amsel vor dem Fenster das letzte Lied vom Sommer sang, und Wehmut zu spüren war, wenn das Alphorn klang, … nein; ein allgemeines Abschied-Nehmen lag in der Luft.
Still ruhte der Karersee unter den vielen hohen Türmen des Latemar und denen des Rosengartens in den Dolomiten. Die Brutnester der Wasservögel an seinem Ufer waren leer. Tief neigte sich das Schilf darüber, als wollte es sie immer noch vor den Augen der Raubmöwen beschützen. Letzte Sonnenstrahlen verirrten sich in den Halmen, tanzten auf dem Wasser und verschmolzen in der untergehenden Sonne zu einer rötlichen Decke, die sich auf dem See ausbreitete.
Die Abende waren still geworden; doch es gab immer wieder einen neuen Tag, an dem sich das Leben regte. Kurz vor der kalten Jahreszeit kamen noch täglich Scharen von Zugvögeln und Enten aus dem hohen Norden, die jeden Herbst über die Alpen nach Süden flogen. In großen Pulks landeten sie an den
Ufern des Sees; dort ruhten sie über Nacht. Andere hockten in der Dunkelheit als kleine schwarze Gestalten auf den Dächern der Häuser. Die wilden Enten mieden das Ufer. Draußen auf dem See schliefen sie Tag und Nacht, bis sie eines Morgens im rauschenden Geschwader in die thermischen Winde stiegen. Alle ahnten den ersten Schnee, der in der nächsten Nacht fallen würde.
Magdalena sah ihnen nach, bis sie in der Ferne als kleine dunkle Punkte in den Wolken verschwanden. Dabei regte sich auch in ihr ein leises Sehnen nach dem Land der Wärme, an dem das Leben neu begann. Irgendwann werde es auch für sie ein Sommerland geben, in dem sie ihr Platzerl finden werde, tröstete sie sich. Der Tag würde schon kommen, an dem auch sie einfach davonfliegen werde. Später, nur noch nicht jetzt!
Waren auch die süßen Düfte der Rosen und die Leichtigkeit des Sommers verflogen, so wehrten sich noch die schönen Erinnerungen gegen die Gedanken an eine bevorstehende kalte Zeit. So auch in Magdalena.
Würde es für alles, was lebte und über den Winter ruhte, einen neuen Frühling geben, so war es für ihr eigenes Leben ungewiss. Eine Sorge hatte sich bei ihr eingeschlichen und sie frieren lassen wie in einem rauen, kalten Wind, der die erste Frostnacht ankündigte. Sie hatte dem Ende nicht mehr viel Kraft entgegen zu setzen. Schmerzen und Krankheiten hatten sie müde gemacht, und ihr die gewohnte Lebenslust zu größeren Alltagsplänen genommen. Ihre Zeit schien absehbar zu sein. Doch den eigentlichen Willen zum Leben hatten sie nicht brechen können. Er lag fest verankert in ihren Wurzeln, wie bei den meisten Menschen.
Noch war es nicht an der Zeit zu resignieren. Sie war es nicht gewöhnt, das aufzugeben, was ihr lieb und teuer war. Und erst recht nicht das Leben!
Hatte sie sich auch schon gebeugt wie das Schilf, und die süßen Früchte des Lebens geerntet, so war sie doch noch nicht bereit, mit den Rosen und dem Hibiskus verblühen zu wollen.
Solange sich die Uhr des Lebens drehte, gab es immer wieder einen neuen Morgen, an dem die Amsel sang wenn die Sonne oben im Sella-Joch erwachte. Sie erhellte zwar die Welt und das Gemüt, aber sie wärmte nicht mehr wie früher, und der Winter war nah.
*
Der erste Frost
Magdalenas Geist und Seele hatten sich im Dämmerlicht eines frühen Morgens auf die Reise gemacht, während er erste Frost die Gräser im Garten in strahlendweiße Kunstwerke verwandelte. Ein kalter Wind zog darüber und ließ die zarten filigranen Eiskristalle klirren. Es hörte sich an wie eine leise Melodie. Erste Sonnenstrahlen fielen auf die glitzernde Fläche, leuchteten goldig, als gäben sie dem jungen Tag den Auftakt eines frohen Festes.
Schön wäre es anzusehen, aber Leonards Augen waren vom Kummer getrübt, und es fror ihn bis ins Herz.
Seine Lena hatte ihn verlassen, die mit ihm das Leben geteilt hatte! Jahr für Jahr, und Tag für Tag war sie an seiner Seite geblieben, zuverlässig und stark; und so hatte er sich bis heute irgendwie auf ihre Dauerhaftigkeit verlassen.
Doch nun schien sie fortgegangen zu sein, still und leise wie in einem komaähnlichem Schlaf. Ihren reglosen Körper hatte sie zurückgelassen. Schön und natürlich sah sie darin aus, solange sie nicht die Augen öffnete. Doch wenn, würden sie ohne ihre Seele ins Nichts blicken, wußte Leonard. Aber er wehrte sich dagegen, sie gehenzulassen. Hätten Beatmungsgeräte sie am Leben halten können, fragte er sich, als er wieder an ihrem Bett stand? Was vermag die Medizin, wenn ein Mensch so einfach stirbt? Sie lag da, und war doch weg. Grübelnd stand er vor ihr. Wohin mochte sie sein? Kein Mensch wußte es! Käme sie zurück, würde sie sich vielleicht nicht erinnern. Und wenn nicht, blieb es das Geheimnis aller Geheimnisse, dem man nur illusorisch folgen konnte.
In Leonards Kopf drehten sich die Gedanken. Er trat ans Fenster und sah zum Himmel hinauf. Lena hatte mit dem Glauben und der Hoffnung an ein späteres Dasein im Paradies gelebt. Es hatte ihr Ruhe und Zuversicht geschenkt. Er war bei diesem Thema stets anderer Meinung gewesen und hatte ihr leid getan. Logisch und nüchtern wie er nun mal war, war ihm der simple Glaube an die imaginären Dinge nicht gegeben.
Manchmal hatte sie ihn sogar trösten wollen und gesagt:
„Auch du wirst nicht einfach sterben und im Nichts enden, Leonard! Nicht du, dessen Geist zu wach ist für nur ein Leben, und die Seele zu gut, um verloren zu gehen!“
Das hätte er schon gerne geglaubt!
„Ach Lena, meine Seele, komm zurück! Und pfiat di Gott, wo immer du jetzt sein magst!
*
Nichts und Amen?
Auch in Magdalenas anderen Welt glitzerten Lichter in der milchigen Blässe des neuen Morgens. Täuschten sie zunächst ein Paradies vor, so waren sie nichts anderes als das Funkeln der Sterne auf den blanken Steinen am Boden.Verwirrt stand sie da und nahm das Niemandsland wahr, in das sie nach dem Eintauchen in eine wunderbare Seligkeit plötzlich hineingeraten war. In ein Land zwischen den Welten?
Wo war es, das Paradies, das helle Licht, die Wärme der Liebe, und das pure Glück, das sie zunächst empfunden hatte?
Doch hier war kein Paradies! Niemand empfing sie. Wo gab es den Duft von süßem Jasmin, wo blühte die Amaryllis; wo war der Geruch nach Nelken und Zimt, wie sie es sich vorgestellt hatte. Keine Orangen- und Olivenhaine, keine süßen Melonen, Ananas oder Mangos! Und Palmen am Strand, deren Zweige im warmen Wind fächelten; wo waren sie? Magdalena sah kein grünes Blatt! Keine Bananensträucher und Dattelbäume, in deren Schatten man sitzen könnte!
Wo war die Sonne, fragte sie sich? Das Licht war weißgetrübt und nicht warm. Darin konnte nichts gedeihen. Nichts, was man Leben nennen könnte! Und kein Mensch!
War dies wirklich das Nichts und Amen, wie Leonard gesagt hatte, und gegen das sie sich immer gewehrt hatte?
Ratlos wie sie war, begann sie zu klagen:
„Ach, wo bin ich gestrandet
aus meinem Land so gut und fern?
Wird mich der Wind forttragen
zur Sonne hin, oder einem Stern?
*
Mariann’s Mission
Mariann war es, die sie aus ihrem Trauma holte.
Sie komme auch aus den Bergen, „die selbst im Sommer Schneemützen tragen!“, lachte sie.
So wie sie lachte, war ihr Wesen: frei und unbekümmert. In Eile hatte sie erst an Magdalena vorbeihuschen wollen und, Gott wußte warum, hatte sie bei ihr angehalten. Leicht und schwerelos hüpfte sie auf einen hohen Stein und sah mitleidig und prüfend auf sie herab.
„Bist‘ erst angekommen?“ fragte sie.
Magdalena nickte und blickte sie verstört und fragend an.
„Aber hier … wo bin ich“?
„Komm, setz dich mit auf diesen Stein!“ sagte Mariann nur und rückte ein wenig zur Seite.
Dort saßen sie schweigend beieinander. Magdalena fragte sich, ob sie wohl ein Engel sei, der ihr geschickt wurde? Einer von diesen schönen aus den Bilderbüchern der Kindheit, der die Kinder über den Steg des Abgrunds führte. War es nicht so, dass auch sie ja noch über eine Brücke gehen musste, wo doch hier kein Platz zum Bleiben war?
Aber nein, Mariann war kein Engel! „Nie gewesen!“ lachte sie laut. „Wo wäre ich denn im Leben hingekommen?! Da musste man sich doch mit allen Bandagen wehren, so oder so“.
Eine gewitzte Seele schien sie zu sein, und eine lebenskluge, gescheite. Doch wohl auch eine gute; denn sie war der Meinung, dass sie hier sei, weil sie nicht einmal eine Fliege hätte erschlagen können, geschweige denn Hühner, Gänse und Ziegen! Ihren frechen Buben habe sie nur gedroht, und sei
ihrem Mann, der den Pflümli-Schnaps mehr liebte als sein Weib, stets zu Diensten gewesen, habe ihm seine Suppe gekocht und an seinen schlechten Tagen auch seine Arbeit getan. Zum Ausgleich dafür habe sie hier eine „himmliche Flamme“, sagte sie lachend. „Rein platonisch! Jenseits von Gut und Böse!“ beteuerte sie.
Wie alt sie war, wußte sie nicht. „Es interessiert doch Niemanden mehr. Geburtstage, Jubiläen und Kalender gibt es hier nicht!“ sagte Mariann.
„Vielleicht habe ich jetzt an die zweihundert Jahre?“ meinte sie schulterzuckend, umfasste ihre hochgezogenen Knie mit den Händen und drehte sich lachend wie ein aufgezogenes Spielzeug auf ihrem Stein.
„Hast du schon mal so eine zweihundertjährige Vergnügte gesehen?“
Ihr fröhliches Lachen schallte über das traurige Land und nahm etwas von der Schwermut mit, die sich wie ein Schatten ausgebreitet hatte.
Mariann kannte ihn, diesen Schatten. Sie nannte ihn „den Scherbenhaufen unserer Illusionen“, auf dem am Ende jeder sitzen und warten würde, davon befreit eingelassen zu werden ins Paradies. Aber auch dort werde ein Asylantrag geprüft, der zum Bleiben berechtigte, sagte Mariann.
„Du mußt dafür hier an diesem Platz dein Leben mit allem Guten und Schlechten ohne Selbstgefälligkeit beurteilen lernen. Dein eigener Geist, der sich ja auch im Leben frei für alles entschieden hat, soll nun auch hier erkennen, was richtig war oder falsch. Er ist im gereiften Menschen die verantwortliche Institution“, sagte sie ernst. „Dein Gewissen!
Eigentlich brauchst du keine Hilfe dafür. An ihm liegt es zu beweisen, ob auch seine Verdienste es wert sind, ein Überleben nur mit der Seele einzugehen, die hier beheimatet ist.
Dieser Prozess ist ein einsames, unbarmherziges Gericht!“ sagte sie. „Und es demütigt! Der Inhalt des Lebens breitet sich vor dir aus, herausfordernd und schonungslos!“
Mariann versuchte dabei zu helfen:
„Der, dem die Demut abhanden gekommen ist, muß sie hier wiederfinden“, sagte sie. „Ohne sie gibt es kein Sehen und Verstehen, und auch kein Urteil. Durch sie legt der Mensch die Selbstherrlichkeit ab, mit der er so gerne durchs Leben ging, so unschuldig und gut. Gut zu sich selbst!
Sie war es, die seine Ichbezogenheit nährte, und die Arroganz und Rechthaberei. Sie war die Krankheit der Macht, die sich daraus entwickelte, und nicht vom Menschen selbst erkannt und behandelt wurde. Sein Gewissen regte sich kaum noch, weil er es mehr und mehr verstand, seine Hände in Unschuld zu waschen“.
So war es wohl. Auch Magdalena erinnerte sich daran, wie sich so mancher Selbstgefällige daraus zum kleinen König gekrönt, und von allen anderen erwartet hatte, dass sie zu ihm als einem Vorbild aufblickten.
„Ja, die Unschuld der Erdenmenschen“, seufzte Mariann. „Hier aber werden die Kronen abgelegt. Und hier kommen auch die Wunden zutage, die Demütigungen, die sie mit ihrer selbstgefälligen Art und stillen Macht zufügten; denn auch der einfachste Mensch fühlt, was ihm an Rechten und Achtung zusteht. Egal, ob jene Menschen öffentliche oder versteckte kleine Despoten im alltäglichen Kleinkrieg waren: herrschen und siegen wollten sie immer, und verletzten und demütigten darüber andere.
Und wie erging es der Liebe in der Welt, und den guten Eigenschaften der Seele, die auch imstande wären, die Welt zu verändern, wenn sie stark genug wären!“
Sie fragten sich, wie man mit der Liebe umging in der Welt? Magdalena schien sie wie eine Handelsware geworden zu sein: Liebe für Liebe – oder keine! Die Menschen waren berechnend. Wo gab es noch die selbstlose Hingabe? Es hatte sie nur bei den wahrhaft Religiösen gegeben, wie bei Mutter Theresa und vielen anderen, an die sich Magdalena erinnerte. Sie waren den göttlichen Weg des Halacha gegangen, allen bequemen egoistischen Eigenschaften zum Trotz! Aber das war nicht jedem gegeben.
Beschämend fragte sich Magdalena auch, wie wenig sie selbst mit ihrer Hingabe aus Liebe bewirkt hatte. Hatte sie auch gern aus ihrem Herzen geschenkt, so war es immer noch nicht genug gewesen. Die Menschen waren so hungrig nach Zuneigung. Auch sie hatte sehr gern von diesem Elixier der Seelennahrung genommen und war nie satt geworden.
Vielleicht war sie gar vermessen gewesen, wenn sie mehr Liebe erwartet hatte? Und dumm zu glauben, dass sie ein Recht darauf habe! Sie war und blieb ein Geschenk aus freiwilliger Hingabe. Erhielt man sie auf Verlangen, war sie es nicht mehr!
Sie, Magdalena, hatte die Liebe selbstloser, auch ohne Eigennutz, verschenkt, wenn jemand sie gebraucht hatte. Sie hatte sogar geliebt, wenn sie vorher gekränkt und enttäuscht worden war.
Dann hatte sie Nachsicht walten lassen. Im Streit hätte ihr zuviel Unfrieden gelegen. Ja, doch, sie hatte ein großmütiges Herz!
„Und damit hast du gedient!“ sagte Mariann.
Still saß sie auf ihrem Stein und folgte Magdalenas Gedanken. Deren Rückblicke ließen auch die Erinnerungen an ihre eigene Zeit wieder aufleben. Sie dachte an die Rolle der Frauen damals, die so ganz anders gewesen war als heute. Kein Wunder, dass sich diese armen Weiber das Paradies erworben hatten, so wie sie!
Im Vergleich dazu zeigte sie Magdalena jene Lebensumstände auf, damit diese ihr eigenes gutes Leben erkennen und dankbar sein möge.
„Schau, wie war es denn früher; wie erging es den Frauen? Und was erleben sie auch heute noch mancherorts in der Welt, wenn sie arm und hoffnungslos den Zwängen unterliegen! Auch wir fügten uns damals“, sagte Mariann und dachte zurück. „Sogar in den heiligen Stand der Ehe wurde auch ich noch als halbes Kind einem Mann mit der Aufforderung befohlen, ihm „untertan“ zu sein, und mit dem kirchlichen Gebot, sich zu achten und zu lieben, verheiratet: „Bis das der Tod euch scheidet!“ Verständnislos schüttelte sie den Kopf. „Wie kann ein Kind das versprechen?“ fragte sie.
„Ja, ich war fügsam und untertan, wie es von mir verlangt wurde; wir Kinder waren zum Gehorsam erzogen worden. Aber ich war es nur solange, bis sich mit den Jahren eine Auflehnung gegen die fehlende Achtung in mir aufbaute. Außer dem Bauern diente ich auch noch seiner herrischen Mutter,
die kein Herz für mich hatte. Beide sahen in mir die kleine Magd, über die sie ganz nach Belieben bestimmten. Er glaubte, sein Weib gehöre ihm, bis ich irgendwann nicht mehr willig und großmütig genug war, ihn bedingungslos zu lieben. Um bestehen zu können, wurde ich raffiniert und berechnend. Aufgemuckt habe ich, und den Streit nicht gescheut – im Gegensatz zu dir, Magdalena! Die kleinen Erfolge, die ich daraus erzielte, reichten nicht weit. Aber sie beruhigten zumindest meinen verletzten Stolz ein wenig, so dass es sich vorübergehend wieder etwas leichter leben ließ.
Na ja“, meinte sie: „Es wurde mir wohl verziehen, weil mein Leben hart und schwer war, und mehr als bescheiden.“
Sechs Buben habe sie schon gehabt, als sie erst Anfang zwanzig gewesen sei. „Und im Ganzen zwölf Kinder!“,erzählte Mariann.
„Ach du Arme!“ bemitleidete sie Magdalena, die gedacht hatte, mit der Versorgung von Mann und vier Kindern schon eine große Leistung erbracht zu haben. „Dann hast du dir schon den Himmel auf Erden verdient!“ sagte sie.
„Ja“, nickte Mariann; „es war schon schwer. Alle hatten es schwer! Wir wurden unserer Kindheit beraubt, mußten stattdessen gleich erwachsen sein, Kinder gebären, Verantwortung tragen und die Not des Lebens erleiden. Viel zu jung waren wir für diese großen Belastungen!“
Und sie erinnerte sich daran, dass sie einmal sogar habe weglaufen wollen. „Vorher sagte ich es meiner Großmutter, die ein Herz für mich hatte. Sie aber erzählte mir, dass auch sie einmal gehen wollte. An einem späten Abend, als alle schon schliefen, sei sie aus ihrem Dorf hinausgegangen. Auf einem Hügel habe sie sich noch einmal umgesehen. Überall auf den
Häusern hätten leuchtende Kreuze gestanden, große und kleine. Das auf ihrem Haus sei das kleinste gewesen. Da habe sie begriffen, dass die Menschen überall ein Kreuz zu tragen hatten, und sie selbst gar kein so großes. Beschämend sei sie zurückgegangen.“
Sie schwiegen eine Weile. Was gäbe es auch dazu zu sagen? Denn es war so auf der Welt, dass man seine eigene Bürde schwerer sah, als die der anderen. Mariann’s Erdenlast hatte sicher zu den großen gehört, und es gebührte ihr weiß Gott ein Platz im Paradies, fand Magdalena.
„Der Bauer war natürlich viel älter als ich“, erzählte Mariann weiter. „Er starb nachdem er zwölf Kinder in die Welt gesetzt hatte, von denen ihm schon zwei Kleine vorausgegangen waren. Da stand ich nun mit dem Rest der Familie, und es kamen andere, noch größere Sorgen. Der Krieg in der ganzen Welt brachte zu unserer Armut auch Krankheit und Leid. Zwei meiner erwachsenen Söhne starben“, sagte sie traurig.
„Ach, das ganze Leben war von Anfang an ein Sorgenbündel! Sobald die ältesten der Kinder erwachsen waren, liefen auch schon die ersten kleinen Enkel zwischen meinen Jüngsten umher. Die Arbeit hörte nicht auf!“ Doch lächelnd meinte sie: „Auch wenn es oft schwer war: für die Kinder tat ich es gern. Über die kleinen Freuden mit ihnen war doch alles erträglich. Sie entschädigten für Vieles. Man muss dankbar sein für Kinder!“ sagte Mariann. Dafür sei heute alles gut, fand sie. Dann lachte sie laut und war der Meinung, Gott habe ihr die unbekümmerte Leichtigkeit ihrer verloren gegangenen Jugend im Paradiesleben zurückgeschenkt. Damit ließ sie ihr Schicksal ruhen, mit dem sie abschließend zufrieden war.
Als sie noch weiter über die Belastungen im menschlichen Leben sprachen, gab Mariann zu bedenken, dass nach ihrer Meinung der gutmütige Mensch zu spät begreife, dass er selbst in seiner Bereitwilligkeit, anderen immer alles recht zu machen – womöglich sogar noch um der eigenen Zufriedenheit willen? – vielleicht dazu herausgefordert habe, dies auszunützen.
„Die Hand, die gibt, wird gern genommen!“ sagte sie.
Damit wäre es kein Vergehen der anderen, das beklagt werden müsse, meinte sie. „Menschen nehmen immer alles, was du ihnen anbietest, und wieviel du bereit bist, zu geben. Das ist nicht verwerflich! Schließlich ist es dein Angebot! Du selbst muss Grenzen setzen!“
Damit rückte sie die Dinge der eigenen Selbsttäuschung ins rechte Licht. Die Sache von Geben und Nehmen konnte man von zwei Seiten betrachten.
Magdalena dachte an Leonard. Auch sie hatte seine Bereitwilligkeit für sie dazusein, gerne genutzt. Hatte er auch mit Umarmungen und Zärtlichkeiten oft gespart, weil die Nüchternheit und Härte des Lebens unsentimental machten; doch wie geborgen hatte sie sich gefühlt, wenn sie sich wenigstens an sein Rückgrat hatte anlehnen können, wenn ihr danach zumute gewesen war! Und wieviel Hartes war an seiner Stärke abgeprallt, wovon sie verschont geblieben war! Er hatte es geschultert, um es der Familie zu ersparen.
Auch die Kinder hatten seine Stärke und Unterstützung gerne genützt. Sie profitierten davon, solange sie am elterlichen gemeinsamen Tisch saßen, und noch darüber hinaus. Damit hatte auch Leonhard seinen Teil an Hingabe geschenkt; und über den Tod hinaus war sie ihm dankbar dafür.
Sie fand jedoch, dass sie selbst noch einiges mehr für die großen Kinder hätte tun müssen. Manches, das ihnen geschadet hatte, hatte sie ja schützend von ihnen fernhalten wollen. Aber es war ihr nicht gelungen! Unüberlegt und leichtfertig hatten sie ihre Fehler gemacht und dafür büßen müssen. Und ihre Eltern hatten mit ihnen gelitten.
Mariann ließ ihre Selbstvorwürfe nicht gelten. In diesem Punkt war sie anderer Meinung: „Eltern und Kinder machen Fehler! Du hättest nicht das Recht gehabt, sie vor allem zu beschützen!“ sagte sie ernst. „Kinder, die alt genug sind, haben das Recht, ihre eigenen Fehler machen zu dürfen, um für ihr Leben daraus zu lernen!“, belehrte sie Magdalena. „Schließlich ist es ihr Leben, über das sie zu gegebener Zeit sogar bestimmen müssen – und es zu verantworten haben!“
Ein kalter Wind zog über das Ödland und wehte Sand und Staub umher. Die Aussicht auf etwas Schönes lag so fern.
Sehnsucht kam auf in Magdalena.
„Ach, wäre ich doch in meinem kleinen Erdenparadies geblieben!“ klagte sie leise. „Wie soll man nur an diesem Ort mit dem Inhalt eines langen Lebens fertigwerden? Wo sind meine Lieben und meine Freunde? Wo ist die erhoffte Seligkeit?“
Mariann ließ sie gewähren. „Ein neugeborenes Kind braucht seine Zeit, atmen zu lernen!“ sagte sie nur.
Erst als Magdalena unruhig und dem Weinen nahe, zwischen den Steinen hin- und herging, kam sie an ihre Seite. Beruhigend legte sie ihren Arm um ihre Schultern und meinte lächelnd: „Aber du hast es schon geschafft!“
So sieh doch:
Du hast die wesentlichen Dinge erfüllt, gearbeitet, gesorgt und rechtschaffen gelebt! Du hast die kleinen Geschenke der Liebe verteilt. Sie waren alle von Wert, auch wenn sie oft unscheinbar waren. Nicht nur die großen zählen!
Du hast geliebt und gedient all denen, die dich brauchten, auch wenn dir oft nicht zum Lieben war! Du hast erduldet, was dich kränkte, deinen gedemütigten Stolz gezügelt und mit Liebe überboten. Damit hast du zusammengehalten, was sonst zerbrochen wäre, Magdalena! Bedenke, dass du das mannigfaltige Los vieler Frauen der Erde geteilt hast, im Erdulden und im Lieben, wie auch in der Sehnsucht nach mehr Verständnis und zärtlicher Liebe. Wie oft ist sie aber doch trügerisch, wenn sie nur zur Begierde gehört. Du hast sie auf andere, ehrlichere Weise erlebt!
Aber glaube mir: Beide Geschlechter aller Völker brauchen die Herzenswärme zum Leben. Und die harten Männer umso mehr. Die Sorgen, die Verantwortung und die Arbeit für die Familie haben sie zu allen Zeiten nüchtern gemacht. Und doch sorgt ein normaler Mann aus Liebe.
Nun wieder zu dir:
Du, Magdalena, hast geholfen, wenn es notwendig war. Manchmal gingst du dabei über die Grenze deiner Belastbarkeit hinaus. Nun fragst du dich immer noch, was du mehr hättest tun können? Natürlich konntest du damit nicht die Not des Elends auf der Erde verbessern. Aber in deiner kleinen Welt hast du deinen bescheidenen Beitrag dazu geleistet. Selbst mit einem guten, mitfühlenden Wort und einem Lächeln, das Einsamkeit linderte, hast du Hilfestellung und Mut gegeben.
Du hast deine Klugheit auch dazu benutzt, einfühlsam in andere, und einsichtig und bescheiden dir selbst gegenüber zu sein. Weil du wußtest, dass in jedem Menschen etwas Gutes und auch irgendein besonderes Können steckt, sahst du in dir immer die Mittelmäßigkeit.
Du hast die Schönheit aller Dinge mit offenen Augen gesehen, und sie geliebt, hast manches Schöne auch in deinem Leben geschaffen und zur Freude der anderen hinterlassen. Dazu hast du deine Ideen und Geschicklichkeit eingesetzt, anstatt diese sinnlos und ungut zu verschwenden. Du sollst wissen, dass auch unser Herrgott Gefallen an den schönen und kunstvollen Dingen hat, die die Menschen schaffen. Schließlich vergibt er ihnen die Talente dazu! So erkennt er in allen großen und kleinen Leistungen, zu denen sie in ihren Berufen oder in ihrem Hobby fähig waren, das Gute und Schöne.
Du hast auch die Besonderheiten der Natur gesehen, große und kleine, und alles bewundert. Du sahst die Schönheit und Vergänglichkeit einer Blume und wußtest, dass auch du nur ein Gast auf der Erde warst, der zu wachsen, zu blühen und zu vergehen hatte.
Du nahmst ebenso die vielen kleinen Wunder wahr, die unbeachtet im Alltag des Lebens geschahen. Für dich waren sie nichts Selbstverständliches, nicht nur allein von Menschen vollbracht! Waren sie doch oft zu ungewöhnlich! Du fühltest den stillen Beistand Gottes darin, und warst ihm dankbar, wenn er auch dir geschenkt wurde.
Das alles war genug! Der Mensch braucht keine Wunder zu vollbringen, um dem Herrgott zu gefallen. Er darf Mensch sein, aber mit einem sinnvollen und moralischen Leben, in dem er sein Bestes gibt in Eigenverantwortung und für andere.“
Mariann beendete ihr Urteil über Magdalenas Leben, als sei sie dazu befugt von der höchsten Instanz:
„Du hast etwas geleistet, mit deinem Kopf, deinem Herzen und deinen Händen, was schön, gut und friedfertig war, und damit deine Pflichten erfüllt, so wie Gott es von dir erwartete.
Er ist damit zufrieden; denn er verlangt nichts Übermenschliches!
Du hast mit Vertrauen an deinen Gott gelebt; er war die Basis für deinen Glauben. Mit dem gleichen Vertrauen bist du auch hier angekommen. Und glaube mir: Er weiß es!
Nun, wo du alles Wesentliche bedacht hast, bist du hier und grübelst noch über die vielen kleinen Fehler nach, die zum Menschsein gehörten. Sei unbesorgt; sie schadeten niemand!
Darum lass gut sein, Magdalena!
Es gibt nur noch eines zu tun:
Löse die guten, schönen Fäden aus deinem Erdenkleid und webe sie in dieses Gewand ein, das ich dir mitgebracht habe. Es wird dich kennzeichnen. Damit wirst du Einlass finden in das Paradies, von dem du geträumt hast!“
Noch bevor Mond und Sterne zu leuchten begannen, war sie soweit. Mühsam war der Wirrwarr von Erdenfäden entknotet, und die guten und schönen Fäden im neuen Gewand zu einem Ornament verarbeitet, ganz nach dem Geschmack ihrer Seele. „So bist du schön!“ sagte Mariann.
In Freundschaft gingen sie beide von dannen, die einstigen Kinder der Berge, leicht und schwerelos. Den Ballast des Lebens ließen sie zurück. Er würde im Winde verwehen.
Niemand nahm ihn mit! Es gab keine zwei Leben miteinander! Man starb das eine und wurde hineingeboren in ein neues.
Dämmerung lag auf ihrem Weg, und Zufriedenheit in der Stille. Magdalena schien es so, als ob sie nach getaner Arbeit von den heimatlichen Almen nach Hause ginge.





























