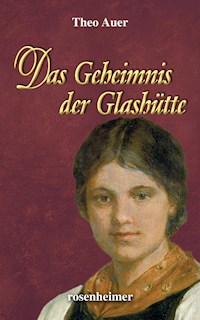
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch die Intrigen eines Grafen verloren die Brüder Johann und Heinrich die väterliche Glashütte. Seitdem schmuggeln sie Pottasche über die bayerisch-böhmische Grenze. Eines Tages begegnet ihnen das Waisenmädchen Bärbel. Sie verliebt sich sofort in Johann, ohne dass es dieser bemerkt. Um den Grafen doch noch zur Rechenschaft zu ziehen, begibt sich Johann auf eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland und Frankreich. Wird Bärbel auf ihn warten? Theo Auer entführt in diesem mitreißenden und spannenden Roman den Leser in die Zeit der Koalitionskriege. Er beschreibt das Alltagsleben im 18. Jahrhundert und gewährt sogar Einblicke in die Machenschaften am französischen Hof.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2017
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Franz von Defregger
Worum geht es im Buch?
Theo Auer
Das Geheimnis der Glashütte
Durch die Intrigen eines Grafen verloren die Brüder Johann und Heinrich die väterliche Glashütte. Seitdem schmuggeln sie Pottasche über die bayerisch-böhmische Grenze. Eines Tages begegnet ihnen das Waisenmädchen Bärbel. Sie verliebt sich sofort in Johann, ohne dass es dieser bemerkt. Um den Grafen doch noch zur Rechenschaft zu ziehen, begibt sich Johann auf eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland und Frankreich. Wird Bärbel auf ihn warten?
Theo Auer entführt in diesem mitreißenden und spannenden Roman den Leser in die Zeit der Koalitionskriege. Er beschreibt das Alltagsleben im 18. Jahrhundert und gewährt sogar Einblicke in die Machenschaften am französischen Hof.
Inhalt
I
Vom »Schwirzen«
Ein wertvoller Fund
Das Mädchen im Wald
Die Brennmeister
Auf nach Kötzting
Zähe Verhandlungen
Freifrau von Schmauß
II
Waldwinter
Eine überraschende Entdeckung
III
Eine abenteuerliche Reise
Eine außergewöhnliche Frau
Im Krieg
Vom Marketenderleben
Würzburg – und ein erneuter Aufbruch
Bei den französischen Truppen
Aufbruch ins Unbekannte
IV
Neue Horizonte
V
Ein Herbst in Saint-Tropez
Abenteuer auf dem Wasser
Ein Winter in Paris
Neue Erkenntnisse
Baron de Montgelas
Zwei Hochzeiten und eine Glashütte
Glossar
I
Vom »Schwirzen«
Schimpfend und fluchend rutschte mein Bruder Heinrich auf dem Moos hangabwärts. Mit knapper Not konnte er sich an einer Wurzel festklammern und wieder hocharbeiten. Ich wartete auf ihn und schnappte nach Luft wie ein Fisch auf trockenem Land.
»’s geht schon noch, Heinrich«, feuerte ich ihn an. Er war ein Bär von einem Mannsbild und hatte Kraft wie ein Ochse. Aber Laufen, gar Bergauflaufen, nein, das war nicht seine Stärke. Es war nicht mehr weit ins Bayerische, aber mit einem halben Zentner Pottasche auf dem Rücken und auf der Flucht vor den böhmischen Zöllnern, da hatte der Spaß ein Loch. Ums Haar hätten sie uns eingefangen dort unten am Teufelssee. Wir hatten uns bereits in Sicherheit gewähnt. Denn unser Kauderer, der Eibl-Hias, hatte uns erklärt, dass die Zöllner heute auf der Arberseite, dem Stangenruck zu, patrouillieren würden. Prustend und hechelnd ging es weiter bergauf.
Dann sahen wir sie endlich, die weiß-blauen Stangen: die Grenze! Noch ein Stück hinüber in ein wildes Staudengebüsch, da sahen wir die Zöllner heranstapfen. In ihren schweren, grün-braunen Uniformen spähten sie herüber, machten aber keine Anstalten, weiterlaufen zu wollen.
Wenn sie uns weiter verfolgt und uns womöglich auf der bayerischen Seite geschnappt hätten, so hätte uns das auch nichts genützt. Kein Hahn hätte danach gekräht, hätten sie uns ins Böhmische verschleppt und eingesperrt. Aber sie nahmen Zunder und Pulver von den Pfannen ihrer Donnerbüchsen und verschnauften, bevor sie zurück ins Böhmische marschierten.
Mein Bruder und ich waren »Schwirzer«. So nannte man hierzulande die Schmuggler, weil man sich, um unerkannt zu bleiben, auf der Tour das Gesicht mit Ruß schwärzte. Zwei Dinge waren es im Wesentlichen, die über die Grenze nach Böhmen geschmuggelt wurden. Das war zum einen Salz. Böhmen war ein salzloses Land. Und zum anderen war es Pottasche. Die Pottasche brauchten die Glasmacher zur Glasproduktion. Und davon konnten sie nie genug haben. Der Salzschmuggel war zwar das bessere Geschäft, aber da kamen kleine Leute wie wir nicht dran.
Der Salzschmuggel war längst in festen Händen. Mit einem halben Zentner – und mehr konnte man zu Fuß nicht so weit tragen – war da nichts anzufangen. Dieses Geschäft hatten die hohen Herren fest im Griff. Sie betrogen da zwar ihren eigenen Kurfürsten, aber das war ihnen ziemlich egal. Umso mehr freuten sie sich, wenn sie einen kleinen Schwirzer in Eisen legen lassen konnten. Der Salzschmuggel war eine Domäne der Herren von Nothafft in Runding oder der Rabensteiner im Zwieseler Winkel.
Dass ich ein Schmuggler wurde, hatte seinen Grund darin, dass man anders in diesen Zeiten kaum Geld verdienen konnte. Das Geld im bayerischen Land war wie ausgekämmt. Selbst der Kurfürst hatte, wie man hörte, einen Haufen Schulden. Aber dem war das wohl egal. Er brauchte ja nur die Steuern und Abgaben erhöhen. Und das tat er auch, in diesem Jahr des Herrn 1795.
Ich war gelernter Glasmacher. Das hatte ich vom Vater, der unter dem Arbersrigl, im Stangenruck-Gebiet, eine große Glashütte betrieben hatte.
In einer Glashütte wurde damals aber keineswegs nur Glas erzeugt. Eine Glashütte versorgte ihre Mitarbeiter und deren Familien mit allem, was man zum Leben brauchte. Sie war also gleichzeitig Landwirtschaft, Getreidemühle, Bäckerei, Schmiede, Metzgerei, Fischerei, Schneiderei, Schusterei, ja selbst eine arzneikundige Person durfte nicht fehlen. Nicht zu vergessen das Recht zum Bierbrauen. Ohne einen ordentlichen Rausch zur rechten Zeit waren viele der Arbeiter auf die Dauer in der Abgeschiedenheit einer Glashütte nicht zu halten. So ein Hüttenherr war damals schon jemand!
Später waren wir in Bodenmais, wo uns der Bergamtsverwalter Schmid mit Heimtücke und böser List schließlich von Haus und Hof vertrieb. Mein Vater starb darüber. Meine Mutter hatte als Inhäuslerin, als Dienstmagd, beim Böhm, einem Oberrieder Bauern, nur ein mühsames Fortkommen.
So haben wir neun Kinder geschaut, dass wir der Mutter bald nicht mehr auf der Tasche gelegen haben. Zu Anfang habe ich als »Eintragbub«, wie man das nannte, verschiedene Hilfsdienste in der Bodenmaiser Glashütte verrichtet. Später habe ich dort als Glasbläser gearbeitet. Aber Geld hab ich da so gut wie nie gesehen. Ein Ganserl oder einen Scheffel Korn hab ich gekriegt. Und wie oft ich nachfragen musste, bis ich es gekriegt hab! Dabei bin ich noch nie ein Faulenzer gewesen. Das Arbeiten haben wir Kinder alle gelernt. Aber der Bergamtsverwalter hat mich immer öfter spüren lassen, dass ich »dem Hainz seiner« bin. Der Sohn des Mannes, den er vertrieben hatte.
Mit siebzehn hab ich ihm die Arbeit vor die Füße geworfen und mein Bündel gepackt. Dann war ich als Aschenbrenner beim Balthasar Frisch von der Lohberger Glashütte. Dort erhielt ich doch im Monat, neben Kost und Naturalien, einen Gulden und 48 Kreuzer Lohn. Das war damals schon viel, denn Bargeld war eine rare Sache. Im ganzen Bayernland.
Beim Aschenbrennen hat man die umgestürzten Bäume zu Asche verbrannt, aus der dann die Pottasche gewonnen wurde. Ich kam bald auf die Idee, das Geschäft selbst zu machen. Die Glashütten auf der böhmischen und der bayerischen Seite wurden immer mehr und konnten gar nicht genug Pottasche bekommen. Der Zentner kostete hier im Bayerischen fünf Gulden, im Böhmischen aber bereits neun Gulden und achtzig Kreuzer. So kann man sich leicht ausrechnen, wie lange ich auf der Glashütte hätte schaffen müssen, um den Verdienst zu erreichen, den mir eine Tour ins Böhmische einbrachte.
Für dieses Mal waren wir den Zöllnern entwischt. Richtig gesehen hatten sie uns überhaupt nicht. Die Hänge zum Teufelssee hinunter waren eine echte Wildnis, wo man schon auf zwei, drei Schritte an jemanden herankommen musste, um ihn richtig zu erkennen.
Dies war, neben dem Eisenbach, dem Weißriegel und dem Osser, die beste Schwirzertour. Aber warum waren heute die Zöllner da? Die Tipps des Eibl aus der Lam, von dem wir unsere Pottasche hatten, waren bisher immer gut gewesen. Er hatte Beziehungen ins Böhmische. Seine Base hatte einen Böhmischen geheiratet. Und diese Kontakte wusste er zu nutzen. Am Ende auch gegen uns? Das musste ich noch herausfinden. Aber vorher wollte, nein musste ich ein weiteres Mal ins Böhmerland. Wir wollten ja unsere Pottasche, die wir jetzt notgedrungen wieder auf die bayerische Seite der Grenze herübergeschleppt hatten, drüben an den Mann bringen. Eine halbe Stunde blieben wir noch im Unterholz, nachdem die Schritte der abziehenden Zöllner verklungen waren. Vorsichtig nach allen Seiten schauend krochen wir schließlich heraus.
»Was jetzt?«, fragte der Heinrich.
»Wir gehen durch die Seewand hindurch und hinüber zur Eisendorfer Hütte.« Das war zwar viel mühsamer, aber in jedem Fall sicherer. Selbst wenn die Zöllner damit rechneten, dass wir noch einmal hineingingen ins Böhmische, dann würden sie keinesfalls in die Seewand einsteigen. Die Seewand über dem Teufelssee ist zwar keineswegs eine blanke Felswand, sondern ein steiler Abhang, der mit Felsbrocken und umgestürzten Bäumen übersät ist. Aber es war dort mühsam und gefährlich genug. Zumal mit dem schweren Sack kamen wir immer wieder aus dem Gleichgewicht und ins Straucheln.
Es war schon heller Mittag, als wir Eisenstraß erreichten, die erste Ortschaft im Böhmischen. Beim Prunner kehrten wir ein. Zu einem Krug Scheps, dem landläufigen Dünnbier, kauten wir unsere Brotkrusteln und hörten, dass die Zöllner schon seit einer Woche am Teufelssee patrouillierten. Und das sollte dem Eibl entgangen sein?
»Heinrich«, sagte ich, »ich möchte fast glauben, dass uns der Eibl absichtlich zum See geschickt hat.«
Der Heinrich machte ein ungläubiges Gesicht. »Warum sollte er denn das tun?«
Viel konnte ich dazu nicht sagen. Ich hatte halt so meine Vermutungen. Am Ende wollte er das Schwirzen selber in die Hand nehmen? Möglicherweise war ihm der Verdienst als »Kauderer«, das war ein Aufkäufer, ein Zwischenhändler für die Pottasche, nicht mehr genug?
»Weißt, Heinrich«, erklärte ich meinem jüngeren Bruder, »wir werden ihn einfach zur Rede stellen. Dann sehen wir schon, was passiert.«
»Wie du meinst«, gab er zurück. Heinrich war ein starker und seelenguter Kerl. Aber den Finessen und Hinterhältigkeiten böswilliger, habgieriger Leute war er nicht gewachsen. Vielleicht deshalb, weil er sich selber keinerlei Gemeinheiten ausdenken konnte. Er meinte, dass alle Leute so gutwillig wären wie er selber.
»Es ist Zeit«, sagte ich, »wenn wir abends wieder zurück sein wollen, dann müssen wir weiter!« Wir bezahlten die zwei Kreuzer für das Dünnbier und marschierten weiter zur Eisendorfer Glashütte, wo wir vor dem Haus des Hüttenherrn unsere Säcke abstellten. Vier Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren rannten heraus und sprangen um uns herum.
»Die Schwirza, die Schwirza, die Schwirza, die san da!« So riefen und sangen sie. Für die Kinder waren wir Abenteurer und geheimnisvolle Leute. Was ja auch nicht ganz unrichtig war. Obwohl ich es nie so angeschaut habe. Für mich war es eine, ja die einzige Möglichkeit, relativ schnell zu Geld zu kommen.
Ziegler, der Hüttenmeister, kam von der Glashütte herüber. »Setzts euch, Boum«, rief er, und wir ließen uns auf der Bank vor dem Haus nieder.
»War recht schwer heut, Hüttenmeister!« Der Heinrich schnaufte tief durch. »Hätten uns fast erwischt!«
Der Ziegler rang die Hände. »Es ist ein Kreuz. Seit drei Tagen ist der Glasofen schon kalt, weil ich keinen Fluss mehr hab.«
Fluss, das ist ein anderes Wort für die Pottasche. Die Glasmacher nennen es so, weil die Pottasche der Zusatz bei der Glasproduktion ist, der das Gemenge schmelzen lässt, »in Fluss« bringt.
»Viermal in der letzten Woche haben die Zöllner Fluss-Schwirzer abgefangen. Aber ich hab mir gesagt, der Johann und der Heinrich, die Hainz-Buben, die lassen sich nicht fangen.«
Ich nickte. »Beinah hätten sie sich doch fangen lassen. Aber daran sind nicht wir schuld, und auch die anderen nicht, die erwischt worden sind. Weißt, wer das war, die da aufgegriffen worden sind?«
Der Hüttenmeister brummte: »Freilich weiß ich’s. Der Groner mit seinem Buben, der Grassl-Johann vom Hoisl-Hans und der Fechter mit seine Inhäusler. Zusammen fünfeinhalb Zentner Fluss.«
Ich schaute zum Ziegler hoch, der vor mir stand. »Den Kauderer kenn ich, für den die alle geschwirzt haben. Und wo hat man sie erwischt?«
»Alle am Teufelssee. Wieso die alle grad da hinunter gegangen sind, wo justament die Zöllner gewartet haben?«
»Ich glaub, dass ich schon eine Ahnung hab. Was zahlst denn?«
»Ich hab schon einen Buben nach Eisenstein hinübergeschickt. Aber die wollen fünfzehn Gulden für den Zentner. Da kann ich gleich zumachen.«
Jetzt ging mir ein Licht auf! »Weißt, Ziegler, so unverschämt will ich nicht sein. Aber zwölf Gulden musst schon zahlen.«
Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Ein Sündengeld, aber was soll ich machen? Ich bring’s euch raus.«
Zwölf Gulden zahlte er uns getreulich auf die Hand. Der Heinrich hat seinen Mund gar nicht mehr zugebracht. Das war für einen Inhäusler der Lohn für ein ganzes Jahr harte Arbeit.
»Wollts über d’ Nacht bleiben, oder müsst ihr gleich zurück?«
Es war der Brauch, dass die Schwirzer, wenn nötig, umsonst ein Nachtquartier und ein Abendessen bekamen.
»Wir wollen mit einer Brotzeit zufrieden sein, Ziegler, wollen heut noch zurück.«
»Auch recht«, meinte er, rief seine Frau und hieß sie uns eine Mahlzeit vorbereiten. Nachdem wir geschmaust und des Hüttenmeisters gutes Bier getrunken hatten, machten wir uns wieder auf den Weg.
»Heinrich«, sagte ich nach einer Weile, »merkst was?«
»Jaja«, gab er zurück, »du hast den Ziegler ganz schön übers Ohr gehauen.«
»Ach Unsinn, der war im Grunde froh, dass er nur zwölf Gulden hat zahlen müssen. Die anderen hätten ihm fünfzehn abgenommen. Hast es doch selber gehört. Nein, ich mein’ was anderes!«
Heinrich marschierte neben mir her, ohne den Kopf zu heben. Er war mir ernsthaft böse. Seiner Meinung nach hatte ich dem Ziegler zu viel Geld abgenommen. »Was hätte ich denn sonst merken sollen?«
Ich stieß ihn in die Seite. »Mensch, Heinrich! Hintereinander vier Schwirzer abgefangen! Überleg doch! Und alle am Teufelssee! Und alles Schwirzer vom Eibl! Merkst immer noch nix?«
Es riss ihn herum. »Holla, du meinst doch nicht, dass uns der Eibl wirklich absichtlich dorthin geschickt hat? Warum denn?« Der Heinrich war in seiner Gutmütigkeit wirklich zu begriffsstutzig.
»Weil dann die Preise steigen. Darum! Ich wette mit dir, dass er ganz dumm schaut, wenn wir daherkommen, und ich wette nochmals, dass er dann keine Pottasche für uns zum Schwirzen hat!«
Es war schon ein besonderer Anblick, wie dem Heinrich nun der Kamm schwoll. »Du meinst also, er will die Preise hochtreiben und dann das Schwirzen selber übernehmen?«
»Dass er das selber übernimmt, glaube ich eher nicht. Aber die Kauderer werden halt keine freien Schwirzer mehr zulassen wollen. Die werden ihre eigenen Schwirzer losschicken, damit sie diesen Verdienst auch noch in die eigene Tasche schieben können.«
Heinrich schnaubte. »Das werden wir ihm abgewöhnen. Uns an die Böhmen zu verraten! Den kauf ich mir!«
Jetzt musste ich ihn wieder bremsen. Wenn sich der Heinrich jemanden »kaufte«, dann war das für den Betroffenen gewöhnlich recht schmerzhaft. Ein blutig geschlagener Schädel war da das Mindeste. Aber so etwas konnten wir momentan überhaupt nicht gebrauchen. Außerdem war der Eibl-Wirt in der Lam ein angesehener Bürger und wir beide nur zwei dahergelaufene Schwirzer. Wie schnell konnte man da mit dem Landrichter in Kötzting Bekanntschaft machen. Darauf hatte ich gar keine Lust.
»Weißt, Heinrich, es nützt uns gar nichts, wenn wir den Eibl grün und blau schlagen, wir müssen das anders anfangen. Im Grunde tut er uns ja einen Gefallen!«
Der Heinrich schaute mich verblüfft an. »Einen Gefallen? Ja wie denn das?«
»Wir haben jetzt an die fünfundzwanzig Grenzgänge hinter uns. Was glaubst du, wie viel Geld wir in der Zwischenzeit verdient haben?«
Mein Bruder musterte mich neugierig. »Weiß nicht, das Geld hast ja du in Verwahrung.«
»Es sind jetzt 123 Gulden. Zwanzig haben wir der Mutter hinübergebracht.«
»Öha, das ist aber ein Haufen Geld!«
Ich dämpfte seine Begeisterung. »So viel Geld ist das noch gar nicht. Aber für das, was ich vorhabe, könnte es reichen.«
Der Heinrich war ein einziges Fragezeichen. »Und was tun wir dann?«
»Weißt Heinrich, die Mutter hat uns Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Das können wir jetzt bald brauchen.«
Heinrich verstand immer noch nicht. »Pass auf, wir fangen jetzt ein eigenes Geschäft an. Das Geld langt für einen großen Eisentiegel, in dem wir unsere Pottasche sieden können, und einen Kalzinierofen bauen wir uns selber. Wir werden jetzt selbstständige Aschenbrenner. Selber brennen und sieden – und schwirzen tun wir unsere War’ auch noch. Dann können wir richtig Geld verdienen. Und dann reicht es auch einmal für eine große Anklag gegen den Bergamtsverwalter, der unserm Vater und uns so bös mitgespielt hat!«
Das war eine lange Rede für mich. Ich bin sonst kein Mann vieler Worte. Aber den Bergamtsverwalter von seinem hohen Ross herunterstoßen, das war eine Sache, für die ich mich begeistern konnte. Wir hatten den Betrug schon ein paar Mal vor das Pfleggericht in Viechtach gebracht. Aber unsere Klage wurde überhaupt nicht zugelassen, geschweige denn verhandelt. Der Bergamtsverwalter Schmid, der doch als Repräsentant des kurfürstlichen Bergamtes auftrat, hatte genug Einfluss, um die Klagen immer wieder abweisen zu lassen. Arme Leute wie wir hatten die Prozesskosten im Voraus zu erlegen. Eine Untersuchung durch das Bezirksgericht in Straubing, wohin die Macht des Bergamtsverwalters nicht reichte, würde uns etliche Hundert Gulden im Voraus kosten.
»Wenn uns die Arbeit gar zu viel wird, dann holen wir uns noch den Sebastian und den Sepperl. Das schaffen wir schon!«
»Aber wir haben doch keinen Wald und nicht einmal das Recht zum Aschenbrennen«, gab der Heinrich zu bedenken.
Ich wies mit der Hand um mich herum. »Ist das nicht Wald genug? Genug für uns alle? Und überhaupt, ich will ja keinen Waldfrevel begehen. Nein, da wo sonst keiner hinkommt, weil es zu mühsam oder zu gefährlich ausschaut, da brennen wir die abgebrochenen und faulen Bäum’ ab.«
Der Heinrich schaute mich zweifelnd an. »Und wenn uns die Aschenbrenner von den Glashüttn erwischen?«
»Da, wo wir brennen, da sind keine anderen! Wir gehen in die Wildnis, hinter den Osser, auf Hammern zu.«
Mein Bruder war noch nicht überzeugt. Aber ich fand, dass wir die Bosheit und Habgier der Kauderer für unsere eigenen Zwecke nutzen sollten. Wenn diese die Preise hochtreiben wollten, dann sollte uns das nur recht sein. Wir produzierten unsere Pottasche dann selbst und konnten die Kauderer immer unterbieten. Dabei würden wir trotzdem noch gut verdienen. Es war mir klar, dass sie versuchen würden, uns zu bekämpfen. Aber wir würden uns unserer Haut schon wehren.
Inzwischen waren wir längst wieder im Bayerischen. Beim Hoisl-Hans in der Sommerau bewohnten wir ein aufgelassenes Inhäusl. Die Bauern im Lamer Winkel hatten harte Zeiten durchzumachen. Manches Inhäusl stand leer, weil die Bauern so viele Ehhalten gar nicht mehr versorgen konnten. Für einige Kreuzer im Jahr durfte man ein solches Häusl bewohnen. Die Einrichtung war natürlich recht primitiv. Für die Erhaltung musste man auch selbst sorgen.
Über die Einöde Oberhaiderberg stiegen wir hinab zur Sommerau. Es war ein mühsames Gehen. Über Wurzelstöcke und wüstes Dickicht kamen wir immer weiter bergab. Es dunkelte schon, als wir schließlich unsere kleine Hütte erreichten. In der Herdstatt war noch etwas Glut vom Morgen, und bald flackerte ein gemütliches Feuer, das uns wärmte und unsere Nachtsuppe zum Sieden brachte. Steinmüde wie ich war, schlief ich auf meinem Strohlager mitten in meinen Überlegungen für die Zukunft ein.
Am Morgen war es unangenehm kühl. Ich schlüpfte unter meiner Decke hervor und fröstelte ordentlich, bis ich mit einigen Birkenspänen das Feuer von Neuem in Gang gebracht hatte. Allmählich wurde es wieder warm in unserer Behausung.
Sie bestand aus rohen Balken und Brettern, deren Ritzen mit Lehm und Moos abgedichtet waren, und hatte nur einen einzigen Raum. Darin standen zwei primitive Bettstellen, wo eine Schütt Stroh mit einem Rupfentuch überdeckt war. Die große Herdstelle war aus Feldsteinen errichtet und mit Lehm verfugt. Die Fenster wurden mit Tuch oder Ziegenleder verhängt. Im Winter wurden sie einfach zugenagelt. Der Schnee lag hier ohnehin oft bis über die Fenster hinauf. Dann war es drin mollig warm. Nur das Dach musste immer wieder abgeschaufelt werden, damit es nicht unter der Schneelast zusammenbrach.
Aber noch war es nicht so weit. Jetzt, Mitte September, waren nur die Nächte empfindlich kühl. Im Wald wurde es nun wieder angenehmer. Die lästigen Mücken- und Fliegenschwärme, die im Hochsommer den Aufenthalt dort zu einer echten Qual machen konnten, verschwanden allmählich. Heinrich, dieser Halunke, blinzelte unter seiner Felldecke hervor. Ich war sicher, er war längst wach und hatte nur gewartet, bis ich das Feuer wieder angemacht hatte.
Zum Frühstück gab es eine Brühe mit Graupen. Die kochte ich ordentlich dick ein, damit zwei junge Burschen wie wir auch richtig satt wurden.
Inzwischen wusch ich mich am Quellbachl, das hinter unserer Hütte ins Tal hinab zum Weißen Regen sprudelte.
»Heinrich, du Faulpelz«, rief ich nach vorne, »raus, und wasch dir den Schlaf aus den Augen.« Da kam er schließlich angetappt.
Nach dem Frühstück gürtete ich mein Wams und steckte mir das Terzerol in den Gurt. Ich hoffte ja, dass ich den Schießprügel nicht brauchen würde. Aber man konnte nie wissen. Ich zog die Jacke darüber. Wenn ich sie lose hängen ließ, konnte man die Waffe kaum sehen. Den Hirschfänger hatte ich ohnehin in meiner Hose.
Der Heinrich wurde blass um die Nase. »Willst den Eibl erschießen?«, fragte er erschrocken.
»Blödsinn«, gab ich zurück, »ich will mich nur meiner Haut wehren können, wenn es nötig sein sollte.«
Dann marschierten wir hinaus in die Lam. Eine gute Stunde Wegs war es dorthin. Beim Eibl war die Gaststube schon offen. Aber es war noch kein Mensch da. Nun, wer hätte sich um diese Jahreszeit auch schon am Vormittag ins Wirtshaus setzen können. In der Lam gab es keine Müßiggänger. Wenn auch einige Schlitzohren und Gauner darunter waren, arbeitsam waren die Leute hier alle. Das ging hier im Waldland gar nicht anders. Der Winter war lang und hart. Und alle hatten schwer zu tun, um genug Lebensmittel für die eigene Versorgung zu beschaffen. Da konnte man keine Faulenzer durchfüttern.
Wenn ab Dezember der Schnee oft bis zu vier oder fünf Fuß hoch lag, dann war selbst die Holzarbeit im Wald nicht mehr möglich. Die Stämme für die Holztrift mussten mit dem ersten und letzten Schnee herangeschafft werden.
»Holla, Wirtschaft«, rief ich. Nun hörte man den schweren Schritt des Eibl, der auf seinen Holzschuhen heranpolterte. Ich schaute zur Türe, weil ich sein Gesicht sehen wollte, wenn er uns erkannte. Es war wirklich ein bemerkenswerter Anblick. Er stand in der Türe, riss Augen und Mund auf und starrte uns sprachlos an. Dann wechselte sein Gesichtsausdruck. Das schlechte Gewissen ließ ihn geradezu schrumpfen, und die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er fing an zu stottern:
»Ja is’ des … dass ihr heut doch … Das gibt’s doch …!?«
»Was hast denn, Eibl? Was gibt’s denn net?«
Er wand sich. »Ich hab halt nicht ’glaubt, dass ihr heut …«
Ich fiel ihm ins Wort: »Wir kommen doch immer am Tag nach der Tour!«
»Ach so, ja, … da hab ich grad gar nicht drangedacht.«
Ich setzte gleich nach: »Weil’s so gut ’gangen ist, könntst uns gleich wieder einen Zentner geben. ’s Geld hab ich gleich mit’bracht.«
Er verdrehte scheinheilig die Augen: »Würd euch ja gern was mitgeben. Aber ich hab nix. Ist rar worden in der letzten Zeit!«
Ich ließ nicht locker: »Wann sollen wir denn dann wieder kommen?«
Er schaute drein wie ein getretener Hund. Ich hab noch niemals jemanden so schlecht lügen gesehen. »Ich kann’s nicht sagen«, jammerte er, »vielleicht nächste Woch, vielleicht auch erst in vierzehn Tagen.«
»Na gut«, gab ich ihm Bescheid, »wir schauen halt dann gelegentlich wieder vorbei.« Ich stand auf.
»Tut das«, sagte er, sichtlich erleichtert, weil wir uns zum Gehen wendeten. »Wenn ich wieder was hab, dann geb ich’s euch natürlich.«
Ich ließ den Heinrich vor mir hergehen und drehte mich in der Türe noch einmal um: »In der letzten Woch, Eibl, sind vier Schwirzer von den böhmischen Zöllnern gefangen worden, weil man sie verraten oder falsch geschickt hat. Diesen Denunzianten suchen wir jetzt. Ich bin sicher, wir werden ihn auch finden. Du kannst dir denken, was dem passiert!«
Der Eibl schrumpfte noch weiter in sich zusammen und stotterte etwas hinter uns her. Aber wir waren schon draußen.
Nachdem wir ein Stück vom Wirtshaus weg waren, hielt mich der Heinrich an: »Und was jetzt?«
»Komm nur«, sagte ich, »wir müssen hinaus zum Vogl nach Kummersdorf.«
Der Heinrich blieb stehen. »Was willst denn beim Vogl? Der is doch auf der Gant! Den hat doch der Landrichter von Kötzting!«
»Auf der Gant« sagte man, wenn einer seine Schulden nicht bezahlen konnte, also Konkurs machte. Da kam es schon vor, dass ihn der Landrichter festhalten ließ, um auch den letzten Kreuzer ausfindig zu machen.
»Der Vogl hat im letzten Jahr noch Aschen gesotten. Vielleicht hat sein Weib den Eisentiegel noch. Den könnten wir dann billig kriegen. Die ist sicher froh, wenn sie ein paar Gulden sieht!«
Der Eisentiegel zum Pottaschensieden war ein recht teures Gerät. Das war ein starker, gehämmerter Eisenkessel, der ein ordentliches Feuer aushalten musste. Weil man ihn befeuerte, bis auch der letzte Tropfen Wasser aus der Aschenlauge verdampft war.
So marschierten wir über Haybühel und Ottenzell hinaus nach Kummersdorf.
»Sag bloß nix von dem Eisentiegel«, wandte ich mich an den Heinrich, »die darf gar nicht merken, dass wir deswegen gekommen sind.«
Der Heinrich zuckte nur die Schultern. »Das Reden musst sowieso du übernehmen.«
Die wenigen Getreideflächen in den Riedhügeln waren längst abgeerntet. Die Bauern waren nun dabei, die Kartoffeln zu graben.
Das war ein mühsames Geschäft. Mit dem Erdäpfelpflug wurden die Bodenfrüchte an die Oberfläche gebracht, wo die Frauen und Kinder sie dann in die Körbe sammelten. Als wir noch Kinder waren, haben wir dabei oft geholfen. Danach haben wir der Mutter einen Korb voll, das war unser Lohn, nach Hause gebracht.
In Kummersdorf war die Voglin dabei, die Kartoffeln mit der Hacke aus der Erde zu holen. So war es noch mühseliger und dauerte entsprechend länger. Das zeigte, dass man beim Vogl nicht einmal mehr eine Milchkuh besaß, die man hätte einspannen können.
»Grüß dich, Voglin«, rief ich ihr zu, »hast noch zwei Hacken? Dann helf’ma dir!«
Sie schaute zu uns herüber: »Ja da schau her, die Schwirzer wollen auch einmal was Richtiges arbeiten! Freilich, im Schupfen stehen noch a paar.«
Wir gingen zu dem Anbau hinter dem Haus, wo das Werkzeug an der Wand lehnte. Ein paar Bodenhacken waren auch dabei. Wir nahmen uns zwei davon, zogen die Jacken aus und gingen hinüber zum Feld. Mein Terzerol hatte ich in die Jacke gesteckt. Die Voglin überließ uns das Aushacken und machte sich daran, mit den Kindern die Kartoffeln einzusammeln. Das tat ordentlich gut, einmal wieder richtig zuzulangen. Es war allerdings nicht nur eine Sache der Kraft! Man musste die Hacke schon mit Gefühl behandeln. Die Kartoffeln sollten ja nicht zerschlagen, sondern nur herausgeholt werden. Natürlich ging das mit uns beiden nun schneller voran. Nach einer Stunde waren wir den Einsammlern bereits um fünf Reihen voraus.
»Tuts langsam, Buam«, rief die Voglin herüber, »ich geh jetzt Mittagessen herrichten. Sonst kommen die Kinder net nach.«
»Ist schon recht.« Ich winkte ihr hinüber.
Es dauerte nicht lange, bis sie uns hineinrief. »’s Essen ist fertig, kommts rein!«
Wir gingen mit den Kindern hinüber zum Häusl, das oben auf der Höhe am Waldrand stand. Hinter dem Häusl stieg der Wald zum Hohen Bogen an. Wir ließen uns rund um den Tisch nieder, wo in einer Schüssel die gelben Schornbladl in einer fetten Soße schwammen. Die Arbeit hatte uns Appetit gemacht, und so hieben wir kräftig ein.
»Hätt euch gern noch eine Milchsuppn gemacht. Aber die Kötztinger Gendarmen haben uns auch noch die Kuh aus dem Stall geholt. Ich weiß nicht, wie es noch weitergehen soll. Wenn’s meinen Paul nicht bald auslassen, wird’s schlimm. Im Novembrari soll ich noch vier Gulden ›Gült‹ aufbringen. Ich weiß nicht, wo ich’s hernehmen soll. Zahl ich nicht, vertreibens’ uns vom Hof! Wir sind’s ja vom letzten Jahr noch schuldig.«
Verzweiflung klang aus ihrer Stimme. Da musste es schon schlimm stehen. Denn so schnell verloren die Menschen hier ihren Mut nicht. Wenn es hart wurde, trotzte man, »jetzt erst recht«, gegen das widrige Schicksal. Nein, so schnell gab sich der Waldler nicht geschlagen.
»Was hat euch denn so zu schaffen gemacht?«, fragte ich nach.
»Das Aschenbrennen hat uns ins Unglück getrieben!«
Ich schaute erstaunt auf: »Aber das ist doch ein gutes Geschäft?«
Sie winkte ab. »Schon, schon, aber wenn man einem die Aschn aus den Aschenhüttn ausräumt, bevor man ans Sieden kommt, dann ist’s kein gutes Geschäft. Der Pfeffer in Rimbach, der das Brennen am Hohen Bogen über hat, der wollt’s nicht dulden, das freie Brennen. Wir können’s nicht beweisen, dass der Pfeffer die Aschn genommen hat. Deswegen können wir auch nix dagegen tun. Und so ist’s halt gekommen. Auf mich hat er nicht hören wollen, der Paul.«
»Wieso«, hab ich nachgehakt, »wolltest du nicht, dass er brennt?«
»Natürlich nicht«, erklärte sie, »ihm konnte es nicht schnell genug gehen mit dem Geldverdienen. ’s hätt auch so gereicht, wenn er am Hof ordentlich gearbeitet hätt. ’s wär halt langsamer gegangen. Aber was haben wir jetzt?« Anklagend streckte sie die Hände von sich.
»Warum hast denn den Brenntiegel nicht verkauft? Da hättet ihr doch etliche Gulden dafür gekriegt.«
Sie schüttelte den Kopf. »Den wollten die Gendarmen auch schon holen. Aber den hat der Paul zu gut versteckt. Weiß nicht einmal ich, wo der ist.«
»Ja«, brummte der Heinrich dazwischen, »wenn du den verkaufen könntest, dann wärt ihr aus dem Gröbsten draußen.«
»Hätt’s schon lang getan«, stieß die Voglin heraus, »aber ich hab sechs Mäuler zu stopfen. Ich hab keine Zeit zum Suchen. Und in den Wald gehen? In die Wildnis bringen mich keine zehn Rösser!«
Jetzt war Zeit zum Einhaken: »Voglin, ich hab einen Vorschlag für dich. Wir kaufen dir den Tiegel ab!«
Sie zog ein langes Gesicht. »Red keinen Blödsinn. Ich hab ihn doch nicht. Und ich weiß auch nicht, wo er ist.«
Ich beschwichtigte sie: »Nein, nein, ich mein’ schon, was ich sag! Wir kaufen dir den Tiegel ab. Suchen tun wir ihn selber. Wenn wir ihn nicht finden, dann haben wir Pech gehabt. Wenn der Paul wieder da ist, dann kann er ihn uns ja selber geben. Einverstanden?«
In ihren Augen keimte Hoffnung auf. »Was tätet ihr denn zahlen?«
Ich tat besorgt. »Das ist so eine Sach. Ich weiß doch nicht, wie alt der Tiegel schon ist. Am End ist er halb verrostet. Und finden müssen wir ihn auch erst. Da mein’ ich, zwanzig Gulden wären schon genug!«
Entrüstet sprang sie auf: »Was, zwanzig Gulden für so einen Tiegel? Du spinnst ja! Das ist ein Riesentiegel für 120 Maß Aschenlauge! Ich hab ihn selbst ja nicht gesehen. Aber in einer Woch hat der Paul einen halben Zentner schwarze Pottaschn gekocht. Da muss es schon ein großer Kessel sein.«
Das hatte ich nur in Erfahrung bringen wollen. Wenn ich den Eisentiegel schon nicht sehen konnte, dann wollte ich wenigstens wissen, worum es sich dabei handelte. Dass die Voglin aufgebracht war, konnte man verstehen – so ein Tiegel kostete damals um die 250 Gulden.
»Gut, gut«, warf ich ein, »das mag ja sein. Aber deshalb könnte er trotzdem verrostet sein. Und finden müssen wir ihn auch erst.«
»Zuletzt hat der Paul im Mai gesotten. Da kann er nicht verrostet sein. Auch wenn er ihn eingegraben hätt.« Sie kämpfte um einen guten Preis. Außerdem hatte sie Angst, ihr Mann könnte ihr ordentlich Bescheid stoßen, wenn sie den Tiegel zu billig abgab.
Ich ging nun auf ihren Handel ein. »Also gut, dann sagen wir dreißig Gulden. Was meinst?«
»Viel zu wenig, sag ich! Wenn ihr den Tiegel haben wollt, dann kostet euch das wenigstens hundert Gulden!«
Ich stand auf. »Dann wollen wir weiter Erdäpfel hauen. Mit dem Tiegel können wir kein Geschäft machen. So viel Geld hätt ich auch gar nicht.«
Sie hatte angebissen. Es war ihr anzusehen, wie es in ihr arbeitete. Aber ich sagte nichts mehr davon. Wir halfen noch beim Einsammeln und trugen die vollen Körbe hinüber zum Haus, wo die Kartoffeln auf einen Haufen geschüttet wurden. Schließlich wuschen wir uns am Steinbrunnen den Dreck und den Schweiß vom Körper. Als die Bäuerin herbeikam und sich bedanken wollte, wehrte ich ab: »Ist schon gut. Wir haben gern geholfen. Aber jetzt müssen wir zurück in die Sommerau, damit wir beizeiten daheim sind.«
Als wir uns schon zum Gehen wendeten, hielt sie uns noch mal auf: »Wegen dem Tiegel, ich mein halt … fünfzig Gulden müsste ich schon dafür bekommen.«
Ich drehte mich um zu ihr: »Weil du’s bist, Voglin, in Gotts Namen halt fünfzig Gulden. Ich muss bloß erst meine Jacke aus dem Schupfen holen.«
Wir gingen hinüber zu dem Anbau. Dort zog ich das Hemd aus der Hose. Darunter hatte ich meinen Geldgurt geschnallt. Ich holte vier Goldstücke heraus. Die Frau musste nicht sehen, dass da noch mehr war. Dann steckte ich das Geld wieder in die Hose, schob das Terzerol hinten in den Hosengurt und schlüpfte in die Jacke. Vor dem Haus drückte ich der Voglin die vier Goldstücke in die Hand. Umgerechnet waren das eigentlich mehr als fünfzig Gulden.
»Damit solltest du es erst einmal schaffen, bis der Paul wieder rauskommt. Wenn wir den Tiegel finden, nehmen wir ihn mit. Finden wir ihn nicht, dann schauen wir in vier bis fünf Wochen wieder vorbei und fragen den Paul. Abgemacht?«
Sie nickte. »Also, vergelt’s Gott fürs Helfen, und kommt gut nach Haus.«
»Segn’s Gott, Voglin, pfüa Gott auch.«
Da hatte ich weiß Gott ein gutes Geschäft gemacht. Dass ich diesen Tiegel finden würde, daran hatte ich keinen Zweifel.
Nachdem der Vogl heimlich im Wald gesotten hatte und alleine war, musste das ein Platz sein, der nicht allzu weit von seiner Aschenhütte entfernt war und Schutz und Unterstand bei der Feuerstelle bot. Selbst wenn er ihn weggeschafft hatte, konnte das nicht sehr weit sein. So ein Eisentiegel wog schwer und war für einen einzelnen Mann nicht leicht zu transportieren.
Nur der Heinrich hatte seine Bedenken. »Ob des gscheit is’, so ein Trumm zu kaufen, von dem man nicht weiß, wo es sein könnt?« Er wiegte den Kopf. »Hoffentlich hast du da nicht Geld zum Fenster hinausgeworfen!«
Ich erklärte es ihm: »Weißt, Heinrich, den Tiegel find ich bestimmt. Und außerdem hat die Geschichte einen wichtigen weiteren Vorteil. Die Voglin wird von dem Geschäft ganz bestimmt nichts verlauten lassen. So weiß also niemand, dass wir einen Tiegel zum Sieden haben, und wir können unser Geschäft völlig unbemerkt betreiben.«
Das leuchtete dem Heinrich ein. Aber er hatte noch weitere Einwände: »Die Böhmischen werden doch erzählen, dass wir immer noch schwirzen!«
»Na und, Heinrich, wer soll denn das nachweisen? Und überhaupt könnten wir unsere Ware von irgendwoher beziehen. Wir müssen uns nach und nach drüben eine feste Kundschaft heranziehen. Du wirst sehen, das wird ein erstklassiges Geschäft!«
Über unsere Unterhaltung waren wir schon bis in die Lam gekommen. Bei der Steidlerschmiede hielt uns der Hopf-Xaver an. Der Xaver war ein Inhäusler, also Knecht, beim Menacher. Von ihm wusste ich, dass er, gleich uns, ein Zubrot mit dem Schwirzen verdiente. Allerdings ging er für den Stöberl.
»He, Hainz-Buam«, rief er, »auf ein Wort!«
Wir gingen zu ihm hinüber.
»Grüß Gott. Sagts, wie schaut’s denn bei euch mit der Schwirzerei aus?«
Ich hob die Schultern. »Schlecht! Der Eibl hat keine Pottaschn mehr. Sagt er!«
Er blinzelte uns mit einem Auge zu. »Und das glaubt ihr ihm?«
Ich stellte mich dumm. »Wird schon so sein. Warum sollte er uns denn keine Pottaschn mehr geben?«
Der Xaver schaute mich erstaunt an. Meine vermeintliche Dummheit ging ihm nicht in den Kopf. »Was tätst denn sagen, wenn ich dir erzähl, dass der Stöberl auch keine Aschn mehr zum Schwirzen hat?«
Da schau her! Da hatten sich die beiden größten Kauderer im Lamer Winkel wohl zusammengetan. Waren beide gut situierte Bauern und Gastwirte, konnten aber wohl den Hals nicht voll genug bekommen. »Warten wir einmal ab«, sagte ich zum Xaver, »die kommen schon wieder, wenn sie zuverlässige Leut brauchen.«
Dem Xaver schwoll der Kamm: »Merkst du denn nicht, dass die uns ausbooten wollen? Die finden schnell ein paar arme Schlucker, die nicht anteilmäßig, sondern entlohnt schwirzen. Das Geld stecken dann nur noch die zwei ein!«
»Musst dir halt einen anderen Kauderer suchen. Wird uns, wenn’s wirklich so ist, auch nix anderes übrig bleiben.«
Der Xaver stampfte trotzig auf: »Ihr tut euch da leichter. Ihr habt keine Familie und könnt hingehen, wo ihr wollt. Ich bin auf die zwei angewiesen. Aber ich werd’s denen schon noch zeigen!« Die Wut loderte aus seinen Augen.
»Was können wir denn dran tun?«, fragte ich und bemühte mich, resigniert zu klingen. »Wenn ein Gschäft vorbei ist, ist’s vorbei.«
Der Xaver konnte es anscheinend nicht fassen. »Von euch hätte ich am ehesten erwartet, dass ihr euch zur Wehr setzt. So kann man sich täuschen!«
Nein, so dumm war ich nicht, dass ich ihm unsere wahren Absichten auf die Nase gebunden hätte. »Wie sollen wir uns denn wehren? Auf die Kötztinger Festung, zum Richter, können wir wohl nicht. Wenn du mir sagst, wie wir uns wehren sollen, dann bin ich gern dabei!«
Aber das wusste der Xaver auch nicht. So verabschiedeten wir uns und gingen hinunter ins Regental und heim nach Sommerau.
Ein wertvoller Fund
Am nächsten Morgen schickte ich den Heinrich hinüber nach Oberried, wo er unsere Brüder, besonders den Sebastian und den Sepperl, über unsere Absichten informieren sollte. Den Sepperl sollte er gleich mitbringen. Der war achtzehn Jahre alt und bei einem Bauern in Arnbruck als Knecht verdingt. Da konnte er ohne Weiteres weg, weil er von seinem Bauern kein Lichtmess-Stöckerl bekommen hatte.
Wenn Sie unsere Bräuche im Bayerischen Wald nicht kennen, dann muss ich das erklären: Für gewöhnlich werden an Lichtmess, das heißt Anfang Februari, die Ehhalten, also die Knechte und Mägde, für das folgende Jahr bis zum nächsten Lichtmesstag fest angestellt. Und das dokumentieren die Bauern dadurch, dass sie ihnen ein geweihtes Wachsstöckerl überreichen, eine zusammengewickelte lange, dünne Wachskerze. Wenn der Bauer sich an einen Angestellten nicht so fest binden will, dann gibt er ihm kein solches Wachsstöckerl. Diese Ehhalten konnte man dann auch unterm Jahr kündigen. Umgekehrt konnte der Knecht oder die Magd das Bündel schnüren, wenn es ihm oder ihr dort nicht mehr gefiel. Der Sepperl mit seinen achtzehn Jahren war schon ein Prügel von einem Mannsbild. Eine vollwertige Arbeitskraft.
Bei Sebastian war das schon schwieriger. Der Sebastian war der Älteste von uns Kindern. Ich glaube, auch der Gescheiteste. Auch er hatte vom Vater die Glasmacherei gelernt. Er hatte sich damit nicht zufriedengegeben und weiter gelernt. Inzwischen hatte er es auch schon weit gebracht. Mit seinen 31 Jahren leitete er bereits für den Nepomuk Poschinger die Glashütte in Zwieselau. An ihm haben das Unglück des Vaters und die Gemeinheit des Bergamtsverwalters Schmid in Bodenmais wohl am meisten gefressen. Ich glaube, dass er auch deshalb so an sich gearbeitet hat, um eines Tages dem Schmid Paroli bieten zu können.
Der Heinrich war seinerzeit zwanzig Jahre alt, und ich selbst bin mit meinen 23 Jahren der Zweite in unserer Geschwisterreihe. Mit fast zweieinhalb Ellen Körperlänge schaue ich über die meisten anderen Leute hinweg. Ein knochiger Kerl, den man beim besten Willen nicht gut aussehend nennen kann. Aber das war mir immer ziemlich egal. Ungebärdige dunkelblonde Haare versuchte ich ebenso vergeblich wie unermüdlich nach hinten zu dressieren.
Die Leute haben von mir immer gesagt, dass ich am meisten meinem Großvater gleichsähe, der noch vor sechzig Jahren die größte Glashütte und – nach den Klosterwäldern – die größten Waldungen im Lamer Winkel besessen hatte. Ihm sind vor allem zwei Dinge zum Verhängnis geworden: der eigene Ehrgeiz und die Habsucht des Adels. Zuerst hat er sich als »Gewerker« – heute würde man sagen Teilhaber – mit viel Geld beim Lamer Bergwerk beteiligt. Er hat halt davon geträumt, zusammen mit den adeligen Herren, die sich auch beteiligt hatten, reich zu werden und vielleicht gar in den Adelsstand aufzusteigen. Aber das ist ein Traum geblieben. Das Bergwerk hat mehr Geld verbraucht, als es eingebracht hat.
Dann hat Graf Nothafft erfolgreich beim Kurfürsten gegen meinen Großvater intrigiert. Der Graf war scharf auf die Waldungen rund um den Arber, für die wir vom Kurfürsten selbst einen Erbrechtsbrief hatten. Er hatte durch seine Heirat fast ganz Eisenstein erworben und wollte diesen Besitz mit unseren Waldungen ausbauen. Später hat sich der Vater bei der zuständigen Instanz, beim Vicedom in Straubing, gegen die ständigen Übergriffe des Grafen beschwert. Aber der Vicedom in Straubing war genau jener Graf Nothafft. Leicht verständlich, dass mein Vater da nicht viel Erfolg haben konnte.
Der Kurfürst selbst hat dann entschieden. Für wen? Natürlich für den einflussreichen Grafen, der ihm bei finanziellen Problemen immer wieder behilflich war. Er hat damit entschieden gegen seinen eigenen Erbrechtsbrief, für den der Vater und der Großvater getreulich Jahr für Jahr ihre Gült an den Kurfürsten entrichtet hatten. Schließlich musste der Vater das ganze Besitztum gegen eine Glashütte in Bodenmais eintauschen, die er aber nur in Pacht bekam. Ein heruntergewirtschaftetes Anwesen. Schließlich hat man uns auch noch von dort vertrieben. Nun, denen wollten wir es eben heimzahlen.
Aber wenn man gegen hohe Herren antreten will, und dabei auch noch Erfolg haben, dann muss man zunächst leise auftreten. Und vor allem Kapital in die Hand kriegen. Diese Grundsätze hat uns die Mutter schon immer eingetrichtert. Trotz ihrer fünfzig Jahre war sie nicht gewillt, sich mit ihrem Schicksal abzufinden. Munter und rüstig wie eine Vierzigjährige, gab sie den Kampf niemals auf. Das war uns Buben ein Vorbild.
Während der Heinrich unterwegs war, richtete ich in unserem Häusl eine weitere Bettstatt her und ging dann in die Lam hinaus. Dort kaufte ich beim Kramer, beim Bäcker und beim Metzger das Zeug ein, das wir während der nächsten Wochen brauchten. Wir würden uns doch die meiste Zeit im Wald aufhalten. Dazu musste man vernünftig ausgerüstet sein, wenn das Unternehmen nicht schon am Anfang scheitern sollte. Um das benötigte Werkzeug bin ich am Tag darauf nach Hohenwarth hinausgegangen. Neue Äxte, Sägen, Eisenkeile und zwei Sapine mussten wir schon haben. Damit war ich in Hohenwarth bestens bedient. Nicht nur, dass sich die Lamer und die Hohenwarther seit jeher nicht besonders grün waren, nein, die Hohenwarther waren seit eh und je dafür bekannt, dass sie mit der Obrigkeit gerne übers Kreuz waren. Sie waren rechte Querschädel, die Leut in Hohenwarth. Das konnte mir nur recht sein. Die würden nicht zum Pfleggericht laufen und erzählen, dass da einer Holzwerkzeug kauft, der gar keinen Wald hat und auch nicht als angestellter Waldarbeiter bekannt ist! Für diesen Vorteil nahm ich gerne einen etwas längeren Weg in Kauf.
Das Werkzeug war auf dem Heimweg recht unangenehm zu tragen. Ich habe zwar breite Schultern, aber zwei große Baumsägen, vier Beile und etliche kurzstielige Hacken waren schon etwas unhandlich. Die Hacken hatte ich kurzerhand in den Gürtel gesteckt, wo sie mich zwickten und zwackten. Aber die Beile und Sägeblätter musste ich wohl oder übel über die Schulter nehmen. Wie gesagt, nicht sehr schwer, aber unangenehm.
Ich kam grade oberhalb von Simpering vorbei, als ein schmutziger, ungeschlachter Bursche auf den Weg heraustrat. »Wohin so eilig, Euer Gnaden?«, fragte er. Trotz seiner höflichen Anrede wirkte er keineswegs sehr vertrauenerweckend. Ein wildes Bartgestrüpp wucherte um sein Kinn. Und schielen tat der Bursche! Man hatte den Eindruck, er könnte sich mit dem rechten Auge in die linke Jackentasche schauen.
»In den Lamer Winkel geht’s, aber ›Euer Gnaden‹ hab ich heut zu Haus gelassen«, erklärte ich und wollte vorbei.
»Ein schönes Werkzeug habt Ihr da. Wollt Ihr’s nicht verkaufen?«
Ich lachte. »Nein, nein, hab’s grad selber erworben und brauch’s für die Arbeit.«
Es war auffallend, wie der Kerl selbst beim Reden immer den Weg nach vorne und nach hinten beobachtete. Er wich nicht von der Stelle, als ich an ihm vorbeiwollte. »Habt Ihr keine Angst, man könnt es Euch wegnehmen? Wo Ihr doch so alleine geht!«
Ich schaute ihn erstaunt an. »Ich Angst? Wüsst nicht warum. Wer soll mir schon was wegnehmen wollen?«
Ich überlegte bereits, was ich tun konnte, wenn der Kerl ein Wegelagerer war. Es versteckten sich einige in den dichten Wäldern am Kaitersberg. Auf der linken Schulter trug ich die Sägeblätter und rechts die Beile. Hand hatte ich gar keine frei, um mich zur Wehr zu setzen. Selbst wenn ich mein Terzerol dabeigehabt hätte, so hätte es mir im Moment auch gar nichts genützt. Ich musste erst sehen, falls er mir ans Leder wollte, wie er bewaffnet war. »Nichts für ungut«, sagte ich deshalb, »es war schön, mit Euch zu schwatzen, aber ich muss weiter.«
Der Struppige nickte. »Das schon«, knurrte er, »aber ohne das Werkzeug!« Dabei zog er hinter seinem Rücken ein Seitengewehr, ein sogenanntes Bajonett, hervor. »Lasst den Krempel einfach fallen!«
Ich tat bekümmert. »Was soll ich denn sonst machen?« Dabei ließ ich die Sägeblätter links von der Schulter gleiten. Im gleichen Moment drückte ich die Stiele der schweren Beile auf der rechten Schulter mit Schwung nach unten. Die schweren Eisenbeile kamen über meine Schulter und flogen nach vorne.
Ich hatte richtig kalkuliert. Noch während der Galgenvogel auf meine Sägeblätter schaute, knallte eines der Beile gegen seinen Schädel. Der wuchernde Bart mochte den Hieb etwas gemildert haben. Aber es reichte auch so. Steif wie ein Brett fiel der Halunke um. Dabei hatte er noch Glück. Ums Haar wäre er noch in sein eigenes Bajonett gefallen. Wenn man sich mehr abschneidet, als man essen kann, dann muss man auch die Folgen tragen.
Ich nahm ihm nur sein Bajonett samt Scheide weg, schulterte mein Werkzeug und machte mich wieder auf den Weg. Ich war sicher, dass der Schnapphahn noch mehr auf dem Kerbholz hatte. Mit etwas Glück würde er sich mit einem Brummschädel in sein Versteck zurückziehen. Jedenfalls hatte er heute etwas dazugelernt. Obwohl man bei solchen Burschen niemals wissen konnte, ob sie jemals etwas dazulernen würden.
Ungesehen und ohne weiteren Aufenthalt kam ich schließlich bei unserem Häusl an. Heinrich war inzwischen mit dem Sepperl zurück, und beide begrüßten mich voller Ausgelassenheit. Besonders der Sepperl war voller Übermut. »Sepperl« war eigentlich kein passender Name für dieses Trumm Mannsbild. Aber so hatte er von klein auf geheißen, und es war ihm bis heute geblieben. Es störte ihn auch gar nicht, wenn er so gerufen wurde.
Nun fing nun ein großes Erzählen an, darüber, wie es ihm in der Zeit ergangen war, da wir uns nicht mehr getroffen hatten. Unser Vorhaben schien ihm ein rechtes Abenteuer zu sein. Und für Abenteuer war der Sepperl immer zu haben. Wir schwatzten bis in die tiefe Nacht hinein. Endlich übermannte uns doch der Schlaf.
Der nächste Morgen sah uns bereits auf dem Weg über den Osser. Zu den Gipfeln des Großen und Kleinen Osser führten einige schmale, fast verwachsene Pfade, die von den Waldgehern des Kurfürsten wohl getreten worden waren. Hinter dem Osser gab es aber auch diese Steiglein nicht mehr. Da begann der reine Urwald.
Unten im Tal der »Eisenstraß«, in Hammern und hinaus bis Neuern, gab es keine Glashütten. Dort baute man vor allem Eisenerz ab. Den Leuten war es egal, wenn auf der Höhe Asche gebrannt wurde. Ganz verheimlichen ließ sich unsere Tätigkeit ohnehin nicht. Denn den Rauch konnten wir nun einfach nicht wegzaubern.
Hinter dem Weißriegel fanden wir genau das, was wir brauchten: einen geschützten Lagerplatz unter einem überhängenden Felsen, den wir mit Stangenholz und Ästen zu einer gemütlichen Wohnhöhle ausbauten. Die umstehenden jungen Fichten schützten uns vor neugierigen Blicken und verteilten den Rauch des Herdfeuers.
Eine halbe Wegstunde entfernt errichteten wir unsere Aschenhütte und legten sie mit trockener Baumrinde aus. Die Holzasche durfte nämlich keine Feuchtigkeit ziehen. Sonst verlor sie die Laugenschärfe und war für die Pottaschegewinnung unbrauchbar.
Als wir uns so weit eingerichtet hatten, kehrten wir in der Woche danach in die Sommerau zurück, um unsere Ausrüstung und die Lebensmittel zu dem Platz hinaufzuschaffen. Fünf Tage benötigten wir im ständigen Hin und Her, bis wir alles an Ort und Stelle hatten.
Ich war der Einzige, der schon Erfahrung im Aschenbrennen hatte, und zeigte den beiden, wie man sorgfältig und ohne Gefahr eines Waldbrandes die umgestürzten Bäume vom Wurzelstock trennt, auf Rundlinge legt und unter ständigem Drehen abbrennt. Die abfallende Asche darf nie über Nacht liegen bleiben, sondern muss, kaum dass sie ausgekühlt ist, sofort in die Aschenhütte gebracht werden.
Nach einer Woche war ich sicher, dass Heinrich und Sepperl alles richtig machen würden. Am Abend erklärte ich den beiden, dass ich mich nun auf die Suche nach dem Eisentiegel vom Vogl in Kummersdorf machen wollte. Der Heinrich machte sich schon wieder Sorgen um mich: »Meinst du nicht, dass ich besser mitgehen sollte? Vier Augen sehen mehr als zwei, und so gefährlich wär’s auch nicht, als wenn du alleine durch den Wald steigst.«
Er war ein guter Kerl, mein Bruder Heinrich. Aber manchmal war er in seiner Sorge schon ein wenig einfältig. »Überleg doch, Heinrich! Willst du gar den Sepperl allein hier oben lassen? Wenn wir alle drei den Tiegel suchen gehen, wer soll denn dann hier Asche brennen? Also, es bleibt dabei. Ich geh morgen Früh los. Wenn ich den Tiegel gefunden hab, komm ich euch holen. Denn alleine kann ich den Tiegel natürlich nicht hier herauf schaffen.« Der Heinrich sah das schließlich ein, und so marschierte ich am nächsten Morgen los.
Erst ging ich nach Lambach hinab. Durch Stauden und Dornen war die feste Kleidung ein wahrer Segen. Ein paarmal bin ich auf die Nase gefallen. Einmal hab ich mir an einem umgeworfenen Baum das Gesicht böse verkratzt. Aber das würde schon wieder verheilen.
Unterwegs hab ich auch Bärenspuren gesehen. Nicht selten haben sie ihre Krallen in die Baumrinde geschlagen. Daran konnte man sehen, wie groß so ein Bär war. Die braunen Waldkameraden waren in der Regel friedliche Burschen. Einmal ist einer zehn Schritte vor mir über eine Waldlichtung getrottet. Er hat mir nur kurz einen Blick zugeworfen und sich in den Wald hinein getrollt. Unangenehm konnte allerdings die Bärin im Frühsommer werden, wenn man einem ihrer Jungen zu nahe kam. Aber jetzt im September hatte es damit keine Not.
Die Wölfe waren in dieser Jahreszeit auch noch weit im Böhmischen. Erst im Winter kamen sie heraus bis in den Bayerwald. Da sollen sie schon einmal an den Dorfrändern Kinder angefallen haben. Aber das ist auch nicht sicher. Ich wollte jedenfalls im Winter keinem hungrigen Wolfsrudel begegnen.
Luchs, Marder und Wildkatze, die sich auch in unseren Wäldern herumtreiben, scheuen jeden Menschen und geben Fersengeld, sobald man in ihre Nähe kommt.
Die meisten Bewohner der Dörfer, besonders aber die Weibsleut, fürchten den Wald. Aber die Waldbauern, die Aschenbrenner und die anderen Waldläufer wissen, dass einem der Wald nichts zuleid tut. Schaden kann man sich im Wald nur selber. Wer sich aus Unachtsamkeit im Wald verletzt, der ist freilich übel dran. Deshalb ist es wichtig, in der Wildnis nicht blind herumzulaufen, sondern auf seine Schritte aufzupassen.
Mit solchen Überlegungen war ich inzwischen nach Lambach hinuntergekommen. Um neugierigen Fragen zu entgehen, wich ich in die Hänge unter dem Mariahilf-Kirchlein aus. Dann ging ich hinaus nach Englashütt und hinauf zur »Absetz«, wo der Fuhrweg hinüberführt nach Furth im Wald. In der Wirtschaft auf der Passhöhe, wo die Fuhrleute einkehren, um Pferde und Maultiere rasten zu lassen, hab ich mir ein Glas Bier gekauft und eine ordentliche Brotzeit. Ich wusste ja nicht, wann ich in den nächsten Tagen wieder etwas Vernünftiges zu essen bekommen würde.
Dermaßen gesättigt bin ich dann hinübergegangen zum Kolmstein. Von da hatte ich einen freien Blick hinunter ins Tal des Weißen Regen. Und von dort wollte ich auch etwaige Waldlücken entdecken, in denen der Vogl vielleicht gebrannt haben konnte.
Dass der Pfeffer aus Rimbach hier am Werk gewesen war, konnte man ausschließen. Dessen Revier war der Hohe Bogen. Weiter als bis zur Kagerhöhe würden dessen Aschenbrenner kaum kommen. Dann wäre selbst der Transport der leichten Asche zu umständlich geworden. Entdecken konnte man solche Brennplätze nur von hier oben.
Als ich auf dem Bergrücken stand und etwa vier oder fünf Lichtungen erkannte, die nach Menschenhand aussahen, dann war das die eine Sache. Eine ganz andere Sache war es, diese Stellen dann im Wald wiederzufinden. Ich musste mir die Landmarken einprägen. Ein fast viereckiger Platz befand sich genau in einer Linie zwischen dem Mühlriegel über der Stanzen und dem Kolmstein über mir. Das war eine einfache Orientierungshilfe, sofern ich einen freien Blick auf beide Berge bekam. Wenn ich erst einen Brennplatz gefunden hatte, so kam ich von da aus zum nächsten. Die hingen wie die Perlen an einer Schnur zusammen.
Ich machte mich also an den Abstieg. Heute würde ich den Platz ohnehin nicht mehr erreichen. Aber ich wollte das Tageslicht noch so weit wie möglich nutzen.
Als die Dämmerung hereinbrach, suchte ich mir einen günstigen Platz zum Nachtquartier. Unter einer steilen Erdböschung, die ein umgestürzter Baum oberhalb in eine Art kleine Höhle verwandelt hatte, fand ich schließlich einen trockenen Lagerplatz. Mit etlichen dürren Zweigen fachte ich ein kleines, beinahe rauchloses Feuer an, auf dem ich mir das Wasser für meine Zichorienbrühe erhitzte. Danach wickelte ich mich in meine Decke und schaute dem Feuer zu, wie es allmählich in sich zusammenfiel. Nach zehn Stunden Marsch durch unwegsames Gelände war ich alsbald eingeschlafen.
Der Morgentau auf meiner Stirn weckte mich und ein Knacken und Rascheln im Unterholz gegenüber, etwa zwanzig Schritte entfernt. Ich holte mein Terzerol aus dem Packen und wischte den Feuerstein trocken, bevor ich ihn in den Schlaghahn steckte. Da schob sich eine schnuppernde Schnauze aus dem Geäst. Ein Dachs! Jetzt im Oktober trug er schon sein dichtes Winterfell. Ich war versucht, einen Schuss zu riskieren, aber ließ es dann doch. Zum einen war ich nicht hinter Fellen her, zum anderen würde man in der Morgenstille diesen Schuss meilenweit hören. Ich beobachtete das Tier noch eine Weile, bis es grunzend und schnüffelnd bergab wieder im Wald verschwand.
Dann schlüpfte ich aus meiner Decke und suchte dürres Holz, um mein Feuer wieder in Gang zu bringen. An einer Quelle unweit von meinem Schlafplatz wusch ich mich zuerst, bevor ich meinen Topf mit Wasser füllte, um mir ein warmes Frühstück zuzubereiten. Nachdem ich meinen Packen zusammengerollt und geschultert hatte, versuchte ich mich zu orientieren. Durch eine Baumlücke konnte ich den Mühlriegel erkennen. Aber hinter mir, nach Norden zu, stieg der Wald so steil und dicht an, dass ich nirgendwo zum Kolmstein emporschauen konnte. Ich versuchte daher aufs Geratewohl, in meiner Linie zu bleiben.
Wer jemals versucht hat, durch einen dichten Wald eine Richtung beizubehalten, der weiß, was ich meine. Immer wieder schaute ich vor- und rückwärts, um keine Möglichkeit auszulassen, Anhaltspunkte für den weiteren Weg zu finden. Als ich nach geraumer Zeit einmal beide Gipfel erkennen konnte, musste ich prompt feststellen, dass ich ein gutes Stück zu weit nach Osten abgekommen war. Also hielt ich mich westlich und kletterte weiter durch Gestrüpp und Unterholz bergab. In einem Hochwald mit hundertjährigen Fichten, Buchen und Eichen war das Gehen zwar ein Kinderspiel, aber dafür hatte ich nun gar keinen Ausblick mehr.
Ich war schon einige Stunden unterwegs, da stellte ich fest, dass mich irgendetwas irritierte. Wer sich in der Wildnis sorgfältig bewegt, kontrolliert nicht nur den Pfad vor und hinter sich. Er achtet – ohne sich auf etwas Spezielles zu konzentrieren – auch auf den Gesamteindruck, den die Umgebung auf ihn macht. So fällt ihm am ehesten auf, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte.
Ich konnte nicht sofort benennen, was es war. Aber ich fühlte: Es stimmte etwas nicht.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus
Die Magd des Herzogs
eISBN 978-3-475-54601-3 (epub)
Anna wächst als Waise bei ihrem Oheim auf dessen Burg auf. Mit seinem Sohn Ludwig verbindet sie von Beginn an eine innige Freundschaft. Doch die Standesunterschiede zwischen den beiden werden zunehmend spürbar …
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























