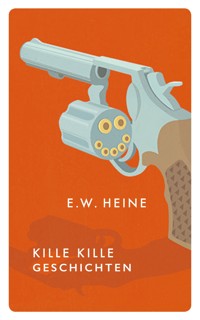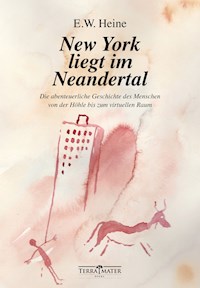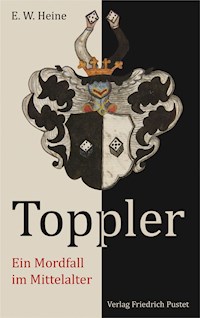Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrer Brust schlägt das Herz einer Löwin … Der historische Roman »Das Geheimnis der Hexe« von Bestsellerautor E.W. Heine als eBook bei dotbooks. Sie reitet wie der Teufel, ist mutig wie ein Ritter – und nicht bereit, sich wie ein sittsames Weibsbild zu benehmen … Das Altmühltal im 13. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Papavera unerwartet früh zur Erbin der Burg Falkenstein. Mit ihrem scharfen Verstand und großen Herzen erobert sie schnell die Herzen ihrer Vasallen – doch sie hat auch Feinde, die sie als Hexe verleumden. Im letzten Moment kann Papavera fliehen. Ihre einzige Hoffnung: Ins Heilige Land zu gelangen, um dort nach ihrem verschollenen Vater zu suchen. Auf der gefahrvollen Reise findet Papavera ungewöhnliche Freunde … und muss doch immer auf der Hut sein vor einem Inquisitor, der sie um jeden Preis auf dem Scheiterhaufen brennen sehen will! Ein farbenprächtiger historischer Roman – meisterhaft erzählt von E.W. Heine, dem Autor des Bestsellers »Das Halsband der Taube«: »Der mitreißendste deutsche Historienerzähler unserer Tage!« Focus Jetzt als eBook kaufen und genießen: der historische Roman »Das Geheimnis der Hexe« von E.W. Heine. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie reitet wie der Teufel, ist mutig wie ein Ritter – und nicht bereit, sich wie ein sittsames Weibsbild zu benehmen … Das Altmühltal im 13. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Papavera unerwartet früh zur Erbin der Burg Falkenstein. Mit ihrem scharfen Verstand und großen Herzen erobert sie schnell die Herzen ihrer Vasallen – doch sie hat auch Feinde, die sie als Hexe verleumden. Im letzten Moment kann Papavera fliehen. Ihre einzige Hoffnung: Ins Heilige Land zu gelangen, um dort nach ihrem verschollenen Vater zu suchen. Auf der gefahrvollen Reise findet Papavera ungewöhnliche Freunde … und muss doch immer auf der Hut sein vor einem Inquisitor, der sie um jeden Preis auf dem Scheiterhaufen brennen sehen will!
Ein farbenprächtiger historischer Roman – meisterhaft erzählt von E.W. Heine, dem Autor des Bestsellers »Das Halsband der Taube«: »Der mitreißendste deutsche Historienerzähler unserer Tage!« Focus
Über den Autor:
E.W. Heine (1935-2023) wurde in Berlin geboren, studierte Architektur und Stadtplanung. Er verbrachte viele Jahre in Südafrika, wo er ein Architekturbüro unterhielt und verschiedene internationale Projekte realisierte. Parallel dazu widmete sich E.W. Heine seiner anderen Leidenschaft, dem Schreiben: Aus seiner Feder stammen unter anderem Drehbücher, Sachbücher, historische Romane und die makabren »Kille-Kille«-Geschichten, die Kultstatus erreichten. E.W. Heine lebt heute in Bayern.
Zu E.W. Heines bekanntesten Werken gehört die Trilogie, in der er sich mit den großen Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum auseinandersetzt: »Das Halsband der Taube«, »Der Flug des Feuervogels« und »Die Raben von Carcassonne«.
Der Autor im Internet: www.ewheine.de
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2020
Unter dem Titel »Papavera - Der Ring des Kreuzritters« erschien dieses Buch bereits 2006 im cbj Verlag, München, und 2016 bei dotbooks, München.
Copyright © der Originalausgabe 2006 cbj Verlag, München.
Copyright © der Neuausgabe 2016, 2020 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/M_A_R_G_O, adobeStock/Michail Guta sowie des Gemäldes »Landschaft mit Schafen am Fluss« von Jacobs van der Stok
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95824-711-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis der Hexe« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
E.W. Heine
Das Geheimnis der Hexe
Historischer Roman
dotbooks.
Noch immer recken die Burgen an der Altmühl ihre Türme trotzig in den Himmel. Noch immer hausen Fledermäuse im Schüler Loch. Noch immer ertönt der Schrei der wilden Schwäne.
Der Fluss, der sich einst wie eine Schlange durch das Tal wand, wurde begradigt und gebändigt, doch nicht entzaubert. Ewig und dennoch in stetem Wandel, beherrscht er alle Wunder der Verwandlung.
Mondlicht, das in milden Maiennächten auf dem Wasser liegt, wird beim Gesang der Nixen zu Silber. Sonnenstrahlen, die zur Sommersonnenwende den dunklen Grund der Altmühl erreichen, werden beim Geläut der Glocken zu Gold. Geschwätzig und wissend wie eine alte Frau ist der Fluss. Er hat mir diese Geschichte vom Knaben im Kupferkessel erzählt, von Leichtfuß, dem Zwerg, vom Ohrenabschneider, von Albi und Assunta, vor allem aber von der feuerroten Papavera und ihrem Rotfuchs Tassilo.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
E.W. Heine
zur Sommersonnenwende 2004
Der Knabe im Kupferkessel
Wenn die Kaufleute mit ihren schwer beladenen Planwagen, von Italien herkommend, durch das Altmühltal gen Norden zogen, so bekreuzigten sie sich beim Anblick der Burg Falkenstein und sprachen: »Gib Gott, dass sich der Ohrenabschneider auf Reisen befindet oder dass ihn wenigstens das Gliederreißen wieder so plagt, dass er vor Reißen nicht auf sein Ross kommt.«
Ritter Randolph von Falkenstein, den alle Welt nur unter dem Spottnamen »Der Ohrenabschneider« kannte, hatte die üble Angewohnheit, allen Räubern, die sich auf sein Gebiet wagten, und allen Händlern, die den geforderten Wegzoll nicht zahlen wollten, die Ohren abzuschneiden. Ihm selber fehlte das linke Ohr. Das hatten ihm die Mamelucken abgehackt.
Wenn aus dem Schornstein der Burg Rauch quoll – ein untrüglicher Beweis dafür, dass der Hausherr daheim war –, so beteten die, die seine Bekanntschaft schon einmal gemacht hatten: »Heiliger Sankt Engelmar, beschütze uns vor der Willkür dieses einohrigen Teufels.«
Dass sie den Alten einen Teufel nannten, war nicht recht, denn bei aller Strenge seiner Herrschaft entzündete er dennoch nach jeder Bestrafung eine Kerze auf dem Altar seiner Burgkapelle, die dem heiligen Petrus geweiht war – wahrscheinlich, so meinten die Bauern im Tal, weil auch der einem römischen Kriegsknecht ein Ohr abgehackt hatte.
Beim Laufen stützte sich der Ohrenabschneider auf seinen Säbel, denn er hatte auch nur ein Bein. Das andere war während einer Floßfahrt auf der Donau vom Blitz getroffen worden. Dennoch ritt er wie ein Hunne, und so soff er auch, mit Vorliebe Bockbier. Mehr noch liebte er gutes Essen. Salat und Gemüse stimmten ihn traurig. Nach Knödeln und Kuchen musste er sich kratzen. Deshalb aß er nur Fleisch.
»Karnickel und Esel fressen Grünzeug«, pflegte er zu sagen. »Raubtiere brauchen bessere Kost.«
Er hatte mehr Feinde als Freunde. Aber er hatte ein Weib mit dem schönen Namen Isabella. Trotz des wohl klingenden Namens war sie weiß Gott keine Schönheit. Isabella von Falkenstein hatte mit den Falken nur die ausdrucksstarke Nase gemein. Mit kurzsichtigen Augen blinzelte sie in die düstere Welt der fast fensterlosen Festung. Da nur selten ein Sonnenstrahl in die dickwandige Burg fiel, war ihre Haut weiß wie Fischbauch, und so roch sie auch. Ihre Zähne, sofern noch vorhanden, waren schartig oder schwarz, ihre Sommersprossen und Leberflecken so zahlreich wie die Sterne über dem Altmühltal zur Johannisnacht. Aber sie war fleischig prall an den richtigen Stellen ihres Leibes und in Liebesdingen talentierter als alle anderen Weiber, die der Ohrenabschneider je im Bett gehabt hatte. Und das waren nicht wenige.
Isabella Maultasch, wie sie mit Mädchennamen hieß, war seine dritte Ehefrau. Die beiden anderen lagen in der Gruft unter der Burgkapelle, gemeinsam mit ihren Neugeborenen. Der Tod hatte sie im Kindbett dahingerafft.
»Einer wie ich zeugt nur Söhne«, pflegte der Ohrenabschneider zu sagen, womit er wohl Recht hatte, denn auch das Kind, das ihm Isabella geboren hatte, war ein Junge, ein prächtiger Säugling im wahrsten Sinne des Wortes.
»Der trinkt für zwei«, sagte Isabella. »Ein Glück, dass unsere Amme Milch für drei in ihren Brüsten hat.«
»Prächtige Brüste«, fand der Ohrenabschneider, wenn er beim Stillen seines Sohnes zuschaute.
»Der wird einmal ein richtiger Schnapphahn. Schon bei seiner Geburt war er so schwer wie ein Zwölfpfünder-Dinkelbrot.«
Die Amme nickte mit dem Kopf, obwohl sie nicht begriff, wovon die Rede war. Als Araberin aus dem Land der Mamelucken verstand sie nicht die Sprache ihres Herrn, an den sie von einem maltesischen Sklavenhändler verkauft worden war. »Betrachtet ihr edles Profil«, hatte der sie angepriesen. »Sie ist von urphönizischem Adel. Obwohl sie keine Christin ist, ist sie ganz gewiss eine gute Amme.«
»Recht habt Ihr«, hatte der Ohrenabschneider erwidert. »Auch ungetaufte Kühe geben fette Milch. Was schert mich ihr Glaube.« Und zu seinem Weib, das bei jeder Gelegenheit den Herrn Jesus und alle Heiligen anrief, sagte er: »Ich bin ja Gott so dankbar, dass er mir die Gabe verliehen hat, nicht allzu sehr an ihn zu glauben.«
»Versündige dich nicht«, sagte sie dann, »sonst holt dich der Teufel.« Und er erwiderte lachend: »Einer wie ich endet nicht im Feuer.«
In diesem Punkt jedoch irrte der Alte. Und das kam so:
Der August ist im Altmühltal nicht nur der Monat mit den meisten Mücken und den mildesten Mondnächten, er ist auch der Monat mit den wildesten Gewittern. Während solch eines Unwetters fuhr der Blitz in den Festungsturm der Burg Falkenstein, sodass die Dachschindeln hundert Fuß hoch in den Himmel geschleudert wurden. Das Getöse war so groß, dass die Eulen und Uhus, die im Gebälk Zuflucht gesucht hatten, mit versengtem Gefieder davonstoben, als sei der Teufel hinter ihnen her.
Auch der Ohrenabschneider fuhr verschreckt aus dem Schlaf, und da er ja bereits sein rechtes Bein durch einen Blitzschlag verloren hatte, tastete er sogleich nach seinem linken. Als er feststellte, dass es noch da war, schickte er erst ein Dankgebet und dann einen schaurigen Fluch zum Himmel. Er schlug ein Kreuz und schrie: »Oh heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an!«
Doch dazu war es bereits zu spät.
Er fasste sein schlafendes Weib bei den Schultern, schüttelte es und schrie: »Feuer, Feuer! Wach auf, wenn dir dein Leben lieb ist!« Doch die drehte sich auf die andere Seite.
Und als er sie weiter wachrütteln wollte, rief sie schlaftrunken: »Scher dich zur Hölle!«
»Weib, wir sind schon mittendrin!«
Da sprang sie aus dem Bett, roch den Rauch, stürzte zur Tür, wollte hinaus zur Treppe, aber da war keine Treppe mehr. Das ganze Stiegenhaus stand in Flammen. Die hölzernen Stufen brannten wie Kaminholz. Die Turmfenster aber waren mit daumendicken Eisenstangen fest vergittert.
»Herr, hilf!«
Aber er half nicht.
Die Amme, die eine Etage darüber schlief, erwachte von dem beißenden Rauch, der die Kammer durchwölkte wie Nebel. Sie hob den schlafenden Knaben aus dem Korb, presste ihn an ihre Brust: fort, nur fort! Der Rauch nahm ihr Atem und Sicht. Wo war die Tür? Als sie sie aufstieß, schlugen ihr die Flammen entgegen. Sie taumelte zum Fenster, das Gott sei Dank nicht vergittert war, aber viel zu hoch, um den Ausstieg zu wagen. Wer von hier oben herabsprang, war auf der Stelle tot. 80 Ellen hoch war der Turm. Und unten an seinem Fuß fiel der Abhang mit steilem Gefälle immer weiter talabwärts.
Schon begannen die Deckenbalken zu brennen. Ihr blieb keine Zeit zum Überlegen. Sie ergriff einen großen Kupferkessel, schüttete das Badewasser aus, das darin aufbewahrt wurde, und stopfte stattdessen den Knaben mit allem Bettzeug, das sie greifen konnte, hinein. Eingewickelt in weiches Lammfell und Leinentuch steckte er in dem großen Kessel wie ein Küken in seinem Ei. Hustend und keuchend riss sie die Laken in Streifen, knotete sie aneinander und befestigte den Henkel des Kessels daran.
Als sie ihn aus dem Fenster hob, brannten bereits die Dielen, auf denen sie stand. Die Flammen umzüngelten ihre Füße, versengten den Saum ihres Rockes. Obwohl sie sich weit aus dem Fenster lehnte, war der Strick aus Leinentuch nicht lang genug. Es fehlten noch gut zehn Ellen bis zum Boden. Das Feuer erfasste ihr Haar. Da ließ sie los. Laut scheppernd polterte der kupferne Kessel zu Tal. Es war das Letzte, was sie vernahm, bevor die Höllenglut sie verschlang.
Der Säugling wurde noch in derselben Nacht gefunden. Die herbeigeeilten Bauern befreiten das Kind aus seiner Verpackung und stellten mit Erstaunen fest, dass es völlig unversehrt war. Mein Gott, was für einen Schutzengel musste dieser Knabe gehabt haben! Der einzige Überlebende von Falkenstein wurde zur nahe gelegenen Burg Prunn gebracht, wo ihn die Freifrau von der Recke, die zu Eusebius ihren eigenen Säugling verloren hatte, an Kindes statt aufnahm, was ihrem Gatten gar nicht recht war, denn – so argumentierte er »Wer ist so dumm und holt sich Ungeziefer ins Haus? Aus der Brut dieses verdammten Ohrenabschneiders wird niemals ein rechter Christenmensch werden, geschweige denn ein Rittersmann. Er wird uns nur Kummer bereiten. Weib, lass die Finger von diesem Findling.« Doch sie ließ sich das Kind nicht ausreden. Und er sollte nicht Recht behalten. Der Säugling wuchs zu einem prächtigen Knaben heran, der seine gleichaltrigen Spielgefährten an Haupteslänge überragte. Schon im Alter von elf Jahren war er ein treffsicherer Bogenschütze. Er ritt wie der Teufel und warf den Jagdspeer 200 Fuß weit. Mithilfe seines Beichtvaters hatte er das Lesen erlernt, eine Kunst, die nicht einmal der Freiherr von der Recke beherrschte.
Eine Aura scheuer Bewunderung umgab den Knaben. Papavero – so nannten ihn alle, die ihn kannten. Den wohl klingenden Namen hatte ihm die Freifrau gegeben. Sie stammte aus der Toskana und dort heißt Papavero roter Mohn. Denn sein Haar war so rot wie der Klatschmohn, oder richtiger wie der Kupferkessel, der ihn vor dem Feuer bewahrt hatte.
Papavero heißt aber auch wahrer Papa oder richtiger Vater. Das sollte er schon bald werden. Und damit beginnt unsere eigentliche Geschichte.
***
Die Jahre vergingen. Viel Wasser war die Altmühl hinuntergeflossen.
Die Türme von Burg Falkenstein ragten wieder in den Himmel, höher und stolzer als zuvor. Der Knabe aus dem Kessel war längst zum Mann geworden. Er hatte geheiratet und Kinder gezeugt, zwei Buben, die kurz nach der Geburt starben, und eine Tochter, die am Tag der heiligen Veronika das Licht der Welt erblickt hatte und daher auf den Namen der Heiligen getauft worden war. Vera nannte sie die Mutter, wenn sie ihren kleinen Liebling auf den Armen wiegte. Veras Haar war so rot wie das ihres Vaters, weshalb alle Burgbewohner sie Papavera riefen, eine doppeldeutige Bezeichnung, die die enge Verbindung, die zwischen Vater und Tochter bestand, unterstrich.
In dem Sommer, in dem unsere Geschichte beginnt, hatte Papavera gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert. Der Vater war vor drei Jahren mit dem Kaiser und den Kreuzfahrern ins Heilige Land gezogen. Zu Ostern vor einem Jahr hatte er zurück sein wollen. Sie hatten vergeblich auf ihn gewartet.
»Der kommt nicht wieder«, wussten die Bauern. »Den haben die Heiden erschlagen.«
Die Mutter war darüber gestorben. »Das Fleckfieber hat sie verbrannt«, hatte der Medicus aus Regensburg gesagt. Aber Papavera wusste es besser. Tag für Tag hatte die Mutter am Turmfenster gestanden und erwartungsvoll gen Süden geschaut. Jeder Reiter im Dunst der Ferne hatte neue Hoffnung in ihr geweckt: »Das ist er! Ja, das muss er sein. Ich erkenne ihn. Das rote Haar.« Aber es war nur eine rote Kappe. Am Ende verließ sie die Kraft. Sie flüchtete sich in fiebrige Tagträume, sprach mit dem Gatten, als sei er heimgekehrt: »Ich wusste, du würdest wiederkommen.« Sie starb mit einem Lächeln auf den Lippen. Zu Walpurgis wurde sie zu Grabe getragen.
Nun war Papavera die Einzige aus dem Geschlecht der Falkenstein. Nach karolingischem Recht war sie erwachsen. Ein Kind mit dreizehn Jahren galt als volljährig. Bis zu diesem Alter wurden Waisen im Findelhaus versorgt. Danach mussten sie sich ihr Brot eigenhändig verdienen.
Gemessen daran ging es Papavera gut, aber auf ihren noch recht mädchenhaften Schultern lastete eine Menge Verantwortung. Von einem Burggrafen wurde erwartet, dass er Autorität ausübte, dass er in der Lage war, schwer wiegende Entscheidungen zu treffen. Vor allem aber wurde erwartet, dass er ein Mann war. Gut, es kam vor, dass eine Adelige nach dem Tod ihres Gatten das Regiment auf dem burggräflichen Anwesen weiterführte. Ein Mädchen als Burgherrin hatte es jedoch, solange die Menschen im Altmühltal zurückdenken konnten, noch nie gegeben.
Aber war dieses wilde Geschöpf, das da hoch zu Ross über die hölzerne Zugbrücke galoppierte, überhaupt ein Mädchen?
»Sie reitet wie der Teufel«, sagten die Bauern, wenn Papavera mit ihrem Hengst Tassilo durch das Tal jagte. Es hieß, die beiden seien miteinander verwachsen wie ein Zentaur: ein Menschenkörper auf einem Pferdeleib. Ein wildes Gespann, ein Paar, das sich auch äußerlich so ähnlich war, wie das zwischen einem Ross und seinem Reiter nur möglich ist. Beide hager und langbeinig mit fuchsrotem Haar, ständig erfüllt von unruhigem Temperament, immer in Bewegung. Die Augen schwarz glänzend wie Käferpanzer. Ihre Mähnen wie vom Wind genährte Flammen.
»Es ist nicht gut«, sagte der Priester von Riedenburg. Aber er fügte verständnisvoll lächelnd hinzu: »Wenn einer so einsam aufwächst wie dieses Mädchen, dann braucht er wohl einen Freund, und wenn der auch vier Beine hat.«
Auf Menschenjagd
Wenn die Händler mit ihren Viehherden und Planwagen peitschenknallend durch das stille Tal zogen, unterstanden sie dem Schutz der Burgen, durch deren Gebiet der Weg führte. Dafür mussten sie Zoll zahlen. Als Gegenleistung hielt der Burgherr die Straße in befahrbarem Zustand, vor allem aber bot er Geleitschutz gegen räuberische Banden, von denen es im ganzen Land viel zu viele gab. Wurde ein Händler auf dem Hoheitsgebiet einer Burg überfallen, so war der Burgherr verpflichtet, den Schaden zu ersetzen.
Dieser Schutz galt natürlich auch für das bäuerliche Umland der Burg. Immer wieder kam es vor, dass bewaffnete Banden einfielen, das Vieh wegtrieben oder gar die Höfe in Brand steckten. Dann musste der Burgherr mit seinen Männern ausrücken, um die Räuber zur Strecke zu bringen. Die schlagkräftige Truppe, die dafür benötigt wurde, bestand zum größten Teil aus den Knechten und Handwerkern der Burg, die in den Ställen, in der Schmiede oder in der Zimmerei ihren Beruf ausübten. Bisweilen beteiligten sich auch die Söhne der zur Burg gehörigen Bauern an der Menschenjagd.
Das geschah jedes Mal unter lautem Geschrei, Lachen und Lärmen, so wie halt eine Hetzjagd ihren Anfang nimmt. Für die Männer war es eine willkommene Unterbrechung in dem tristen Alltag der abgelegenen Burg. Hier konnte einer beweisen, ob er ein ganzer Kerl war. Bewaffnet mit Äxten, Hellebarden, Lanzen und Mistforken, der Schmied sogar mit seinem schwersten Hammer, ritten sie in die Schlacht, die Kettenhunde sprangen ihnen bellend voraus. So auch an jenem Morgen. Ein Bauernbursche hatte in der Nacht die Hiobsbotschaft überbracht, eine Bande von Berittenen habe die Mühle beim Markus-Wehr überfallen und in der benachbarten Schäferei unter den Wollschafen gehaust wie die Wölfe.
Der Himmel war mit Wolken verhangen. Von der Sonne keine Spur. Gespenstisch und fast unmerklich zog von allen Seiten das Morgengrauen herauf. Nicht eine Vogelstimme verkündete den neuen Tag. Von den Tannen tropfte der Tau. Der Huftritt der Pferde klang in der Stille wie Trommelschlag. Papavera ritt vor den zehn Männern her, dicht gefolgt von Albin, dem Schmied. Wer die Machtverhältnisse auf der Burg nicht kannte, hätte Albin leicht für den Burgherrn halten können. Er war schon seiner massigen, kraftvollen Gestalt wegen das geborene Leittier. Seine silbergraue Löwenmähne und die tief in Falten eingebetteten Augen verliehen ihm eine kluge, überlegene Ausstrahlung. Er sprach nur wenig. Sein Wort hatte Gewicht.
»Ich werde auf Eure Tochter Acht geben wie auf meinen Augapfel«, hatte er dem Burggrafen bei dessen Aufbruch ins Heilige Land geschworen. »Sie ist der Kopf und das Herz der Burg. Ich bin ihr Arm.« Und dabei hatte er seinen Hammer geschwungen wie Thor, der germanische Gott des Donners.
Als die Reiter jetzt die Altmühl erreichten, brach die Sonne durch die Wolken. Der Ufersaum war so schmal, dass sie hintereinander reiten mussten. Eine stattliche Kette von Kriegern.
Bevor sie noch an die Straße zur Mühle kamen, hörten sie Hufschlag. Sie stiegen von ihren Pferden, überließen sie der Obhut des jüngsten Knechtes und pirschten sich zu Fuß näher heran. Da sahen sie den Reiter am Ende der Pappelallee. Er kam direkt auf sie zugetrabt. Ein Mann auf einem kurzbeinigen Pferd mit einem blanken Brustpanzer. An seinem Hut steckte eine Reiherfeder.
Papavera und ihre Männer hatten sich im hohen Haselgebüsch neben der Straße versteckt. Jetzt war der Fremde mit ihnen auf gleicher Höhe. Seine Gesichtszüge waren für einen Mann auffallend fein geschnitten. Es hätte das Gesicht einer jungen Frau sein können, bartlos und auffallend hellhäutig.
»Auf ihn!«, rief Albin. Er sprang aus seinem Versteck hervor und stieß den Fremden mit einem Faustschlag vom Pferd. Der wollte nach seinem Dolch im Gürtel greifen, da waren die anderen schon über ihm. An Armen und Beinen gefesselt, banden sie ihn an einen Weidenbaum.
Papavera fragte: »Wo sind die anderen?«
Als die Antwort ausblieb, hob Albin seinen Hammer und fragte: »Söhnchen, hörst du schlecht?«
»In der Mühle. Sie sind bei der Mühle.«
»Wie viele seid ihr?«
»Vier.«
»Wer bist du?«
»Zacharias von Hasenagger.«
»Und wer sind die anderen?«
»Meine Brüder Norman und Rochus.«
»Und der vierte?«
»Mein Oheim Otto.«
»Wenn dir dein Leben lieb ist, hältst du das Maul. Hast du verstanden?«
Zacharias von Hasenagger nickte. Er war jetzt noch blasser als bei seiner Gefangennahme.
Sie folgten dem Bach, der die Mühle mit Wasser versorgte. Zacharias’ Pferd nahmen sie mit. Nach einer Weile vernahmen sie Holzhacken und Männerlachen. Die Burschen schienen sich unglaublich sicher zu fühlen. Sie unterhielten sich mit lauten Stimmen:
»Es geht doch nichts über einen fetten Hammelbraten am Spieß«, sagte eine tiefe Bassstimme.
»Jetzt fehlt uns nur noch das Gerstenbier«, erwiderte schmatzend eine sehr viel jüngere Stimme.
Und eine dritte meinte: »Das holen wir uns auch noch, am besten gleich aus dem Keller der Burg.«
»Und wie soll das gehen, du Großmaul?«
»Falkenstein ist herrenlos. Den Burggrafen haben die Heiden im Heiligen Land erschlagen.«
»Du meinst, da ist keiner?«
»Doch, seine Tochter.«
»Ein Weib?«
»Nein, ein Mädchen: die Jungfrau von Falkenstein.«
»Das gibt es nicht.«
»Doch, das gibt es.«
»Eine Jungfrau, ganz alleine?«
»Mit ihrem Gesinde.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt? Haudegen wie wir werden doch wohl mit ein paar Knechten und Mägden fertig werden. Hast du nicht gesehen, wie der Müller und die Schafhirten sich vor Angst in die Hosen gemacht haben, als wir sie überfallen haben?«
»Eine Burg ist kein Schafstall.«
»Aber die Stallknechte da oben sind die gleichen Jammerlappen wie die Schäfer. Dieses ganze elende Bauernpack ist nur gut zum Kühemelken. Fechten ist denen so fremd wie den Fischen das Fliegen. Die greifen nur zum Messer, um ein Schwein abzustechen. Und auch das nur, weil Schweine sich nicht wehren können.«
»Wo der Zacharias bloß bleibt?«
»Sag mal, ist das nicht sein Gaul, der dort angetrabt kommt?«
»Ja, das ist er. Verdammt noch mal, und wo ist Zacharias?«
»Vom Pferd gefallen.«
»Der doch nicht. Der reitet wie der Teufel. Ich glaube, ich sehe mal nach ihm.«
»Gut, wenn du meinst.«
Der Bursche kam direkt auf ihr Versteck zugelaufen. Ein Faustschlag von Albin, und die Zahl der Raubritter hatte sich um einen weiteren Galgenvogel verringert.
»Mit den anderen zwei werden wir fertig«, meinte Albin, nachdem er den Gefangenen gefesselt und geknebelt hatte.
»Nein«, widersprach Papavera. »Sie tragen Schwerter, und sie wissen, wie man damit umgeht. Ich will kein Blutvergießen.«
»Was habt Ihr vor?«
»Ich werde sie erschrecken. Sie werden mich für ein Gespenst halten. Überwältigt sie, wenn sie vor Erstaunen nicht Acht geben und wehrlos sind.«
»Nein.«
»Doch.«
Albin wollte sie zurückhalten, aber sie hatte sich schon erhoben. Mit aufgelöstem Zopf, lautlos und fast tänzerisch schritt sie auf die Männer am Feuer zu. Ihr rotes Haar wehte im Morgenwind. Die beiden Räuber starrten mit offenem Mund auf die gespenstische Erscheinung, die da auf sie zuschwebte. Gelähmt wie Mäuse beim Anblick der Schlange ließen sie sich ohne Widerstand überwältigen. Bevor die Sonne senkrecht am Himmel stand, lagen sie alle vier im untersten Kerker der Burg.
»Diebe gehören gehenkt«, sagte Albin. »Und das sollten wir tun, bevor sie noch weiteren Schaden anrichten, am besten noch heute.«
»Nein«, widersprach Papavera. »Einer von ihnen wird morgen früh freigelassen. Gebt ihm sein Pferd und acht Tage Zeit, das Lösegeld für die anderen beizubringen. Nachdem er eine Nacht in unserem stockdunklen, feuchten Keller verbracht hat, weiß er, dass man dort unten nicht lange überlebt. Fünf Pfund Heller pro Kopf lautet unsere Forderung. Wenn seine Sippe die Summe nicht aufzubringen vermag, sollen sie sich das Geld vom Juden leihen.«
»Und wenn er das Lösegeld nicht bringt?«
»Er wird es bringen, verlass dich darauf. Die anderen werden ihn heute Nacht so inständig darum bitten, dass er es nicht übers Herz bringen wird, sie ihrem Elend zu überlassen, zumal sie alle miteinander verwandt sind.«
Wie vorausgesagt, so geschah es. Nur fünf Tage später hielt Papavera das Lösegeld in den Händen. Schmutzig und mit steifen Gliedern wurden die Gefangenen aus dem Verlies nach oben geholt. Bevor Albin ihnen die Ketten abnahm, mussten sie schwören, niemals mehr den Boden von Falkenstein zu betreten. Und Papavera war sich ganz sicher, dass sie den Eid nicht brechen würden, denn sie hatten mit der Hand auf der Bibel im Namen Gottes und aller Heiligen geschworen. Meineid aber war ein schlimmeres Verbrechen als Mord und Totschlag, die man mit einer Geldbuße oder einer Pilgerfahrt ins Heilige Land abtragen konnte. Meineid war Gotteslästerung, weil der Schwur im Namen Gottes erfolgt war. Wer einen heiligen Eid brach, verriet den Herrn wie Judas Ischariot, der dazu verdammt war, für alle Ewigkeit in der finstersten aller Höllen zu schmachten.
»Und wenn diese gottlosen Strolche dennoch ihren Schwur brechen?«, wollte der Pferdeknecht wissen, den sie Fischauge nannten.
»Dann werden wir sie aufhängen«, sagte Albin. »Denn auf Meineid steht die Todesstrafe. Vorher aber werden wir ihnen die Schwurfinger abhacken.«
Von dem Lösegeld wurden die beraubten Schäfer entschädigt und die Arztkosten für den armen Bauern beglichen, dem die Bande vier Rippen und den rechten Arm gebrochen hatte.
Papaveras unblutiges und zudem noch recht erfolgreiches Vorgehen gegen Gesetzesbrecher verbreitete sich wie ein Lauffeuer bis weit über das Altmühltal hinaus. Das Gesindel machte einen großen Bogen um die Burg, und die anderen Burgherren sagten sich: »Recht hat sie, diese Kleine vom Falkenstein. Welchen Vorteil bringt es uns, einen Halunken aufzuhängen? Einsperren bis zum Zahltag! Und das nicht zu knapp.«
Aber es gab natürlich auch andere Stimmen, neidvoll und oft bösartig: »Was glaubt sie wohl, wer sie ist? Benimmt sich wie ein Mann. Seit wann hat es so etwas gegeben, dass ein Weib über Männer zu Gericht sitzt? Ein Mädchen ganz allein auf einer Burg. Was die wohl da oben treibt? Und wie die schön aussieht? Rothaarig wie eine Füchsin. Haben nicht Hexen rotes Haar?« Am meisten hetzten natürlich die räuberischen Sippen, die bereits Bekanntschaft mit Papaveras strengem Regiment gemacht hatten: »Sie hat den bösen Blick. Schwerter werden in ihrer Anwesenheit stumpf, Spiegel zerbrechen. Das Korn verdorrt auf den Feldern. Sie spricht mit ihrem Pferd wie mit einem Geliebten.« Einer wollte sogar gehört haben, wie der Hengst ihr geantwortet hatte, mit entsetzlich krächzender Rabenstimme. »Dieser Satansgaul hat die gleiche Farbe wie sie und ihr Vater, den das Höllenfeuer wieder ausgespien hat. Schaut sie euch doch an! Sie kommen alle aus dem Feuer – Ausgeburten der Hölle, Hexenbrut. Zurück ins Feuer mit ihnen!«
Wenn man Papavera hinterbrachte, was im Geheimen über sie geredet wurde, sagte sie unbekümmert: »Dummes Zeug. Das ist alles dummes Zeug. Die sind bloß neidisch.«
Lästiger als die Neider waren die, die sagten: »Ein Mann muss her. Die Kleine von der Burg Falkenstein gehört unter die Haube.« Nicht nur die noch ledigen Söhne der umliegenden Burgen, auch der benachbarte Gaugraf Rudolf von Randersacker zeigte Interesse an ihr, oder richtiger: an Burg Falkenstein. Geschenke wurden überbracht. Einladungen zu Turnieren und Treibjagden, die Papavera ablehnte, weil ihr die armen Tiere Leid taten und weil sie dort wie eine Porzellanpuppe behandelt wurde.
In dieser Gesellschaft waren Frauen keine vollwertigen Menschen. Behütet wie hilflose Kinder, wurden sie in den Sattel gehoben. Sie ritten nicht, wie es sich gehörte, sondern saßen im Damensitz zu Pferde, beide Beine auf einer Seite, verborgen unter langem Rock. Es gab eine feste Kleiderordnung, die vorschrieb, wie eine Unverheiratete Haar und Gewand zu tragen hatte. Von Mädchen wurde erwartet, dass sie sich geziert und anmutig bewegten. Sie sollten lächeln und artig plappern, aber schweigen und aufmerksam zuhören, wenn die Männer das Wort ergriffen.
Papavera verabscheute dieses falsche Getue. Sie wollte kein Lurch am Grunde eines Teiches sein, der nur hin und wieder den Kopf zur Oberfläche erhebt. Frei wie die Schwalben wollte sie sein: »Ich will nicht so werden, wie man es von mir verlangt; ich will so bleiben, wie ich bin.«
Manche Dinge müssen ständig in Bewegung sein, so wie das Herz, das nur lebt, solange es schlägt. Von ähnlicher Unruhe erfüllt war auch Papavera. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes ständig auf dem Ritt. Am wohlsten fühlte sie sich auf Tassilo, wobei man das auf nicht allzu wörtlich nehmen sollte. Sie erfand immer wieder neue akrobatische Reitkunststücke: Auf- und Absprünge in gestrecktem Galopp. Stehend freihändig und sogar im Handstand auf dem Pferderücken flog sie vorüber, sodass alle, die sie sahen, vor Schreck ihren Schutzengel um Beistand anriefen.
Vermutlich hatte sie diese Unruhe vom Vater geerbt, der auch nicht stillzusitzen vermochte, der auf allen Ritterturnieren im Frankenland mitfocht und der am Ende Weib und Kind verlassen hatte, um mit dem Kaiser ins Heilige Land zu ziehen.
Wenn Tassilo nicht mehr mitspielen wollte, weil der Klee zu verlockend duftete, dann legte Papavera sich ins hohe Gras und spielte auf ihrer Flöte, die sie ständig unter dem Wams mit sich führte. Sie kannte hundert Melodien und beherrschte sie mit der spielerischen Leichtigkeit, mit der Vögel singen. Dabei konnte sich keiner erinnern, dass ihr jemals jemand das Flötenspiel beigebracht hätte. Es war ihr so geläufig wie das Atmen und das Reiten.
Wenn sie in den Spiegel schaute, blickte sie in große, hellwache Augen, erfüllt von unruhiger Lebenslust, aber auch von der früh erworbenen Erfahrung, dass das Leben schmerzhaft sein kann. Eine Spur von Trotz war ihr ins Gesicht geschrieben: Ich will kein artiges Mädchen sein, hatte sie sich schon als Kleinkind geschworen. Ist die Katze artig, wenn sie sich die Maus krallt? Wie kann einer beten »Der Herr ist mein Hirte« und sich dann einen Lammbraten einverleiben?
Selbst Gott konnte nicht immer gut sein. Wie anders war es sonst zu erklären, dass er Blitze in seine eigenen Gotteshäuser schleuderte?
Tod im Teufelsmoos
Still und abweisend stiegen die Felswände aus dem nebeldunstigen Tal empor. Darüber himmelhoch und erhaben die Burg.
Vor dem Tor mit dem vergoldeten Wappen nahmen die Bauern die Mützen vom Kopf. Zögernd betraten sie die Zugbrücke, die an rostigen Ketten über dem Abgrund hing. Bevor die Festung sie aufnahm, mussten sie das Fallgitter passieren, dessen eiserne Zacken über ihnen aufblitzten wie die entblößten Reißzähne in einem Raubtierrachen, jederzeit bereit zum Zuschlagen. Am Ende der dunklen Durchfahrt gelangte man endlich aufatmend in den hellen Burghof mit dem steinernen Ziehbrunnen unter der mächtig ausladenden Linde, die den Brand der Burg überlebt hatte. Links und rechts zu beiden Seiten, etwas zurückgesetzt, lagen die Wirtschaftsgebäude: Kuh- und Pferdeställe, Schmiede, Scheune, Lager und Remise, darüber die Kammern für die Knechte und Mägde, die Speicher und das Waffenarsenal. In der Mitte hinter einer hohen Steintreppe das Herrenhaus mit seinen Wehrtürmen und der Burgkapelle.
In den bleiverglasten Kirchenfenstern spiegelten sich die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Von dem Wirtschaftsgebäude wehte der Wind lebhafte Geräusche herüber: Lachen, Hühnergackern und den hellen Klang eines Schmiedehammers. Am Ende erlosch auch der. Abendstille lag über dem Land.
Aber was war das? Rief da nicht jemand mit lauter Stimme? Es klang wie ein Hilferuf, so als sei ein Unglück geschehen. Ein Mensch in der ledernen Tracht der Pferdeknechte kam atemlos über die herabgelassene Zugbrücke in den Burghof gestürzt, laut schreiend und wild mit den Armen gestikulierend: »Die Rösser, die Rösser …«
»Was ist mit den Rössern?«, fragte die Magd, die vor der geöffneten Küchentür saß und ein Huhn rupfte.
»Im Sumpf. Sie sind im Sumpf.«
»Wo sind sie?«, fragte die Magd, die glaubte, nicht recht verstanden zu haben.
»Zur Hölle gefahren sind sie, alle, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen.«
Inzwischen war auch Papavera im Hof erschienen: »Mein Gott, warum schreist du so? Was ist passiert?«
»Die Pferde, Herrin, sie sind aus der Koppel ausgebrochen.«
»Das geschieht nicht zum ersten Mal. Was ist daran so schlimm? Fang sie wieder ein!«
»Sie sind …« Der Knecht rang nach Luft. Der Aufstieg vom Tal und die Aufregung hatten ihm den Atem geraubt. »Sie sind ins Moor gelaufen und stecken im Sumpf.«
»Ruf die Männer zusammen!«, befahl Papavera, »alle, und nehmt Laternen mit und Stricke und Äxte und Planken! Beeilt euch!«
Eine halbe Stunde später waren sie im Teufelsmoos, wie die Bauern den Sumpf bei den Gerbergruben nannten. Schon von weitem war das ängstliche Schnauben der Tiere zu hören. Es verhieß nichts Gutes. Das Bild, das sich ihnen bot, war erschreckend. Die fünf Pferde steckten mit allen vier Beinen im Morast. Sie waren bereits so tief eingesunken, dass sie mit ihren Bäuchen auf dem Schlamm lagen. »Vorsicht, nicht näher herangehen, sonst sinkt ihr auch noch ein!« Papavera ließ Weidenäste abschlagen. Gebündelt und dicht aneinander gelegt, ergaben sie einen schwankenden Steg, auf dem die Männer sich den Tieren nähern konnten.
Tassilo begrüßte seine Herrin mit leisem Wiehern.
»Schon gut, schon gut.« Papavera kraulte dem verängstigten 'Pier die Mähne. »Keine Angst. Wir werden euch herausholen.«
»Aber wie?«, fragte Albin, der sich mit Pferden auskannte wie der Pfarrer mit den Geboten der Bibel. Keine Rosskrankheit, die er nicht zu heilen verstand. Er wusste, wie man Fohlen auf die Welt holte, wenn es Schwierigkeiten bei der Geburt gab. Papavera würde nie vergessen, wie der Alte eine Stute kuriert hatte, von der alle sagten: »Der ist nicht mehr zu helfen. Es gibt nichts Schlimmeres für Pferde als unreife Lupinen.« Halb tot hatte die Stute im Stall gelegen, der Bauch aufgedunsen wie ein Kugelfisch. Albin hatte sich aus der Sattlerei die größte Schusterahle bringen lassen, eine Nadel fast einen Fuß lang. Die hatte er der Stute in den aufgeblähten Leib gestoßen, genau an der richtigen Stelle, ohne ein anderes Organ zu verletzen. Es hatte gezischt und gestunken, als sei der Leibhaftige ausgetrieben worden. Aber die Stute hatte überlebt.
Jetzt steckte sie mit den anderen Rössern bis zur Brust im Morast. Alle Augen waren auf Albin gerichtet.
Los, sag uns, was wir tun sollen! Wie kriegen wir sie frei?
Der Alte kratzte sich den Kopf, wie er es immer tat, wenn er angestrengt nachdachte. Unbeweglich, wie aus Holz geschnitzt, stand er da, die Lederhose mit einem Strick zugebunden, den Kittel offen, sodass die behaarte Brust herausschaute. Er strich sich über den Bart und sagte: »Die Tiere sind verloren.«
»Verloren? Wie meinst du das?«
»Das Moor wird sie nicht mehr hergeben.«
»Nicht mehr hergeben? Was soll das heißen?«, rief Papavera. »Bist du von Sinnen? Willst du sie hier elendig verrecken lassen?«
Der Alte schwieg, und alle wussten, dass es ein Todesurteil war.
»Nein!«, schrie Papavera. »Nein, das darf nicht sein!« Sie riss einem Knecht die Lederschürze vom Leib, kniete neben Tassilo nieder, schob das Leder unter seiner Brust hindurch. Dann verknotete sie die Schürze mit starken Hanfseilen.
»Die Hälfte der Männer hierher!«, befahl sie. »Ihr zur anderen Seite! Und jetzt zieht, so fest ihr könnt! Hau ruck! Hau ruck!« Alle gaben ihr Bestes. Aber die Brust des Pferdes hob sich keinen Fingerbreit. Dafür versanken die Männer bis über die Knöchel in dem schwarzen, klebrigen Morast.
»Holt mehr Reisig herbei! Noch einmal! Schnell!«
Sie versuchten es immer wieder und immer vergeblich. Am Ende waren sie nass wie aus dem Wasser gezogen, nass und schwarz vor Schlamm.
Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Die Männer hockten erschöpft auf einem umgestürzten Erlenstamm.
»Was soll nun werden?«, fragte ein junger Knecht.
»Wir sollten sie töten«, meinte Albin.
»Töten? Bist du verrückt?«
»Wollt Ihr mit ansehen, wie sie immer tiefer in diesem verfluchten Sumpf versinken? Gibt es etwas Schlimmeres, als unendlich langsam im Schlamm zu ersaufen? Seien wir gnädig.«
Er schlug nach einer Mücke, die ihn in die Wange gestochen hatte. »Mit der Dunkelheit kommen die Stechmücken. Sie werden zu tausenden über die wehrlosen Tiere herfallen und sie quälen bis zum letzten Atemzug.« Er erhob sich, griff nach der Axt und meinte: »Ein Schlag mit der stumpfen Seite vor die Stirn, und sie haben ausgelitten.«
»Nein!« Papavera eilte zu Tassilo und schlang dem Hengst die Arme schützend um den Hals. »Nein, nicht töten! Lasst ihn mir. Geht nach Hause! Ich bleibe bei ihm.«
»Das können wir nicht zulassen«, sagte Albin.
»Was wollt ihr nicht zulassen?«
»Wir werden Euch nicht allein im Moor zurücklassen.«
»Ich befehle es euch.«
»Ich habe Eurem Vater versprochen, auf Euch aufzupassen. Ich bin für Euer Leben verantwortlich. Kommt! Den Rössern ist nicht mehr zu helfen. Wollt Ihr wirklich mit ansehen, wie sie elendiglich ersaufen?«
Papavera hatte die Hände vor ihr Gesicht geschlagen.
»Ich bitte Euch, kommt mit uns«, sagte Albin.
Und als sie sich immer noch nicht von der Stelle bewegte, nahm er sie auf seine Schmiedearme und trug sie davon wie ein Kind. »Nicht weinen«, sagte er, und dabei rannen ihm Tränen über die faltigen Wangen.
»Ich werde für sie beten.«
»Ja, das werden wir tun.«
***
Mitternacht war längst vorüber. In der Burgkapelle flackerte noch immer Kerzenlicht. Die Bauern im Tal schauten zu den hell erleuchteten Fenstern empor und fragten sich kopfschüttelnd, was da oben wohl vor sich ging. Wäre es ihnen möglich gewesen, hinter die bleiverglasten Scheiben zu blicken, so hätten sie ein Mädchen gesehen, das vor dem Altar kniete, um von Gott und allen Heiligen Hilfe zu erflehen: »Ihr habt mir den Vater genommen, die Mutter und die Brüder. Lasst mir Tassilo. Ich liebe ihn mehr als mein Leben. Nehmt mir, was ihr wollt, aber lasst mir Tassilo. Er ist alles, was ich habe. Herr, du hast die Kinder Israels aus der Gefangenschaft des Pharao gerettet, da kann es doch nicht schwer für dich sein, ein Pferd aus einem Schlammloch zu befreien. Was ist das Teufelsmoor gegen das Rote Meer, das du geteilt hast, um deinem Volk zu helfen. Hilf auch mir! Hilf mir, wie du meinen Vater aus der brennenden Burg gerettet hast. Rette Tassilo! Lass ihn nicht sterben!«
Sie betete und rang mit Gott wie nie zuvor. Die Nacht verrann. Die Kerzen brannten nieder. Am Ende siegte der Schlaf über die Angst. Traumbilder stiegen aus dem Dunkel auf. Schwarz wie ein bodenloser Abgrund war der Sumpf, ein schauriger Schlund, der sich auftat, um sie zu verschlingen. Klebriger Morast umwaberte ihren Leib, saugte sie immer tiefer in sich hinein. Schon quoll ihr der Schlamm bis zum Kinn. Sie wollte schreien, da nahm ihr der Sumpf die Atemluft. Sie erwachte schweißgebadet auf den harten Stufen vor dem Altar. Mondlicht fiel durch das Fenster. Das Buntglas warf farbige Schatten auf den Steinboden: blutrot, giftgrün neben schlammschwarz.
Eine Wolke schob sich vor den Mond. Papavera fror, fühlte sich elend. Wenn Tassilo stirbt, will auch ich nicht mehr leben. Schlafen, schlafen ist so gut wie tot sein.
Die Kapellentür tat sich auf, lautlos wie von Geisterhand. Licht fiel herein. In dem weit geöffneten Tor stand ein Einhorn, umstrahlt von überirdischem Glanz. Das Horn schimmerte wie warmes Gold. Es beugte den Hals, scharrte mit dem Huf. Ein leises Wiehern löste sich aus seiner Brust. Wie vertraut das klang! Tassilo!!! Sie wollte zu ihm eilen. Da zerrann sein Bild wie Nebelschwaden. Ich muss zu ihm, dachte sie. Er ruft mich.
Im Traum eilte sie den schmalen Pfad hinab, der von der Burg ins Tal führte. Zweige zerkratzten ihr das Gesicht. Spinnenweben verfingen sich in ihrem Haar. Eulengeschrei begleitete sie. Heulte da nicht ein Werwolf? Endlich erreichte sie das Moor. Welch entsetzlicher Anblick! Die Tiere waren so tief eingesunken, dass nur noch ihre Köpfe aus dem Schlamm herausragten. Die Raben hatten ihnen die Augen ausgehackt und aus den leeren Augenhöhlen quollen grün schillernde Schmeißfliegen. Wo war Tassilo? Dort drüben. Sie erkannte seine rote Mähne. Sie leuchtete über dem pechschwarzen Wasser. Papavera wollte zu ihm eilen. Da hob er seinen Kopf aus dem Wasser. Aber was war das? Oh mein Gott, es war nicht Tassilo, es war ihr Vater. Vater!
Papavera fuhr mit einem Aufschrei aus dem Schlaf, stürzte aus der Kapelle, rannte hinaus ins Freie. Regen schlug ihr entgegen. Im Osten kündigte sich der neue Tag an. Im Tal krähten die ersten Hähne. So schnell ihre Füße sie trugen, rannte sie den gewundenen Weg hinab. Es war wie im Traum. Nein, bitte nicht wie im Traum! Sie fiel, zerschrammte sich Knie und Ellenbogen. Sie spürte es nicht. Weiter. Ich muss weiter.
Bevor sie das Teufelsmoor erreichte, hörte sie laute Männerstimmen. Was hatte das zu bedeuten? Menschen im Moor, jetzt um diese Zeit? Sie eilte weiter und erschrak vor dem Spuk, der sich vor ihr auftat: schwarze Gestalten, von Nebelwolken umwabert, eine schaurige Meute. Sie bildeten einen Kreis um einen Gegenstand in ihrer Mitte, dem ihre ganze Aufmerksamkeit galt. Papavera glaubte, jeden Augenblick aus einem Traum zu erwachen. Aber das hier war kein Hirngespinst. Die Gestalten lösten sich aus dem Dunst, stürzten auf sie zu, umringten sie, und sie erkannte Fischauge, den Stotterer und die anderen Stallknechte, durchnässt und schlammverschmiert. Da war auch Albin. Er nahm sie bei der Hand und zog sie mit sich. Die anderen wichen zur Seite.
Tassilo! Da lag er wie tot, die Beine weit von sich gestreckt. Sie warf sich über ihn, umarmte seinen nassen Hals, spürte die Wärme seines Körpers, sah, wie der Atem die Flanken hob und senkte. Tassilo – er lebte! Er lebte und war frei.
»Er ist am Ende seiner Kräfte und braucht noch etwas Zeit«, sagte Albin. »Aber Ihr werdet sehen, er wird bald wieder auf den Beinen stehen.«
»Wie habt Ihr das fertig gebracht?«, wollte Papavera wissen.
»Gott hat unsere Gebete erhört.«
»Und die anderen Rösser?«
»Ihnen war nicht mehr zu helfen. Das Moor hat sie verschluckt.«
***
Am nächsten Tag brannten bis in die Nacht im Burghof die Freudenfeuer. Ihr Schein färbte die Türme leuchtend rot. Und alle, die es von ferne sahen, bekreuzigten sich: Brennt Falkenstein schon wieder? Aber dann wehte der Wind den Gesang der Knechte durch das Tal. Bei Wein und Kesselfleisch feierten sie die wundervolle Auferstehung eines totgeglaubten Freundes. Und kein Mensch im ganzen Land war so glücklich wie Papavera, die den ganzen Tag und sogar noch die nächste Nacht im Pferdestall bei Tassilo verbrachte. Albin fand sie am Morgen auf dem Stroh. Sie hatte ihre Arme um Tassilos Hals geschlungen. Ein Lächeln lag auf ihren Lippen.
Als Assunta davon erfuhr, rief sie kopfschüttelnd: »Wie kann man nur bei einem Pferd schlafen. Seine Hufe hätten dich zerstampfen können. Qui amat periculum, peribit illo. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.«
Assunta liebte die lateinische Sprache, denn sie war eine Braut Christi. Der Vater hatte sie vor seiner Abreise aus dem Kloster geholt. »Nur vorübergehend, bis ich aus dem Heiligen Land zurück bin«, hatte er der Äbtissin versichert.
Assunta war die Schwester von Papaveras Mutter. Als Mädchen hatte man sie ins Kloster geschickt, weil sie zu hässlich war, um einem Mann zu gefallen. Mit ihren wimperlosen, schielenden Augen und dem Hinkefuß, vor allem aber wohl wegen ihrer schwarzen, fauligen Zähne wollte sie keiner ins Brautbett holen. Dennoch gab es keine zufriedenere Seele als die ihre. Sie war wie der Sonnenschein, unschuldig ohne alles Zutun und glücklich, ohne es zu wissen.
Als Papavera ihr den Traum von dem Einhorn schilderte und wie anstelle von Tassilo der Vater im Sumpf gesteckt hatte, da sagte Assunta: »Das ist ein Zeichen des Himmels. Dein Vater lebt und wird wie dein Pferd auf wunderbare Weise errettet werden.«
Papavera dachte: Die Rettung aus dem Moor war ein Wunder, aber eines, an dem Albin und die Knechte der Burg tatkräftig beteiligt waren. Wie hatte Vater immer gesagt: »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.« Wer aber konnte ihm jetzt beistehen, damit sich Gottes Wunder auch an ihm erfüllte? Wenn er noch lebte, wo war er? Und warum kehrte er nicht zurück? Hatten sie ihn eingekerkert? Oder war er verwundet, zu krank, um den langen Heimritt zu bewältigen? Warum war er überhaupt fortgegangen? Warum hatte er Weib und Kind allein zurückgelassen?
»Was für ein Mensch war er?«, fragte sie Assunta. »Du bist seine Schwägerin und kennst ihn schon länger als ich. Ich war noch ein Kind, als er fortritt.«
»Er war ein stolzer Mann«, sagte Assunta und strich sich über ihre schwarze Haube, die sie nur im Bett absetzte. »Ich erinnere mich an ein Turnier vor dem großen Stadttor zu Regensburg. Es war in dem Jahr, bevor ich ins Kloster gegangen bin. Ich war noch ein Mädchen mit langen Zöpfen. Die Elite des fränkischen und bayerischen Adels war herbeigeeilt, um sich im Buhurt zu messen, dem ritterlichen Zweikampf zu Pferd und mit langer Lanze. Die Damen hatten auf der Tribüne Platz genommen, die der Herzog ihnen errichtet hatte. Ich erinnere mich noch so gut, als sei es gestern geschehen.
Das Turnier
Dem Turnier war eine Frühmesse unter freiem Himmel vorausgegangen. Der geistigen Stärkung folgte ein Frühstück mit Honigmandeln, weißem Brot, Eiermus und gebratenen Wachteln. Dazu spielten die Schalmeien, Zimbeln und Flöten. Die Luft war erfüllt von Frauenlachen, von Pferdewiehern und Waffenklirren. Die Ritterrüstungen blitzten in der Morgensonne. Die bunten Bänder der Mädchen flatterten im Wind. Es war eine wahre Lust, dies anzusehen. Und dann das Hornsignal! Georg, dein Vater! Mit aufgerichteter Lanze trabt er in die Arena. Er reitet einen Rappen mit silberner Satteldecke. Sein Wappenschild zeigt den vertrauten schwarzen Falken auf rotem Grund. Er grüßt hinauf zur Empore, wo die Gäste des Herzogs unter buntem Tuch Platz genommen haben.
Dann trabt sein Gegner auf einem plumpen Ross heran, ein gepanzerter Riese, den keiner der Anwesenden kennt. Schwarzer Ritter, so nennt er sich, ein unheimlicher Geselle. Ein giftgrüner Totenkopf auf schwarzem Grund ist sein Wappenschild. Die beiden Kontrahenten reiten zu der hölzernen Barriere, die die Kämpfer voneinander trennt. Sie reicht den Rössern bis zur Brust. Am Endpunkt der Barriere warten sie mit gesenkten Lanzen und heruntergelassenem Helmvisier auf das Angriffssignal. Die Trommeln schlagen. Endlich, das Hornsignal. Ein Schrei aus hundert Kehlen. Wie zwei abgeschossene Pfeile fliegen die Reiter aufeinander zu. Ein Brechen und Knacken wie von tausend Knochen. Dein Vater hält nur noch den Schaft seiner Lanze in der eisenbewehrten Faust. Sein Gegner liegt mit zerborstenem Schild am Boden. Die Knechte eilen herbei, befreien den Bewusstlosen aus der Rüstung. Er wird auf einer Trage davongebracht. Dein Vater badet im Beifall. Die Damen werfen ihm Blumengebinde und farbige Bänder zu. Lachend, mit leuchtenden Augen winkt er mir zu. Ich sehe ihn noch immer vor mir. Ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Der Held des Tages. Aber schon am Abend war aller Glanz erloschen, so sah es jedenfalls dein Vater.«
»Wieso? Was war geschehen?«, wollte Papavera wissen.
»Es hatte sich herausgestellt, dass der schwarze Ritter gar kein Ritter war. Ein Rossknecht aus dem Nürnberger Land, der sich unerlaubterweise in den Buhurt der Herren eingeschlichen hatte. Dein Vater war außer sich vor Zorn: ›Er hat mir den Ruhm gestohlen. Welch erbärmlicher Sieg ist das, einen Bauernlümmel aus dem Sattel zu heben. Ein Leibeigener, der sich anmaßt, von Adel zu sein, ist eine Beleidigung der gottgewollten Ordnung. Der Bursche gehört in den Turm!‹ Aber er war genug gestraft. Dein Vater hatte ihm das Brustbein gebrochen.«
Das Schuler Loch
Nichts liebt man so sehr wie die Dinge, die man fast oder für immer verloren hat. So war es auch mit Tassilo, den das Moor beinahe verschlungen hatte. Papavera wich nicht mehr von seiner Seite.
»Ich wusste es immer«, sagte sie zu ihm. »Du bist kein gewöhnliches Pferd. Du bist ein Einhorn. Es heißt, dass ihr Einhörner euch nur ganz besonderen Jungfrauen zu erkennen gebt. Für alle anderen seid ihr unsichtbar. Ich habe dein wahres Wesen erkannt.«
Sie konnte sich nicht satt sehen an ihm. Wie schön er war! Feingliedrig und fuchsfarben mit feurigen Reflexen im Fell. Die Augen groß und voller Hingabe. Mit welchem Ungestüm er dahinflog, wenn sie über die Felder jagten! Wie ein wilder Schrei war sein Wiehern. Oh, wie sehr sie ihn liebte!
Sie erinnerte sich sehr genau an den Tag, an dem Vater ihn mitgebracht hatte. Es war ihr zehnter Geburtstag gewesen.
»Behandle ihn gut«, hatte er gesagt. »Er hat unsere Haarfarbe und unser Temperament. Er ist einer von uns.«
Ja, das ist er, dachte sie, und sie erinnerte sich daran, wie sich Tassilo im Traum in den Vater verwandelt hatte. Vaters Kopf in dem schlammschwarzen Wasser. Wie flehentlich er sie angeblickt hatte, so als riefe er um Hilfe.
Immer öfter kreisten ihre Gedanken um den Vater. Gemeinsame Erlebnisse, an die sie sich gern erinnerte: früh am Morgen an einem nebelbedeckten Teich, um vom Kahn aus Hechte zu fangen. Schweigend kauerten sie nebeneinander auf der Ruderbank. Er hatte seinen Arm um sie gelegt.
Wie sehr hab ich ihn geliebt. Ob auch er mich so geliebt hat? Er hat es mir nie gesagt. Oder doch?
Sie dachte an das Rehkitz, das sie im Wald gefunden hatten. Ein Luchs hatte es angefallen. Es verblutete in ihren Armen.
»Warum müssen kleine Rehe sterben?«, wollte sie wissen.
Er hatte mit den Schultern gezuckt, und sie hatte sich an ihn gehängt und gesagt: »Ich will nicht, dass du stirbst.«
Er hatte geantwortet: »Ich lebe, und wenn dir jemand sagt, ich sei tot, glaube es nicht. Ich bin der Wind, der Regen und das Feuer, vor allem das Feuer, und das wird immer brennen, solange die Sonne über den Himmel wandert.«
Ich weiß so wenig von ihm, dachte sie. Ich habe ihn verloren, bevor ich ihn besaß.
»In seiner Jugend war er ein stürmischer, neugieriger Geist«, sagte Assunta. »Keine Höhle im Altmühltal, die er nicht erforscht hat. Mit brennenden Fackeln und Hanfseilen ist er dort umhergeklettert.«
Papavera erinnerte sich, dass er auch mit ihr in eine Höhle gestiegen war. Schüler Loch hatte er sie genannt.
»Er hat diese Höhle ganz besonders geliebt«, meinte Assunta. »Bevor er ins Heilige Land aufgebrochen ist, war er mehrmals dort. ›Was treibst du in diesem dunklen Loch?‹,
hat deine Mutter ihn gefragt, und er hat geantwortet: ›Höhlen sind wie Dome, heilige Hallen im Schoß der Erde, der ideale Ort, um mit Gott und sich selbst Zwiesprache zu halten.«
***
Am Tag darauf ritt Papavera zum Schüler Loch, um herauszufinden, was den Vater dort so magisch angezogen hatte.
Die Sonne lachte vom wolkenlosen Himmel, als sie gegen Mittag die Höhle über dem Tal erreichte. Tief unter ihr wand sich wie eine silberne Schlange die Altmühl. Papavera nahm Tassilo das Zaumzeug ab, damit er sich beim Äsen nicht im Gezweig verfing. Sie gab ihm mit der Hand einen Klaps und sagte: »Lauf mir nicht weg. Ich bin bald zurück.«
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie zwischen dem üppig wuchernden Brombeergestrüpp den Höhleneinstieg entdeckte. Sie nahm zwei Lackeln aus der Satteltasche, entzündete eine und leuchtete damit in den dunklen Schacht, der sich senkrecht unter ihr auftat. Eine grob zusammengezimmerte Leiter lehnte an der Wand. Sie sah reichlich morsch aus.
Ob die wohl hält?, dachte sie, bevor sie ihren Fuß auf die erste Sprosse setzte. Ach was, sie hat Vater getragen, dann wird sie auch unter meinem Gewicht nicht zusammenbrechen. Ich bin viel leichter als er.
Sie zählte neunzehn Sprossen. Dann hatte sie festen Boden unter den Füßen. Vor ihr lag ein niedriger Gang. Sie tastete sich weiter und gelangte in einen Saal, der gewölbt war wie ein Kirchenschiff. Stalaktiten hingen wie Eiszapfen von der hohen Decke herab. Der Schein der Lackel huschte über unheimliche Gebilde, Versteinerungen, die aussahen wie schlafende Drachen, Feuersalamander, flügelschlagende Engel, tanzende Gnome, die sich im flackernden Flammenschein geisterhaft bewegten. Noch beängstigender als der steinerne Spuk war die Stille. Nur der Hall ihrer Schritte und das Geräusch ihres Atems waren zu hören. Hin und wieder fiel ein Tropfen von der Decke. Sie durchquerte den Saal, watete durch eiskaltes Wasser, das ihr bis über die Knöchel reichte. Hatte sich da nicht etwas bewegt, leise nur, aber flatternd und bedrohlich? Sie blieb stehen und lauschte in die Stille. Doch da war nichts, nur ihr eigener Herzschlag. Wie konnte ein Mensch hier nur eindringen, um Zwiesprache mit sich selbst zu halten?
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich ihr Herzschlag wieder beruhigt hatte. Am Ende des Saales stieß sie auf eine Nische. Boden und Wände waren elfenbeinweiß und so glatt wie polierter Marmor. Ein Brandfleck an der Decke zeigte an, dass hier ein Feuer gebrannt hatte. Im Fußboden ein Loch, wie gemacht, um eine brennende Fackel aufzunehmen. Papavera steckte die ihre dorthinein. Sie war sich ganz sicher, sie hatte die Stelle gefunden, die der Vater aufgesucht hatte.
Sie kniete nieder und stieß dabei mit der Hand gegen einen runden Gegenstand. Was war das? Sie griff danach, hob ihn ins Licht. Ein Ring, zu klein, um ein Armreif zu sein, und viel zu groß für einen Fingerring. Papavera hatte nie zuvor dergleichen gesehen. Die Flammen spiegelten sich in dem glänzenden Metall.
Ein Ring aus purem Gold – wie kam der in diese Höhle? Hatte er Vater gehört? Und wenn ja, warum lag er dann hier? War er versehentlich verloren gegangen?
Sie ließ den Ring aus geringer Höhe auf den steinernen Boden fallen. Das metallische Klingeln war nicht zu überhören. Nein, dieser goldene Reif war hier absichtlich abgelegt worden. Aber warum? Ein Zauberring? Eine Botschaft vom Vater?