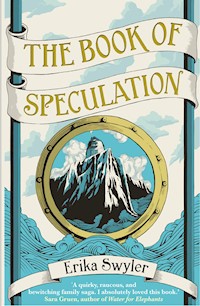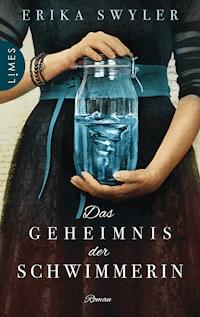
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um einen Fluch zu bannen, musst du seine Quelle finden
Simon Watson lebt allein in einem verwitterten Haus an der Küste Long Islands. Eines Tages findet er ein altes Buch auf seiner Türschwelle, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Die brüchigen Seiten erzählen von einer großen Liebe, vom dramatischen Tod einer Schwimmerin und vom tragischen Schicksal einer ganzen Familie – Simons eigener Familie. Denn wie es scheint, finden die Watson-Frauen seit 250 Jahren im Wasser den Tod – immer am 24. Juli. Auch Simons Mutter ertrank in den Fluten des Atlantiks. Als nun seine Schwester Enola zu Besuch kommt, scheint sie seltsam verändert – und der 24. Juli steht unmittelbar bevor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ERIKA SWYLER
Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence
Die Originalausgabe erschien 2015unter dem Titel The Book of Speculationbei St. Martins Press, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Erica Swyler
Published by arrangement with Erica Swyler
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Limes in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Bernd Stratthaus
Umschlaggestaltung und -motiv: © www.buerosued.de
BS · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15954-2V003
www.limes-verlag.de
Für Mom. Es gibt keine Worte.
1
20. Juni
Vorn auf dem Hochufer hockt das Haus und ist in Gefahr. Der Sturm letzte Nacht hat Land weggerissen und das Wasser aufgewühlt, der Strand liegt voller Flaschen, Seetang und Panzer von Pfeilschwanzkrebsen. Der Ort, an dem ich mein gesamtes Leben zugebracht habe, wird die Herbststürme wohl nicht überstehen. Ich sehe hinaus auf den Long Island Sound, er ist durchsetzt mit den Resten von Häusern und Lebzeiten, die er in seinem gierigen Schlund zu Sand zermahlen hat. Sein Hunger ist unermesslich.
Maßnahmen hätten ergriffen, Befestigungen gebaut, Abstufungen des Geländes vorgenommen werden müssen – nichts ist geschehen. Die Antriebslosigkeit meines Vaters hat mir ein unlösbares Problem hinterlassen, viel zu teuer für einen Bibliothekar in Napawset, doch wir Bibliothekare sind für unseren Einfallsreichtum bekannt.
Ich gehe zur Holztreppe hinüber, die hinunter auf den Sand führt. Ich habe meine Schwielen dieses Jahr nicht gepflegt, und meine Füße schmerzen auf den harten Steinen. An der Nordküste sind wenige Dinge wichtiger als harte Füße. Meine Schwester Enola und ich sind im Sommer immer so lange barfuß herumgerannt, bis die Straße so heiß wurde, dass unsere Zehen im Teer versanken. Wer nicht von hier ist, kommt auf dieser Küste barfuß nicht weiter.
Unten an der Treppe steht Frank McAvoy und winkt mir zu, bevor er den Blick aufs Steilufer richtet. Er hat sein Skiff dabei, ein wunderschönes Boot, das aussieht wie aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt. Frank ist Bootsbauer und ein guter Kerl, er kannte meine Familie schon, als es mich noch gar nicht gab. Wenn er lacht, wird sein Gesicht zur verwitterten, fleckigen Faltensammlung eines Iren, der zu viele Jahre in der Sonne verbracht hat. Die Brauen biegen sich nach oben und verschwinden unter der Krempe des alten Leinenhutes, den er nie abzusetzen scheint. Wäre mein Vater älter geworden, über sechzig, hätte er vielleicht wie Frank ausgesehen, mit den gleichen vergilbten Zähnen und rötlichen Sommersprossen.
Wenn ich Frank ansehe, muss ich daran denken, wie ich als kleiner Kerl zwischen dem Holz für ein großes Lagerfeuer herumgekrochen bin und mich seine riesige Hand von einem umkippenden Balken weggezogen hat. Sofort denke ich auch an meinen Vater und sehe ihn über einen Grill gebeugt Maiskolben wenden. Ich rieche die verkohlten Blätter und Grannen. Frank erzählte uns Fischergeschichten, und natürlich log er, dass sich die Balken bogen. Meine Mutter und seine Frau stachelten ihn an, und ihr Lachen verschreckte die Möwen. Zwei von diesen Menschen leben nicht mehr. Ich sehe Frank an und sehe meine Eltern vor mir, und ich stelle mir vor, dass es ihm nicht anders geht, und er mich nicht ansehen kann, ohne an seine verstorbenen Freunde denken zu müssen.
»Sieht so aus, als hätte dich der Sturm übel erwischt«, sagt er.
»Ich weiß. Ich hab anderthalb Meter verloren.« Das ist noch untertrieben.
»Ich habe deinem Dad gesagt, dass er das befestigen und Bäume pflanzen muss.« Das Grundstück der McAvoys liegt westlich von meinem Haus, weiter vom Wasser weg, und das Ufer davor ist terrassiert, befestigt und bepflanzt, um Franks Haus vor Tod, Teufel und Hochwasser zu schützen.
»Dad war nie gut darin, auf andere Leute zu hören.«
»Nein, das war er nicht. Trotzdem, die eine oder andere Verstärkung des Ufers hätte dir eine Menge Ärger erspart.«
»Du weißt doch, wie er war.« Das Schweigen, die Resignation.
Frank saugt Luft durch die Zähne und lässt dabei einen trockenen Pfeifton hören. »Wahrscheinlich hat er gedacht, er hätte mehr Zeit, um die Dinge zu richten.«
»Wahrscheinlich«, sage ich. Wer weiß schon, was mein Vater gedacht hat?
»Die letzten paar Jahre kommt das Wasser aber auch besonders hoch rein.«
»Ich muss was unternehmen. Kennst du eine Baufirma, der man trauen kann?«
»Absolut. Ich kann jemanden vorbeischicken.« Er kratzt sich am Nacken. »Ich will dir allerdings nichts vormachen: Billig wird das nicht.«
»Nichts ist heutzutage mehr billig, oder?«
»Nein, das stimmt wohl.«
»Vielleicht muss ich am Ende verkaufen.«
»Das würde mir gar nicht gefallen.« Frank zieht die Stirn in Falten und damit den Hut tiefer in die Augen.
»Das Grundstück ist schon was wert, selbst ohne Haus.«
»Denk ein bisschen drüber nach.«
Frank kennt meine finanziellen Zwänge. Seine Tochter Alice arbeitet ebenfalls in der Bibliothek. Die rothaarige Alice sieht gut aus, hat das Lächeln ihres Vaters geerbt und einen guten Draht zu Kindern. Sie kommt ganz allgemein besser mit Leuten zurecht, weshalb sie sich um die Veranstaltungen kümmert. Ich bin fürs Nachschlagen und Recherchieren zuständig. Aber wir sind nicht wegen Alice oder wegen der heiklen Lage meines Hauses hier, sondern um die Bojen neu zu setzen, die den Schwimmbereich abgrenzen. Seit zehn Jahren kümmern wir uns darum. Der Sturm war so stark, dass er die Dinger mit ihren Ankern auf den Strand geworfen hat. Ein Haufen rostiger Ketten voller Seepocken und verwickelter orangefarbener Seile liegt da. Kein Wunder, dass ich Land verloren habe.
»Sollen wir?«, frage ich.
»Warum nicht. Was getan ist, ist getan.«
Ich ziehe mein Hemd aus, hieve mir die Ketten und Seile über die Schulter und beginne meinen langsamen Gang ins Wasser.
»Bist du sicher, dass ich nicht mit anfassen soll?«, fragt Frank und schiebt sein Boot ins Wasser. Der Kiel knirscht durch den Sand.
»Nein danke, ich hab’s schon.« Ich könnte es auch allein machen, aber es ist sicherer, wenn Frank mir folgt. Er ist nicht wirklich meinetwegen hier, sondern aus dem gleichen Grund, aus dem ich das immer wieder mache: um meiner Mutter zu gedenken, Paulina, die hier ertrunken ist.
Dafür, dass wir Juni haben, ist der Sund eisig, aber ich fühle mich gut, als ich erst einmal im Wasser bin, und meine Füße und Zehen legen sich um die algenbedeckten Steine, als wären sie dafür gemacht. Die Ankerketten wiegen schwer, Frank bleibt rudernd auf meiner Höhe. Ich gehe, bis das Wasser meine Brust erreicht, den Hals, und kurz bevor ich untertauche, atme ich aus und tief ein, genau wie meine Mutter es mir vor langer Zeit an einem warmen Julimorgen beigebracht hat (und ich es später meiner Schwester).
Der Trick beim Luftanhalten ist es, durstig zu sein.
»Schnell und kräftig ausatmen«, sagte meine Mutter mit sanfter Stimme direkt neben meinem Ohr. Ihr dickes schwarzes Haar trieb in Ranken durchs flache Wasser. Ich war fünf Jahre alt. Sie drückte auf meinen Magen, bis der Muskel sich nach innen stülpte und der Nabel beinahe das Rückgrat berührte. Sie drückte fest, ihre scharfen Fingernägel piksten. »Und jetzt einatmen, schnell. Schnell, schnell, schnell. Dehn die Rippen weit aus. Denk es. Weit.« Sie atmete ein, und ihr Brustkorb weitete sich, vogeldünne Knochen weiteten sich, bis ihr Leib einem Fass glich. Ihr Badeanzug war ein helles weißes Leuchten im Wasser. Ich blinzelte. Sie klopfte mit einem Finger auf mein Brustbein. Klopf, klopf, klopf. »Du atmest oben, Simon. Wenn du oben atmest, ertrinkst du. Damit blockierst du den Raum im Bauch.« Eine sanfte Berührung. Ein kleines Lächeln. Meine Mutter sagte, ich solle mir vorstellen, durstig zu sein, völlig ausgetrocknet und leer, und dann die Luft in mich hineintrinken. Dehn die Knochen, trink sie weit und tief in dich hinein. Und als sich mein Leib zu einer fetten Tonne rundete, flüsterte sie: »Wundervoll, wundervoll. Jetzt tauch unter.«
Ich tauche unter. Weiche Lichtstrahlen dringen um den Schatten von Franks Boot nach unten. Manchmal höre ich sie noch, wie sie durchs Wasser treibt, und hin und wieder erhasche ich auch einen flüchtigen Blick auf sie, hinter Algenvorhängen, das schwarze Haar durchsetzt mit Tang.
Mein Atem fährt mir als feiner Nebel über die Haut.
Paulina, meine Mutter, war eine Zirkusartistin und Kirmesattraktion, eine Zaubererassistentin und Wassernixe, die ihr Geld damit verdiente, die Luft anzuhalten. Sie brachte mir bei, wie ein Fisch zu schwimmen, und zauberte ein Lächeln auf das Gesicht meines Vaters. Oft verschwand sie, gab einen Job auf oder hatte gleich zwei, drei auf einmal, wohnte in Hotels, nur um andere Betten auszuprobieren. Mein Vater Daniel war Maschinenschlosser und ihr fester Halt im Leben. Er blieb zu Hause, lächelte, wartete auf ihre Rückkehr und darauf, dass sie ihn Liebling nannte.
Simon, Liebling. Mich nannte sie auch so.
An dem Tag, als sie ins Wasser ging, war ich sieben Jahre alt. Ich habe versucht, es zu vergessen, doch es ist meine intensivste Erinnerung an sie. Sie verließ uns morgens, nachdem sie das Frühstück gemacht hatte. Hart gekochte Eier, die seitlich am Teller angeschlagen und mit den Fingernägeln gepellt werden mussten. Kleine Stückchen blieben darunter hängen. Ich pellte auch das Ei meiner Schwester und schnitt es in Scheiben, damit sie es mit ihren Kleinkinderfingern besser zu fassen bekam. Dazu gab es trockenen Toast und Orangensaft. Die frühen Sommerstunden machten die Schatten dunkler, die Gesichter heller und alle Höhlungen noch hohler. Paulina war an dem Morgen eine Schönheit, schwanengleich und wie nicht von dieser Welt. Dad war in der Fabrik, sie war allein mit uns, sah uns zu und nickte, als ich Enolas Ei schnitt.
»Du bist ein guter großer Bruder, Simon. Pass auf Enola auf. Sie wird dir davonlaufen wollen. Versprich mir, dass du sie nicht lässt.«
»Versprochen.«
»Was für ein wundervoller Junge du bist. Ich hätte das nie erwartet. Ich habe dich überhaupt nicht erwartet.«
Das Pendel der Kuckucksuhr schwang hin und her. Meine Mutter klopfte mit dem Fuß aufs Linoleum und sagte nichts mehr. Enola bekleckerte sich mit Ei und Krümeln. Ich hatte damit zu tun, zu essen und meine Schwester einigermaßen sauber zu halten.
Nach einer Weile stand meine Mutter auf und strich sich den Stoff ihres Sommerrocks glatt. »Bis später, Simon. Tschüss, Enola.«
Sie küsste ihre Tochter auf die Wange und drückte mir ihre Lippen oben auf den Kopf. Sie winkte zum Abschied, lächelte, und ich dachte, sie ginge zur Arbeit. Wie konnte ich wissen, dass es ein Abschied für immer war? In kleinen Wörtern wohnen oft große Dinge. Als sie mich an jenem Morgen ansah, wusste sie, ich würde mich um Enola kümmern. Sie wusste, wir würden ihr nicht folgen. Es war ihre Gelegenheit zu gehen.
Nicht lange danach, Alice McAvoy und ich veranstalteten gerade ein Autorennen auf unserem Wohnzimmerteppich, ertränkte sich meine Mutter im Sund.
Ich lehne mich gegen das Wasser, drücke mit der Brust und grabe die Zehen in den Grund. Noch ein paar Schritte, und ich setze den ersten Anker ab. Mit einem gedämpften Schlag landet er auf den Steinen. Ich sehe zum Schatten des Bootes hinauf. Frank ist nervös. Die Ruder schlagen aufs Wasser. Wie muss es sein, Wasser zu atmen? Ich stelle mir das verzerrte Gesicht meiner Mutter vor und gehe weiter, bis ich den anderen Anker absetzen kann, lasse die Luft aus meiner Lunge und gehe weiter in Richtung Strand. Ich versuche so lange wie möglich am Grund zu bleiben, das ist ein Spiel, das Enola und ich immer gespielt haben. Ich schwimme nur, wenn es zu schwierig wird, beim Gehen die Balance zu halten, dann bewegen sich meine Arme mit stetigen Zügen und schneiden wie eines von Franks Booten durch den Sund. Wenn das Wasser gerade noch tief genug ist, dass es meinen Kopf bedeckt, setze ich die Füße wieder auf den Grund. Was jetzt folgt, ist für Frank.
»Langsam, Simon«, erklärte mir meine Mutter. »Halt die Augen offen, auch wenn es sticht. Beim Herauskommen tut es mehr weh als beim Hineingehen, aber halt sie offen. Ohne zu blinzeln.« Salz brennt, aber sie hat nie geblinzelt, weder im Wasser, noch wenn die Augen wieder an die Luft kamen. Sie war eine sich bewegende Skulptur. »Atme nicht, auch wenn deine Nase über der Wasseroberfläche ist. Atmest du zu schnell, gibt es einen Mundvoll Salz. Warte«, sagte sie und dehnte das Wort wie ein Versprechen. »Warte, bis dein Mund aus dem Wasser kommt, aber atme durch die Nase, sonst sieht es aus, als wärst du müde. Du darfst nie müde sein. Dann lächle.« Obwohl sie einen kleinen Mund und schmale Lippen hatte, war ihr Lächeln weit wie das Wasser. Sie zeigte mir, wie man sich richtig verneigt: die Arme hoch, die Brust vorgewölbt, wie ein Kranich, der sich in die Lüfte erhebt. »Die Zuschauer mögen sehr kleine und sehr große Leute. Verbeuge dich nicht aus der Taille wie ein Schauspieler, das macht dich kleiner. Lass sie denken, dass du größer bist.« Sie lächelte mich zwischen ihren erhobenen Armen hindurch an. »Und du wirst sehr groß werden, Simon.« Ein kleines Nicken zu einem unsichtbaren Publikum hin. »Sei anmutig. Immer anmutig.«
Ich verbeuge mich nicht, nicht für Frank. Das letzte Mal habe ich mich verbeugt, als ich es Enola beigebracht habe und uns das Salz so schlimm in den Augen stach, dass wir aussahen, als hätten wir gekämpft. Trotzdem lächle ich, atme tief durch die Nase ein, dehne meine Rippen und fülle mir den Leib.
»Ich dachte schon, ich müsste dich heraufholen«, ruft Frank.
»Wie lange war ich unten?«
Er sieht auf seine Uhr mit dem rissigen Lederarmband und atmet hörbar aus. »Neun Minuten.«
»Mom hat elf geschafft.« Ich schüttele mir das Wasser aus dem Haar und hüpfe zweimal, um es auch aus dem Ohr zu bekommen.
»Ich habe das nie verstanden«, murmelt Frank und hebt die Ruder aus den Dollen. Sie klappern, als er sie ins Boot legt. Es gibt eine Frage, die wir beide nicht stellen: Wie lange dauert es, bis jemand wie meine Mom ertrinkt?
Ich schlüpfe zurück in mein Hemd, es ist voller Sand. Lebst du an der Küste, ist der Sand immer überall, im Haar, unter den Zehennägeln, in den Falten des Bettzeugs.
Frank schnauft vor Anstrengung, als er hinter mir das Boot aus dem Wasser zieht.
»Du solltest dir dabei von mir helfen lassen.«
Er klopft mir auf den Rücken. »Wenn ich nicht hin und wieder etwas tue, werde ich nur alt.«
Wir reden über ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Jachthafen. Er beklagt, dass die Fiberglasboote überhandnehmen, und wir werden poetisch, als wir auf die Windmill kommen, die Segeljacht, die er sich mit meinem Vater teilte. Nach Moms Ertrinken verkaufte Dad das Boot ohne Erklärung. Es war Frank gegenüber gefühllos, aber der hätte es ja kaufen können, wenn er gewollt hätte. Über das Haus reden wir nicht mehr, obwohl klar ist, wie sehr ihn der Gedanke mitnimmt, dass ich es womöglich nicht halten kann. Ich hätte es auch lieber anders. Stattdessen tauschen wir Nettigkeiten über Alice aus. Ich sage, ich achte auf sie, obwohl es unnötig ist.
»Wie geht es deiner Schwester? Hat sie sich schon irgendwo niedergelassen?«
»Nicht, dass ich wüsste, und um ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher, ob sie es je tun wird.«
Ein Lächeln huscht über Franks Gesicht. Wir denken beide, dass Enola genau so rastlos wie meine Mutter ist.
»Legt sie immer noch Tarotkarten?«, fragt er.
»Sie kommt zurecht.« Sie ist mit einem Kirmesunternehmen unterwegs. Als auch das gesagt ist, sind unsere Themen erschöpft. Wir trocknen uns ab und hieven das Skiff zum Ufer hinauf.
»Gehst du hoch?«, frage ich. »Dann gehe ich mit.«
»Es ist ein so schöner Tag«, sagt er. »Ich glaube, ich bleibe noch etwas.« Das Ritual ist beendet. Wir trennen uns, nachdem wir unsere Geister ertränkt haben.
Ich steige die Treppe hinauf und vermeide den Giftsumach, der über das Geländer wächst. Das Zeug wuchert wild über das ganze Steilufer. Niemand reißt es aus. Alles, was im Sand wurzelt, ist wertvoll, wie übel es auch sein mag. Quer durch den Strandhafer gehe ich zurück nach Hause. Wie viele Häuser in Napawset ist auch meines ein waschechtes Kolonialhaus, gebaut im späten 17. Jahrhundert. Bis es vom Nordostwind weggerissen wurde, hing ein Schild der Historischen Gesellschaft neben der Tür. »Das Timothy-Wabash-Haus.« Mit seiner abblätternden Farbe, den vier schiefen Fenstern und der schräg abfallenden Treppe zeugt das Haus von fortgesetzter Vernachlässigung und einem ernsten Mangel an Geld.
Auf der verblichenen grünen Eingangstreppe (um die muss ich mich kümmern) hält ein Päckchen das Fliegengitter auf. Der Bote lässt die Gittertür immer offen stehen, egal wie viele Zettel ich auch schon aufgehängt habe, dass er es nicht tun soll. Das Letzte, was ich brauche, ist eine vom Wind weggerissene Tür, die ich an einem Haus erneuern muss, an dem es seit seiner Errichtung keinen rechten Winkel gegeben hat. Ein Päckchen? Ich habe nichts bestellt, und mir will niemand einfallen, der mir etwas schicken könnte. Enola ist selten länger an einem Ort, um Zeit dafür zu finden, mehr als eine Postkarte zu schicken. Und selbst auf denen steht für gewöhnlich kaum etwas.
Das Päckchen ist schwer, plump, die Spinnenschrift auf dem Adressaufkleber die einer älteren Person. Ich kenne diese Art Schrift, gehören doch auch die Bibliotheksbesucher eher der älteren Generation an. Das erinnert mich daran, dass ich mit Janice reden muss, ob sich nicht ein paar dehnbare Dollars im Bibliotheksetat finden lassen. Vielleicht ist alles nicht so schlimm, wenn ich das Ufer oben ein bisschen befestigen kann. Es wäre keine Gehaltserhöhung, eher vielleicht ein einmaliger Bonus nach all den Dienstjahren. Den Absender kenne ich nicht, eine oder einen M. Churchwarry aus Iowa. Ich nehme einen Stapel Papiere vom Tisch, ein paar Artikel über Zirkusse und Volksfeste, die ich über die Jahre gesammelt habe, um mit dem Leben meiner Schwester Schritt zu halten.
In dem Päckchen ist ein ziemlich großes, sorgfältig eingeschlagenes Buch. Noch bevor ich es auswickle, signalisiert der muffige, leicht bittere Geruch altes Papier, Holz, Leder und Leim. Unter dem Zeitungs- und Seidenpapier kommt ein dunkler Ledereinband mit ehedem wohl feinen Verzierungen, die durch einen heftigen Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen wurden, zum Vorschein. Mein Herz schlägt etwas schneller. Es ist ein sehr altes Buch, im Grunde keines, das man mit bloßen Händen anfasst, doch da ich sehe, dass es bereits ruiniert ist, gebe ich mich dem stillen Kitzel hin, etwas so Altes, etwas mit Geschichte, zu berühren. Die Ränder des unbeschädigten Papiers sind grobkörnig, aber weich. Die Walfangsammlung der Bibliothek ist mit genug archivarischer und Restaurationsarbeit verbunden, dass ich sagen kann, dieses Buch fühlt sich an, als stamme es wenigstens aus dem 18. Jahrhundert. So was lässt sich nur mit Termin ansehen und ist nicht einfach zu bestellen. Aus meinen Papieren baue ich zwei kleine Stapel, um den Band zu stützen, was ein schlechter Ersatz für die Ständer ist, die er eigentlich verdient, aber so wird es gehen.
Vorne im Buch steckt ein Brief, geschrieben mit derselben zittrigen Hand wie die Adresse.
Lieber Mr. Watson,
ich habe dieses Buch bei einer Auktion als Teil eines größeren Bestands erworben. Der Schaden macht es unbrauchbar für mich, aber ein Name darin, Verona Bonn, lässt mich glauben, dass es für Sie oder Ihre Familie von Interesse sein könnte. Es ist ein entzückendes Buch, und ich hoffe, es findet bei Ihnen ein gutes Zuhause. Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, von denen Sie annehmen, dass ich sie beantworten kann.
Unterzeichnet ist der Brief von einem Mr. Martin Churchwarry von Churchwarry & Söhne, einem auf alte und antiquarische Bücher spezialisierten Buchhändler. Ebenfalls vermerkt ist eine Telefonnummer.
Verona Bonn. Was der Name meiner Großmutter in diesem Buch macht, ist mir schleierhaft. Als umherreisende Darstellerin wie meine Mutter hatte sie in ihrem Leben keinen Platz für so ein Buch. Mit dem Rand des Fingers blättere ich eine Seite um. Das Papier knistert vor Anstrengung. Ich muss daran denken, zusammen mit dem Ständer Handschuhe mitzubringen. Die Innenseite ist mit kunstvoll gestochener Schrift bedeckt, über die Maßen verziert mit skurrilen Schnörkeln, die das Ganze so gut wie unlesbar machen. Es scheint das Geschäfts- oder Tagebuch eines gewissen Mr. Hermelius Peabody zu sein und mit etwas zu tun zu haben, das die Worte »reisende« und »Wunder« enthält. Andere mögliche Hinweise sind dem Wasserschaden zum Opfer gefallen, und Mr. Peabodys Faible für Kalligrafie. Beim Durchblättern sehe ich Zeichnungen von Frauen und Männern, Gebäuden und Wagen mit fantasievoll gerundeten Dächern, alles in Braun. Ich habe meine Großmutter nicht mehr kennengelernt. Sie starb, als meine Mutter noch ein Kind war, und die hat kaum etwas von ihr erzählt. Mir ist nicht klar, was dieses Buch mit meiner Großmutter zu tun hat, interessant ist es auf jeden Fall.
Ich ignoriere das Gestotter, das mich auf eine Nachricht hinweist, und wähle die Nummer. Es klingelt außerordentlich lange, bis sich ein Anrufbeantworter meldet und die zittrige Stimme eines Mannes erklärt, dass ich mit Churchwarry & Söhne verbunden bin und Datum und Uhrzeit sowie eine detaillierte Angabe zu dem Buch hinterlassen soll, das ich suche. Die Handschrift hat mich nicht getäuscht. Es ist ein alter Mann.
»Mr. Churchwarry, hier ist Simon Watson. Ich habe das Buch von Ihnen erhalten. Ich bin nicht sicher, warum Sie es mir geschickt haben, aber ich bin neugierig. Heute ist der 20. Juni, gerade sechs Uhr. Es ist ein fantastisches Buch, und ich würde gern mehr darüber erfahren.« Ich hinterlasse mehrere Nummern: vom Handy, vom Haus und der Bibliothek.
Auf der anderen Seite der Straße steuert Frank auf seine Werkstatt zu, eine Scheune am Rand seines Grundstücks. Er trägt ein Stück Holz unter dem Arm, eine Art Spannvorrichtung. Ich hätte ihn nach Geld fragen sollen, nicht nach der Nummer eines Bauunternehmers. Arbeiter werde ich schon finden, das Geld, um sie zu bezahlen, ist das Problem. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Oder einen anderen Job. Oder beides.
Mein Blick fällt auf ein blinkendes Lämpchen. Eine Nachricht. Okay. Ich gebe die Nummer ein. Die Stimme am anderen Ende ist nicht die, die ich erwartet habe.
»Hey, ich bin’s. Ach, Scheiße, rufe ich oft genug an, um eine ›Ich bin’s‹ zu sein? Ich hoffe, du hast eine. Eine ›Ich bin’s‹, meine ich. Das wäre gut. Also, ich bin’s, Enola. Ich will dich vorwarnen. Ich komme im Juli nach Hause. Es wäre toll, dich zu sehen. Wenn du Lust hättest, da zu sein. Eigentlich möchte ich, dass du da bist. Also, noch mal, ich komme im Juli, und du solltest zu Hause sein. Okay? Bye.«
Ich spiele die Nachricht noch einmal ab. Sie ruft nicht oft genug an, um eine »Ich bin’s« zu sein. Im Hintergrund sind Leute zu hören, die reden und lachen, ich meine, sogar ein Fahrgeschäft oder zwei zu hören, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Kein Datum, keine Nummer, nur Juli. Enola hat ein anderes Zeitverständnis, für sie ist es ganz normal, sich auf die Monatsangabe zu beschränken. Es tut gut, ihre Stimme zu hören, ist aber auch leicht besorgniserregend. Sie hat seit über zwei Monaten nicht angerufen und war seit sechs Jahren nicht zu Hause, nicht seit sie verkündet hat, wenn sie noch einen Tag mit mir in diesem Haus verbringe, werde sie sterben. Es war typisch für sie, so was zu sagen, aber doch auch anders, weil wir beide wussten, dass sie es ernst meinte, und ich mich die letzten vier Jahre, seit Vaters Tod, um sie gekümmert hatte. Seitdem ruft sie von Zeit zu Zeit an und hinterlässt weitschweifige Nachrichten. Unsere Gespräche dagegen sind kurz und nüchtern. Vor zwei Jahren hatte sie die Grippe. Ich fand sie in einem Hotel in New Jersey, wo sie die Toilettenschüssel umarmte. Ich blieb drei Tage. Sie weigerte sich, mit nach Hause zu kommen.
Sie will mich besuchen. Das kann sie. Ich habe ihr Zimmer nicht angerührt, seit sie weg ist, wahrscheinlich weil ich gehofft habe, dass sie zurückkommt. Ich habe schon daran gedacht, eine Bibliothek daraus zu machen, aber es gab immer dringlichere Dinge, leckende Hähne und Rohre mussten abgedichtet, Kurzschlüsse beseitigt, Fenster ersetzt werden. Das Zimmer meiner lange enteilten Schwester einer neuen Bestimmung zuzuführen, hatte keine Priorität. Aber vielleicht war das auch einfach nur eine bequeme Ausflucht.
Das Buch liegt neben dem Telefon, ein verführerisches kleines Rätsel. Heute Nacht werde ich nicht schlafen. Das geht mir oft so. Ich werde wach sein und über Verschiedenes nachgrübeln. Über das Haus, meine Schwester, Geld. Mit dem Daumen folge ich den Windungen eines verschnörkelten H. Wenn dieses Buch für mich bestimmt ist, sollte ich besser herausfinden, warum.
2
Der Junge kam als Bastard zur Welt, auf einer Tabakfarm in den fruchtbaren Hügeln Virginias. Wäre seine Geburt registriert worden, wären es die 1780er gewesen. Das war, als die Farmer den Preis für ein Fass Tabak nicht mehr selbst festsetzen durften, aber noch bevor sie von der alles verschlingenden Baumwolle geschluckt wurden. Das Haus war wenig mehr als eine Holzhütte, winzig, bemoost und mit ständig geschlossenen Fensterläden, gegen den Regen, die Fliegen und den alles durchdringenden Tabakgeruch aus dem Trockenschuppen.
Seine Mutter war die Farmersfrau, die kräftige Eunice Oliver, sein Vater Lemuel Atkinson, ein attraktiver junger Mann und Besitzer einer reisenden Medizinshow. Durch wenig mehr als ein paar sanfte Koseworte und die Verlockung geschmeidiger Gentlemenhände kam Eunice zu drei Flaschen von Atkinsons Elixier und einer Schwangerschaft.
Der Farmer, William Oliver, hatte bereits drei Kinder und wollte kein viertes, uneheliches mit durchfüttern. Als der Junge stehen und gehen konnte und ihm die Reste vom Tisch zum Überleben nicht mehr reichten, führte Oliver ihn tief in den Wald und überließ ihn seinem Schicksal. Eunice weinte bitterlich, weil ihr der Sohn genommen worden war. Der Junge blieb still. Sein großes Unglück war nicht, dass er unehelich, sondern dass er stumm das Licht der Welt erblickt hatte.
Er überlebte ein paar Jahre ohne die Worte, mit denen er von ihnen hätte erzählen können. Bei Tag war er hungrig und ernährte sich, wovon immer er konnte, pflückte mit seinen dreckverkrusteten Händen wilde Beeren, und kam er an einer Farm vorbei, bediente er sich auf leisen Sohlen. Ein Schuppen zum Fleischtrocknen bedeutete Schutz für eine Nacht und Verpflegung für Wochen. Wurde es dunkel, schlief er, wo immer es warm war. Seine Tage schrumpften, wurden zu Nebel, Bergen und einem Wald so dicht, dass die Welt darin verschwand. Der Junge selbst verschwand – er lernte, sich unsichtbar zu machen.
Menschen können hundert Jahre leben, ohne das Geheimnis des Verschwindens zu entdecken. Der Junge tat es, weil er frei war, dem Summen der Erde zu folgen, ihren feinen Bewegungen und dem Atmen des Wassers, einem Flüstern, das den Herzschlag kaum übertönte. Das Wasser war der Schlüssel. Wenn er seiner Tiefe und seinem Rhythmus lauschte und ihm den Atem anglich, wenn er sein Herz verlangsamte, bis es kaum mehr schlug, ging seine dünne braune Gestalt in ihrer Umgebung auf. Hätte es jemand beobachtet, hätte er einen schmuddeligen Jungen gesehen, der sich seitwärts wandte, zwischen den Bäumen des Waldes auflöste und am Rand des großen Wassers zu einem Sandkorn wurde, unmöglich vom Rest der Küste zu unterscheiden. Der Hunger, sein ständiger Begleiter, war das Einzige, was ihm sicher zeigte, dass er lebte.
Die Fähigkeit zu verschwinden erleichterte sein Überleben und gewährte ihm Zutritt zu Vorrats- und Räucherkammern, ließ ihn essen, bis Hitze und Rauch ihn wieder vertrieben. Er stibitzte Brot von Tischen und Kleider von Bäumen und Büschen, auf denen sie trockneten. Er stahl, was immer er konnte, um die Bedürfnisse seines Körpers zu befriedigen.
Nur einmal wagte er sich zu dem Haus, aus dem er verstoßen worden war. Da war seine Erinnerung daran schon so vage, dass er dachte, es wäre alles nur Einbildung. Doch dann stieß er ganz zufällig auf das graue Haus mit dem schiefen Dach, und es erschreckte ihn, feststellen zu müssen, dass es tatsächlich existierte und kein Relikt eines Traumes war. Er hob den Riegel eines Fensterladens und öffnete ihn gerade so weit, dass er mit einem tiefbraunen Auge hineinblicken konnte. Was er sah, war das Innere eines Schlafraums, erleuchtet von dem bisschen Mondlicht, das am schlecht passenden Fensterladen vorbei nach drinnen fiel.
Ein Mann und eine Frau schliefen auf einer Matratze aus Stroh. Der Junge musterte die groben Züge des Mannes, die rauen dunklen Stoppeln auf dem Kinn und fühlte nichts. Die Frau lag auf der Seite, und ihr braunes Haar floss über den Rand ihres Kittels. Etwas erwachte in dem Jungen, eine Erinnerung daran, wie ihm eine Strähne dieses Haares über die Hand strich. Er schlich sich ins Haus, an einem langen Tisch und dem Bett eines schlafenden Kindes vorbei, und schlüpfte in den Raum, in dem die Frau und der Mann lagen. Sein Körper erinnerte sich an den Weg, als wäre er ihn Tausende Male gegangen. Sanft hob er die Decke, glitt darunter und schloss die Augen. Der Geruch der Frau war ihm gleich vertraut, Laugenseife und trocknender Tabak. Tief in ihm hatte dieser Geruch geschlafen, und er hatte ihn vergessen. Ihre Wärme ließ seine Brust erbeben.
Er floh, bevor sie erwachte.
Er floh, bevor die Frau den Mann weckte, hörte nicht, wie sie ihm erklärte, das Gefühl gehabt zu haben, dass sie jemand betrachtete. Von ihrem Sohn geträumt zu haben. Der Junge kehrte nicht wieder zum Haus zurück. Er ging zurück in die Wälder, suchte sich anderes Obdach, anderes Essen und Orte, die seine Haut nicht brennen ließen.
Am Ufer des schlammigen Dan River, nicht weit von Boyd’s Ferry, lag die Stadt Catspaw, die nach der Form des Tales, in der sie lag, benannt worden war. Sie war ockerfarben wie der Lehm des Flusses und voller Staub von den Pferde- und Maultierpfaden. Die Hochwasser, die Boyd’s Ferry plagten, würden Catspaw später in die Hügel schmelzen lassen, aber im Moment war es eine aufblühende Siedlung am Fluss. Der Junge kam an den Windungen des Dan entlanggewandert und stieß so auf die Stadt, die furchterregend, aber voller Möglichkeiten war. Waschfrauen kochten Kleider in riesigen Zubern und kippten Seife und Waschwasser in den Fluss. Männer stießen flache Boote mit Stangen übers Wasser, Pferde zogen Wagen am Ufer entlang und hinauf durch die Straßen, Wagen mit Frauen und Männern. Das misstönende Durcheinander von Wasser, Menschen und Wagen erschreckte den Jungen. Sein Blick schoss herum, bis er am hellblauen Kleid einer Frau hängen blieb und sah, wie der schwere Stoff vor- und zurückschwang. Er versteckte sich hinter einem Baum, hielt sich die Ohren zu und versuchte seinen Herzschlag zu beruhigen, dem Atem des Flusses zu lauschen.
Dann – ein wundersames Geräusch.
Angekündigt von einer herrlichen Stimme, kam eine Truppe reisender Künstler in die Stadt, eine kaum zusammenpassende Mischung aus Jongleuren, Akrobaten, Wahrsagern, Schlangenmenschen und Tieren, angeführt von Hermelius H. Peabody, dem selbst ernannten Visionär der Unterhaltung und Edukation, der Schausteller und Tiere (ein zählendes, als gelehrt geltendes Schwein, ein Miniaturpferd und ein spuckendes Lama) für Instrumente hielt, um den Geist zu bilden und seine Brieftasche zu füllen. An besseren Tagen fühlte Peabody sich professoral, an schlechteren zeigten sich die Stadtleute unempfänglich für jedwede Erleuchtung und jagten ihn aus der Stadt. Der Schweinewagen, frisch blau gestrichen und stolz mit dem Namen des Tieres, »Toby«, geschmückt, trug die Narben unglücklicher Begegnungen mit Mistgabeln.
Der Junge sah, wie sich die Leute um einen grün-gelben Wagen drängten, der auf den offenen zentralen Platz rollte. Gleich dahinter nahten ein paar langweiligere Karren und Kutschen, einige mit runden Dächern aus riesigen Fässern in allen Farben der Schöpfung, alle angefüllt mit einem Mischmasch aus Mensch und Tier. Die Wagen beschrieben einen Kreis, Frauen zogen Kinder an ihre Röcke, damit sie den Rädern nicht zu nahe kamen. Der vorderste Wagen war mit so kunstvoller Schrift bemalt, dass man sie fast nicht lesen konnte, und auf ihm fuhr, stehend, ein beeindruckender Mann in einem prächtigen Gewand: Peabody. Die Bürger der Stadt waren allein reisende Jongleure und Musiker gewohnt, doch solch ein Spektakel hatten sie noch nicht erlebt.
Nie hatte es einen Mann wie Hermelius Peabody gegeben, und dem verlieh er gern Ausdruck. Seine schiere Größe und Erscheinung forderten Aufmerksamkeit. Sein Bart mündete in eine gezwirbelte Spitze, die ihm über die Brust fuhr, und sein makellos weißes Haar hing ihm bis auf die Schultern, gekrönt von einem gewellten Hut, der mit seinem Zerfall kokettierte. Dass er überhaupt noch zusammenhielt, schien einem Zaubertrick geschuldet. Peabodys Bauch verspottete unverfroren die Schwerkraft, ragte hoch und rund vor, forderte die Messingknöpfe der Weste heraus, ihn zu halten, und dehnte die rote Samtjacke bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Doch das Bemerkenswerteste an Hermelius Peabody war seine Stimme. Mit einer Kraft, die tief aus seinem Leib kam, hallte sie lautstark durch das Tal.
»Hochverehrtes Publikum, Ihr habt ein solches Glück!« Er bewegte sich zu einem schlanken Mann hinter sich, an dessen Mundwinkel eine mächtige Narbe zerrte und der Peabody etwas ins Ohr flüsterte. »Bürger Virginias«, rief Peabody, »werdet Zeugen des erstaunlichsten Spektakels, das Ihr je zu sehen bekommen habt. Fern aus dem Osten bringe ich Euch die großartigste orientalische Schlangenfrau!« Ein schlankes, biegsames Mädchen kletterte auf ein Wagendach, legte ein Bein hinter den Kopf, beugte sich vor und machte einen einhändigen Handstand.
Der Junge war fasziniert und bewegte sich Zentimeter um Zentimeter hinter seinem Baum hervor.
»Aus dem Herzen der Karpaten«, rief Peabody und reckte die Arme in Richtung Himmel, »eingehüllt in die Tiefen des slawischen Mystizismus, aufgezogen von Wölfen und geschult in der uralten Kunst des Wahrsagens: Madame Ryschkowa!« Ein Raunen ging durch die Menge, als eine in ein weites Seidentuch gehüllte, bucklige Frau aus einem Runddachwagen trat und eine verkrüppelte Hand ausstreckte.
Peabodys Stimme hallte im wilden Teil des Jungen wider, summend und beruhigend. Er schob sich auf die Zuschauer zu, auf die Wagen, schlängelte sich durch die Körper, bis er hinter einem Rad den Platz mit dem besten Blick auf den weißhaarigen Mann mit der Stimme wie ein Fluss fand. Er ging in die Hocke, stellte sich auf die Zehenspitzen, lauschte und zählte die Atemzüge des Mannes.
»Einmal im Leben, hochverehrtes Publikum. Wann sonst werdet Ihr einen Mann sehen, der ein ausgewachsenes Pferd mit einem Arm in die Höhe hebt? Wann sonst, frage ich Euch, werdet Ihr das nächste Mal ein Mädchen erleben, das sich in einen Seemannsknoten winden kann, wann eine Seherin, die Euch sagt, was Gott selbst in Euer Schicksal geschrieben hat? Niemals wieder, Ihr edlen Damen und Herren!« In einem hastigen Gewimmel sprangen die Schausteller zurück in ihre Karren und Wagen, rollten dicke Stoffbahnen herunter, schlugen und schlossen Türen zu. Peabody blieb, lief langsam auf und ab und fuhr mit einer Hand über die Knöpfe seiner Weste. »Am Mittag und in der Abenddämmerung, hochverehrtes Publikum. Drei Pence fürs Zusehen, und wir nehmen gern auch spanische Scheine. Am Mittag und in der Abenddämmerung!«
Die Menge zerstreute sich und kehrte zu ihren Alltagsverrichtungen zurück, zu ihren Fuhren, ihrer Wäsche und ihren Käufen und Verkäufen, zum Hin und Her des Catpaw’schen Lebens. Der Junge blieb neben dem Karren stehen. Peabodys scharfe blaue Augen richteten sich auf ihn.
»Junge«, rief die Stimme.
Der Junge fiel nach hinten, und alle Luft fuhr aus ihm hinaus. Sein Körper weigerte sich, dem Befehl zur Flucht Folge zu leisten.
»Das ist ein toller Trick«, fuhr Peabody fort. »Das Verschwinden, das kurz Reinschauen und sich wieder Verabschieden. Wie nennst du es? Flüchtig, ephemer vielleicht? Uns fällt schon was ein, oder wir erfinden einfach etwas.«
Der Junge verstand die Laute nicht, die aus dem Mann purzelten. »Junge« fühlte sich vertraut an, doch der Rest war ein Wirrwarr schöner Geräusche. Er wollte den Stoff fühlen, der den Bauch des Mannes umschloss.
Peabody kam näher. »Wen haben wir denn da? Du bist ein Junge, richtig? Und scheinst doch eine Mischung aus Dreck und Stecken. Seltsame Kreatur.« Er machte ein lockendes Geräusch. »Was sagst du?« Peabody legte ihm eine Hand auf die Schulter. Seit Monaten hatte der Junge keinen Menschen mehr getroffen. Die Berührung nicht gewohnt, erschauderte er unter dem Gewicht der Hand und tat, was Angst und Instinkt geboten: Er pinkelte sich in die Hose.
»Verdammnis!« Peabody fuhr zurück. »Das müssen wir dir abgewöhnen.«
Der Junge blinzelte. Ein Kratzen entfuhr seinen Lippen.
Peabodys Blick wurde mitfühlend. Ein Zucken seiner Wange verriet ein Lächeln. »Sorg dich nicht, Junge, wir werden uns bestens vertragen. Ja, ich verlass mich darauf.« Er griff nach dem Arm des Jungen und zog ihn in die Höhe. »Komm. Ich zeig dir alles.«
Voller Angst, aber fasziniert folgte ihm der Junge.
Peabody führte ihn zu dem grün-goldenen Wagen, wo sich hinter einer sauber eingepassten Tür ein gut ausgestatteter Raum mit Schreibtisch, Bücherstapeln, einer Messinglampe und sämtlichen Zutaten für eine bequeme Heimstatt des Reisenden auftat. Der Junge setzte einen Fuß hinein.
Peabody musterte ihn. »Du bist dunkel genug, um als Muselmann oder Türke durchzugehen. Das Kinn hoch.« Er beugte sich hinunter und hob den Kopf des Jungen mit einem Finger an, um ihn besser betrachten zu können. Der Junge zuckte zurück. »Nein, dafür bist du zu wild.« Peabody ließ sich schwer auf einen kleinen dreibeinigen Hocker fallen. Der Junge wunderte sich, dass das Ding unter dem Gewicht des Mannes nicht zusammenbrach.
Er sah zu, wie der Mann nachdachte. Seine Finger waren sauber, die Nägel geschnitten. Ganz anders als die des Jungen. Wenn die Größe des Mannes auch furchterregend war, hatte er doch etwas Sanftes an sich. Der Junge sah die Fältchen um seine Augen, trat an den Tisch, an dem der Mann saß, und lauschte dessen Worten.
»Indien hatten wir noch nicht. Indien«, sagte der Mann zu sich selbst. »Ja, ein indischer Wilder, denke ich.« Er gluckste. »Mein neuer Wilder.« Er beugte sich hinunter, als wollte er dem Jungen den Kopf tätscheln, hielt jedoch inne. »Würde es dir gefallen, ein Wilder zu sein?« Der Junge antwortete nicht. Peabody hob die Brauen. »Kannst du nicht sprechen?«
Der Junge drückte sich mit dem Rücken an die Wand. Er fühlte sich kribblig und angespannt, starrte auf die komplizierte Schnürung der Schuhe des Mannes und reckte seine Zehen über den Boden.
»Das macht nichts, Junge. Du bekommst keine Sprechrolle.« Seine Mundwinkel zuckten. »Du löst dich in Luft auf.«
Der Junge streckte die Hand nach den Schuhen des Mannes aus.
»Die gefallen dir, wie?«
Der Junge wich zurück.
Peabody legte die Stirn in Falten, und sein Bart senkte sich entsprechend. Seine Augen füllten sich mit Mitgefühl, und er sagte sanft: »Du bist nicht gut behandelt worden. Das bringen wir wieder ins Lot, Junge. Du bleibst über Nacht, sehen wir mal, ob dich das beruhigt.
Der Junge bekam eine Decke aus einer Truhe. Sie war kratzig, aber es gefiel ihm, sich damit über die Schläfe zu fahren. Er drängte sich an den Schreibtisch des Mannes und zog die Decke um sich. In der Nacht ging der Mann einmal hinaus, und der Junge fürchtete, verlassen worden zu sein, aber kurz darauf kam der Mann zurück, mit Brot. Der Junge verschlang es. Der Mann sagte nichts, sondern begann etwas in ein Buch zu schreiben. Gelegentlich senkte sich seine Hand, um dem Jungen die Decke über die Schulter zu ziehen.
Als ihn der Schlaf überkam, beschloss der Junge, dem Mann überallhin zu folgen.
Am Morgen zeigte Peabody dem Jungen die im Kreis stehenden Wagen, ging dabei einige Schritte voraus und erwartete, dass er ihm folgte. Als sie zu einem mächtigen Käfig auf einem Zugwagen kamen, blieb Peabody stehen.
»Ich habe es mir überlegt. Der hier ist für dich. Du sollst unser junger Wilder sein.«
Der Junge untersuchte den Käfig, war sich der Blicke nicht bewusst, die sich aus den anderen Wagen auf ihn richteten. Der Boden war mit Stroh und Sägespänen bedeckt, die abends Wärme spendeten, was gut war, denn der Jungen würde barfuß und nackt sein. Draußen vor dem Käfig hing ein aufwendiger, üppiger Samtvorhang, den Peabody aus dem Wohnzimmer seiner Mutter befreit hatte. Er war mit Gewichten beschwert (um das Licht draußen zu halten, sagte Peabody) und über Rollen hochziehbar. Peabody demonstrierte, wie man das Publikum überraschen konnte, indem man ihn in dem Moment hochzog, in dem der junge Wilde gerade defäkierte oder etwas ähnlich Widerliches tat.
»Er ist von unserem früheren jungen Wilden, aber jetzt gehört er dir.«
Dem Jungen gefiel seine Rolle. Er mochte das kühle Metall auf der Haut, und der Käfig bot ihm ebenso viel Gelegenheit zur Beobachtung, wie er selbst darin beobachtet wurde. Gesichter glotzten ihn an, und er glotzte zurück, ohne Angst. Er versuchte zu verstehen, warum Frauen ihr Haar eingerollt trugen, warum ihre Hüften breiter zu sein schienen als die der Männer und warum sich die Männer das Haar in ihrem Gesicht so seltsam striegelten. Er sprang, krabbelte, kletterte, aß und entleerte sich, wo und wie es ihm gefiel. Wenn er jemanden nicht mochte, konnte er ohne Angst höhnen und spucken, im Gegenteil, er wurde dafür noch belohnt. Er erlebte Ansätze von Behaglichkeit.
Ohne dass es dem Jungen bewusst geworden wäre, studierte und organisierte Peabody seine Zurschaustellung. Er machte sich mit den Umständen seines Verschwindens vertraut und verstand sie wahrscheinlich besser als der Junge selbst. Wenn er ihn den Morgen über im Käfig ließ, legte sich der Junge auf den Boden, und sein Atem ging immer flacher, bis sich seine Brust kaum mehr hob, und dann, von einem Moment auf den anderen, verschwand er. Peabody lernte, den Vorhang vor dem verschwundenen Jungen langsam und vorsichtig zu heben.
»Psst, liebe Leute«, instruierte er das Publikum mit gedämpfter Stimme. »Es liegt kein Heil darin, ein wildes Tier zu erschrecken.«
Den Vorhang zu heben, reichte, um den Jungen aus seiner Auflösung zu holen, und als die Zuschauer näher an den, wie es den Anschein hatte, leeren Käfig herantraten, zeigte er sich. Das abrupte Erscheinen eines Wilden, wo vorher keiner gewesen war, ließ die Kinder aufschreien. Im Übrigen musste der Junge kaum etwas tun, außer stumm und nackt zu bleiben, um die Menge zur Raserei zu bringen. Dem Jungen gefiel sein neues Leben. Wenn er seinen Penis hüpfen ließ und die Hoden vorschob, so fand er heraus, konnte es sein, dass die eine oder andere sittsame Dame in Ohnmacht fiel. Worauf Peabody den Vorhang fallen ließ und die Vorführung für geglückt erklärte. Der Junge begann nach Wegen zu suchen, wie er noch furchterregender wirkte, indem er zischte und fauchte und Speichel aus seinem Mund triefen ließ, und wenn Peabody ihm auf die Schulter klopfte und »Gut gemacht«, sagte, spürte er eine Fülle in seinem Leib, die besser als Essen war.
Obwohl der Käfig des jungen Wilden seiner war, schlief er nicht darin. Unter den Sägespänen und dem Heu gab es eine versteckte Tür, und wenn der Vorhang zugezogen war, öffnete er den Riegel und kletterte in den Raum unter dem Käfig, in dem eine Wolldecke für ihn lag. Von dort lief er zu Peabodys Wagen, wo es frische Kleider für den geschätzten jungen Wilden gab. Peabody saß hinten im Wagen, kaute auf seiner Pfeife, schrieb und zeichnete im Laternenlicht und warf ab und zu einen verschwörerischen Blick in seine Richtung.
»Eine ausgezeichnete Vorführung, mein Junge«, sagte er. »Du hast das gewisse Etwas und bist vielleicht der beste junge Wilde, den ich je hatte. Hast du die Frau in Ohnmacht fallen sehen? Die Röcke sind ihr über den Kopf gerutscht.« Sein Bauch zitterte, als er dem Jungen auf den Rücken klopfte, und der Junge begriff, dass der Mann ihn mochte. Er begann sich an Wörter vor seiner Zeit im Wald zu erinnern, Wörter wie »Junge« und »Pferd«, »Brot«, »Wasser«, und daran, dass Lachen gut war. Je mehr er Peabody zuhörte, desto mehr Sprache begann sich zu verbinden.
Peabody sprach anders mit dem Jungen, mit ruhigerer Stimme als den anderen gegenüber. Der Junge wusste nicht, dass Hermelius Peabody ihn schon nach wenigen Wochen der Bekanntschaft als Sohn betrachtete.
Es fing damit an, dass Peabody nicht wollte, dass der Junge eine ungewöhnlich kalte Nacht im Käfig des jungen Wilden verbrachte. Vielleicht empfand er Mitleid mit ihm, weil er so mager war, auf jeden Fall beschloss Peabody, dass es eine gute Investition war, ihn im Warmen schlafen zu lassen, und das im Übrigen ein gutes Licht auf seine Seele warf. So rollte sich der Junge denn auf einem Strohsack zusammen, demselben Strohsack, auf dem auch schon Peabodys Sohn Zachary geschlafen hatte. Etwas in Peabody bewegte sich. Zachary war vor Jahren schon in die Welt gezogen, um sein Glück zu versuchen, was Peabody stolz, aber verloren zurückließ. Jetzt betrachtete er den schlafenden Jungen und begriff, dass ihr letzter Zugang eine Lücke füllen mochte. Als der Junge aufwachte, wartete ein Stapel Kleider auf ihn, die fortan ihm gehören sollten. Die Kniebundhosen und langärmeligen Hemden waren nicht einfach nur abgelegt und von irgendwem, sie hatten einmal Zachary gehört.
Abends saß der Junge auf dem Boden in Peabodys Wagen, lauschte, hörte Namen, Orte und Shownummern heraus. Nat, Melina, Susanna, Benno, Meixel. Peabody brachte ihm keine sozialen Nettigkeiten bei, da er sie selbst für nutzlos hielt, sondern unterrichtete ihn in Schaustellerei und Selbstsicherheit, die daher rührte, dass man das Publikum verstand. Erst wollte der Junge nichts über die Menschen wissen, die ihn durch die Gitterstäbe ansahen, sondern war froh, dass sein Käfig sie von ihm fernhielt. Aber die Neugier erwachte, als Peabody ihn andere Vorführungen sehen ließ, den Akrobaten, die Schlangenfrau und den Starken.
»Sieh doch«, sagte er. »Benno sieht die Frau direkt an, zieht sie in die Sache hinein, und dann tut er so, als würde er gleich umfallen.« Der Akrobat balancierte auf einer Hand, wackelte gefährlich, und die Frau keuchte erschrocken auf. »Er ist in keiner größeren Gefahr als du oder ich. Er macht den Trick mit der Wackelei, seit ich ihn in Boston aufgegabelt habe. Wir verlocken sie, Junge, wir verlocken sie und machen ihnen ein bisschen Angst. Das mögen sie. Dafür geben sie uns ihr Geld.« Der Junge verstand, dass die, die ihnen zusahen, die »anderen« waren. Er selbst, Peabody und die Schausteller waren »wir«.
Über mehrere Wochen lehrte Peabody seinen jungen Wilden die Kunst, Menschen zu lesen. Vor jeder Abendvorführung setzte er sich zu ihm in den Käfig und studierte mit ihm, hinter dem schweren Vorhang verborgen, die Menge.
»Die da drüben«, flüsterte Peabody. »Die hält sich an der Hand des Mannes neben ihr fest. Die hat schon Angst. Ein einziger Sprung in ihre Richtung, und sie kriegt Zustände.« Er kicherte, und die runden Backen blähten sich über dem weißen Bart. »Und der Dicke da? Der aussieht wie aufgeblasen?« Der Blick des Jungen schoss zu einem Mann, schwer wie ein Ochse. »Sehen wir mal, ob der nicht gegen unseren Starken antreten mag.« Er murmelte etwas davon, dass er ein zweites Paar Gewichte für die Vorführung brauche.
Der Junge begann die Leute mit Tieren zu vergleichen, jedes mit seinem eigenen Temperament. Peabody war ein Bär, kräftig, Schutz bietend und immer geneigt loszubrüllen. Nat, der Starke, mit seiner breiten Stirn und dem ruhigen Wesen, war ein Zugpferd. Benno, mit dem zusammen der Junge neuerdings aß, besaß die Verspieltheit einer Ziege. Die gerippte Narbe, die Bennos Mund beim Sprechen nach unten zog, faszinierte den Jungen. Die Wahrsagerin war etwas Fremderes. Madame Ryschkowa war ein Vogel und ein Raubtier zugleich. Trotz ihres hohen Alters bewegte sie sich ruckartig und flink. Sie sah die Leute an, als wären sie ihre Beute, ihr Blick hatte stets etwas Hungriges. Ihre Stimme stellte ihm die Nackenhaare auf.
Nachdem sie in aller Frühe eine Stadt namens Rawlson verlassen hatten, errichteten sie ein neues Lager.
»Dir geht es gut bei mir«, sagte Peabody, fasste den Jungen, der seinen Käfig fegte, bei der Schulter und nahm ihn beiseite. »Es ist an der Zeit, dass wir etwas ändern. Wir können dich nicht auf ewig ›Junge‹ nennen.«
Peabody führte ihn in den Kreis der Wagen, wo ein paar Mitglieder der Truppe Kaninchen und Fisch über dem Feuer brieten. Einige dunkelhäutige Männer, die manch einer vielleicht Zigeuner genannt hätte, waren bei einem Würfelspiel. Susanna, das Schlangenmädchen, dehnte sich an einer Weide und ließ die Gelenke krachen, während Nat im Schneidersitz dahockte, das Miniaturpferd auf dem Schoß hielt und mit dunkler Hand über sein raues Fell strich. Vor Wochen noch hätte dem Jungen das alles Angst gemacht, jetzt zog Peabody ihn zu der Versammlung, und er verspürte nur Neugier.
Peabody fasste den Jungen unter den Achseln, hob ihn hoch in die Luft und setzte ihn auf einen Baumstumpf beim Feuer.
»Freunde und Komplizen.« Seine silbrige Showstimme ließ alle innehalten. »Heute Abend obliegt uns eine anstrengende, aber freudige Pflicht. Ein Wunder reist mit uns in Gestalt dieses jungen Wilden.« Die Truppe kam näher. Wagentüren öffneten sich. Melina, die Jongleurin mit den erstaunlichen Augen, trat näher. Meixel, der kleine blonde Kunstreiter, kam zwischen den Bäumen hervor, bedeckt mit Stroh und Spucke des Lamas. Die Tür Madame Ryschkowas knarzte. »Dieser Bursche tut bei uns seinen Teil der Arbeit und ist auf dem besten Wege, uns reicher zu machen. So ist es denn unsere Pflicht, ihm einen Namen zu geben, damit er eines Tages, meine höchstgeschätzten Freunde, Herr seiner Welt ist.« Ein Scheit im Feuer platzte und schickte einen Funkenwirbel hoch in die Luft, sternengleich. »Einen starken Namen«, sagte Peabody.
»Benjamin«, rief eine Stimme.
»Einen wahren Namen.«
»Peter.«
»Einen Namen, der Bedeutung in sich trägt«, sagte Peabody. Seine Stimme hallte im Inneren des Jungen wider, unausweichlich, füllte ihm juckend den Kopf. Er starrte ins Feuer und spürte, wie sein Herz schneller schlug.
»Er heißt Amos.« Madame Ryschkowas Stimme war leise, und doch schnitten die Worte durch die Luft. »Amos ist der Träger der Bürden, wie es dieser Junge sein wird. Amos ist ein Name, der stark und traurig in dieser Welt besteht.«
»Amos«, sagte Peabody.
Amos, dachte der Junge. Die Augen der Wahrsagerin funkelten ihn an, zwei schwarze Perlen. Der Name klang lang und kurz, rund und flach. Er gehörte ihm.
Meixel holte seine Fiedel und spielte eine fröhliche Melodie, die Susanna tanzen und alle trinken und lachen ließ. Amos sah und hörte eine Weile zu, schlich sich jedoch davon, als er merkte, dass sie ihn wieder vergessen hatten. Die Nacht, in der er seinen Namen erhielt, verbrachte er ausgestreckt auf der Matratze in Peabodys Wagen. Stumm wiederholte er seinen neuen Namen und hörte die Silben so, wie sie auf Madame Ryschkowas Lippen geklungen hatten. Amos, dachte er. Ich bin Amos.
Später kam Peabody in den Wagen, setzte sich und zeichnete in seinem Buch. Es dauerte noch lange, bis er das Licht löschte. Als er es tat, warf er einen Blick über die Schulter auf den Jungen. »Gute Nacht, mein Junge. Schöne Träume, Amos.«
Und Amos lächelte in die Dunkelheit.
3
22. Juni
Es ist eine absurde Zeit für einen Telefonanruf, aber je absurder die Zeit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu Hause ist. Obwohl sich die Sonne gerade erst aus dem Wasser gehoben hat, klingt Mr. Churchwarry, als wäre er schon seit Stunden wach.
»Mr. Churchwarry? Ich bin so froh, dass ich Sie erreiche. Hier ist Simon Watson. Sie haben mir ein Buch geschickt.«
»Oh, Mr. Watson«, sagt er. »Es freut mich zu hören, dass es heil bei Ihnen eingetroffen ist.« Er scheint aufgeregt, fast ein wenig außer Atem zu sein. »Es ist ziemlich fantastisch, nicht wahr? Es tut mir nur leid, dass ich es selbst nicht behalten konnte, aber Marie hätte mich umgebracht, hätte ich einen weiteren Streuner mit nach Hause gebracht.«
»Absolut«, sage ich nachdenklich, und nach einer kurzen Pause: »Ich glaube nicht, dass ich Ihnen folgen kann.«
»Es ist das Berufsrisiko des Buchhändlers. Je länger sie im Geschäft sind, desto stärker verwischt die Grenze zwischen Geschäft und Privatem. Oh, seien wir ehrlich. Da gibt es überhaupt keine Grenze mehr, und Marie, meine Frau, duldet es nicht, wenn ich noch mehr Platz mit Büchern fülle, die ich nicht verkaufen kann, die mir aber gefallen.«
»Verstehe.«
»Aber Sie rufen sicher nicht wegen meiner Frau an. Sie werden eine Frage haben.«
»Ja. Und zwar, woher haben Sie das Buch, und warum haben Sie es gerade mir geschickt?«
»Natürlich, natürlich. Ich habe erwähnt, dass ich auf antiquarische Bücher spezialisiert bin, richtig? Tatsächlich bin ich ein wenig wie ein Spürhund. Ich suche bestimmte Bände und Ausgaben, nach denen meine Kunden verlangen. Ihres war Teil eines Postens in einer Reihe von Nachlassversteigerungen. Speziell darauf hatte ich es eigentlich nicht abgesehen, sondern war einer wunderschönen Ausgabe von Moby-Dick auf der Spur. Ein Kunde von mir leidet da unter einer gewissen Besessenheit.« Da ist ein freundlicher Schwung in seiner Stimme, und ich stelle mir einen älteren Mann wie einen Elfen vor. »Es gab eine 1930er-Lakeside-Press-Ausgabe, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Ich hatte Glück, gewann die Auktion, bekam jedoch etwa zwanzig andere Bände dazu, nichts Besonderes, wenn auch verkäuflich, Dickens, ein paar Woolfs – und dann war da noch Ihr Buch.«
Mein Buch. So habe ich es noch nicht gesehen, obwohl das Leder angenehm in der Hand liegt. »Aus wessen Nachlass?«
»Die Sache wurde von einer Verwaltungsgesellschaft ausgeführt. Ich wollte die Moby-Dick-Ausgabe direkt kaufen, aber sie waren nicht sehr hilfreich. Wenn etwas keine Provenienz hat, ist das Interesse generell gering, und der Posten gehörte zu einem gemischten Ganzen von mehr Umfang als Qualität. Alles zusammen hat einem John Vermillion gehört.«
Den Namen kenne ich nicht. Ich weiß nicht viel von meiner Familie. Dad war ein Einzelkind mit älteren Eltern, die noch vor meiner Geburt starben, und Mom hat nicht lange genug gelebt, um mir viel zu erzählen. »Warum haben Sie das Buch mir und nicht seiner Familie geschickt?«
»Der Name, Verona Bonn. Klingt wunderbar. Die Hälfte des Reizes alter Bücher liegt in den Lebenszeugnissen, die sich in ihnen finden. Die Art, wie der Name geschrieben war, schien Besitz auszudrücken, und das Buch war zu hübsch, um es wegzuwerfen oder weiter verrotten zu lassen, ich selbst konnte es jedoch nicht behalten. Also habe ich dem Namen ein wenig hinterherrecherchiert. Eine Turmspringerin, im Zirkus, wie außergewöhnlich. Ich fand eine Todesnachricht, die mich zu Ihrer Mutter und damit zu Ihnen führte.«
»Ich bezweifle, dass das Buch meiner Großmutter gehört hat«, sage ich. »Soweit ich weiß, hat sie aus einem Koffer gelebt.«
»Nun, dann vielleicht jemand anderem aus der Familie? Oder einem Verehrer Ihrer Großmutter? Die Leute lieben eine gute Geschichte.«
Ja, eine Geschichte. Natürlich sind wir eine gute Geschichte. Plötzlich rutscht meine Hand weg, mein Kaffee landet auf dem Küchenboden und fließt auf dem rissigen Linoleum zusammen.
Ich greife nach einem Küchentuch, um ihn aufzuwischen und stoße die Zuckerdose um. Das alte bittere Gefühl macht sich in meiner Brust breit, die vertraute Empfindung, der tragische Fall der Stadt zu sein. Eine Mutter, die sich ertränkt, ein Vater, der an seiner Trauer stirbt, ein junger Mann, der seine Schwester großzieht.
»Machen Sie das oft? Die Familien von Leuten ausfindig machen, denen Ihre Bücher einmal gehört haben?«
»Öfter, als Sie denken würden, Mr. Watson … Simon. Darf ich Sie Simon nennen?«
Blut pocht aus der Sohle meines Fußes, eine dunkelrote Blüte vermischt sich mit Kaffee und Zucker. Ich muss in eine Scherbe der Tasse getreten sein. »Wenn Sie mögen.«
»Wunderbar. Gerade erst letztes Jahr bin ich auf eine hübsche Ausgabe von Scotts Die Jungfrau vom See gestoßen. Sie hatte einen schön gepolsterten, geprägten Leineneinband. Drinnen lag eine getrocknete Veilchenblüte, mindestens vierzig Jahre alt. Ein kleines Wunder. Die Besitzerin, Rebecca Willoughby, hatte ihren Namen innen auf den Einband geschrieben. Rebecca war natürlich längst verschieden, doch mir gelang es, ihre Nichte ausfindig zu machen, die sich sehr gefreut hat über das Buch, das ihre Tante als Mädchen ganz offenbar geliebt hat. Sie sagte, es sei ein bisschen wie sie noch einmal zu treffen. Ich hatte gehofft, mit diesem Buch etwas Ähnliches auszulösen. Hat es das bei Ihnen?«
Das Gespräch hat Erinnerungen hochgebracht, aber keine angenehmen. »Sie haben mich gefunden, also müssen Sie wissen, dass meine Eltern tot sind.«
Ich höre ein unbeholfenes Husten. »Es tut mir schrecklich leid. Ich entschuldige mich, wenn ich Ihnen Kummer bereitet habe.«
»Es ist lange her.« Ich atme aus. Und das Buch ist faszinierend und irgendwie mit jemandem verbunden, der ein Interesse an meiner Großmutter hatte.
»Ich verstehe, wenn Sie es nicht wollen. Ich würde Sie nur bitten, es mir zurückzuschicken und es nicht wegzuwerfen. Ich bezahle Ihnen gerne das Porto. Es ist ein so hübsches Buch und so alt. Ich denke, ich kann Marie überzeugen, mich doch noch eines behalten zu lassen.«
Der Gedanke, etwas wegzuwerfen, das so viel überlebt hat, ist abscheulich. »Nein, nein, ich behalte es. Und ich bin absolut in der Lage, es sicher zu verwahren. Wie es sich trifft, haben Sie es an die richtige Person geschickt. Ich bin Bibliothekar. Ich arbeite mit Archiven.«
»Das trifft sich wunderbar.« Churchwarry lacht, und ich fange an, seine Freude daran zu verstehen, Bücher weiterzugeben. Es ist ein glücklicher Zufall, ein kleines Licht, das in meiner Brust angegangen ist.
Er bittet mich um einen Gefallen, vorsichtig, als erwarte er meine Ablehnung. »Würden Sie es mich wissen lassen, wenn Sie herausfinden, warum der Name Ihrer Großmutter in dem Buch steht? Es ist natürlich nicht wichtig, ich kenne nur gern die Geschichte meiner Bücher. Das ist so eine Marotte von mir.«
Ich werde dem nachgehen, nicht weil er gefragt hat, sondern weil ich es tun sollte. Zu viel von meiner Familie ist im Nebel der Zeit und des Vergessens verloren gegangen. »Das werde ich«, versichere ich ihm, bevor ich auflege.
Meine Hände fühlen sich groß und ungeschickt an. Ich klebe ein Pflaster auf meinen Fuß, ziehe meine Schuhe an und sehe zu, wie die Sonne über dem Wasser aufsteigt. Den Kaffee und den Zucker wische ich nicht auf. Später. Eine Stunde vergeht, nachdem ich das verwirrende Gespräch mit Churchwarry beendet habe. Wie ich sie verbringe, kann ich nicht sagen.
Um die Tür zu schließen, muss man unvermittelt an ihr ziehen, ohne dieses Überraschungsmoment geht es nicht. Das Haus ist alt, und auch das Wegbrechen des Landes bleibt nicht ohne Folgen. Ich werde die Tür neu ausrichten müssen. Vielleicht kann Frank mir eine passende Angel drehen. Ich werfe das Buch auf den Beifahrersitz und zucke zusammen. Es ist ein Verbrechen, etwas so Altes so zu behandeln.
Die Fahrt zur Grainger-Bibliothek führt quer durch Napawset, durch den drei Blocks Kolonialkästen umfassenden historischen Teil, in dem alles von den Williams stammt (den Brüdern, die die Stadt 1694 unter sich aufteilten), die geschwungene Hafenstraße entlang, vorbei am Jachthafen mit den von Frank so gehassten Fiberglasbooten und zwischen dem Hafen und den von den Touristen so geliebten Kapitänshäusern hindurch. Der Hafen steht voller Autos, die auf die Fähre nach Connecticut wollen, und der Riesenpott hat den Schlund bereits geöffnet und verschlingt Limousinen und Sportwagen. Die Hafenstraße erklimmt einen Hügel mit einem Kloster und sinkt gleich wieder ab, quert das salzige Marschland und wendet sich schließlich dem Inneren der Insel zu. Auf einem flachen Stück Land steht dort die Grainger-Bibliothek.
Leslie und Christina an der Buchausgabe bestätigen, dass ich zu spät bin. So früh am Morgen ist nie jemand da, und die Kinderlesegruppen fangen nicht vor zehn an, aber die Schmach des Zuspätkommens ist dennoch vorhanden, als ich den Gang hinunter am Büro der Direktorin vorbei zu meinem Schreibtisch bei den Nachschlagewerken gehe. Ich höre das hohle Klacken von Janice Kupfermans Absätzen in ihrem Büro. Ja, sie hat mich gesehen.
Mich auf meinen Stuhl gleiten zu lassen, fühlt sich normalerweise an wie ein Nachhausekommen, heute jedoch scheint alles in Schieflage. Ich lege mein Buch auf den Tisch und starre es an. Ich sollte mit den Zuschussanträgen anfangen, oder dem nie enden wollenden Strom von Anschaffungsvorschlägen, die unvermeidlich abgelehnt werden. Nach ein paar Versuchen, unseren Bedarf an einem Update unserer elektronischen Kataloge auszuformulieren, erwische ich mich dabei, die Anfragestapel vor mir anzustarren. Die Grainger ist wie Mehltau und wird von einer Atmosphäre des Verfalls durchweht.