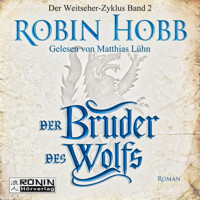9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Seelenschiff-Händler
- Sprache: Deutsch
Um ihr geliebtes Seelenschiff zu retten, muss sie ihre Heimat in größter Not im Stich lassen.
Althea Vestrit hält endlich ihr heiß begehrtes Schiffszeugnis in den Händen und kann nun alles daran setzen, ihre geliebte Viviace – das Seelenschiff ihrer Familie – zurückzugewinnen. Doch der Pirat Kennit hat die Viviace erobert und bemüht sich, die noch junge Persönlichkeit des Seelenschiffes in seinem Sinne zu beeinflussen. Bevor Althea aufbrechen kann, um ihn zu stellen, hält das Schicksal einen weiteren Schlag für sie und ihre Familie bereit: Eine Söldnerflotte nähert sich ihrer Heimat Bingstadt.
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 3 – Der blinde Krieger« und »Die Zauberschiffe 4 – Die Stunde des Piraten«. Diese Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1606
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Althea Vestrit hält endlich ihr heiß begehrtes Schiffszeugnis in den Händen und kann nun alles daran setzen, ihre geliebte Viviace – das Seelenschiff ihrer Familie – zurückzugewinnen. Doch der Pirat Kennit hat die Viviace erobert und bemüht sich, die noch junge Persönlichkeit des Seelenschiffes in seinem Sinne zu beeinflussen. Bevor Althea aufbrechen kann, um ihn zu stellen, hält das Schicksal einen weiteren Schlag für sie und ihre Familie bereit: Eine Söldnerflotte nähert sich ihrer Heimat Bingstadt.
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Von Robin Hobb bei Penhaligon erschienen:
Die Chronik der Weitseher
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten (ab 10/19)
3. Die Tochter des Wolfs (ab 12/19)
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Das Geheimnis der Seelenschiffe
Der Freibeuter
Roman
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »The Liveship Traders 2. Mad Ship« bei Bantam Books, New York.
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 3 – Der blinde Krieger« und »Die Zauberschiffe 4 – Die Stunde des Piraten«. Diese Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 1999 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München
Redaktion: Maike Claußnitzer
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock (Adrian Niederhaeuser; Aprilphoto)
HK · Herstellung: sam
eBook-Erstellung im Verlag
ISBN 978-3-641-25386-8V003
www.penhaligon.de
Frühling
Prolog
Eine Erinnerung an Flügel
Unter den Seeschlangen wogten die Seegraswiesen sacht in der Strömung der Gezeiten. Das Wasser hier war warm, so warm wie damals im Süden, bevor sie emigriert waren. Trotz Maulkins Erklärung, dass sie der Versorgerin mit dem silbrigen Rumpf nicht länger folgen würden, hing ihr lockender Duft dennoch weiter im Salzwasser. Und sie war auch nicht weit entfernt. Sie folgten ihr immer noch, wenn auch in einigem Abstand. Shreeva überlegte, ob sie ihn deswegen zur Rede stellen sollte, entschied sich aber dagegen. Besorgt betrachtete sie ihren Anführer. Die Verletzungen, die Maulkin bei seinem kurzen Kampf mit der weißen Seeschlange davongetragen hatte, heilten nur langsam. Die Wunden beeinträchtigten das Muster seiner Schuppen. Die goldenen Scheinaugen, die über seinen ganzen Körper verteilt waren und ihn als Propheten auswiesen, waren verblasst und schimmerten nur trüb.
Genauso fühlte sich Shreeva, blass und trüb.
Sie waren auf ihrer Suche nach »Der, die sich erinnert« weit gekommen. Maulkin war am Anfang ihrer Odyssee so zuversichtlich gewesen. Jetzt jedoch wirkte er ebenso verwirrt wie Shreeva und Sessurea. Die drei waren die Letzten, die von dem großen Knäuel Seeschlangen geblieben waren, das diese Wanderung einmal begonnen hatte. Die anderen aus ihrem Knäuel hatten das Vertrauen in ihr Unterfangen verloren und sich von Maulkin abgewandt. Als sie sie das letzte Mal gesehen hatten, waren sie einem großen, dunklen Versorger gefolgt und hatten sich ohne Sinn und Verstand an dem widerstandslosen Fleisch satt gefressen, das er ihnen lieferte. Doch das war schon vor vielen Gezeiten gewesen.
»Manchmal«, vertraute Maulkin Shreeva an, als sie ruhten, »manchmal verliere ich meinen festen Punkt in der Zeit. Mir scheint es dann so, als wären wir hier schon einmal entlanggekommen, als hätten wir diese Dinge schon einmal getan, vielleicht sogar diese Worte schon einmal gesprochen. Manchmal ist meine Überzeugung so stark, dass ich glaube, das Heute wäre einfach nur eine Erinnerung oder ein Traum. Dann glaube ich, dass wir eigentlich nichts tun müssen, weil alles, was uns widerfahren ist, erneut geschehen wird. Oder vielleicht sogar längst passiert ist.« Seine Stimme klang schwach und war ohne rechte Überzeugung.
Sie glitt neben ihn. Sie schwammen nebeneinander, wobei sie ihre Körper wellenförmig bewegten, und wedelten dabei nur so viel mit den Flossen, wie nötig war, um ihre Position zu halten. Unter ihnen schüttelte Sessurea plötzlich die Mähne und stieß eine schwache Giftwolke aus, um sie zu warnen. »Seht! Nahrung!«, bellte er.
Eine Schule von Fischen kam silbrig schimmernd wie ein Segel auf sie zugeschwommen. Hinter den Fischen folgte ein anderes Knäuel von Seeschlangen. Sie hingen wie Schatten über dem Fischschwarm und fraßen von seinem Rand. Es waren drei rote, eine grüne und zwei blaue. Das Knäuel der Jäger war zwar nicht groß, aber sie wirkten lebhaft und gesund. Ihre glänzenden Häute und ihre prallen Körper bildeten einen auffälligen Kontrast zu den matten Schuppen und eingesunkenen Flanken von Maulkins Knäuel.
»Kommt«, forderte Maulkin sie auf und führte sie zu den anderen, um gemeinsam mit ihnen zu fressen. Shreeva gab ein erleichtertes Trompeten von sich. Endlich konnten sie wieder ihre Bäuche füllen. Vielleicht gesellten sich die anderen ja sogar zu Maulkins Knäuel, sobald sie merkten, dass er ein Prophet war.
Ihre Beute waren keine einzelnen Fische, sondern eine ganze Schule, die silbrig glitzerte und das Auge verwirrte. Sie bewegten sich wie eine einzige Kreatur, und doch war es ein Geschöpf, das sich plötzlich aufteilen und um einen ungeschickten Jäger herumfließen konnte. Die Schlangen aus Maulkins Knäuel waren jedoch alles andere als ungeschickte Jäger, und alle drei folgten elegant den Fischen. Das andere Knäuel trompetete ihnen Warnungen zu, aber Shreeva konnte keine Gefahr entdecken. Mit einem kurzen Schlag ihres Schwanzes glitt sie in die Schule und packte mit dem aufgerissenen Maul mindestens drei Fische. Sie weitete ihren Hals, um sie zu schlucken.
Zwei rote Seeschlangen wandten sich plötzlich zur Seite und griffen Maulkin an. Sie schlugen mit den Schnauzen nach ihm, als wäre er ein Hai oder ein anderer gemeinsamer Feind. Die Blauen stürzten sich mit weit aufgerissenen Mäulern auf Shreeva. Mit einer kurzen Drehung wich sie ihnen aus und schoss in die andere Richtung davon. Sie sah, wie der andere Rote versuchte, Sessurea zu umschlingen. Seine Mähne war aufgerichtet, und er spie Gift, stieß Obszönitäten und Drohungen aus. Seine Beschimpfungen entbehrten jedes Sinnes, ja sogar jeder Syntax. Sie spiegelten nur nackte Wut.
Shreeva floh und schrie ihre Angst und Verwirrung heraus. Maulkin folgte ihr jedoch nicht. Er schüttelte die gewaltige Mähne und stieß eine Giftwolke aus, die die Roten beinahe gelähmt hätte. Die Angreifer wichen zurück, schwangen die offenen Mäuler und pumpten mit den Kiemen, um die Gifte wegzuspülen.
»Was ist los mit euch?«, fuhr Maulkin das merkwürdige Knäuel an. Er drehte sich durch einen Knoten und richtete die Mähne drohend auf, während er sie schalt. Seine Scheinaugen schimmerten schwach. »Warum greift ihr uns wie seelenlose Biester an, die sich um Nahrung streiten? Das ist nicht unsere Art! Selbst wenn es nur wenige wären, Fisch gehört immer dem, der ihn fängt, nicht dem, der ihn zuerst gesehen hat! Habt ihr gänzlich vergessen, wer ihr seid und was ihr seid? Hat man euch denn vollkommen den Verstand gestohlen?«
Einen Augenblick schwebten die Seeschlangen des anderen Knäuels bewegungslos im Wasser, bis auf das leichte Zucken ihrer Schwänze, mit denen sie ihre Position korrigierten. Der Fischschwarm floh unbeachtet. Doch als ob die Vernunft in Maulkins Worten sie noch mehr angestachelt hätte, stürzten sie sich plötzlich auf ihn. Alle sechs schossen auf ihn zu, rissen die Mäuler weit auf, zeigten die Zähne, hatten die Mähnen aufgestellt und verströmten ihr Gift, während sie mit den Schwänzen schlugen. Shreeva sah entsetzt mit an, wie sie ihn umklammerten und in den Schlamm hinunterzogen.
»Hilf mir!«, trompetete Sessurea. »Sie werden ihn sonst ersticken!«
Seine Worte brachen ihre Lähmung. Seite an Seite schossen sie hinunter und stürzten sich, stoßend und mit den Schwänzen schlagend, auf das Knäuel, das Maulkin gefangen hielt. Die anderen Seeschlangen bearbeiteten Maulkin mit den Zähnen, als wäre er Beute. Sein Blut vermischte sich mit seinen Giften in einer erstickenden Wolke, während er sich heftig wehrte. Seine Scheinaugen glommen in dem aufsteigenden Schlamm. Shreeva schrie auf, entsetzt über die sinnlose Brutalität dieser Attacke. Dennoch schnappte sie mit den Zähnen nach ihnen, während Sessurea seine größere Körperlänge nutzte und mit dem Schwanz nach ihnen schlug.
Im richtigen Moment umschlang er Maulkins übel zugerichteten Körper mit seinem und riss ihn mitten aus dem wütenden Knäuel heraus. Er floh mit Maulkin im Griff. Shreeva war froh, dass sie den Angriff abbrechen und ihm folgen konnte. Die anderen setzten ihnen nicht nach. In ihrem vergifteten Wahn stürzten sich die Mitglieder des anderen Knäuels aufeinander, brüllten Beleidigungen und Drohungen. Ihre Schreie waren bloße Klänge, die sie ohne jeden Sinn und Verstand ausstießen, während sie aneinander rissen und sich schlugen. Shreeva sah nicht zurück.
Als sie einige Zeit später den heilenden Schleim aus ihrem Körper auf Maulkins Wunden rieb, sagte er: »Sie haben es vergessen. Sie haben vollkommen vergessen, wer und was sie waren. Es ist einfach zu lange her, Shreeva. Sie haben jeden Fetzen Erinnerung und Sinn verloren.« Er zuckte zusammen, als sie einen abgerissenen Hautfetzen wieder an seine Stelle schob und mit etwas Schleim versiegelte. »Sie sind das, was aus uns werden wird.«
»Schh«, erwiderte Shreeva zärtlich. »Schh. Ruh dich aus.« Sie umschlang ihn noch enger mit ihrem langen Körper und verankerte ihren Schwanz um einen Felsen, damit sie nicht von der Strömung weggerissen wurden. Sessurea hatte sich ebenfalls mit ihnen verwoben und schlief bereits. Vielleicht war er aber auch einfach nur schweigsam und passiv, Opfer derselben Entmutigung, die auch an Shreeva nagte. Hoffentlich war das nicht so. Ihr war kaum genug Mut geblieben, um ihre eigene Entschlossenheit aufrechtzuerhalten.
Aber am meisten sorgte sie sich um Maulkin. Ihre Begegnung mit der silbernen Versorgerin hatte ihn verändert. Die anderen Versorger, die durch die Leere und die Fülle glitten, waren bloße Nahrungsquellen. Aber die silberne war anders gewesen. Ihr Duft hatte in allen Erinnerungen geweckt. Sie waren ihr gefolgt, weil sie davon überzeugt waren, dass ihr Duft sie zu »Der, die sich erinnert« führen würde. Stattdessen jedoch war sie nicht einmal von ihrer Art gewesen. Voller Hoffnung hatten sie sie trotzdem angerufen, aber sie hatte nicht geantwortet. Doch der weißen Seeschlange, die an ihrer Seite gebettelt hatte, hatte sie Fleisch gegeben. Maulkin hatte sich von ihr abgewandt, verkündet, sie könne nicht »Die, die sich erinnert« sein, und gesagt, er wolle ihr nicht länger folgen. Doch seitdem war in allen Gezeiten ihr Duft präsent gewesen. Sie mochte außer Sicht sein, aber Shreeva wusste, dass sie nicht weit entfernt war. Maulkin folgte ihr immer noch, und sie folgten noch immer ihm.
Maulkin stöhnte und rührte sich in ihrer Umklammerung. »Ich fürchte, es ist das letzte Mal, dass einer von uns diese Reise als etwas anderes als ein bloßes Vieh unternimmt.«
»Was meinst du damit?«, wollte Sessurea wissen. Er drehte sich umständlich herum, bis sich ihre Augen gegenüberlagen. Er hatte selbst viele Verletzungen davongetragen, aber keine war wirklich gefährlich. Eine tiefe Wunde an einer seiner Giftdrüsen unmittelbar hinter seinem Kiefergelenk war die schlimmste. Wäre der Biss tiefer gegangen, hätten seine eigenen Gifte ihn getötet. Das Knäuel hatte Glück gehabt, dass es noch existierte.
»Sucht eure Erinnerungen ab«, befahl Maulkin tonlos. »Durchforstet nicht nur die Gezeiten und die Tage, sondern die Jahreszeiten und die Jahre, Jahrzehnte auf Jahrzehnte. Wir waren schon einmal hier, Sessurea. Alle Knäuel sind ausgeschwärmt und in diese Gewässer gewandert, und zwar nicht nur einmal, sondern unzählige Male. Wir sind hergekommen, um die zu suchen, die sich erinnern, die wenigen, denen die gesamten Erinnerungen unserer Art anvertraut worden sind. Das Versprechen war eindeutig. Wir sollten uns versammeln. Wir würden unsere Geschichte zurückbekommen, und wir würden an einen sicheren Ort gelangen, an dem wir unsere Transformation vollziehen könnten. Dort würden wir wiedergeboren werden. Trotzdem wurden wir immer und immer wieder enttäuscht. Zyklus auf Zyklus sind wir ausgeschwärmt und haben gewartet. Ebenso oft haben wir unsere Hoffnungen begraben, unseren Zweck vergessen und sind schließlich wieder in die südlichen Gewässer zurückgeschwommen. Und jedes Mal haben die von uns, die noch über eine Handvoll Erinnerungen verfügten, gesagt: ›Vielleicht haben wir uns geirrt. Vielleicht war das nicht die Zeit, nicht die richtige Jahreszeit, und die Erneuerung kommt erst nächstes Jahr.‹ Aber so war es nicht. Wir haben uns nicht geirrt. Diejenigen, die uns treffen sollten, haben versagt. Sie sind nicht gekommen. Damals nicht, und vielleicht kommen sie auch diesmal nicht.«
Maulkin verstummte. Shreeva sicherte ihn immer noch gegen den Strom des Wassers. Es gab keinen wohltuenden Schlamm, in den man sich hätte verkriechen können, nur grobes Seegras, Steine und Felsbrocken. Sie hätten sich einen besseren Platz zum Rasten aussuchen sollen. Doch bis Maulkin wieder genesen war, wollte sie nicht reisen. Außerdem, wohin sollten sie sich wenden? Sie waren in dieser Strömung voller merkwürdiger Salze auf und ab geschwommen, und sie hatte den Glauben daran verloren, dass Maulkin wusste, wohin er sie führte. Und wenn sie sich selbst überlassen waren, wohin sollten sie gehen? Die Frage schien sie plötzlich niederzudrücken, und sie wollte einfach nicht darüber nachdenken.
Sie reinigte die Linse ihrer Augen und sah dann an ihrem Körper entlang, der mit denen der anderen verschlungen war. Das Rot ihrer Schuppen war hell und strahlend, aber vielleicht wirkte das auch nur im Vergleich zu Maulkins trüber Haut so. Seine goldenen Scheinaugen schimmerten blassbraun. Die eiternden Bisswunden entstellten sie. Er brauchte Futter, Wachstum und eine neue Haut. Dann würde er sich wieder besser fühlen. Sie alle würden sich dann besser fühlen. Shreeva äußerte diesen Gedanken laut. »Wir müssen fressen. Wir sind alle ganz schwach vor Hunger. Meine Giftsäcke sind beinahe leer. Vielleicht sollten wir nach Süden gehen, wo es mehr Nahrung gibt und das Wasser warm ist.«
Maulkin drehte sich in ihrer Umschlingung herum und sah sie an. Seine großen Augen verfärbten sich kupfern vor Sorge. »Du verschwendest zu viel von deiner Kraft an mich, Shreeva«, tadelte er sie. Sie spürte, wie viel Mühe es ihn kostete, seine Mähne freizuschütteln und sie aufzurichten. Ein zweiter Ruck löste eine schwache Wolke seines Giftes aus. Es reizte und weckte sie, erneuerte ihre Bewusstheit. Sessurea beugte sich dichter zu ihnen heran und umwickelte sie mit seinem längeren Körper. Er nahm Maulkins Gifte in sich auf, sog sie mit pumpenden Kiemen ein.
»Alles wird gut«, versuchte Sessurea sie zu beruhigen. »Du bist nur müde. Und hungrig. Wie wir alle.«
»Todmüde«, bestätigte Maulkin erschöpft. »Und fast wahnsinnig vor Hunger. Die Entbehrungen des Körpers beeinträchtigen das Funktionieren des Geistes. Aber hört mir zu, ihr beiden. Hört mir zu und merkt es euch und haltet euch daran. Wenn alles andere vergessen ist, hegt und pflegt diesen Gedanken: Wir können nicht wieder nach Süden gehen. Wenn wir diese Gewässer verlassen, dann ist es endgültig. Solange wir denken können, müssen wir hier bleiben und nach ihr suchen, nach ›Einer, die sich erinnert‹. Ich weiß es instinktiv. Wenn wir diesmal nicht wiedergeboren werden, dann werden wir uns niemals erneuern. Wir und alle von unserer Art werden untergehen und von da an für immer unbekannt sein im Meer, in der Luft oder auf dem Land.« Er sprach die merkwürdigen Worte langsam aus, und einen Moment glaubte Shreeva, sie könnte sich an das erinnern, was sie bedeuteten. Nicht die Fülle oder die Leere. Die Erde, der Himmel und das Meer, die drei Teile ihres Hoheitsgebietes und früher einmal die drei Sphären von … von irgendetwas.
Maulkin schüttelte erneut seine Mähne. Diesmal öffneten Shreeva und Sessurea die Kiemen weit, um seine Gifte und die darin enthaltenen Erinnerungen tief in sich einzusaugen. Shreeva sah auf die behauenen Felsbrocken hinunter, die sich auf dem Meeresboden türmten, auf die Schichten von Muscheln und das Seegras, das wie ein verhüllender Vorhang über dem Bogen des Eroberers hing. Der schwarze Stein, den silbrige Adern durchzogen, schien nur an wenigen Stellen hindurch. Die Erde hatte ihn in einem gewaltigen Beben heruntergeworfen, und das Meer hatte ihn geschluckt. Früher einmal, vor Äonen, war sie auf diesem Bogen gelandet, hatte die gewaltigen Schwingen ausgebreitet und dann hinter ihren Schultern zusammengefaltet. Sie hatte dem Gefährten ihre Freude in dem frischen Morgenregen zutrompetet, und ein strahlender blauer Drache hatte ihr seine Antwort entgegengeschmettert. Früher einmal hatten die Uralten ihre Ankunft mit Blumen und Willkommensrufen begrüßt. Früher einmal, in dieser Stadt unter einem strahlend blauen Himmel …
Es verblasste. Und es ergab keinen Sinn. Die Bilder verflogen wie Träume nach dem Erwachen.
»Seid stark!«, forderte Maulkin. »Wenn es uns nicht bestimmt sein sollte zu überleben, dann wollen wir wenigstens bis zum Ende kämpfen. Soll uns doch das Schicksal auslöschen, nicht unsere eigene Verzagtheit. Um des Schicksals unserer ganzen Art willen sollten wir dem treu sein, was wir sind.« Sein Kamm stand aufgerichtet und giftig von seinem Hals ab. Wieder einmal sah er aus wie der visionäre Führer, der vor so langer Zeit Shreevas Loyalität gewonnen hatte. Ihr Herz schwoll an vor Liebe zu ihm.
Plötzlich verdunkelte sich die Welt, und sie hob den Blick zu dem großen Schatten, der über ihnen entlangschwebte. »Nein, Maulkin«, trompetete sie leise. »Wir sind nicht dem Untergang geweiht und auch nicht dem Vergessen. Sieh nur!«
Ein dunkler Versorger glitt träge über ihnen dahin. Als er sich direkt über ihren Köpfen befand, warf er ihnen Futter zu. Das Fleisch sank langsam zu ihnen herab und bewegte sich sacht in der Strömung hin und her. Es waren tote Zweibeiner. An einem hing noch eine Kette. Sie würden nicht um ihre Nahrung kämpfen müssen. Sie brauchten sie nur zu akzeptieren.
»Kommt«, drängte sie Maulkin, als Sessurea sich von ihnen löste und eilig dem Futter entgegenschwamm. Sanft zog sie Maulkin mit sich, als sie sich erhob, um die Spende des Versorgers in Empfang zu nehmen.
1Das verrückte Schiff
Die Brise wehte kalt und frisch über sein Gesicht und seine Brust, aber etwas in ihr versprach die baldige Ankunft des Frühlings. Die Luft schmeckte nach Jod, und es herrschte Ebbe. Der Saum aus Seetang direkt an der Wasserlinie war deutlich zu erkennen. Der grobe Sand unter seinem Rumpf war noch feucht von den starken Regenfällen der letzten Tage. Und der Rauch von Ambers Feuer kitzelte ihn in der Nase. Die Galionsfigur drehte den Kopf zur Seite und kratzte sich.
»Es ist ein schöner Abend, findest du nicht?«, fragte Amber im Plauderton. »Der Himmel ist ganz klar. Da sind zwar noch ein paar Wolken, aber ich kann den Mond und sogar ein paar Sterne sehen. Ich habe Muscheln gesammelt und sie in Algen eingewickelt. Sobald das Feuer stärker brennt, nehme ich ein bisschen Holz weg und koche sie auf den glühenden Steinen.« Sie machte eine erwartungsvolle Pause.
Paragon antwortete nicht.
»Möchtest du welche probieren, wenn sie gar sind? Ich weiß, dass du nicht essen musst, aber vielleicht findest du die Erfahrung interessant.«
Er gähnte, reckte sich und verschränkte dann die Arme vor der Brust. Er war viel besser in diesem Spiel als sie. Dreißig Jahre Zwangspause am Strand hatten ihn wahre Geduld gelehrt. Wie sie wohl heute Abend reagieren würde? Wütend oder traurig?
»Was nützt es uns beiden, wenn du dich weigerst, mit mir zu sprechen?«, fragte sie. Er spürte, dass ihre Geduld allmählich schwächer wurde. Aber er machte sich nicht einmal die Mühe, die Schultern zu zucken.
»Paragon, du bist ein hoffnungsloser Idiot! Warum sprichst du nicht mit mir? Begreifst du denn nicht, dass ich die Einzige bin, die dich retten kann?«
Wovor retten?, hätte er gefragt. Wenn er mit ihr geredet hätte.
Paragon hörte, wie sie aufstand und um ihn herum zu seinem Bug ging. Gelassen drehte er den Kopf von ihr weg.
»Na gut, dann tu so, als ob du mich ignorierst. Mir ist es gleich, ob du mir antwortest oder nicht, aber du musst zumindest zuhören, was ich dir zu sagen habe. Du schwebst in Gefahr, und zwar in einer sehr konkreten Gefahr. Ich weiß, du willst nicht, dass ich dich von deiner Familie loskaufe, aber ich habe ihnen trotzdem ein Angebot gemacht. Sie haben es abgelehnt.«
Paragon ließ sich zu einem kurzen, verächtlichen Schnauben herab. Natürlich hatten sie das getan. Er war das Seelenschiff der Familie Lutglück. Sie würden ihn niemals verkaufen, ganz gleich, wie sehr er in Ungnade gefallen war! Zwar hatten sie ihn dreißig Jahre lang auf diesem Strand vertäut liegen lassen, aber sie hatten ihn niemals verkauft! Weder an Amber noch an die Neuen Händler. Das würden sie auch nicht tun. Das hatte er die ganze Zeit über gewusst.
Amber ließ nicht locker. »Ich habe direkt mit Amis Lutglück gesprochen. Es war nicht gerade leicht, zu ihr vorzudringen. Als wir uns unterhielten, tat sie, als wäre sie schon von meinem bloßen Angebot schockiert. Sie behauptete, dass du nicht zu verkaufen wärst, zu keinem Preis. Und sie hat dasselbe wiederholt, was du gesagt hast, nämlich dass keine Händlersippe aus Bingstadt ihr Seelenschiff verkaufen würde. Dass man so etwas einfach nicht täte.«
Paragon konnte sich das Lächeln nicht verkneifen, das ihn unwillkürlich überkam. Er war ihnen also noch nicht gleichgültig. Wie hatte er das jemals bezweifeln können? In gewisser Weise war er geradezu froh, dass Amber dieses lächerliche Kaufangebot gemacht hatte. Jetzt, da Amis Lutglück einer Fremden gegenüber zugegeben hatte, dass er immer noch zu ihrer Familie gehörte, würde sie sich vielleicht auch bewegt fühlen, ihm einen Besuch abzustatten. Und wenn Amis ihn erst einmal besucht hatte, konnte das möglicherweise noch ganz andere Dinge nach sich ziehen. Vielleicht würde er sogar bald wieder die Meere befahren, mit einer wohlwollenden Hand am Ruder. Seine Phantasie trug ihn davon.
Doch Ambers Stimme riss ihn abrupt wieder in die Realität zurück. »Sie tat, als wäre sie sogar darüber entsetzt, dass Gerüchte in Umlauf sind, sie würde dich verkaufen wollen. Ihren Worten nach beleidige das die Familienehre. Und dann sagte sie …« Ambers Stimme wurde plötzlich ganz leise, und ein Unterton von Angst schwang darin mit. »Sie sagte, dass sie einige Männer engagiert hätte, die dich von Bingstadt wegschleppen würden. Dass es vielleicht besser wäre, wenn du außer Sicht kämst und niemand mehr an dich dächte.« Amber machte eine bedeutungsvolle Pause.
Paragon fühlte, wie sich etwas in seiner Brust aus Hexenholz zusammenzog.
»Deshalb habe ich sie gefragt, wen sie denn engagiert hätte.«
Er hob beide Hände und stopfte sich die Finger in die Ohren. Er wollte nicht zuhören. Sie wollte ihm nur Angst machen. Seine Familie wollte ihn also wegschleppen. Das musste noch gar nichts bedeuten. Es war vielleicht ganz nett, einmal woanders zu sein. Vielleicht würden sie ihn diesmal ja sogar aufbocken, wenn sie ihn an Land zogen. Er hatte es satt, immer Schlagseite zu haben.
»Sie erwiderte, das würde mich nichts angehen.« Ambers Stimme wurde lauter. »Dann habe ich sie gefragt, ob es Bingstädter Händler wären. Sie hat mich nur angesehen. Also habe ich sie ganz direkt gefragt, ob Mingsleh dich irgendwo hinbringen würde, um dich anschließend auseinandernehmen zu lassen.«
Paragon begann verzweifelt zu summen. Laut. Amber redete weiter, aber er konnte sie nicht hören. Er wollte sie nicht hören. Er schob die Finger weiter in die Ohren und sang aus Leibeskräften: »Ein Pfennig für ein süßes Brötchen, ein Pfennig für eine Pflaume, ein Pfennig für die Rennen, um die Pferdchen laufen zu sehen …«
»Sie hat mich rausgeworfen!«, schrie Amber. »Als ich draußen war und ihr zugerufen habe, dass ich diese Sache vor den Rat bringen würde, hat sie ihre Hunde auf mich gehetzt. Sie hätten mich fast erwischt!«
»Schwing mich tief, schwing mich hoch, schwing mich bis in den Himmel hinauf.« Paragon sang verzweifelt sein Kinderlied. Sie irrte sich, sie musste sich irren. Seine Familie würde ihn irgendwohin in Sicherheit bringen. Das war alles. Es spielte nicht die geringste Rolle, wen sie dafür engagiert hatten. Sobald sie ihn zu Wasser gelassen hatten, würde er bereitwillig segeln. Er würde ihnen zeigen, wie einfach es sein konnte, ihn zu segeln. Ja. Das war eine Chance, sich ihnen zu beweisen. Er konnte ihnen zeigen, dass ihm all das leidtat, wozu sie ihn gebracht hatten.
Sie redete nicht mehr weiter. Er sang langsamer und summte schließlich nur noch. Bis auf seine eigene Stimme herrschte Ruhe. Vorsichtig nahm er die Finger aus den Ohren. Nichts war mehr zu hören bis auf das Klatschen der Wellen, den Sand, den der Wind über den Strand trieb, und das Knacken von Ambers Feuer. Plötzlich schoss ihm eine Frage durch den Kopf, und er sprach sie laut aus, bevor ihm einfiel, dass er gar nicht mit ihr hatte sprechen wollen.
»Wirst du mich auch an meinem neuen Platz besuchen?«
»Paragon, du kannst das nicht einfach verdrängen. Wenn sie dich hier wegholen, dann werden sie dich wegen deines Hexenholzes auseinandernehmen.«
Die Galionsfigur erwiderte: »Das ist mir egal. Es wäre ganz schön, tot zu sein.«
Amber klang leise und verzagt. »Ich weiß nicht, ob du dann wirklich tot bist. Ich fürchte, sie werden dich von dem Rest des Schiffs trennen. Wenn dich das nicht umbringen sollte, werden sie dich nach Jamaillia bringen und dort als Monstrosität verkaufen. Oder dich dem Satrapen zum Geschenk machen, im Tausch gegen Ländereien und andere Gefälligkeiten. Ich weiß nicht, wie du dort behandelt wirst.«
»Wird es wehtun?«, fragte Paragon.
»Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß zu wenig über das, was du bist. Hat es … Als sie dein Gesicht zerhackt haben, hat das wehgetan?«
Er wandte sein entstelltes Gesicht von ihr ab, hob die Hände und fuhr mit den Fingern über das zersplitterte Holz, wo einmal seine Augen gewesen waren. »Ja.« Er runzelte die Stirn. Doch im nächsten Atemzug fügte er hinzu: »Ich erinnere mich nicht mehr. Es gibt eine Menge, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Meine Logbücher sind verschwunden.«
»Manchmal ist es das Bequemste, wenn man sich nicht erinnert.«
»Also glaubst du, dass ich lüge, ja? Du glaubst, ich könnte mich erinnern, wenn ich nur wollte, hm?« Er sagte das, weil er hoffte, damit einen Streit vom Zaun brechen zu können.
»Paragon, wir können das Gestern nicht ändern. Wir sprechen vom Morgen.«
»Sie kommen schon morgen?«
»Das weiß ich nicht! Es war nur ein Bild, eine Metapher.« Sie trat näher heran und legte die Hände flach auf seinen Rumpf. Wegen der Kälte trug sie Handschuhe, aber er fühlte die Umrisse ihrer Hände als zwei warme Flecken an seiner Beplankung. »Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, dass sie dich einfach in Stücke hacken. Selbst wenn es nicht wehtun sollte und auch wenn es dich nicht umbringt. Ich ertrage diesen Gedanken nicht.«
»Du kannst nichts dagegen tun«, erklärte er. Plötzlich hielt er es für angebracht, diese Überlegung zu äußern. »Wir können beide nichts dagegen tun.«
»Das ist fatalistisches Gerede«, erklärte Amber wütend. »Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich schwöre dir, dass ich mich hier hinstelle und gegen sie kämpfe.«
»Du könntest nicht gewinnen«, erwiderte Paragon. »Es wäre dumm zu kämpfen, wenn du von vornherein weißt, dass du nicht gewinnen kannst.«
»Das mag sein«, antwortete Amber. »Und hoffentlich kommt es erst gar nicht dazu. Ich habe nicht vor zu warten, bis die Lage so verzweifelt wird. Ich will handeln, bevor sie es tun. Paragon, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen jemanden, der sich beim Händlerrat für uns einsetzt.«
»Kannst du das nicht tun?«
»Das weißt du genau. Nur ein Alter Händler kann an diesen Versammlungen teilnehmen. Wir brauchen jemanden, der zu ihnen geht und sie überredet, den Lutglücks das zu verbieten.«
»Aber wen?«
»Ich hatte gehofft, du wüsstest jemanden, der für uns spricht«, antwortete Amber kläglich.
Paragon dachte eine Weile schweigend nach. Dann lachte er barsch auf. »Für mich wird sich niemand einsetzen. Das ist vergebliche Liebesmüh, Amber. Denk nach. Nicht einmal meine eigene Familie kümmert sich um mich. Ich weiß, was man über mich sagt. Ich wäre ein Mörder. Und das Schlimme daran ist, es stimmt, oder etwa nicht? Ich habe ganze Besatzungen verloren. Ich bin gekentert und habe sie alle ertränkt, und das nicht nur einmal. Die Lutglücks haben recht, Amber. Sie sollten mich verkaufen und in Stücke hauen lassen.« Verzweiflung überkam ihn, eisiger und stärker als jede Sturmwelle. »Ich wäre gern tot«, erklärte er. »Ich würde gern enden.«
»Das willst du nicht wirklich«, widersprach Amber leise. Doch er erkannte an ihrem Tonfall, dass sie es wusste. Er meinte es ernst.
»Würdest du mir einen Gefallen tun?«, fragte er schließlich.
»Was für einen?«
»Töte mich, bevor sie es können.«
Er hörte, wie sie nach Luft schnappte. »Ich … Nein, das könnte ich nicht.«
»Wenn du wüsstest, dass sie kommen, um mich in Stücke zu hacken, könntest du es. Ich werde dir die einzige sichere Methode verraten. Du musst auf mir Feuer legen. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen gleichzeitig, damit niemand es löschen und mich retten kann. Wenn du trockenes Holz sammelst, jeden Tag ein bisschen, und es in meinen Laderäumen aufschichtest, dann …«
»Sprich nicht einmal von solchen Dingen«, erwiderte Amber schwach. Zerstreut fügte sie hinzu: »Ich koche jetzt die Muscheln.« Er hörte, wie sie im Feuer stocherte, und dann zischte das feuchte Seegras auf den heißen Kohlen. Sie kochte die Muscheln bei lebendigem Leib. Sollte er sie darauf hinweisen? Das würde sie nur aufregen, sie jedoch nicht unbedingt für seine Sache einnehmen. Er wartete, bis sie wieder zu ihm kam. Sie setzte sich in den Sand und lehnte sich an seinen Rumpf. Ihr Haar war sehr fein. Als es an seinen Planken vorbeistrich, verfing es sich in den Fasern und blieb am Holz hängen.
»Das ergibt wenig Sinn«, meinte er freundlich. »Du hast geschworen, du würdest hier bleiben und für mich kämpfen, obwohl du weißt, dass du verlieren musst. Aber diese einfache, sichere Gnade verweigerst du mir.«
»Tod durch Verbrennen ist alles andere als eine Gnade.«
»Sicher. Wenn man in Stücke gehackt wird, ist das vermutlich weit angenehmer«, konterte Paragon sarkastisch.
»Du wechselst so schnell von kindlicher Wut zu eiskalter Logik«, erklärte Amber nachdenklich. »Bist du ein Kind oder ein Mann? Was bist du wirklich?«
»Vielleicht beides. Aber du lenkst ab. Komm schon, versprich es mir.«
»Nein«, erwiderte sie flehentlich.
Paragon seufzte. Sie würde es tun. Er hörte es in ihrer Stimme. Wenn es keinen anderen Weg gab, ihn zu retten, dann würde sie es tun. Ein merkwürdiger Schauer überlief ihn. Es war ein seltsamer Sieg, den er da errungen hatte. »Und Ölfässer«, sagte er. »Wenn sie kommen, bleibt dir vielleicht nicht mehr viel Zeit. Öl lässt das Holz schneller brennen. Und heißer.«
Ein langes Schweigen folgte seinen Worten. Als sie wieder sprach, hatte sich ihre Stimme verändert. »Sie werden versuchen, dich heimlich zu verlegen. Sag mir, wie sie es machen werden.«
»Vermutlich auf dieselbe Weise, wie sie mich an Land gezogen haben. Wahrscheinlich nutzen sie die höchste Flut des Monats, in der Nacht. Sie kommen mit Walzen, Eseln, Männern und kleinen Booten. Natürlich ist das kein leichtes Unterfangen, aber erfahrene Leute sollten es schnell bewerkstelligen können.«
Amber dachte nach. »Ich muss meine Sachen in deinen Laderaum bringen. Wenn ich dich bewachen soll, muss ich an Bord schlafen. Ach, Paragon«, rief sie plötzlich. »Hast du wirklich niemanden, der sich beim Händlerrat für dich einsetzen würde?«
»Nur dich.«
»Ich werde es versuchen. Aber ich bezweifle, dass sie mir eine Chance geben werden. In Bingstadt bin ich eine Außenseiterin. Sie hören gewöhnlich nur auf ihresgleichen.«
»Du hast mir einmal gesagt, dass du in Bingstadt respektiert wirst.«
»Das stimmt. Sie respektieren mich als Künstlerin und Geschäftsfrau. Aber ich bin keine Alte Händlerin. Sie hätten nicht viel Nachsehen mit mir, wenn ich mich in ihre Angelegenheiten einmischen würde. Vermutlich säße ich dann bald ohne Kunden da. Oder es würde etwas noch Schlimmeres passieren. Durch die ganze Stadt zieht sich eine Kluft zwischen Alten Händlern und Neuen Sippen. Es kursiert sogar das Gerücht, dass der Rat von Bingstadt eine Delegation mit der Originalcharta zum Satrapen geschickt hat. Sie verlangen, dass er sich an das Wort hält, das ihnen einst der Satrap Esclepius gegeben hat. Und angeblich bestehen sie weiterhin darauf, dass der Satrap alle Neuen Händler zurückruft und die Landschenkungen an sie zurücknimmt. Sie wollen den Satrapen Cosgo auffordern, sich in Zukunft an die Originalcharta zu halten und von weiteren Landschenkungen ohne die Einwilligung der Bingstädter Händler Abstand zu nehmen.«
»Ein sehr genaues Gerücht«, bemerkte Paragon.
»Ich habe ein sehr scharfes Ohr für Gerüchte und Klatsch. Und das hat mir mehr als einmal das Leben gerettet.«
Sie schwiegen.
»Ich wünschte, ich wüsste, wann Althea zurückkommt«, sagte Amber plötzlich sehnsüchtig. »Ich könnte sie bitten, für uns zu sprechen.«
Paragon spielte mit dem Gedanken, Brashen Trell zu erwähnen. Brashen war sein Freund. Brashen würde für ihn sprechen. Brashen war ein Alter Händler. Aber noch während er das dachte, fiel ihm wieder ein, dass Brashen enterbt worden war. Für die Familie Trell war Brashen genauso eine Schande wie Paragon für die Lutglücks. Es wäre nicht gut, wenn Brashen sich für ihn einsetzte, selbst wenn er den Rat dazu bringen könnte, ihn anzuhören. Es war, als würde ein schwarzes Schaf zugunsten eines anderen sprechen. Niemand würde sich davon beeindrucken lassen. Er legte die Hand über die Narbe auf seiner Brust und verdeckte kurz den primitiven siebenzackigen Stern, der ihn brandmarkte. Nachdenklich strich er mit den Fingern darüber, seufzte und holte dann tief Luft.
»Die Muscheln sind gar. Ich kann sie riechen.«
»Möchtest du eine kosten?«
»Warum nicht?« Er sollte alles Neue ausprobieren, solange er es noch konnte. Vielleicht dauerte es nicht mehr lange, bis er nie mehr die Möglichkeit hatte, Neues zu erfahren.
2Das Bein des Piraten
»Damals im Kloster hat Berandol immer gesagt, dass der beste Weg, Angst zu vertreiben und zu einer Entscheidung zu kommen, der wäre, sich die schlimmsten Konsequenzen seiner Handlungen auszumalen.« Nach einem Moment fügte Wintrow hinzu: »Berandol sagte, dass man entscheidungsfähig sei, wenn es so weit sei und man sich vorher die schlimmste Konsequenz ausgemalt habe und auch den Weg, wie man reagieren wolle.«
Viviace sah Wintrow über die Schulter hinweg an. Der Junge lehnte schon den halben Morgen an der Bugreling und starrte auf das bewegte Wasser des Kanals. Der Wind hatte schwarze Haarsträhnen aus seinem Zopf gelöst. In den zerlumpten Resten seiner braunen Kutte sah er eher wie ein Bettler denn wie ein Priester aus. Die Galionsfigur hatte ihn zwar bemerkt, sich aber seinem Schweigen und seiner nachdenklichen Stimmung angepasst. Außerdem gab es nur wenig zu sagen, was sie nicht bereits gewusst hätten. Und selbst jetzt sprach der Junge nur, um seine Gedanken zu sortieren, nicht weil er wirklich ihren Rat wollte. Obwohl sie das wusste, drängte sie ihn weiterzusprechen. »Und was ist unsere größte Angst?«
Wintrow seufzte. »Der Pirat leidet an ständig wiederkehrenden Fieberattacken. Jedes Mal wenn Kennit ein Fieber überfällt, ist er danach schwächer. Und die Quelle ist offensichtlich die Infektion in seinem Beinstumpf. Jeder Tierbiss hinterlässt eine infektiöse Wunde, aber der Biss der Seeschlange scheint unverhältnismäßig giftig zu sein. Der entzündete Teil muss amputiert werden – je früher, desto besser. Er ist zwar eigentlich für eine solche Operation zu schwach, aber ich sehe nicht, dass er stärker wird. Also rede ich mir ein, dass ich schnell handeln muss. Außerdem weiß ich, wie schlecht die Chancen stehen, dass er diese Amputation überlebt. Und wenn er stirbt, müssen auch mein Vater und ich sterben. Das ist der Handel, den ich mit ihm geschlossen habe.« Er hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Ich werde sterben. Aber das ist in Wahrheit nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass du allein weitermachen musst, als Sklavin dieser Piraten.«
Er sah sie nicht an, sondern blickte unverwandt über die ständig wogenden Wellen, als er hinzufügte: »Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich zu dir gekommen bin. Du hast ein größeres Recht als ich, in dieser Sache eine Entscheidung zu fällen. Ich habe die ganze Angelegenheit nicht bis zu Ende gedacht, als ich den Handel mit Kennit abschloss. Für mich standen nur der Tod meines Vaters und mein Tod auf dem Spiel. Doch dadurch habe ich unabsichtlich auch dein Leben riskiert. Dazu hatte ich kein Recht. Denn du hast weitaus mehr zu verlieren als ich, glaube ich.«
Viviace nickte, antwortete aber nicht auf Wintrows Gedanken, sondern sprach aus, woran sie vorher gedacht hatte. »Er ist ganz anders, als ich mir einen Piraten vorgestellt habe. Kapitän Kennit, meine ich.« Nachdenklich fügte sie hinzu: »Ich wäre eine Sklavin, hast du eben gesagt. Ich glaube nicht, dass er mich als seine Sklavin ansieht.«
»Kennit entspricht auch nicht meinem Bild von einem Piraten. Doch trotz seines Charmes und seiner Intelligenz dürfen wir nicht vergessen, dass er einer ist. Mehr noch, wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass er im Falle meines Versagens nicht derjenige sein wird, der dich befehligt. Er ist dann tot. Niemand kann sagen, wer dich dann führen wird. Vielleicht Sorcor, sein Erster Maat. Oder Etta, seine Frau. Möglicherweise wird sogar Sa’Adar noch einmal versuchen, dich für sich selbst und seine befreiten Sklaven zu beanspruchen.« Wintrow schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht gewinnen. Wenn die Operation Erfolg hat, muss ich zusehen, wie Kennit dich mir wegnimmt. Er schmeichelt dir ja schon mit seinen Worten, und seine Mannschaft arbeitet auf deinen Decks. Ich habe kaum noch etwas dazu zu sagen, was auf dir vorgeht. Und ob Kennit nun lebt oder stirbt, ich werde bald nicht mehr die Macht haben, dich zu beschützen.«
Viviace zuckte die Hexenholzschulter. »Hattest du das denn vorher?« Ihre Frage klang ein wenig kühl.
»Wohl kaum«, räumte Wintrow beinahe entschuldigend ein. »Aber wenigstens wusste ich, was ich zu erwarten hatte. Es ist zu viel zu schnell geschehen, für uns beide. Es gab zu viele Tote und zu große Veränderungen. Ich habe keine Zeit zum Trauern gehabt und auch nicht zum Meditieren. Ich weiß kaum noch, wer oder was ich eigentlich bin.«
Sie schwiegen beide nachdenklich.
Wintrow fühlte sich, als treibe er zeitlos dahin. Sein Leben, sein wirkliches Leben, war weit weg, in einem friedlichen Kloster in einem warmen Tal mit fruchtbaren Obstgärten und Feldern. Wenn er Entfernung und Zeit überschreiten könnte, wenn er auf seiner schmalen Pritsche in seiner kühlen Zelle aufwachen könnte, würde er die verwirrten Fäden seines Lebens wieder aufnehmen können, davon war er überzeugt. So sehr hatte er sich nicht verändert, jedenfalls redete er sich das ein. Nicht wirklich. Gut, ihm fehlte ein Finger. Er hatte gelernt, damit zurechtzukommen. Und die Sklaventätowierung auf seinem Gesicht blieb an der Oberfläche auf seiner Haut. Er war niemals wirklich ein Sklave gewesen; die Tätowierung entsprang nur der grausamen Rache seines Vaters für seinen Fluchtversuch. Er war immer noch Wintrow. Nach ein paar ruhigen Tagen würde er wieder den friedlichen Priester in sich entdecken.
Aber hier an Bord bestand diese Chance nicht. Die schnellen Veränderungen der letzten Zeit hatten so viele merkwürdige Gefühle in ihm erzeugt, dass er im Augenblick gar nichts empfinden konnte. Die Gefühle von Viviace waren genauso verwirrt wie seine eigenen, denn die Erfahrungen, die sie hatte machen müssen, waren gleichermaßen brutal gewesen. Kyle Haven hatte das gerade erwachte Seelenschiff in den Dienst seines Sklavenhandels gezwungen und sie all den finsteren Gefühlen ihrer elenden Fracht ausgeliefert. Nicht einmal Wintrow hatte sie trösten können, obwohl er ein Blutsverwandter ihrer Gründerfamilie war. Sein eigener unfreiwilliger Dienst auf dem Schiff hatte das eigentlich natürliche Band zwischen ihnen nachhaltig geschwächt. Und die Entfremdung von ihr hatte Viviaces Elend noch verschärft. Trotzdem waren sie mehr recht als schlecht miteinander ausgekommen, wie zwei Sklaven, die aneinandergefesselt waren.
In einer stürmischen Nacht hatte ein Sklavenaufstand sie von der Herrschaft Kyle Havens befreit – und auch von ihrer Funktion als Sklavenschiff. Von der ursprünglichen Mannschaft lebten nur noch Wintrow und sein Vater. In der Morgendämmerung war das Schiff von Piraten gekapert worden. Kapitän Kennit und seine Mannschaft hatten die Viviace ohne einen einzigen Schwertstreich erbeutet. Und dann war Wintrow einen Handel mit Kennit eingegangen: Er würde das Leben des Piraten zu retten versuchen, wenn Kennit ihm und seinem Vater das Leben schenkte. Sa’Adar allerdings, ein Priester und ehemaliger Sklave, der Anführer des Aufstands, hatte entschieden andere Pläne. Er wollte nicht nur über Kyles Leben bestimmen, sondern verlangte von Kennit auch, dass er die Viviace den Sklaven als ihre rechtmäßige Beute überließ. Ganz gleich, wer sich durchsetzen würde, sowohl Wintrow als auch das Schiff erwartete eine ungewisse Zukunft. Dennoch schien das Schiff bereits den Piraten zu bevorzugen.
Vor ihnen durchpflügte die Marietta die schäumende See. Die Viviace folgte in ihrem Kielwasser. Sie waren zu irgendeinem Stützpunkt der Piraten unterwegs, mehr wusste Wintrow nicht. Im Westen wurde der Horizont von den diesigen Ufern der Verfluchten Gestade verhüllt. Die rauschenden, dampfenden Ströme dieser Region ergossen ihre warmen, schlammigen Fluten in den Kanal. Das führte dazu, dass fast ständig Nebel und Dunst vorherrschten, die eine sich ständig verändernde Küstenlinie mit Sandbänken und Untiefen verbargen. In den Wintermonaten waren überraschende, heftige Stürme an der Tagesordnung, die aber auch an freundlicheren Sommertagen auftreten konnten. Die Pirateninseln waren nicht kartographiert. Welchen Sinn hätte es schon gehabt, eine Küste aufzuzeichnen, die sich ständig veränderte? Allgemein war man sich einig, einen möglichst großen Bogen darum zu schlagen und schnellstens daran vorbeizusegeln. Dennoch schoss die Marietta zuversichtlich weiter, und die Viviace folgte ihr. Offenbar waren den Piraten diese Gewässer sehr vertraut.
Wintrow wandte den Kopf und sah die Viviace an. In der Takelage reagierte die Piratenmannschaft schnell und gewandt auf Brigs knappe, gebellte Befehle. Wintrow musste zugeben, dass er noch nie geschicktere Männer auf der Viviace gesehen hatte. Sie mochten Piraten sein, aber sie waren auch hervorragende Seeleute, die sich diszipliniert und koordiniert bewegten, und das so schnell, als wären sie lebendige Teile des erwachten Schiffs.
Nur die anderen Gestalten an Deck verdarben das Bild. Die meisten Sklaven hatten die Rebellion überlebt. Und auch wenn sie von ihren Ketten befreit waren, mussten sie sich doch erst langsam an ihre wiederhergestellte Menschlichkeit gewöhnen. Die Spuren der Handschellen waren noch auf ihrer Haut zu sehen, genauso wie die Sklaventätowierungen auf ihren Gesichtern. Ihre Kleidung war zerrissen, und die Körper unter den Lumpen waren blass und knochig. Außerdem waren es für ein Schiff dieser Größe viel zu viele. Obwohl sie sich jetzt auf die Decks und die Laderäume verteilten, wirkten sie immer noch wie Schlachtvieh, das zusammengepfercht verschifft wurde. Sie standen in kleinen Gruppen auf den geschäftigen Decks herum und bewegten sich nur, wenn die Mannschaft sie anwies, aus dem Weg zu gehen. Einige der Kräftigeren arbeiteten teilnahmslos mit Lappen und Eimern und säuberten die Decks und Laderäume der Viviace. Viele wirkten unzufrieden. Und Wintrow fragte sich unbehaglich, ob sie irgendwann auch entsprechend reagieren würden.
Er überlegte, was er ihnen gegenüber empfand. Vor ihrem Aufstand hatte er sich unter Deck um sie gekümmert. Damals war er vor Mitleid mit ihnen beinahe zerflossen. Trotzdem konnte er ihnen nur wenig Trost bieten. Die Linderung durch Salzwasser und den feuchten Lappen kam ihm mittlerweile wie eine falsche Gnade vor. Er hatte versucht, ihnen die Dienste eines Priesters angedeihen zu lassen, aber es waren einfach zu viele gewesen. Wann immer er sie jetzt ansah, erinnerte er sich nicht an sein Mitgefühl für sie, sondern nur an die Schreie und das Blut, als sie seine Schiffskameraden abgeschlachtet hatten. Es fiel ihm schwer, die Gefühle zu benennen, die ihn nun beim Anblick der ehemaligen Sklaven durchströmten. Es war eine Mischung aus Furcht und Wut, aus Ekel und Mitleid, und gleichzeitig schämte er sich bitterlich dafür. Diese Gefühle waren eines Priesters von Sa nicht würdig. Also flüchtete er sich in eine andere Möglichkeit: Er empfand gar nichts.
Einige der Seeleute hatten vielleicht tatsächlich ihren gewaltsamen Tod selbst herbeigeführt. Aber galt das auch für Mild, Wintrows Freund, und den Geiger Findus oder den Spaßvogel Beinwell und die anderen guten Männer? Sicher hatten sie ein gnädigeres Ende verdient. Die Viviace war kein Sklavenschiff gewesen, als sie angeheuert hatten. Doch sie waren an Bord geblieben, als Kyle sie dieser Bestimmung zugeführt hatte. Sa’Adar, der Sklavenpriester, der die Rebellion angeführt hatte, glaubte, dass sie schon dadurch den Tod verdient hätten. Er predigte, dass sie die Feinde aller gerechten Menschen geworden waren, weil sie sich entschieden hatten, auf einem Sklavenschiff zu arbeiten. Wintrow befand sich diesbezüglich in einem großen Zwiespalt. Er klammerte sich an die tröstende Vorstellung, dass Sa jedes Urteil sich selbst vorbehielt, weil nur der Schöpfer die nötige Weisheit besaß, urteilen zu können.
Die Sklaven an Bord des Schiffs allerdings teilten Wintrows Ansicht nicht. Einige sahen ihn an und erinnerten sich an die leise Stimme in der Dunkelheit und an die Hände mit dem kühlen, feuchten Lappen. Andere betrachteten ihn als Scharlatan, als Sohn des Kapitäns, der nur ein bisschen Wohltäter gespielt, sonst aber wenig für ihre Freiheit getan hatte, bis sie die Angelegenheit in ihre eigenen Hände nahmen. In einem verhielten sie sich jedoch alle gleich: Sie mieden ihn. Und er konnte es ihnen nicht verdenken. Er mied sie ebenfalls. Die meiste Zeit verbrachte er auf dem Vordeck in der Nähe von Viviace. Die Piratenmannschaft kam nur dorthin, wenn der Betrieb des Schiffs es erforderte. Ansonsten schlugen sie einen großen Bogen darum; sie waren genauso abergläubisch wie die Sklaven. Die lebende, sprechende Galionsfigur flößte ihnen Angst ein. Viviace ließ sich nicht anmerken, ob diese Scheu sie kränkte. Wintrow dagegen war sogar froh, dass es noch einen Fleck auf dem Schiff gab, wo er relativ ungestört war. Er lehnte den Kopf gegen die Reling und versuchte an etwas weniger Schmerzliches zu denken.
Zu Hause war jetzt fast Frühling. Die Knospen in den Obstgärten des Klosters würden bereits schwellen. Wie es wohl Berandol mit seinen Studien ging? Ob sein ehemaliger Tutor ihn überhaupt vermisste? Mit tiefem Bedauern malte er sich aus, was er mittlerweile studieren würde, wenn er dort wäre. Wintrow sah auf seine Hände hinunter. Früher einmal hatte er damit Manuskripte übertragen und bunte Glasfenster geformt. Es waren die Hände eines Jungen gewesen, beweglich und dennoch zart. Jetzt bedeckten Schwielen seine Handflächen, und an einer Hand fehlte ihm sogar ein Finger. Es waren die rauen Hände eines Seemanns. Und sein Finger würde niemals einen Priesterring tragen.
Hier war der Frühling anders. Das Segeltuch flatterte knatternd im kühlen Wind. Über ihre Köpfe flogen Schwärme von Zugvögeln hinweg und stießen ihre unheimlichen Schreie aus. Die Inseln zu beiden Seiten des Kanals schimmerten in einem noch üppigeren Grün, und an ihren Stränden stritten sich kreischend Landvögel um Nistplätze.
Jemand rief ihn im Geiste in die Gegenwart zurück.
»Dein Vater ruft dich«, sagte Viviace leise.
Sicher. Er hatte es durch sie gespürt. Die Fahrt durch den Sturm hatte das Band aus Verstand und Seele zwischen ihm und dem Schiff verstärkt und gefestigt. Er wies es nicht mehr so heftig zurück wie einst und spürte, dass Viviace es auch nicht mehr so stark hegte wie früher. Vielleicht trafen sich wenigstens diesbezüglich ihre Gefühle in der Mitte. Seit dem Sturm war sie freundlich zu ihm, aber nicht mehr. Wie ein abgelenkter Elternteil mit einem quengeligen Kind umgeht, dachte Wintrow.
»In gewisser Weise haben wir seit dem Anfang unserer Reise die Rollen getauscht«, erklärte sie laut.
Er nickte. Ihm fehlten die Lust und auch die Kraft, um die Wahrheit zu leugnen. Dann straffte er sich, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und schob das Kinn vor. Sein Vater sollte nicht sehen, wie unsicher er war.
Mit hocherhobenem Kopf suchte er sich den Weg über das Deck. Er mied die Trauben von Sklaven und die Piraten. Niemand sah ihn an, und es hielt ihn auch keiner auf. Du bist verrückt, wenn du glaubst, dass dich alle beobachten, schalt er sich. Sie hatten gewonnen. Warum sollten sie sich um das Verhalten des letzten überlebenden Mitglieds der alten Mannschaft kümmern? Wenigstens hatte er es körperlich unversehrt überstanden.
Die Viviace jedoch hatte Spuren des Sklavenaufstands davongetragen. Nach wie vor schimmerten Blutflecken auf ihren Planken. Diese Male würden nicht vergehen, ganz gleich, wie intensiv die Männer sie mit Sand schrubbten. Und das Schiff stank auch immer noch wie ein Sklavenschiff, trotz der ständigen Reinigung, die Brig angeordnet hatte. Der Sturm hatte ebenfalls seinen Tribut von ihren Segeln gefordert. Man sah das hastige Flickwerk der Piraten nur zu offensichtlich. Auf dem Achterdeck waren Türen gewaltsam geöffnet worden, als die Sklaven die Offiziere gejagt hatten. Das glänzende Holz war zersplittert und hing schief in den Angeln. Es war nicht mehr das ordentliche, feine Schiff, das von Bingstadt aus in See gestochen war. Plötzlich beschämte es Wintrow, sein Familienschiff so zu sehen. Es war fast, als hätte er seine Schwester bei der Hurerei in einer Taverne ertappt. Ein zärtliches Gefühl für die Viviace wallte plötzlich in ihm hoch, und er fragte sich, wie es wohl gewesen wäre, wenn er aus freien Stücken an Bord des Schiffs gekommen wäre, vielleicht als Schiffsjunge, um unter dem Befehl seines Großvaters zu dienen.
Energisch schob er diese Gedanken beiseite. Er gelangte an eine leicht demolierte Tür, vor der zwei mürrische Kartenvisagen Wache hielten. Er trat an den ehemaligen Sklaven vorbei, als sähe er sie nicht, und klopfte an die Tür der Kabine, die einmal Gantry gehört hatte. Als er noch lebte. Jetzt war der geplünderte, kahle Raum die Gefängniszelle seines Vaters. Wintrow wartete nicht auf eine Antwort, sondern trat ein.
Sein Vater saß auf dem Rand der Koje und starrte Wintrow entgegen. Ein Auge war blutunterlaufen, und sein Gesicht war geschwollen und blass. Kyle Havens Haltung verriet, dass er Schmerzen empfinden musste, aber seine Begrüßung war nur sarkastisch. »Nett, dass du dich noch an mich erinnerst. Vermutlich warst du zu beschäftigt, deinen neuen Herren in den Hintern zu kriechen.«
Wintrow unterdrückte einen Seufzer. »Ich wollte schon früher zu dir, aber du hast geschlafen. Und ich wusste, dass Schlaf dich besser heilen würde als alles, was ich zu bieten hätte. Wie geht es deinen Rippen?«
»Sie brennen. Und mein Kopf schmerzt bei jedem Herzschlag. Außerdem bin ich hungrig und durstig.« Er deutete mit dem Kinn zur Tür. »Sie wollen mich nicht einmal hinauslassen, damit ich frische Luft schnappen kann.«
»Ich habe Essen und Wasser für dich hiergelassen. Hast du es nicht …?«
»Doch, ich habe es gefunden. Einen Schluck Wasser und zwei Stücke trockenes Brot.« Die Stimme seines Vaters vibrierte vor unterdrückter Wut.
»Mehr konnte ich nicht für dich bekommen. Brot und Wasser sind im Moment knapp an Bord. Während des Sturms ist viel Nahrung vom Salzwasser verdorben worden …«
»Du meinst wohl, die Sklaven haben sie verschlungen.« Kyle schüttelte angewidert den Kopf und zuckte anschließend zusammen. »Sie besitzen nicht einmal genug Verstand, um zu begreifen, dass Nahrung eingeteilt werden muss. Sie töten mitten in einem Orkan die einzigen Männer, die das Schiff segeln können, und fressen oder vernichten die Hälfte der Lebensmittelrationen an Bord. Sie können für sich genauso wenig Verantwortung übernehmen wie eine Schar Küken. Ich hoffe, dass wenigstens du dich über die Freiheit freust, die du ihnen geschenkt hast. Sie wird wahrscheinlich sowohl ihr Tod als auch ihre Erlösung sein.«
»Sie haben sich selbst befreit, Vater«, erwiderte Wintrow hartnäckig.
»Aber du hast sie nicht aufgehalten.«
»Genauso wenig, wie ich dich aufgehalten habe, als du sie in Ketten an Bord gebracht hast.« Wintrow holte Luft, weil er weitersprechen wollte, hielt dann aber inne. Ganz gleich, wie sehr er versuchte, sein Tun zu rechtfertigen, sein Vater würde seine Gründe niemals akzeptieren. Stattdessen verstärkten Kyles Worte noch Wintrows schlechtes Gewissen. War er schuld an dem Tod der Mannschaft, weil er nichts unternommen hatte? Und wenn ja, lud er damit nicht auch die toten Sklaven auf sein Gewissen, die vor dem Aufstand verreckt waren? Dieser Gedanke war so peinigend, dass er nicht darüber nachdenken wollte.
»Willst du, dass ich nach deinen Wunden sehe, oder soll ich versuchen, Nahrung für dich aufzutreiben?«
»Hast du die Medizinkiste gefunden?«
Wintrow schüttelte den Kopf. »Sie ist verschwunden. Niemand gibt zu, dass er sie genommen hätte. Vielleicht ist sie beim Sturm über Bord gegangen.«
»Nun, ohne diese Kiste kannst du wenig für mich tun«, meinte sein Vater zynisch. »Aber etwas zu essen wäre trotzdem ganz nett.«
Wintrow wollte sich nicht provozieren lassen. »Ich werde sehen, was ich tun kann«, entgegnete er leise.
»Das kann ich mir denken«, erwiderte sein Vater in schneidendem Ton. Er senkte unvermittelt die Stimme, als er weitersprach. »Und was wirst du mit dem Piraten tun?«
»Das weiß ich nicht«, gab Wintrow aufrichtig zu und erwiderte unerschrocken den Blick seines Vaters. »Leider. Ich weiß, dass ich versuchen muss, ihn zu heilen. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist: die Aussicht, dass er überlebt und wir weiterhin Gefangene bleiben oder dass er stirbt und wir mit ihm und die Viviace allein zurückbleibt.«
Sein Vater spie auf den Boden. Das war so untypisch für ihn, dass es Wintrow wie ein Schlag traf. Kyles Augen glitzerten wie zwei kalte Kiesel. »Ich verachte dich«, knurrte er. »Deine Mutter muss sich mit einer Seeschlange eingelassen haben, wenn sie so etwas wie dich ausgebrütet hat. Es beschämt mich, dass die Menschen dich meinen Sohn nennen. Sieh dich an! Piraten haben unser Familienschiff gekapert, den Lebensunterhalt für deine Mutter, deine Schwester und deinen kleinen Bruder. Ihr Überleben hängt davon ab, dass du das Schiff zurückeroberst! Aber du denkst nicht einmal daran! Nein. Du denkst nur darüber nach, ob du den Piraten töten oder heilen sollst, dessen Stiefel dir im Nacken sitzt und dich zu Boden drückt. Du hast mit keinem Gedanken überlegt, Waffen für uns zu besorgen oder das Schiff zu überreden, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen, wie es sich gegen mich gewehrt hat. All die Zeit, die du verschwendet hast, dich um die Sklaven zu kümmern, als sie noch in Ketten lagen! Hast du versucht, bei ihnen Hilfe zu bekommen? Nein. Du kuschst und hilfst dem verdammten Piraten, das Schiff zu behalten, das er uns gestohlen hat.«
Wintrow schüttelte den Kopf. Er war verwundert und gleichzeitig traurig. »Du denkst nicht logisch. Was erwartest du von mir, Vater? Soll ich im Alleingang Kennit und seiner Mannschaft das Schiff entreißen, die Sklaven wieder in die Frachträume werfen und dann nach Chalced segeln?«
»Du und dieses teuflische Schiff waren in der Lage, mich und meine Mannschaft zu übertölpeln! Warum bringst du das Schiff nicht gegen ihn auf, wie du es bei mir geschafft hast? Warum kannst du nicht wenigstens einmal im Interesse deiner Familie handeln?« Sein Vater stand auf und ballte die Fäuste, als wolle er Wintrow schlagen. Dann flogen seine Hände zu seiner Brust, und er schnappte vor Schmerz scharf nach Luft. Sein Gesicht verlor alle Zornesröte und wurde bleich. Kyle schwankte. Wintrow wollte ihn stützen.
»Fass mich nicht an!«, knurrte Kyle drohend, stolperte zum Rand der Koje und ließ sich langsam darauf niedersinken. Dort saß er und starrte seinen Sohn finster an.
Was sieht er wohl in mir?, dachte Wintrow. Vermutlich war er für den großen, blonden Mann eine einzige Enttäuschung. Er war klein, dunkelhaarig und zierlich wie seine Mutter und würde niemals über die körperliche Kraft seines Vaters verfügen. Mit seinen vierzehn Jahren ähnelte er äußerlich immer noch mehr einem Jungen als einem Mann. Aber er enttäuschte die Erwartungen seines Vaters nicht nur in körperlicher Hinsicht. Auch sein Mut würde niemals dem seines Erzeugers nahekommen.
»Ich habe das Schiff nicht gegen dich aufgewiegelt, Vater.« Wintrows Stimme klang leise. »Das hast du selbst getan, durch deine Behandlung von Viviace. Ich kann mittlerweile nicht mehr vollumfänglich Anspruch auf sie erheben. Das Beste, was ich hoffen kann, ist, uns am Leben zu erhalten.«
Kyle Haven richtete seinen Blick gegen die Wand und starrte sie unbewegt an. »Geh und hol mir etwas zu essen!« Er bellte den Befehl, als habe er immer noch das Kommando über das Schiff.
»Ich werde es versuchen«, erwiderte Wintrow unbeeindruckt. Er drehte sich um und verließ den Raum.
Als er die beschädigte Tür hinter sich zuzog, sprach ihn eine der Kartenvisagen vor der Tür an. Die Spuren der Tätowierungen, die seine vielen Besitzer auf seinem Gesicht hinterlassen hatten, schienen zu tanzen, als er fragte: »Warum lässt du dir das von ihm gefallen?«
»Was?«, erwiderte Wintrow überrascht.
»Er behandelt dich wie einen Hund.«
»Er ist mein Vater.« Wintrow versuchte seinen Unwillen darüber zu verbergen, dass sie das Gespräch belauscht hatten. Wie viel hatten sie gehört?
»Er ist ein Pferdearsch«, bemerkte der andere Posten kalt und sah Wintrow herausfordernd an. »Und du bist folglich der Sohn eines Pferdearschs.«
»Halt die Klappe!«, knurrte der erste Posten. »Der Junge ist nicht schlecht. Wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wer freundlich zu dir war, als du angekettet warst, ich kann es noch!« Er sah wieder Wintrow an und deutete mit dem Kopf auf die Tür. »Ein Wort von dir genügt, Junge. Ich sorge dafür, dass er vor dir kriecht.«
»Nein«, sagte Wintrow. »Das will ich nicht. Ich will nicht, dass jemand vor mir kriecht.« Es schien ihm geraten, dem Mann sein Anliegen unmissverständlich klarzumachen. »Bitte. Tut meinem Vater nichts.«
Die Kartenvisage zuckte die Schultern. »Wie du willst. Aber ich spreche aus Erfahrung, Junge. Es ist der einzige Weg, wie man mit solchen Kerlen umgehen kann. Er kriecht vor dir, oder du kriechst vor ihm. Etwas anderes gibt es für ihn nicht.«
»Vielleicht«, räumte Wintrow zögernd ein. Er wollte schon weggehen, blieb dann aber stehen. »Ich kenne Eure Namen nicht.«
»Villia. Du bist Wintrow, richtig?«
»Ja. Ich bin Wintrow. Es freut mich, dass ich Euren Namen weiß, Villia.« Wintrow sah den anderen Posten erwartungsvoll an.
Der runzelte die Stirn und wirkte beklommen. »Deccan«, antwortete er schließlich.
»Deccan«, wiederholte Wintrow und beschloss, sich die Namen zu merken. Er erwiderte den Blick des Mannes und nickte ihm zu, bevor er sich umdrehte. Er spürte die Belustigung, aber auch den Respekt bei Villia. Als er auf Deck trat, blinzelte er im Sonnenlicht. Sa’Adar versperrte ihm den Weg. Der hochgewachsene Priester wirkte von seinem Sklavendasein immer noch mitgenommen. Die Hand- und Fußfesseln hatten die Haut an seinen Gelenken aufgeschabt.
»Ich habe nach dir gesucht«, verkündete er. Zwei Kartenvisagen flankierten den Priester wie angeleinte Bluthunde.
»Habt Ihr das?« Wintrow beschloss weiterzumachen, wie er angefangen hatte. Er straffte die Schultern und sah dem älteren Mann offen in die Augen. »Habt Ihr diese Männer vor der Kajüte meines Vaters postiert?«, wollte er wissen.
Der Wanderprediger ließ sich nicht einschüchtern. »Allerdings. Dieser Mann muss eingesperrt bleiben, bis man über ihn zu Gericht gesessen und ihn verurteilt hat.« Der Priester sah Wintrow hochmütig an. Er war so viel größer und älter als er. »Willst du das infrage stellen?«
»Ich?« Wintrow tat, als dächte er ernsthaft darüber nach. »Warum sollte es Euch kümmern, wenn ich es täte? Wenn ich Ihr wäre, würde es mich nicht interessieren, was Wintrow Vestrit denkt. Ich würde mir darüber Sorgen machen, was Kapitän Kennit darüber denkt, wenn ich mir eine solche Autorität anmaße.«
»Kennit ist ein sterbender Mann«, erwiderte Sa’Adar unerschrocken. »Brig hat hier das Kommando. Und er scheint meine Autorität über die Sklaven zu begrüßen. Er lässt ihnen durch mich seine Befehle übermitteln. Und er hat auch nichts dagegen gehabt, dass ich Kapitän Haven unter Bewachung gestellt habe.«
»Sklaven? Es sind doch jetzt sicher alles freie Menschen, oder?« Wintrow lächelte bei diesen Worten und tat so, als merke er nicht, wie gespannt die Kartenvisagen der Unterhaltung folgten. Die anderen ehemaligen Sklaven an Deck lauschten ebenfalls. Und einige rückten näher.
»Du weißt, was ich meine!«, rief Sa’Adar verärgert.
»Normalerweise sagt man, was man meint …« Wintrow ließ diese Feststellung eine Weile wirken und fügte dann hinzu: »Ihr sagtet, Ihr hättet mich gesucht?«
»Allerdings. Hast du Kennit heute gesehen?«
»Warum wollt Ihr das wissen?«, konterte Wintrow gelassen.