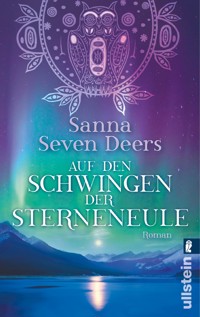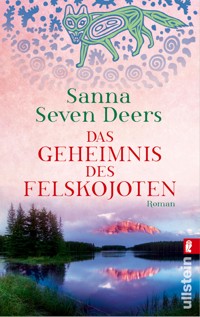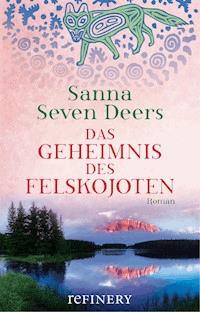
4,99 €
Mehr erfahren.
Die 26-jährige Serena wird durch einen Anruf ihres Bruders in Angst und Schrecken versetzt: Fabian, ein begabter Physiker, ist den dunklen Machenschaften eines mächtigen Konzerns auf die Spur gekommen und in Nordamerika untergetaucht. Von vorahnungsvollen Träumen geplagt, macht Serena sich gemeinsam mit Fabians Freund, dem Indianer Shane Storm Hawk, auf, ihren Bruder zu finden. Die Suche, bei der sie schnell selbst zu Verfolgten werden, führt sie durch den Westen der USA bis nach Kanada. Serena fühlt sich stark zu Shane hingezogen, doch nun stehen auch ihre Leben auf dem Spiel. Sie muss auf die mystischen Zeichen vertrauen, nicht nur um Fabians willen, sondern auch um ihrer Liebe zu Shane eine Chance zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Die 26-jährige Serena wird durch einen Anruf ihres Bruders in Angst und Schrecken versetzt: Fabian, ein begabter Physiker, ist den dunklen Machenschaften eines mächtigen Konzerns auf die Spur gekommen und in Nordamerika untergetaucht. Von vorahnungsvollen Träumen geplagt, macht Serena sich gemeinsam mit Fabians Freund, dem Indianer Shane Storm Hawk, auf, ihren Bruder zu finden. Die Suche, bei der sie schnell selbst zu Verfolgten werden, führt sie durch den Westen der USA bis nach Kanada. Serena fühlt sich stark zu Shane hingezogen, doch nun stehen auch ihre Leben auf dem Spiel. Sie muss auf die mystischen Zeichen vertrauen, nicht nur um Fabians willen, sondern auch um ihrer Liebe zu Shane eine Chance zu geben.
Die Autorin
Sanna Seven Deers ist geborene Hamburgerin. Sie heiratete einen kanadischen Indianer und zog mit ihm in die Wildnis der Rocky Mountains. Dort leben die beiden mit ihren vier Kindern.
www.sannasevendeers.com
Von der Autorin sind außerdem in unserem Hause erschienen:
Der Ruf des weißen Raben
Sanna Seven Deers
Das Geheimnis des Felskojoten
Roman
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt
Der Verlag dankt David Seven Deers für die freundliche Genehmigung, seine Illustration für die Covergestaltung sowie seine Karte auf S. 6 / 7 zu verwenden
ISBN 978-3-96048-033-4 Neuausgabe bei Refinery
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Juli 2013 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © plainpicture / Design Pics; Fine Pic®, München; © David Seven Deers (Illustration)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
The Great Spirit is in all things, he is in the air we breathe.
The Great Spirit is our Father, but the Earth is our Mother.
She nourishes us.
That which we put into the ground she returns to us …
Big Thunder (Bedagi) – Wabanaki Algonquin
Der Große Geist ist in allen Dingen, er ist in der Luft, die wir atmen.
Der Große Geist ist unser Vater, aber die Erde ist unsere Mutter.
Sie nährt uns.
Das, was wir in den Boden geben, gibt sie an uns zurück …
What is life?
It is the flash of a firefly in the night.
It is the breath of a buffalo in the wintertime.
It is the little shadow which runs across
the grass and loses itself in the sunset.
Crowfoot(Häuptling des kanadischen Blackfoot-Stammes)
I
Der Mond schien hell. Der Pier war verlassen. Nur das gleichmäßige Schwappen der Wellen unterbrach die Stille. Das kalte Licht der Hafenlaternen erleuchtete den Anlegeplatz und ließ den dichten Nebel noch unheimlicher wirken. Der salzige Geruch von Seetang hing in der Luft. Aus der Ferne ertönte ein Schiffshorn, und irgendwo schrie eine Möwe.
Dimitri Csaba strich sich über das kurzgeschorene dunkelblonde Haar und sah sich nervös um. Die anderen Matrosen waren längst von Bord gegangen. Mit schnellen Schritten überquerte er den Landungsplatz.
Dimitri – wie fremd ihm der Name war. Wie viel in den vergangenen Tagen passiert war.
Der junge Mann seufzte tief und zerrte an dem Halsausschnitt seines T-Shirts. Es fiel ihm schwer, sich wieder an moderne Kleidung zu gewöhnen. Nun schon zum dritten Mal in seinem Leben war er im Begriff, alle Brücken hinter sich abzubrechen und eine neue Identität anzunehmen. Vor drei Jahren war er einem Kloster beigetreten. Damals war aus Fabian Eckehard Bruder Simeon geworden. Nun hatte Bruder Simeon dem Kloster für immer den Rücken zugekehrt. Unter dem Namen Dimitri Csaba und mit gefälschtem ungarischen Pass hatte er in Rotterdam auf einem Schiff nach Nordamerika angeheuert. Fabian wusste selbst kaum mehr, wer er wirklich war. Bruder Simeon kam seinem wahren Ich am nächsten, und Fabian konnte von sich nur schwer als jemand anderem als den Mönch denken, der er noch vor weniger als drei Wochen gewesen war. Er spürte in seinem Herzen, dass es auch in Zukunft dabei bleiben würde. Und noch einer Sache war er sich eindeutig bewusst: dass er erreichen musste, was er sich vorgenommen hatte.
Fabian blickte sich unruhig um. Er musste von der Bildfläche verschwinden. Das Gelingen seines Vorhabens hing allein davon ab, dass niemand herausfand, wo er sich aufhielt. Er musste untertauchen, seine Spuren verwischen. Und dazu musste er erneut seine wahre Identität verbergen.
Fabian kam an einem Abfalleimer vorbei. Er blieb kurz stehen, fischte Dimitris ungarischen Pass aus der Jackentasche und warf ihn, ohne zu zögern, hinein. Dann zog er einen kanadischen Ausweis hervor und schlug ihn auf. Der Pass zeigte sein Bild. Doch daneben stand: Michael Hall.
Fabian seufzte erneut. Er würde sich auch an diesen Namen gewöhnen müssen. Wenn sein Freund und ehemaliger Arbeitskollege Shane Storm Hawk, ein Blackfoot-Indianer, ihn jetzt sehen könnte, würde er über Fabian lachen. Bei den Blackfoot und vielen anderen indianischen Völkern war es üblich, im Laufe seines Lebens mehrere Male den Namen zu ändern. Aber Fabian war in Deutschland aufgewachsen, und dort waren Namensänderungen nicht gerade üblich.
Er rief sich zur Ordnung. Er durfte keine Zeit verschwenden. Er musste verschwinden, bevor man ihn fand. Aber vorher hatte er noch etwas Wichtiges zu erledigen.
Die sechsundzwanzigjährige Serena Eckehard hatte es sich auf dem Sofa im Wohnzimmer ihrer kleinen Berliner Wohnung gemütlich gemacht. Diffuses Sonnenlicht strömte durch die hellen Gardinen an den Fenstern, und obwohl es noch früh am Vormittag war, war es drückend heiß. Serena hatte ihr schulterlanges schwarzes Haar mit ihrer Lieblingshaarnadel aufgesteckt und blätterte in einer Zeitschrift. Sie fächerte sich beim Lesen Luft zu, aber es half nicht viel.
Verärgert ließ Serena die Zeitschrift sinken. Sie hätte sich einen dieser elektrischen Tischventilatoren besorgen sollen, als noch welche zu haben waren. Mittlerweile waren alle ausverkauft. Aber eine derartige Hitzewelle war auch wirklich ungewöhnlich, selbst für August. Sie konnte kaum einen Temperaturunterschied zu Tunesien feststellen, von wo aus sie erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt war. Serena war freiberufliche Fotografin und oft auf Reisen. Besonders seit ihr Bruder sich vor drei Jahren ganz überraschend in ein Kloster zurückgezogen hatte, hielt sie nicht viel in ihrem Heimatland. Wieder zu Hause, hatte sie sich eigentlich nach ein wenig Ruhe und Erholung gesehnt. Aber davon konnte bei dieser Hitze keine Rede sein.
Das schrille Klingeln des Telefons ließ Serena aus ihren Gedanken aufschrecken. Sie sprang vom Sofa auf, erfreut über die Ablenkung.
Das Display des Telefons zeigte eine Nummer aus Nordamerika an. Verwundert meldete sie sich.
»Ich bin es«, ertönte die vertraute Stimme ihres Bruders.
Serena stockte der Atem. Es konnte doch unmöglich wahr sein! Als Fabian damals ins Kloster gegangen war, hatten sie einander für immer Lebewohl gesagt. Sie hatte es sich nicht träumen lassen, seine Stimme in diesem Leben noch einmal zu hören.
»Fabian«, hauchte sie, »bist du es wirklich?« Tränen stiegen ihr in die Augen. Und für einen kurzen herrlichen Augenblick glaubte sie, dass ihr geliebter großer Bruder zu ihr zurückkehren würde. Aber dieses Wunschbild wurde ihr schon mit seinen nächsten Worten genommen.
»Serena, hör mir gut zu«, sagte Fabian. »Ich habe nicht viel Zeit.« Seine Stimme klang nervös, seine Worte überstürzt. »Ich habe das Kloster verlassen. Ich werde nicht dorthin zurückkehren. Meine Gebete sind erhört worden. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe.«
»Ich verstehe nicht …«, begann Serena, aber Fabian fiel ihr ins Wort.
»Ich habe dir damals nicht die ganze Wahrheit gesagt«, erklärte er hastig. »Diese Leute wollten, dass ich für sie arbeite. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen. Sie sind in schlimme Sachen verwickelt, Serena. Sehr schlimme. Und ich habe gesehen, was sie machen. Sie hätten mich umgebracht. Mein einziger Ausweg war das Kloster. Sie ließen mich gewähren, denn dort stellte ich keine Gefahr für sie dar. Aber ich konnte und kann nicht mit dem Wissen um die Verbrechen leben, die sie begehen. Ich muss versuchen, sie aufzuhalten, koste es, was es wolle.«
»Fabian, wo bist du?« Serenas Stimme stockte. Wovon sprach ihr Bruder nur? »Sag mir, was los ist. Vielleicht kann ich dir helfen!«
»Niemand kann mir helfen«, erwiderte Fabian. »Und es ist besser, wenn du keine Einzelheiten kennst. Ich will dich nicht unnötig in Gefahr bringen. Jetzt, wo ich nicht mehr im Kloster bin, werden sie nach mir suchen. Vielleicht auch bei dir. Deshalb rufe ich an – um dich zu warnen. Diese Leute schrecken vor nichts zurück.«
»Wer, um Himmels willen, Fabian? Bitte lass mich doch …«
»Und ich wollte, dass du mich in guter Erinnerung behältst«, unterbrach Fabian sie. »Egal was du irgendwann einmal über mich liest oder was dir jemand einmal über mich weismachen will. Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun, das weißt du. Nur dieses eine Mal habe ich es nicht getan. Aus Angst. Das werde ich jetzt geradebiegen.«
»Das hört sich so an, als ob …«
»Ich hab dich lieb, kleine Schwester. Vergiss mich nicht.«
»Fabian!«, rief Serena aufgebracht. »Fabian!«
Aber alles, was sie hörte, war ein monotones Dröhnen. Die Verbindung war abgebrochen.
»Ich hab dich auch lieb«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme. Dann legte sie das Telefon zurück auf den Tisch und ließ sich aufs Sofa fallen. Entsetzt presste sie die Hand vor den Mund. Worin war Fabian nur verwickelt?
Willst du eine freie Seele haben, so musst du entweder arm sein oder wie ein Armer leben, hatte Fabian Seneca zitiert, als er ihr von seinem Vorhaben, Mönch zu werden, erzählt hatte – Fabian hatte eine Schwäche für Zitate. Dabei hatten eine solche Entschlossenheit und Willensstärke in seinem Blick gelegen, dass Serena nicht einen Augenblick an seinen Motiven gezweifelt hatte. Doch überrascht hatte sie sein Entschluss schon. Natürlich waren sie beide katholisch erzogen worden. Aber Fabian hatte nie viel auf den Glauben gegeben. Im Gegenteil, er war ein sehr praktisch veranlagter Mensch, jemand, der alles hinterfragte, jemand mit sehr viel Köpfchen. Deshalb hatte er erfolgreich Physik studiert, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Seitdem war er immer viel unterwegs gewesen, aber er hatte seine zehn Jahre jüngere Schwester nie vergessen. Von überall, wo er sich aufhielt, hatte er ihr lange Briefe geschrieben, Postkarten geschickt und ihr Souvenirs mitgebracht. Und wann immer er zu Hause gewesen war, hatten sie viel Zeit miteinander verbracht. Das Alter, in dem man sich als junger Mensch fragt, warum man eigentlich auf dieser Welt ist, woher man kommt und wohin es einen führen wird, hatte er zu dem Zeitpunkt, als er sich entschloss, ins Kloster zu gehen, längst hinter sich gelassen. Es war damals vielmehr Serena gewesen, die sich mit all diesen Fragen beschäftigt hatte, ohne zu einem wirklichen Ergebnis zu kommen. Trotzdem hatte es bei Fabian diesen plötzlichen Sinneswandel gegeben.
Als Serena jetzt an den Tag des Abschieds zurückdachte, wurde ihr zum ersten Mal bewusst, dass zu jener Zeit noch etwas anderes in dem Blick ihres Bruders gelegen hatte: ein Hauch von unterdrückter Verzweiflung, von Ausweglosigkeit, den Serena bisher versucht hatte zu verdrängen. Das Telefonat eben hatte es ihr wieder in Erinnerung gerufen. Sollte sie die Motive ihres Bruders bisher missdeutet haben? Hatte er damals ihre Hilfe gebraucht und ihr war es nicht aufgefallen? Wie dem auch sei, jetzt hatte sie es bemerkt und sie würde handeln.
Serena holte ihre Handtasche und wühlte hastig darin herum. Wo hatte sie den Zettel nur hingesteckt? Da war er! Vorsichtig faltete sie das zerknitterte Papierstückchen auseinander. Darauf war in ihrer klaren, geschwungenen Handschrift eine Telefonnummer vermerkt. Sie hatte sich geschworen, niemals weich zu werden und die Nummer nur im äußersten Notfall zu gebrauchen. Aber jetzt musste es sein.
Serena griff nach dem Telefon und wählte mit zitternder Hand die Rufnummer. Nach zweimaligem Klingeln meldete sich eine Männerstimme.
»Kloster Engelstein.«
»Guten Tag«, sagte Serena, so ruhig es ging. »Ich muss meinen Bruder in einer dringenden Familienangelegenheit sprechen. Würden Sie ihm bitte ausrichten, er möge sich umgehend bei mir melden?«
»Wer bitte ist Ihr Bruder?«, fragte die Männerstimme.
»Fabian Eckehard.«
»Warten Sie bitte einen Augenblick.«
Stille. Serena rutschte nervös auf dem Sofa hin und her. Endlich meldete sich jemand. Ein Mann. Aber es war nicht Fabian.
»Man sagte mir, dass Sie Bruder Simeon in einer wichtigen Familienangelegenheit sprechen möchten.«
»Fabian Eckehard, das ist richtig«, erklärte Serena mit stockender Stimme.
»Es tut mir aufrichtig leid, verehrte Frau, aber Bruder Simeon ist nicht mehr bei uns.«
»Sind Sie ganz sicher?«
»Meine Tochter, ich stehe diesem Kloster vor, ich weiß, wovon ich spreche.« Dann fügte er mitfühlend hinzu: »Es tut mir wirklich sehr leid.«
»Ich danke Ihnen«, sagte Serena leise und legte auf. Es war also tatsächlich wahr. Alles war wahr. Fabian hielt sich nicht mehr im Kloster auf. Er war irgendwo da draußen, und er brauchte Hilfe. Sie musste ihn finden!
Serena nahm erneut das Telefon. Diesmal rief sie ihre Eltern an. Mit wenigen Worten berichtete sie, was vorgefallen war.
»Fabian ist aus dem Kloster verschwunden, Vati. Und ich glaube, er ist in irgendwelchen Schwierigkeiten«, beendete sie ihren Bericht.
»Das Leben deines Bruders ist für deine Mutter und mich nicht mehr von Belang«, erwiderte ihr Vater kühl. »Als er vor drei Jahren ins Kloster ging, habe ich ihm ins Gesicht gesagt, dass er für uns gestorben ist, sollte er bei seiner Entscheidung bleiben. Nun, er ist dabei geblieben. Dann muss er auch für die Konsequenzen geradestehen.«
»Aber Vati«, versuchte Serena es noch einmal, »es hat sich wirklich angehört, als ob …«
»Bitte spar dir deine Worte«, wehrte ihr Vater ab. »Es bleibt dabei.« Dann hängte er einfach auf.
Serena seufzte. Ihr Vater konnte so starrköpfig sein! Er hatte es Fabian nie verziehen, dass er seine brillante Karriere, sein gesamtes Leben aufgegeben hatte, um Mönch zu werden.
Serena wusste, sie hatte diesen Starrsinn von ihrem Vater geerbt. Wenn sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann blieb sie dabei. Und jetzt hatte sie sich vorgenommen, ihrem geliebten Bruder zu helfen, und das würde sie auch tun!
Aber um Fabian zu helfen, musste sie zunächst einmal herausfinden, wo er sich aufhielt.
Fabian hat aus Nordamerika angerufen, ging es ihr durch den Kopf. Und plötzlich kam ihr eine Idee. Sie hatte auf ihrem Kleiderschrank eine Schachtel mit Fabians persönlichsten Sachen verstaut, die er ihr übergeben hatte, bevor er ins Kloster gegangen war. Vielleicht konnte sie dort einen Anhaltspunkt für ihre Suche finden.
Sie lief ins Schlafzimmer, kletterte auf einen Stuhl und holte die Schachtel vom Schrank. Sie war nicht groß und vollkommen verstaubt. Serena hatte sie seit langer Zeit nicht in den Händen gehabt. Die Erinnerung an Fabian schmerzte sie zu sehr.
Mit der Schachtel auf dem Schoß setzte sie sich aufs Bett. Sie holte tief Luft. Sie würde nicht weinen. Sie würde sich zusammenreißen und die Angelegenheit ganz praktisch angehen.
Serena öffnete den Deckel und begann, einen Gegenstand nach dem anderen herauszunehmen. Obenauf lag Fabians Lieblingspullover. Serena drückte ihn an sich. Er roch noch immer nach Fabian. Schnell legte sie ihn zur Seite. Sie hatte keine Zeit für Sentimentalitäten. Als Nächstes kam ein zerfleddertes Taschenbuch zum Vorschein. Dantes Göttliche Komödie. Serena konnte Dante nichts abgewinnen, aber Fabian hatte es geliebt, ihr aus seinen Werken vorzulesen.
Nach und nach leerte sie den gesamten Schachtelinhalt auf dem Bett aus, ohne wirklich etwas zu finden, das ihr weiterhalf. Da fiel ihr Blick auf Fabians abgegriffenes Adressbuch. Sie schlug das Büchlein auf und blätterte es sorgfältig durch. Fabian hatte eine Weile in Toronto studiert und auch in einigen Städten in den USA gearbeitet. Sein Anruf eben war aus Nordamerika gekommen. Vielleicht hatte er bei einem Freund von der Uni oder einem ehemaligen Arbeitskollegen Zuflucht gesucht.
Serena sah die aufgelisteten Telefonnummern daraufhin durch. Aber weder für Kanada noch für die Staaten gab es viele Eintragungen. Sie war bereits bei »S« angelangt und gerade dabei, aufzugeben, als sie plötzlich hellhörig wurde: Shane Storm Hawk, Gleichen, Alberta, Canada.
Shane Storm Hawk. Shane Storm Hawk. Den Namen hatte Fabian oft erwähnt. Aber wer war er doch gleich? Fabian hatte so viele Bekannte. Dann fiel es Serena ein: Shane Storm Hawk war der Blackfoot-Indianer, mit dem Fabian in Toronto studiert und mit dem er vor einigen Jahren für eine Weile in Denver zusammengearbeitet hatte. Fabian hatte immer in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Vielleicht konnte er ihr weiterhelfen.
Serena lief zurück ins Wohnzimmer, das Adressbuch in der Hand. Entschlossen griff sie zum Telefon und wählte die Nummer. Es läutete viermal, aber niemand nahm ab. Dann meldete sich der Anrufbeantworter. Serena hinterließ eine kurze Nachricht.
Es gab noch eine andere Eintragung für Storm Hawk, eine Handynummer. Kurzerhand rief Serena auch dort an. Wieder meldete sich nur der Anrufbeantworter, und wieder blieb Serena nichts weiter übrig, als um baldigen Rückruf zu bitten.
Enttäuscht setzte sie sich aufs Sofa. Doch gleich darauf fuhr sie entgeistert auf: »Natürlich! Was für ein Dummerchen ich doch bin«, schalt sie sich selbst. Sie hatte die Zeitverschiebung vergessen. In Amerika war es noch mitten in der Nacht. Gut, dass sie niemanden aufgeweckt hatte. Sie würde sich einfach noch ein paar Stunden gedulden müssen.
»Damn it!«, fluchte Newman und knallte sein Handy auf den kleinen Tisch im Laderaum des VW-Transporters. »Unsere Leute waren nicht schnell genug. Eckehard ist ihnen entwischt! Das ist jetzt das zweite Mal!«
»Sollen wir ihm nach Halifax folgen, Chef?«, wollte Berger wissen.
»Natürlich nicht, du Dummkopf. Bis wir dort sind, ist der Kerl schon wer weiß wohin verschwunden.«
»Was schlägst du vor, Chef?«, fragte Berger vorsichtig.
»Was schlägst du vor, Chef?«, äffte Newman nach. »Habt ihr kein Gehirn? Die Schwester ist unsere einzige Chance. Bleib in der Leitung. Vielleicht meldet sich Eckehard noch einmal per Telefon oder E-Mail bei ihr. Schumann, du behältst ihre Wohnung im Auge. Sag sofort Bescheid, wenn sich etwas tut.«
Dennis Newman ließ sich auf einen der Stühle fallen und starrte wütend vor sich hin. Wie hatte man ihm nur solche hirnlosen Mitarbeiter und einen derart idiotischen Job zuweisen können? Um einem entflohenen Mönch und seiner kleinen Schwester nachzustellen, war er wirklich völlig überqualifiziert.
Newman arbeitete für Global Industries, eine Sicherheitsfirma, die ihren Hauptsitz in Frankfurt hatte. Er besaß sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsangehörigkeit, und er sprach das amerikanische Englisch akzentfrei. Obwohl er erst Anfang dreißig war, hatte er bereits mehrere Jahre als Verbindungsoffizier für BND und CIA gearbeitet. Überall auf der Welt hatte er geheime Aufträge durchgeführt, zuletzt in Irak und Afghanistan.
Vor einem Jahr hatte er genug davon gehabt, jeden Tag seinen Hals für andere Leute zu riskieren, und war bei Global Industries eingestiegen. Bisher waren seine Aufträge in Ordnung gewesen. Gutes Geld und geringes Risiko. Aber dies? Man brauchte keinen Mann mit Newmans Ausbildung, um einem Mönch hinterherzuspionieren. Umso mehr regte es Newman auf, dass ebendieser Mönch es nun schon zum zweiten Mal geschafft hatte, ihn an der Nase herumzuführen. Zuerst war Eckehard in Italien spurlos verschwunden, obwohl Newmans Männer ihn rund um die Uhr bewacht hatten. Newmans Vorgesetzter hatte ihn daher angewiesen, Eckehards Schwester zu observieren. Tagelang war nichts passiert. Heute endlich hatte Eckehard den Fehler begangen, sich telefonisch bei ihr zu melden. Berger und Schumann hatten den Anruf zurückverfolgt. Eckehard hielt sich im Hafen von Halifax auf. Newman hatte weitreichende Verbindungen, und Global Industries hatte überall auf der Welt Handlanger. Das öffentliche Telefon, von dem aus Eckehard angerufen hatte, war innerhalb von wenigen Minuten umstellt gewesen. Aber Eckehard war ihnen ein weiteres Mal durch die Finger geschlüpft.
»Chef, unser Verbindungsmann in Halifax hat gerade durchgegeben, dass Eckehard unter dem Namen Dimitri Csaba auf einem brasilianischen Frachter von Rotterdam aus nach Halifax gekommen ist«, riss Berger Newman aus seinen Gedanken.
»Und? Haben sie ihn aufgespürt?«
»Nein«, gab Berger zurück. »Unter diesem Namen ist niemand durch die Passkontrolle gegangen. Eckehard muss entweder auf ein anderes Schiff umgestiegen oder unter einem völlig anderen Namen nach Kanada eingereist sein.«
»Unser kleiner Mönch ist schlauer, als ich angenommen habe«, murmelte Newman aufgebracht und drehte seine schwarze Sonnenbrille unruhig in der Hand. »Aber wir werden sehen, wer am Ende der Schlauere von uns beiden ist.«
II
Shane Storm Hawk war zu Fuß im Banff National Park unterwegs. Es war ein sonniger Augusttag, und selbst hier, hoch oben in den kanadischen Rockies, wehte ein warmer Wind. Dem Sommer blieb in dieser Gegend nur eine kurze Zeit, aber er war umso schöner.
Shane wanderte kurz unterhalb der Baumgrenze. Hier standen Espen und Lodgepole-Kiefern dicht an dicht. Wapitiherden durchzogen die Wälder. Die großen, anmutigen Tiere grasten genüsslich in der warmen Sonne. Nach dem langen harschen Winter wussten sie die Sommermonate zu schätzen. Gruppen von Bergschafen kletterten über die zerklüfteten Felsen der Berghänge und ließen ihre riesigen geschwungenen Hörner blitzen. Und hoch über den von Schnee und Gletschern bedeckten Berggipfeln zogen majestätische Adler und Habichte ihre Runden. Die einsamen Schreie der großen Raubvögel echoten durch die Stille.
Andere Leute konnten diese unberührte Natur nur im Urlaub genießen. Shane hingegen war beruflich oft in ihr unterwegs. Diese Tatsache war es, was er am meisten an seinem Beruf liebte und weswegen er den Job in Banff angenommen hatte. Shane war Geologe und kümmerte sich im Park zurzeit um die Analyse einiger Gesteinsproben, die von der Provinzregierung angefordert worden war. Überhaupt lag ihm die Wildnis im Blut. Shanes Mutter war Indianerin vom Stamm der Blackfoot. Sein Vater stammte ursprünglich aus Norwegen, war aber nach Kanada umgesiedelt, weil es in den Siebzigern gutbezahlte Jobs im hohen Norden gegeben hatte. Auch er war dem Ruf der Wildnis verfallen.
Shane grinste, als er wieder einmal feststellte, wie merkwürdig sich die Gene seiner Eltern bei ihm gemischt hatten. Er hatte nicht etwa das dominante schwarze Haar, die dunklen Augen und die schlanke Gestalt seiner indianischen Vorfahren geerbt, sondern die stattliche Wikingergröße, die breiten Schultern und die dunkelblauen Augen seines Vaters. Sein langes Haar war zwar von einem dunklen Braun, aber wenn die Sonne daraufschien, zeigte es einen rötlichen Schimmer, der eindeutig auf die norwegische Seite seiner Familie zurückzuführen war. Nur seine Gesichtszüge verrieten dem Außenstehenden die indianische Herkunft. Doch Shanes Mutter Helen und Großmutter Storm Hawk hatten ihm von klein auf erklärt, dass es nicht auf Äußerlichkeiten ankam. Was zählte, war allein das, was in den Herzen der Menschen zu finden war. Und vom Herzen und Wesen her, das hatten die beiden Frauen sehr schnell festgestellt, war Shane ein Indianer und sonst nichts. Das hatte auch sein Grundschullehrer gleich zu Schulbeginn gemerkt. Shane war bereits damals ein Einzelgänger gewesen, nie überstürzt in seinem Handeln, nie unüberlegt in seinen Worten, aber von Grund auf aufrichtig. Dazu besaß er einen feinen Humor und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Shane setzte seinen Weg über den dichtbewaldeten Berghang fort. Er war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass er nicht aufpasste, wohin er trat. Für diese Unachtsamkeit bezahlte er sofort: Er stolperte über etwas, das unmittelbar vor ihm etwa fünf Zentimeter aus der Erde ragte, und fiel unsanft zu Boden.
»Was ist denn das?«, murmelte Shane verärgert. Er stand auf und klopfte die lose Erde von seiner Kleidung. Dann begutachtete er, was ihn hatte stolpern lassen. Mitten in den felsigen Boden war ein Betonring eingelassen, breit genug, dass ein ausgewachsener Mann hindurchpasste. Der Ring war mit einem Metallgitter abgedeckt.
Shane beugte sich nach vorne, um in den Ring hineinzusehen, zog sich jedoch sofort überrascht zurück. Er spürte einen starken Luftstrom. Shane hockte sich neben den Betonring und hielt die Hand über das Gitter. Er hatte es sich nicht eingebildet. Irgendetwas sog eine Menge Luft nach unten ins Innere des Berges. Shane war hier oben in der unberührten Wildnis nicht bloß auf irgendeinen Betonring gestoßen, sondern auf einen Schacht! Und da war noch etwas: Für einen kurzen Augenblick meinte er, ein leises Flüstern zu vernehmen. Es schien aus den Felsen zu kommen.
Unwillkürlich musste er an die Geschichten denken, die Großmutter Storm Hawk ihm über die rock listeners erzählt hatte, als er ein Junge gewesen war. Rock listeners waren Blackfoot mit der besonderen Gabe, die Stimmen der Spirits, der Geistwesen, zu vernehmen, wenn sie ihr Ohr an Steine oder Felsen legten. Shane gehörte seinem Wissen nach nicht zu diesen besonderen Menschen, niemand in seiner Familie. Hatte er sich das Flüstern dann einfach eingebildet? Shane schüttelte den Kopf. Seine indianische Erziehung hatte ihn gelehrt, seinen Instinkten zu folgen. Auf sie musste er sich auch jetzt verlassen.
Shane stand auf und blickte sich aufmerksam um. So ein Luftschacht war nicht umsonst mitten in der Wildnis. Er musste irgendwo dazugehören, zu einem Bergwerk vielleicht oder einem anderen unterirdischen Bau.
Shane brauchte nicht lange zu suchen. Keine fünf Meter von ihm entfernt entdeckte er einen weiteren Schacht. Auch hier verspürte er einen starken Luftzug. Er folgte der unsichtbaren Linie, entlang derer die Betonringe angelegt zu sein schienen, und stieß auf vier weitere Schächte. Dann vernahm er ein dumpfes Geräusch.
Vorsichtig und ohne den geringsten Laut zu verursachen, schlich Shane weiter. Plötzlich teilten sich die Bäume, und ein hoher, sehr offiziell wirkender Drahtzaun versperrte ihm den Weg. Shane hielt überrascht inne. Der Zaun war am oberen Ende mit mehreren Reihen Stacheldraht eingefasst. Merkwürdigerweise zeigte der mit Stacheldraht versehene Teil des Zauns nach innen, nicht nach außen, wie Shane es erwartet hätte. Verwundert lief er ein Stück am Zaun entlang. Dies war der Banff National Park. Hier gab es keine Privatgrundstücke, schon gar nicht mit hohen, bedrohlichen Drahtzäunen.
Kurz darauf blieb er vor mehreren großen Schildern stehen. Das erste Schild war gelb und zeigte einen schwarzen Blitz. Der Zaun stand unter Strom. Shane tat unwillkürlich einen Schritt zurück. Ein elektrischer Zaun, hier im Park? Aber es war das zweite Schild, das ihn komplett aus der Fassung brachte. In großen Buchstaben stand darauf zu lesen: Militärischer Sicherheitsbereich – Zutritt verboten!
Militärischer Sicherheitsbereich, was mochte das bedeuten? Shane hatte im Verlaufe der vergangenen Wochen alle Karten, die von dem Park existierten, eingehend studiert, auch solche, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Aber eine staatliche Einrichtung war in keiner von ihnen eingetragen.
Shane spähte hinunter in die Tiefe. Vielleicht konnte er einsehen, was dort vor sich ging.
Er hatte kein Glück. Alles, was er sah, war eine staubige, unbefestigte Straße, die sich zwischen den Bäumen den Berghang hinaufschlängelte. Wo sie hinführte, war nicht zu erkennen. Ein riesiger Felsvorsprung versperrte die Sicht. Shane wägte das Gelände ab. Der Zaun endete nicht weit von ihm entfernt an einer steilen Felswand. Ohne eine richtige Kletterausrüstung würde er sie nicht erklimmen können. Und es gab keinen Weg daran vorbei. Wollte er mehr über die Straße und die merkwürdige Anlage herausfinden, dann musste er an einem anderen Tag und besser ausgestattet wiederkommen. Verdrießlich machte Shane sich auf den Rückweg. Was immer hier vor sich ging, etwas war faul an der Sache.
Selbst am nächsten Morgen, als Shane wieder in seiner kleinen Wohnung in Banff war, weilten seine Gedanken noch immer bei den Luftschächten und der merkwürdig abgeriegelten Anlage, tief in der unberührten Wildnis des Parks.
Er stellte die kalte Pizza, die gestern beim Abendessen übrig geblieben war, auf dem Küchentresen ab und biss herzhaft in das erste Stück, als ihm einfiel, dass er vergessen hatte, die Nachrichten auf seinem Handy abzuhören. Er fischte das Telefon aus seiner Jackentasche und öffnete die Mailbox. Nur eine Nachricht, er hatte nicht viel verpasst. Doch die Worte, die er kurz darauf vernahm, trafen ihn derart unvorbereitet, dass er sich an seiner Pizza verschluckte.
Fabian lächelte zufrieden. Bisher war alles besser verlaufen, als er zu hoffen gewagt hatte. Am Morgen, gleich nachdem die Geschäfte geöffnet hatten, hatte er einen Gebrauchtwagenhändler aufgesucht und einen silberfarbenen, vier Jahre alten Ford Focus erstanden. Er hätte einen älteren Wagen für die Hälfte des Geldes haben können, aber Fabian wollte so unsichtbar wie möglich bleiben. Ein zu neues oder zu altes Auto würde unnötig auffallen, besonders der Polizei. Das wollte er um jeden Preis vermeiden. Der Händler hatte ihm immerhin einen guten Nachlass gegeben und keine Fragen gestellt, denn Fabian hatte die rund zehntausend Dollar in bar bezahlt. Und eine knappe Stunde später war er in seinem neuen Wagen vom Hof des Gebrauchtwagenhändlers gefahren.
Jetzt hatte er Halifax verlassen und fuhr auf dem Trans-Canada Highway nach Westen. Es war ein wunderschöner Sommermorgen. Dunkle Tannen- und leuchtende Laubwälder zogen sich an der Straße entlang, und hier und da ragten schroffe Felsbrocken zwischen den Bäumen hervor. Bald würde zu seiner Linken der Northumberland Strait auftauchen und er würde Nova Scotia hinter sich lassen. Dann ging es weiter durch New Brunswick und Quebec, immer weiter und weiter nach Westen. Irgendwo würde er anhalten, um ein paar Tage Luft zu holen und seine Seele zur Ruhe kommen zu lassen.
Zunächst jedoch lag nur der wenig befahrene Trans-Canada Highway vor ihm. Fabian schaltete den Tempomat ein und drehte das Radio lauter.
Serena ging ruhelos im Wohnzimmer auf und ab. Seit Fabians Anruf waren viele Stunden vergangen. Es war Abend geworden, und sie fühlte sich ungewohnt erschöpft. Sie hatte versucht, ein wenig zu schlafen, aber es war ihr nicht gelungen. Ihre Gedanken kreisten allein um Fabian. Eine Welle der Hilflosigkeit war über ihr zusammengebrochen. Sie wollte etwas unternehmen, ihrem Bruder irgendwie helfen, aber sie wusste nicht wie. Ihre einzige Hoffnung war der Rückruf von Shane Storm Hawk. In Alberta war es jetzt fast zehn Uhr vormittags. Er müsste ihre Nachricht doch längst erhalten haben.
Serena blieb ruckartig stehen. Was, wenn Shane Storm Hawk im Urlaub war oder beruflich außer Haus? Wie lange würde sie dann auf eine Antwort warten müssen? Alle Hilfe für Fabian könnte dann schon zu spät sein! Sie konnte einfach nicht mehr länger warten. Sie musste aus dem Haus gehen und sich ablenken, sonst würde sie vor Sorge noch verrückt werden.
Entschlossen trat sie in den Flur. Sie nahm ihre Jacke vom Haken und steckte ihre Hausschlüssel in die Tasche. Sie wollte sich gerade die Schuhe zubinden, als das Telefon schrillte.
Serena stürzte zurück ins Wohnzimmer und nahm ab. Mit klopfendem Herzen meldete sie sich.
»Eckehard.«
»Serena Eckehard?«, ertönte eine tiefe, wohlklingende Männerstimme.
»Ja.«
»Shane Storm Hawk hier«, stellte sich der Mann auf Englisch vor. »Du hast eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Es geht um Fabian. Du bist seine Schwester, richtig? Er hat oft von dir gesprochen.«
»Das ist richtig.« Serenas Stimme zitterte. »Ich bin Fabians Schwester, und ich versuche, ihn zu kontaktieren. Er hat sich nicht zufällig bei dir gemeldet?«
»Nein«, meinte Shane verwundert. »Warum sollte er? Soviel ich weiß, ist er in einem Kloster, irgendwo in Italien.«
Serena seufzte tief. Ihr Hoffnungsschimmer war erloschen.
»Serena, irgendetwas stimmt doch nicht«, hakte Shane nach. »Ist Fabian in Schwierigkeiten? Vielleicht kann ich helfen.«
Serena zögerte einen Augenblick, aber ihre Sorge war zu groß. Sie musste sich einfach jemandem anvertrauen.
»Fabian ist nicht mehr im Kloster«, begann sie mit bebender Stimme. »Ich weiß nicht genau wieso. Auf jeden Fall hat er mich heute Morgen angerufen. Er schien sehr nervös und war in großer Eile.« Sie machte eine Pause und versuchte sich Fabians Worte ins Gedächtnis zurückzurufen.
»Er sagte, dass er nicht ins Kloster zurückkehren würde. Dass jemand ihm vor drei Jahren, kurz bevor er sich dem Kloster anschloss, einen Job angeboten hätte und dass diese Leute in irgendwelche schlimmen Sachen verwickelt seien. Er meinte, sie würden nach ihm suchen, weil er das Kloster verlassen habe, aber er hätte erkannt, dass er etwas gegen sie unternehmen müsse. Dann war die Leitung plötzlich tot.« Tränen wallten in ihren Augen auf, aber sie riss sich zusammen.
»Und er hat nicht gesagt, wo er sich zurzeit aufhält?«, wunderte Shane sich. »Hat er irgendwelche Namen erwähnt?«
»Nein, nichts. Das ist es ja gerade. Aber mein Telefondisplay hat angezeigt, dass er aus Nordamerika angerufen hat. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich komme hier fast um vor Sorge. Also habe ich die Schachtel mit Fabians persönlichen Sachen durchforscht. Dabei bin ich auf deinen Namen gestoßen. Du warst meine einzige Hoffnung, Fabian zu finden.«
»Du kannst unmöglich alleine nach ihm suchen. Du solltest die Polizei einschalten.«
»Die Polizei«, schnaufte Serena. »Bis die mal etwas unternehmen.« Sie schwieg einen Augenblick. Dann fragte sie aus einem Gefühl heraus: »Shane, kennst du jemanden, bei dem Fabian untergetaucht sein könnte?«
»Fabian hatte nie viele enge Freunde«, überlegte Shane. »Ich kenne niemand außer mir, dem er in Kanada oder den USA derart vertrauen würde. Aber sollte Fabian tatsächlich in Schwierigkeiten sein, dann würde er nie jemanden mit hineinziehen wollen. Er ist ein Mensch, der seine Probleme immer allein zu bewältigen versucht.«
Serena seufzte. Shane hatte recht. Er musste ihren Bruder wirklich sehr gut kennen, um seinen Charakter so treffend beurteilen zu können.
»Aber es gibt einen Ort, der vielleicht …«, begann Shane. »Nein, das macht keinen Sinn.«
»Was macht keinen Sinn?«, fragte Serena. »Von welchem Ort sprichst du?«
Shane schwieg einen Augenblick.
»Ich weiß nicht, ob Fabian es dir gegenüber je erwähnt hat, aber meine Mutter ist Blackfoot-Indianerin«, erklärte er schließlich. »Die Blackfoot haben viele heilige Orte. Wir gehen dorthin, um zu Great Spirit, dem Großen Geist, und all den anderen Spirits, den Geistwesen, zu beten, die uns Menschen helfen. Aber das Gebet ist nicht der einzige Grund, warum wir diese Orte aufsuchen. Unsere heiligen Plätze haben besondere Energien, besondere Kräfte, die einem helfen, Stärke und Mut, Weisheit und Klarheit zu finden. Traditionell werden solche Orte in wichtigen Situationen aufgesucht, vor einem bevorstehenden Kampf zum Beispiel oder einer Prüfung. Vielleicht hat Fabian vor, einen dieser Orte zu besuchen, bevor er mit dem beginnt, was er sich vorgenommen hat – was auch immer das sein mag.«
»Dann hast du mit Fabian über diese heiligen Plätze gesprochen?«, fragte Serena gespannt.
»Viele Male. Besonders über einen, weil ich schon oft dort war, um zu beten. Fabian ist sogar einmal mit mir dort gewesen.«
»Darf ich wissen, wie er heißt und wo ich ihn finden kann?«, erkundigte Serena sich vorsichtig.
Shane lachte auf. »Natürlich. Der Ort ist kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil, heutzutage ist er eine Touristenattraktion. Leider. Ich spreche von Bear Butte in South Dakota.«
»South Dakota«, wiederholte Serena nachdenklich. »Ich muss sofort dorthin!«
»Serena, warte einen Moment!«, rief Shane. »Du solltest da nicht allein hinreisen.«
»Ich habe niemand, der mich begleiten könnte«, stellte Serena sachlich fest.
»Ich würde dich gerne begleiten«, erklärte Shane sofort. »Aber ich habe gerade diesen neuen Job im Banff National Park in Alberta angenommen. Vielleicht wenn …«
»Mach dir keine Umstände«, beruhigte Serena ihn. »Ich möchte dich wirklich nicht noch mehr in die Angelegenheit mit hineinziehen. Ich werde schon alleine zurechtkommen, keine Angst.«
»Bitte überleg dir gut, worauf du dich einlässt. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.«
»Ich habe es mir gut überlegt«, erwiderte Serena. »Und ich danke dir von Herzen für deine Hilfe.«
»Also gut, viel Glück. Und halt mich auf dem Laufenden.«
»Das werde ich tun«, sagte Serena. »Und nochmals vielen Dank.« Dann legte sie auf.
Serena war plötzlich ganz gelassen. Alle Unruhe war von ihr abgefallen. Es gab etwas, das sie tun konnte, sie brauchte nicht mehr untätig in ihrer Wohnung herumsitzen. Sie würde nach South Dakota reisen und an diesem heiligen Ort, diesem Bear Butte, mit ihrer Suche nach Fabian beginnen. Vielleicht gab es dort einen weiteren Anhaltspunkt. Vielleicht hatte jemand Fabian dort gesehen. Vielleicht …
»Chef, wir haben etwas!«, rief Berger aufgeregt. »Eckehards Schwester hat gerade mit einem Shane Storm Hawk in Kanada gesprochen.«
»Und? Was gibt´s?« Newman sprang von seinem Stuhl auf. »Ich brauche Einzelheiten!«
»Sie reist nach South Dakota. Hofft, dort auf ihr liebes Brüderlein zu treffen.«
»Wann wird sie aufbrechen?«
»Sie hat gerade ein Ticket nach New York gekauft, Chef. Der Flug geht morgen früh.«
»Wieso New York?«
Berger zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen, Chef?«
»Und was ist mit diesem Storm Hawk? Reist der auch nach South Dakota?«
»Hat sich nicht so angehört, Chef.«
»Komm schon, Berger, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen«, fuhr Newman ihn an.
»Sonst haben sie nichts gesprochen, Chef, ehrlich«, erwiderte Berger gekränkt.
»Also gut«, meinte Newman und beruhigte sich ein wenig. »Verständige unseren Verbindungsmann in South Dakota. Er soll Ausschau nach Eckehard halten.«
»Aber sie ist doch noch hier, Chef«, wunderte Berger sich.
»Nach dem Bruder, du Idiot!«, brauste Newman auf. »Dann häng einen Schatten an diesen Storm Hawk. Wir müssen uns nach allen Seiten absichern. Ich werde ein paar Mitarbeiter in New York anfordern und versuchen, einen Platz in derselben Maschine zu bekommen, die Eckehard gebucht hat.« Er zog sein Handy aus der Jackentasche.
»Schumann und ich werden dich nicht begleiten?«, fragte Berger missmutig.
»Sieht nicht so aus, oder?«
III
Erleichtert steckte Serena den Reisepass zurück in ihre Handtasche. Die Warteschlange an der Passkontrolle war so lang gewesen, dass sie schon fast nicht mehr daran geglaubt hatte, den Flughafenausgang jemals zu erreichen. Serena war nach 9 / 11 nicht mehr in den Staaten gewesen. Die Sicherheitskontrollen waren auch davor schon erheblich gewesen, aber jetzt waren sie noch viel strenger geworden. Für die Reisenden bedeutete das noch einmal längere Wartezeiten, und sie mussten viel Geduld aufbringen. In der Maschine, mit der Serena geflogen war, waren viele Familien mit kleinen Kindern gewesen. Für sie mussten die Wartezeiten an der Passkontrolle, besonders nach dem langen Flug, eine wahre Tortur sein.
Serena rieb sich den schmerzenden Rücken. Sie fühlte sich müde und erschöpft. Wie sehr sie diese langen Flüge hasste! Aber meckern half ihr jetzt nicht weiter. Sie schlang sich die kleine Umhängetasche um, in der sie ihre Fotokamera aufbewahrte, ergriff ihre Reisetasche und machte sich auf den Weg zur Autovermietung. Sie hatte sich spontan dazu entschlossen, die Strecke von New York bis nach South Dakota mit dem Auto zurückzulegen. Vom Fliegen hatte sie erst einmal genug.
Serena musste noch ein ganzes Stück laufen, denn der JFK-Flughafen war riesig. Aber Sonnenlicht strömte durch die hohen Glasscheiben des Flughafengebäudes, und ihre Laune besserte sich schon bald. Sie kam an einem Kiosk vorbei und besorgte sich etwas zu trinken.
Während sie an der Kasse anstand, fiel ihr Blick auf die verschiedenen Zeitungen, die am Verkaufstresen auslagen. Eines der Titelblätter weckte ihr Interesse. Kojoten in den Vorstadtorten auf Long Island, lautete die Überschrift. Aber es war das Foto darunter, das Serena zweimal hingucken ließ. Es war die Nahaufnahme eines Kojoten, ein ausgesprochen guter Schuss, wie sie zugeben musste.
Serena war mit dem Bezahlen an der Reihe. Kurzerhand griff sie nach der Zeitung und kaufte auch sie. Vor dem Kiosk blieb sie stehen und trank ein paar Schlucke ihres stillen Wassers. Dabei studierte sie eingehend das Foto des Kojoten. Etwas Besonderes lag in seinem Blick, etwas Schelmenhaftes und gleichzeitig etwas sehr Weises, Wissendes. Das Tier schien sie aus dem Foto heraus direkt anzublicken. Wie war es dem Fotografen nur gelungen, diesen Blick, diesen Ausdruck einzufangen?
Dennis Newman trat aus dem Eingang des JFK-Flughafens. Er setzte seine dunkle Sonnenbrille auf und blickte sich suchend um. Etwas abseits entdeckte er zwei Männer. Sie trugen schwarze Sonnenbrillen, schwarze Anzüge und weiße Hemden. Newman sah auf den ersten Blick, dass es billige Kleidung von der Stange war, nicht die europäische Qualität, die er selbst ausschließlich trug.
Newman rückte seine Krawatte zurecht und musterte die Männer unauffällig. Die beiden hielten die Hände vor dem Körper verschränkt und standen noch immer starr wie Statuen, die Blicke nach vorn gerichtet. Der eine war groß, mit kurzem braunem Haar und Schultern wie ein Schrank. Der andere war klein und wirkte eher schmächtig. Sein schwarzes Haar war glatt aus dem Gesicht gekämmt, seine Miene finster. Dies waren unverkennbar Newmans neue Mitarbeiter.
Expolizisten, unehrenhaft aus dem Dienst entlassen, ging es Newman durch den Kopf. Wann würde man ihm endlich einmal vernünftige Mitarbeiter zuteilen?
»Dennis Newman?«, fragte der Schrank, ohne eine Miene zu verziehen, als Newman näher kam.
Newman nickte.
»Mein Name ist Miller«, stellte der Mann sich vor. »Und dies ist Sorrento.« Er zeigte auf seinen Partner. »Wir freuen uns, mit dir arbeiten zu dürfen.«
Newman schüttelte den beiden die Hände.
»Miller, Sorrento, freut mich. Ist alles vorbereitet?«
»Alles wie angeordnet, Boss«, erklärte Miller. »Unser Wagen steht dort drüben.«
Newmans Blick folgte seiner Kopfbewegung. In einiger Entfernung erspähte er einen nagelneuen, glänzend schwarzen Hummer.
»Ich hatte etwas von unauffällig gesagt«, meinte Newman düster.
»Der Wagen ist unauffällig, Boss«, antwortete Miller.
Newman warf ihm einen irritierten Blick zu.
»Eckehard hat gerade einen Jeep gemietet«, erklärte Miller. »Wir sollten uns ranhalten, damit wir sie nicht aus den Augen verlieren. Komm, Boss, schau dir unsere Ausstattung an.«
Newman folgte den beiden über die Straße zu dem schwarzen Hummer.
»Du bist aus Deutschland eingeflogen, stimmt´s, Boss?«, fragte Miller.
»Das stimmt«, sagte Newman kurz angebunden.
»Wo ist denn das?«, wollte Miller wissen.
Newman seufzte. Sein erster Eindruck von Miller hatte ihn nicht getäuscht. Kein Gehirn.
»Was ist mit Sorrento los, Miller?«, fragte Newman, anstatt die Frage zu beantworten. »Ist er stumm?«
»Nein, Boss«, erklärte Miller. »Er redet bloß nicht viel. Aber mach nicht den Fehler, ihn zu verärgern. Er hat ein mehr als aufbrausendes Temperament. Italiener. Ihm entgeht nichts.«
Sie hatten den Hummer erreicht. Sorrento öffnete schweigend die Türen zum Laderaum und grinste Newman stolz an.
Newman spähte über den Rand seiner Sonnenbrille, um im Licht der abgedunkelten Fenster besser sehen zu können. Die Ladefläche war voller Waffen: Schrotflinten, automatische Gewehre, Scharfschützengewehre, Zielfernrohre und Handfeuerwaffen.
Newman hob die Augenbrauen und pfiff durch die Zähne.
»Habe ich etwas durcheinandergebracht? Hinter wie vielen Leuten sind wir her? Ich dachte, es wären ein entlaufener Mönch und seine kleine Schwester?«
»Du hast etwas von einem Indianer gesagt«, erwiderte Miller gekränkt. »Die sind gefährlich, Boss.«
Newman stieg auf den Beifahrersitz, zog die Tür ins Schloss und warf die Zeitung, die er unterwegs gekauft hatte, auf das Armaturenbrett.
Miller setzte sich ans Steuer.
»Kojoten auf Long Island, hm«, kommentierte er die Titelseite. »Das wird den feinen reichen Leuten dort nicht gefallen.«
»Vielleicht sollten wir Sorrento hinschicken«, versuchte Newman zu scherzen. »Seine Miene ist so finster, dass sie jedes wilde Tier verscheuchen wird.«
»Ich verscheuche nichts, Boss«, brach Sorrento sein Schweigen. »Ich töte. Peng, peng, peng, peng. Kein Problem mehr mit Kojoten.«
»Okay«, meinte Newman. »Fahr los, Miller.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. Eine so schmerzhafte Kombination von Mitarbeitern wie Miller und Sorrento hatte er noch nie erlebt. Im Vergleich zu ihnen waren Berger und Schumann wahre Genies.
Der Highway zog sich wie ein graues Band entlang der großen Seen durch die raue Wildnis. Zu beiden Seiten der Straße reihten sich Kiefern dicht an dicht. Felsbrocken ragten zwischen ihnen hervor. Oft war das Gebirge so unüberwindbar gewesen, dass die verantwortlichen Ingenieure ganze Schluchten durch die Berge hatten sprengen lassen, um Platz für den Highway zu machen. An diesen Stellen begrenzten zum Teil sehr hohe Felswände die Fahrbahn. Alles in allem war es jedoch ein recht monotoner Anblick. Seit Hunderten von Kilometern war immer das Gleiche zu sehen. Das Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde und die wenigen anderen Autos, die ihm begegneten, verschafften keine Erleichterung. Der Weg um die Großen Seen schien sich endlos hinzuziehen.
Fabian unterdrückte ein Gähnen. Er war seit gut zwei Tagen unterwegs, hatte zu viel am Steuer gesessen und zu wenig geschlafen. Er befand sich irgendwo zwischen Sault Ste. Marie und Thunderbay, in der einsamen Wildnis des nördlichen Ontario. Ein Hinweisschild tauchte neben dem spärlich befahrenen Highway auf.
Raststätte2Kilometer, las Fabian.
Endlich. Er musste sich unbedingt ein paar Stunden ausruhen.
Die Raststätte befand sich nahe des Highways in einiger Entfernung zum Seeufer. Fabian parkte seinen Wagen und stieg aus. Außer ihm war niemand dort. Er streckte sich und ging auf einem schmalen Trampelpfad zum Wasser hinunter, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Der Lake Superior lag in seiner ganzen Weite vor ihm. Fabian hätte genauso gut irgendwo am Meer sein können. Der See war so riesig, dass das andere Ufer hinter dem Horizont verborgen lag. Möwen kreischten. Der Himmel war wolkenverhangen und verlieh den gewaltigen Wassermassen und dem felsigen, dichtbewaldeten Ufer ein beinahe mystisches Aussehen. Es war ein unvergesslicher Anblick.
Fabian setzte sich auf einen der großen Felsbrocken, die am Ufer verstreut lagen, und blickte hinaus aufs Wasser. Seine Gedanken wanderten zurück zu dem Telefonat mit Serena. Es war zu dumm gewesen, dass er das Gespräch so plötzlich hatte abbrechen müssen. Er hatte seine Schwester nicht unnötig beunruhigen wollen. Dass sie jetzt in heller Aufregung war, schien ihm sicher, aber es ließ sich nicht mehr ändern. Er konnte es kein zweites Mal riskieren, sie zu kontaktieren. IPC – International Pharmaceutical Corporation – war ein mächtiger Konzern und hatte seine Handlanger überall.
Der Gedanke an IPC brachte Fabian zurück zu seinem Plan. Doch zunächst musste er sich ausruhen, neue Kräfte sammeln und vor allen Dingen von seinem alten Leben als Bruder Simeon gebührend Abschied nehmen. Es schien ihm, als sei seine Seele noch immer irgendwo draußen auf dem stürmischen Atlantik. Er musste warten, bis sie seinen Körper eingeholt hatte.
Plötzlich kam Fabian ein sehr willkommener Gedanke: Warum blieb er nicht einfach für ein paar Tage hier? Hier konnte er ungestört fasten und beten und wieder zu sich selbst finden.
Mit einem zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht ging er zurück zum Parkplatz. Dies war mit Abstand der letzte Ort, an dem ihn die IPC-Typen vermuten würden.
Fabian holte sich eine Decke, Trinkwasser und bequemere Klamotten aus dem Kofferraum. Er musste unbedingt aus diesen steifen und engen Jeans heraus. Dann kehrte er zum Ufer des Sees zurück. Er tauschte die Jeans gegen Jogginghosen, breitete die Decke aus und kniete sich nieder. Es war an der Zeit, Gott in aller Ausführlichkeit Dank entgegenzubringen.
Am Freitag kehrte Shane eher als gewöhnlich von der Arbeit zurück. Er parkte seinen Wagen und stieg aus. Es war ein herrlicher Sommerabend, aber Shane schenkte dem fröhlichen Gezwitscher der Vögel und der lauen, würzigen Brise, die von den Berghängen herabwehte, keine Beachtung. Seine Gedanken weilten noch immer bei dem Telefonat, das er vor zwei Tagen mit Serena Eckehard geführt hatte, und bei seinem alten Freund Fabian. In was für Sachen war er bloß verwickelt?
Shane nahm die Post aus dem Briefkasten. Reklame und Rechnungen. Gedankenverloren öffnete er die Haustür, legte die Briefe auf dem Küchentresen ab und warf seine Jacke aufs Sofa. Wie stickig es hier drinnen war. Er öffnete die Fenster, dann checkte er den Anrufbeantworter. Drei Nachrichten. Er drückte auf die Wiedergabetaste.
»Shane, ich bin´s, Mom. Ruf kurz an, wenn du Zeit hast. Grandma möchte wissen, wann du mal wieder nach Hause kommst. Sie hätte dich selbst angerufen, aber du weißt ja, wie sehr sie es hasst, auf Band zu sprechen.«
Shane lächelte. Grandma hatte wie immer recht, es war höchste Zeit, dass er sich zu Hause blicken ließ. Seine Mutter und Großmutter hingen sehr an ihm, das wusste er. Aber sie ahnten nicht, dass er genauso sehr an ihnen hing. Der Zusammenhalt der Familie war ihm sehr wichtig, und die beiden waren alles, was er an Familie hatte.
Die Maschine piepte, und die nächste Nachricht wurde abgespielt.
»Desiree hier, Shane. Ich habe jetzt schon ein paarmal eine Nachricht hinterlassen, aber nie von dir gehört. Versuchst du, mir aus dem Weg zu gehen? Ruf mich an. Ich lasse dich nicht entwischen.«
Shane seufzte. Er war einige Male mit Desiree ausgegangen, nichts Ernstes. Aber nun rief sie ihn jeden Tag an und ließ sich überhaupt nicht mehr abwimmeln. Diesem Problem würde er sich in den nächsten Tagen stellen müssen.
Er hörte sich die letzte Nachricht an.
»Dies ist eine automatische Nachricht von Telus«, ertönte eine künstliche Stimme. »Ihr Kundenkonto ist seit mehr als dreißig Tagen im Minus. Bitte begleichen Sie die ausstehenden Beträge sofort.«
Shane runzelte die Stirn. Was sollte das nun wieder? Er hatte alle Rechnungen vor einer Woche bezahlt. Oder war er durcheinandergekommen? Er blickte zum Küchentresen hinüber. Dort lag ein großer Stapel loser Papiere. Es konnte durchaus möglich sein, dass ihm in dem Durcheinander eine der Rechnungen entgangen war.
Ungehalten wühlte Shane in den Papieren herum. Dabei kam ihm auch die neueste Post unter die Finger. Er sortierte die Reklame aus und überflog, was übrig blieb: Autoversicherung, Kontoabrechnung, ein Rundschreiben seines Schießvereins. Das alles hatte Zeit. Dann fiel sein Blick auf den letzten Brief. Es war eine Eilsendung. Er schaute auf die Rückseite des Umschlags. Kein Absender. Shane studierte den Brief. Er war vor zwei Tagen in Halifax, Nova Scotia, abgestempelt worden.
Halifax? Shane kannte niemanden, der dort lebte. Verwundert öffnete er den Umschlag. Er enthielt nur ein einziges Blatt Papier. Shane faltete es auseinander und – erstarrte. Er kannte die Handschrift nur zu gut. Es war Fabians. Offensichtlich war er sehr in Eile gewesen, denn die Zeilen waren sehr flüchtig geschrieben:
Mein lieber Shane,
unvorhergesehene Ereignisse haben es notwendig gemacht, dass ich unkonventionelle Wege einschlagen muss. Man ist hinter mir her, um mich zum Schweigen zu bringen, und die Zeit, dir endgültig Lebewohl zu sagen, ist sehr viel eher gekommen, als es mir lieb ist. Ich möchte mich bei dir für die Freundschaft bedanken, die du mir all die Jahre über so offen und rückhaltlos entgegengebracht hast. Ich werde es dir nie vergessen.
Zum Schluss noch eine Bitte: Sollte sich meine Schwester Serena bei dir melden, dann kümmere dich, so gut du kannst, um sie. Ich befürchte, es wird nicht einfach für sie werden.
Denk immer an Gandhis Worte, mein Freund:
Du unterstützt ein böses gesellschaftliches System am effektivsten, wenn du seine Befehle und Anordnungen befolgst. Ein böses System verdient niemals eine solche Treue. Ihm Treue zu zeigen heißt, am Bösen teilzunehmen. Ein guter Mensch wird sich einem bösen System mit seiner oder ihrer ganzen Seele widersetzen.
Pass auf dich auf.
Fabian
PS: Vertraue niemandem!
Shane starrte fassungslos auf den Brief. Dann las er die Worte ein zweites Mal.
»Verflucht, Fabian!«, rief er anschließend und schlug mit der Faust auf den Tresen. »Ein Abschiedsbrief? Das kann doch nicht dein Ernst sein! Und ich habe Serena gesagt, dass du nie jemanden in deine Probleme hineinziehen würdest. Nun, du hast es soeben getan, wenn auch unbeabsichtigt.«
Shane nahm den Umschlag und versuchte, das Absendedatum zu entziffern: 18. August. Der Tag, an dem Fabian Serena in Berlin angerufen hatte.
Serena – auch sie hatte Fabian in sein Problem mit hineingezogen. Sie war in diesem Augenblick mutterseelenallein unterwegs nach Bear Butte, um nach ihrem geliebten großen Bruder zu suchen. Shane selbst hatte ihr den Tipp gegeben. Was, wenn sie dort mehr fand, als sie sich vorgestellt hatte?
Shane ging ruhelos im Zimmer auf und ab. Er musste versuchen, seinem Freund zu helfen, so viel stand fest. Aber wie? Er wusste nicht einmal, wo Fabian sich zurzeit aufhielt.
Und dann war da Serena. Er konnte sie unmöglich alleine in den Staaten herumirren lassen. Eine allein reisende junge Frau war heutzutage nirgends sicher, und schon gar nicht, wenn gefährliche Leute hinter ihrem Bruder her waren.
Shane hatte die Ernsthaftigkeit von Fabians Situation unterschätzt. Jetzt machte er sich bittere Vorwürfe. Er hätte schon vor Tagen etwas unternehmen sollen. Was er brauchte, war ein Plan. Zuerst galt es, Serena in Sicherheit zu bringen, dann würde er Fabian suchen. Er würde nach South Dakota fliegen, gleich morgen früh, Job hin oder her. Für lange Erklärungen oder Entschuldigungen blieb ihm keine Zeit.
Serena fuhr durch die dunkle Prärie. Drei lange Tage waren vergangen, seit sie in New York gelandet war. Nachts war sie in Motels eingekehrt und hatte sich etwas Ruhe gegönnt. Tagsüber war sie gefahren, so viel sie konnte, und hatte lediglich Pausen eingelegt, um etwas zu essen. Ein paarmal hatte sie angehalten, weil ein Motiv einfach zu schön war, um daran vorbeizufahren. Dann war sie ausgestiegen und hatte Fotos gemacht. Sie hoffte, dass sie die Bilder irgendwann einmal mit Fabian ansehen und sie beide über diese ganze Angelegenheit lachen konnten. Im Augenblick jedoch war ihr nicht nach Lachen zumute.
Serena strich sich müde über die Stirn. Dann griff sie nach dem Pappbecher mit dem Kaffee, den sie an der letzten Tankstelle gekauft hatte, und nahm einen Schluck. Der Kaffee war kalt, aber sie hoffte, dass er seine aufmunternde Wirkung nicht verfehlen würde. Sie trank nur selten Kaffee, deshalb reichte ihr meist schon eine Tasse, um wirklich wach zu werden.
Die Sonne war schon lange untergegangen. Lediglich die Scheinwerfer ihres Mietwagens erhellten nun den Highway. Serena starrte angestrengt auf die Straße. Sie fuhr nicht gerne nachts, aber sie war ihrem Ziel so nahe und konnte einfach nicht mehr bis zum nächsten Morgen warten.
Ein Straßenschild tauchte neben dem Highway auf. Sie hatte Sturgis und damit die Black Hills in South Dakota erreicht. Bear Butte war nur noch zehn Meilen entfernt. Serenas Herz begann, schneller zu schlagen. Vielleicht würden sich ihre Sorgen schon in wenigen Minuten in Luft auflösen. Vielleicht war Fabian tatsächlich dort.
Bitte, Gott, bitte lass mich ihn dort finden, flüsterte sie.
Der Highway war jetzt hell erleuchtet. Serena durchfuhr Sturgis, ohne dem Ort große Beachtung zu schenken. Es war eine typische nordamerikanische Kleinstadt, wie sie sie in den letzten Tagen schon oft gesehen hatte. Die Hauptstraße war breit, ein Zeugnis der alten Wildwesttage, als die Postkutschen die einzige Verbindung zur Zivilisation waren. Neonschilder hingen über den kleinen Geschäften, von denen die meisten bereits geschlossen hatten. Nur aus dem Saloon drang laute Musik und Gegröle zu ihr herüber.
Serena ließ Sturgis hinter sich und folgte dem Highway 34. Die Straße war nun wieder unbeleuchtet, und Dunkelheit umhüllte sie wie eine Decke.