
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Am Abend eines ungewöhnlich kalten Novembertages im Jahr 1890 betritt ein elegant gekleideter Herr die Räume von Sherlock Holmes‘ Wohnung in der Londoner Baker Street 221b. Er wird von einem mysteriösen Mann verfolgt, in dem er den einzigen Überlebenden einer amerikanischen Verbrecherbande erkennt, die mit seiner Hilfe in Boston zerschlagen wurde. Ist der Mann ihm über den Atlantik gefolgt, um sich zu rächen? Als Holmes und Watson den Spuren des Gangsters folgen, stoßen sie auf eine Verschwörung, die sie in Konflikt mit hochstehenden Persönlichkeiten bringen wird ‒ und den berühmten Detektiv ins Gefängnis, verdächtigt des Mordes. Zunächst gibt es nur einen einzigen Hinweis: ein weißes Seidenband, befestigt am Handgelenk eines ermordeten Straßenjungen … Erstmals seit dem Tod von Arthur Conan Doyle erscheint ein neuer Roman um den genialsten Detektiv aller Zeiten, aus der Feder des internationalen Bestsellerautors Anthony Horowitz. Es ist Sherlock Holmes‘ spektakulärster Fall.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANTHONY HOROWITZ
Das Geheimnis des weißen Bandes
Ein Sherlock-Holmes-Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Für meinen alten Freund Jeffrey S. Joseph
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Anfang des Buches
Cover
Titel
Widmung
Vorwort
1 Der Galerist aus Wimbledon
2 Die Flat Cap Gang
3 Ridgeway Hall
4 Die Baker-Street-Irregulären
5 Lestrade schaltet sich ein
6 Die Chorley Grange School for Boys
7 Das weiße Band
8 Ein Rabe und zwei Schlüssel
9 Die Warnung
10 Bluegate Fields
11 Unter Arrest
12 Die Beweise in diesem Fall
13 Gift
14 In die Finsternis
15 Holloway
16 Das Verschwinden
17 Eine Botschaft
18 Die Wahrsagerin
19 Das House of Silk
20 Keelan O’Donaghue
Nachwort
Danksagung
Leseprobe: Die Morde von Pye Hall
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort
Ich habe oft darüber nachgedacht, wie eigenartig die Verknüpfung von Umständen war, die zu meiner jahrzehntelangen Verbindung mit einer der ungewöhnlichsten und bemerkenswertesten Gestalten meiner Epoche geführt hat. Wäre ich ein Philosoph, so würde ich mich vielleicht fragen, inwieweit wir unser eigenes Schicksal überhaupt bestimmen oder die weitreichenden Folgen von Handlungen ermessen können, die zum gegebenen Zeitpunkt womöglich gänzlich unbedeutend erscheinen.
So war es zum Beispiel mein Vetter Arthur, der mich bei den Fünften Northumberland-Füsilieren als Wundarzt empfahl, weil er dachte, das wäre möglicherweise eine nützliche Erfahrung für mich. Hätte er wissen können, dass ich auf diese Weise schon einen Monat später nach Afghanistan geschickt werden würde? Der Konflikt, der später der Zweite Anglo-Afghanische Krieg genannt werden sollte, hatte ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal begonnen. Und was war mit dem Ghazi, der mir in der Schlacht von Maiwand mit einem einzigen Zucken des Zeigefingers eine Kugel in die Schulter gejagt hat? Über neunhundert Briten und Inder sind an jenem Tag gestorben, und dass ich dazugehören sollte, war mit Sicherheit seine Absicht. Aber er hatte nicht gut gezielt, und obwohl ich schwer verwundet war, hat mich mein gutherziger, treuer Bursche Jack Murray gerettet. Über zwei Meilen hat er mich durch feindliches Gelände zurück zu den britischen Linien getragen.
Murray starb im September desselben Jahres bei Kandahar und hat deshalb nie erfahren, dass ich als Invalide nach Hause geschickt wurde und anschließend – ein magerer Tribut für seine Heldentat – mein Leben am Rande der Londoner Gesellschaft mehrere Monate lang eher fristete als gestaltete. Am Ende dieser Zeit war ich ernsthaft entschlossen, an die Südküste Englands zu ziehen, was weniger meiner Neigung als der bitteren Realität immer schneller schwindender Mittel geschuldet war. Man hatte mir allerdings auch gesagt, dass die Seeluft meiner Gesundheit zuträglich wäre. Eine billigere Unterkunft in London wäre die wünschenswerte Alternative gewesen, und ich hätte beinahe Räumlichkeiten in der Euston Road bei einem Börsenmakler gemietet. Aber das Gespräch verlief nicht eben günstig, und so entschloss ich mich: Ich würde nach Hastings ziehen. Das war gesellschaftlich weniger attraktiv als Brighton, aber dafür nur halb so teuer. Meine Habseligkeiten waren schon fertig gepackt, und ich war bereit zur Abreise.
Aber ich hatte die Rechnung ohne Henry Stamford gemacht, keinen engen Freund, sondern einen bloßen Bekannten, der mir im St. Bart’s Hospital als Assistent gedient hatte. Hätte er am Abend zuvor nicht übermäßig getrunken, so hätte er vermutlich kein Kopfweh gehabt, und wäre nicht dieses Kopfweh gewesen, hätte er sich bei dem chemischen Labor, wo er mittlerweile Arbeit gefunden hatte, wahrscheinlich nicht frei genommen. Aber so wie die Dinge lagen, bummelte er an diesem Tag eine Weile am Piccadilly Circus herum und beschloss dann, die Regent Street hinaufzuschlendern, um in Arthur Libertys East India House nach einem Geschenk für seine Frau zu suchen. Es ist schon merkwürdig! Wenn er einen anderen Weg genommen hätte, wäre alles ganz anders gekommen; denn dann wäre ich nicht mit ihm zusammengeprallt, als ich aus der Bar des Criterion trat, und das wiederum hätte zur Folge gehabt, dass ich womöglich Sherlock Holmes nie begegnet wäre.
Denn wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe: Es war Stamford, der mir den Vorschlag machte, mir eine Wohnung mit einem seiner Kollegen zu teilen, den er für einen analytischen Chemiker hielt und der im selben Krankenhaus wie er arbeitete. Stamford machte mich mit Holmes bekannt, der damals gerade nach einer Methode suchte, mit der man Blutflecken nachweisen konnte. Unsere erste Begegnung war eigenartig und verwirrend, aber auch äußerst denkwürdig … ein deutlicher Vorgeschmack dessen, was noch kommen sollte.
Es war der große Wendepunkt meines Lebens. Ich habe keinerlei literarische Ambitionen, und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich würde dereinst Autor eines halben Dutzends veröffentlichter Bücher sein, hätte ich darüber gelacht. Aber ich glaube, ich kann in aller Bescheidenheit und ohne übertriebene Eitelkeit sagen, dass ich die Abenteuer dieses großen Mannes in einer Weise geschildert habe, der eine gewisse Anerkennung zuteilwurde, und ich habe es deshalb als Ehre empfunden, als man mich eingeladen hat, bei seinem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey zu sprechen – eine Einladung, die ich respektvoll abgelehnt habe. Holmes hat über meinen Prosastil oft gespottet, und ich hätte befürchten müssen, dass er mir, wenn ich tatsächlich auf die Kanzel gestiegen wäre, die ganze Zeit über die Schulter geschaut und über alles, was ich gesagt hätte, von jenseits des Grabes mit sanftem Spott gelacht hätte.
Er war immer der Ansicht, ich würde seine Fähigkeiten und die außergewöhnlichen Erkenntnisse seines brillanten Gehirns überschätzen. Er lächelte darüber, dass ich meine Erzählungen so konstruierte, als würde sich am Ende plötzlich alles auflösen, während es doch in Wirklichkeit von Anfang an offenbar gewesen sei. Mehr als einmal beschuldigte er mich eines trivialen Hangs zur Romantisierung und sagte, ich sei nicht besser als irgendein Schreiberling aus der Grub Street. Ich glaube, dass dieser Vorwurf insgesamt nicht gerechtfertigt war. In all den Jahren, in denen ich ihn gekannt habe, habe ich ihn nie auch nur mit einem einzigen belletristischen Werk gesehen – außer der allertrivialsten Schundliteratur; und obwohl ich keinerlei Anspruch auf literarische Fähigkeiten erhebe, wage ich doch zu behaupten, dass meine Erzählungen ihre Aufgabe einigermaßen erfüllt haben und er selbst seine Abenteuer nicht besser zu schildern gewusst hätte. Holmes hat das sogar zugegeben, als er eines Tages selbst zu Papier und Feder griff, um den merkwürdigen Fall Godfrey Emsworth in seinen eigenen Worten zu schildern. Diese Episode wurde schließlich als Der gebleichte Soldat vorgestellt, ein Titel, den ich alles andere als perfekt finde, denn bleichen würde ich allenfalls eine Mandel.
Ich habe, wie ich schon sagte, eine gewisse Anerkennung für meine literarischen Bemühungen erfahren, aber eigentlich ging es mir darum gar nicht. Aufgrund der verschiedenen schicksalhaften Wendungen, die ich oben beschrieben habe, bin ich auserwählt worden, die Leistungen des besten beratenden Detektivs der Welt ans Licht zu bringen, und habe einem begeisterten Publikum nicht weniger als sechzig Abenteuer vorstellen dürfen. Die lange Freundschaft mit diesem Mann aber war für mich persönlich viel wertvoller.
Es ist jetzt ein Jahr her, dass man ihn leblos und still in seinem Haus in den Downs fand, wo sein gewaltiger Verstand für immer zur Ruhe gekommen ist. Als ich die Nachricht erhielt, wurde mir sofort klar, dass ich nicht nur meinen engsten Freund und Gefährten verloren hatte, sondern in mancher Hinsicht auch meine ganze Daseinsberechtigung. Zwei Ehen, drei Kinder und sieben Enkel, eine erfolgreiche medizinische Karriere und der Verdienstorden, den mir Seine Majestät König Edward VII. im Jahre 1908 verliehen hat, mögen von manchen als beträchtliche Lebensleistung erachtet werden. Mir war das nie genug. Ich vermisse Holmes bis zum heutigen Tage, und oft genug bilde ich mir in meinen Tagträumen ein, noch einmal die vertrauten Worte zu hören: ›Das Wild ist auf, Watson!‹ Aber sie erinnern mich natürlich nur daran, dass ich nie wieder mit meinem treuen Dienstrevolver in der Faust in die neblige Düsternis der Baker Street tauchen werde. Ich denke oft an Holmes, der auf der anderen Seite jenes großen Schattens auf mich wartet, der uns alle irgendwann überfällt, und ich sehne mich sogar danach, wieder an seiner Seite zu stehen. Ich bin allein. Meine alte Verletzung wird mich bis zum Ende quälen, und während in Europa ein sinnloser Krieg wütet, spüre ich, dass ich die Welt, in der ich lebe, nicht länger verstehe.
Warum also greife ich erneut zur Feder, ein letztes Mal, um Erinnerungen zu wecken, die vielleicht besser vergessen wären? Vielleicht bin ich selbstsüchtig. Vielleicht ist es so wie bei vielen anderen Männern, die ihr Leben längst hinter sich haben, und ich suche eine Art Trost. Die Krankenschwestern, die mich pflegen, versichern mir, dass Schreiben der Therapie nützt und verhindern wird, dass ich in jene schwarzen Stimmungen verfalle, die mich gelegentlich heimsuchen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund.
Die Abenteuer um den Mann mit der flachen Mütze und das House of Silk waren in vieler Hinsicht die sensationellsten in der Karriere von Sherlock Holmes, aber seinerzeit war es unmöglich, sie zu erzählen. Warum das so ist, wird sehr bald klar werden. Sie waren eng miteinander verknüpft und ließen sich deshalb nicht trennen. Dennoch habe ich mir immer gewünscht, sie niederzuschreiben und den Holmes-Kanon so zu vollenden. In dieser Beziehung bin ich wie ein Wissenschaftler, der einer bestimmten Formel nachjagt, oder ein Briefmarkensammler, der auf seine Kollektion nicht wirklich stolz sein kann, solange es noch ein, zwei seltene Marken gibt, die sich seinem Zugriff entziehen. Ich kann nicht anders. Es muss getan werden.
Bisher war es unmöglich – und das lag nicht nur an der bekannten Abneigung gegen öffentliche Aufmerksamkeit, die meinen Freund auszeichnete. Nein, die Ereignisse, die ich im Folgenden beschreiben will, waren einfach zu ungeheuerlich und schockierend, um gedruckt zu werden. Und das sind sie noch immer. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass sie das ganze Gefüge unserer Gesellschaft zerreißen könnten, wenn sie veröffentlicht würden, und das ist, besonders in Zeiten des Krieges, ein Risiko, das ich nicht eingehen darf. Wenn ich die Kraft dafür aufbringe, die Niederschrift abzuschließen, werde ich das Manuskript versiegeln und in einem Schließfach im Tresor von Cox & Co am Charing Cross deponieren lassen, wo auch gewisse andere private Papiere von mir aufbewahrt werden. Ich werde Anweisung geben, dass dieses Päckchen erst in hundert Jahren geöffnet werden darf. Man kann zwar nicht wissen, wie die Welt dann aussehen und welche Fortschritte die Menschheit bis dahin gemacht haben wird, aber vielleicht sind künftige Leser im Hinblick auf Skandale und Korruption doch etwas besser gewappnet, als es die heutigen sind. Ihnen hinterlasse ich ein letztes Porträt meines Freundes Sherlock Holmes – und eine Perspektive, die bisher noch ganz unbekannt war.
Aber ich habe schon zu viel Kraft auf meine eigenen Sorgen verschwendet. Ich hätte längst die Tür von Baker Street 221b öffnen und den Raum betreten sollen, in dem so viele Abenteuer begonnen haben. Ich sehe alles vor mir, das Glühen der Lampe hinter den Scheiben und die siebzehn Stufen, die mich von der Straße zur Tür führten. Wie weit weg sie mir heute erscheinen! Wie lange es her ist, dass ich zuletzt dort war! Ja. Da steht er, die Pfeife in der Hand. Er dreht sich zu mir um. Er lächelt. »Das Wild ist auf!«
1 Der Galerist aus Wimbledon
»Die Grippe ist unangenehm«, sagte Sherlock Holmes. »Aber Sie haben vollkommen recht: Mit der Hilfe Ihrer Gemahlin wird das Kind schnell wieder zu Kräften kommen.«
»Das hoffe ich sehr«, erwiderte ich, dann hielt ich inne und starrte ihn mit aufgerissenen Augen an. Ich hatte meine Tasse schon zum Mund geführt, aber jetzt stellte ich sie so abrupt wieder hin, dass der Tee fast herausgeschwappt und die Untertasse vom Tisch gerutscht wäre. »Aber jetzt haben Sie wirklich Gedanken gelesen!«, rief ich. »Wie, um Himmels willen, haben Sie das gemacht, Holmes? Ich schwöre, ich habe weder über das Kind noch über seine Krankheit auch nur ein Wort verloren. Sie wissen, dass meine Frau verreist ist – das konnten Sie vermutlich schon daraus schließen, dass ich hier anwesend bin. Aber ich habe keinerlei Gründe für ihre Abwesenheit genannt, und ich denke, auch mit meinem Verhalten habe ich Ihnen keinerlei Hinweis darauf gegeben.«
Es war einer der letzten Novembertage des Jahres 1890, als dieser Wortwechsel stattfand. Ein gnadenloser Winter hatte London im Griff, auf den Straßen war es so kalt, dass sogar die Gaslaternen wie gefroren erschienen, und das wenige Licht, das sie spendeten, wurde vom ewigen Nebel geschluckt. Vor dem Fenster trieben die Passanten wie Geister über das Pflaster, mit gesenkten Köpfen und fest umhüllten Gesichtern, während die endlose Kolonne schwarzer Kutschen vorbeiratterte, deren Zugpferde eilig zum heimischen Stall strebten. Ich war froh, in diesem warmen Zimmer zu sitzen, wo ein Feuer im Kamin flackerte, wo der vertraute Duft von Pfeifentabak in der Luft hing und wo – bei allem Durcheinander verschiedenster Gegenstände, mit denen mein Freund sich umgab – doch stets das Gefühl herrschte, dass alles am rechten Fleck war.
Ich hatte Holmes telegrafiert, dass ich gern für ein paar Tage mein altes Zimmer wieder beziehen würde, und war sehr erleichtert, als er mir umgehend mitteilte, dass dem nichts entgegenstünde. Meine Praxis konnte eine Weile ohne mich auskommen. Und eine Zeitlang würde ich Strohwitwer sein. Insgeheim war mir aber auch daran gelegen, bei meinem Freund Wache zu halten, bis er gänzlich wieder genesen war. Denn Holmes hatte drei Tage und drei Nächte gehungert und auch kein Wasser zu sich genommen, um einem besonders üblen, rachsüchtigen Schurken den Eindruck zu vermitteln, dass er, Holmes, nicht mehr lange zu leben hätte und dem Tod nahe sei. Die List hatte ihren Zweck auf triumphale Weise erfüllt, und der besagte Verbrecher befand sich jetzt in den fähigen Händen von Inspektor Morton von Scotland Yard. Dennoch war ich in Sorge wegen der großen gesundheitlichen Belastung, die Holmes auf sich genommen hatte, und hielt es für angezeigt, ihn im Auge zu behalten, bis sein Stoffwechsel ganz wiederhergestellt war.
Ich war deshalb außerordentlich glücklich, als ich ihn dabei beobachtete, wie er sich einen großen Teller Scones mit Veilchenhonig und Sahne sowie ein Stück Rührkuchen und heißen Tee einverleibte, die uns Mrs. Hudson serviert hatte. Holmes war offensichtlich auf dem Weg der Besserung, er lag gemütlich in seinem großen Ledersessel, die Füße ausgestreckt vor dem Kamin und bekleidet mit seinem Morgenrock. Er war schon immer von ausgeprägt schlanker Statur, ja beinahe ausgemergelt gewesen, und seine scharfen Augen schienen durch die Adlernase noch schärfer zu werden, aber zumindest war jetzt schon etwas Farbe in seinem Gesicht, und seine Stimme und seine Haltung zeigten, dass er in jeder Hinsicht fast wieder der Alte war.
Er hatte mich herzlich begrüßt, und als ich ihm jetzt gegenübersaß, hatte ich das eigenartige Gefühl, aus einem Traum aufzuwachen. Es war, als hätte es die letzten zwei Jahre nie gegeben, als hätte ich meine geliebte Mary weder kennengelernt noch geheiratet und wäre auch nicht in das Haus in Kensington eingezogen, das ich durch den Verkauf der Agra-Perlen hatte erwerben können. Es schien, als wäre ich noch immer der Junggeselle, der hier bei Holmes gewohnt und regelmäßig den Nervenkitzel einer Verbrecherjagd und die allmähliche Entwirrung eines neuerlichen Geheimnisses mit ihm geteilt hatte.
Ich hatte den Eindruck, dass es ihm auch ganz recht war. Holmes sprach selten über die neue Häuslichkeit, die ich mir geschaffen hatte. Zum Zeitpunkt meiner Eheschließung war er verreist gewesen, und ich hatte mich schon damals gefragt, ob das wohl nur Zufall war. Es war nicht so, dass meine Ehe ein gänzlich verbotenes Thema zwischen uns war, aber es gab doch eine Art stillschweigende Übereinkunft, die Gespräche darüber nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Mein Glück und meine Zufriedenheit blieben Holmes nicht verborgen, und er war großzügig genug, sie mir nicht zu missgönnen. Als ich eingetroffen war, hatte er sich nach Mrs. Watson erkundigt, aber keine weiteren Informationen erbeten, und ich hatte auch keine gegeben. Das alles machte seine zielsichere Bemerkung noch rätselhafter.
»Sie schauen mich an, als ob ich ein Hellseher wäre«, sagte Holmes lachend. »Ich nehme an, Sie haben die Werke von Edgar Allan Poe nicht zur Gänze gelesen?«
»Sie sprechen von seinem Detektiv, Auguste Dupin?«
»Er benutzte eine Methode, die er Ratiocination – Schlussfolgern – nannte. Seiner Ansicht nach war es möglich, die innersten Gedanken eines Menschen zu lesen, ohne dass er auch nur den Mund öffnen muss. Es konnte alles durch einfache Analyse seines Verhaltens erschlossen werden, das Zucken einer Augenbraue zum Beispiel. Die Idee beeindruckte mich damals sehr, aber ich glaube mich zu entsinnen, dass Sie eher skeptisch waren.«
»Und dafür muss ich jetzt sicher büßen«, bestätigte ich. »Aber wollen Sie mir wirklich weismachen, dass Sie auf Grund meines Benehmens beim Verzehr von Teegebäck auf die Krankheit eines Kindes schließen konnten, das Sie nicht einmal kennen?«
»Das und noch einiges andere«, erwiderte Holmes. »Ich konnte feststellen, dass Sie gerade vom Holborn Viaduct kommen. Sie haben Ihr Haus zwar in großer Eile verlassen, den Zug aber letzten Endes dann doch verpasst. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Sie derzeit kein Hausmädchen haben.«
»Nein, Holmes!«, rief ich. »Das kann ich mir nicht bieten lassen!«
»Hab ich denn unrecht?«
»Nein, was Sie sagen, stimmt hundertprozentig. Aber wie ist das möglich …?«
»Alles eine Frage der Beobachtung und der entsprechenden Schlussfolgerungen. Wenn ich es Ihnen erläutern würde, erschiene alles geradezu kindisch einfach.«
»Und doch muss ich darauf bestehen, dass Sie genau das tun.«
»Nun denn, da Sie so freundlich waren, mir diesen Besuch abzustatten, muss ich mich wohl revanchieren«, erwiderte Holmes mit einem unterdrückten Gähnen. »Lassen Sie uns mit den Umständen beginnen, die Sie hierhergeführt haben. Wenn ich mich recht entsinne, steht bald Ihr zweiter Hochzeitstag an, nicht wahr?«
»In der Tat, Holmes. Der Jahrestag ist übermorgen.«
»Dann ist dies eine ungewöhnliche Zeit, um sich von Ihrer Frau zu trennen. Wenn Sie also beschlossen haben, Ihren Aufenthalt bei mir zu nehmen, und das auch noch für längere Zeit, dann muss es einen zwingenden Grund für Ihre Frau geben, Sie gerade jetzt allein zu lassen. Und welcher könnte das sein? Wenn ich mich recht entsinne, kam die ehemalige Miss Mary Morstan aus Indien nach England und hatte hier weder Familie noch Freunde. Sie wurde als Gouvernante angestellt, um sich der Erziehung des Sohnes von Mrs. Cecil Forrester aus Camberwell zu widmen, und aus diesem Grund haben Sie, wie Sie natürlich am besten wissen, ja auch ihre Bekanntschaft gemacht. Mrs. Forrester hat sich ihr gegenüber sehr nobel verhalten, besonders als es ihr schlecht ging, und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden noch heute befreundet sind.«
»Das ist tatsächlich der Fall.«
»Wenn also jemand Ihre Frau von zu Hause wegruft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es Mrs. Forrester ist. Ich habe mich daher gefragt, was für Gründe sich hinter so einer Vorladung verbergen könnten, und bei dem derzeitigen kalten Wetter fällt einem natürlich als Erstes eine Erkrankung ein – und zwar die eines Kindes. Wenn Mrs. Forresters Sohn also krank wäre, könnte ihm die Anwesenheit seiner früheren Gouvernante sehr viel Trost spenden.«
»Sein Name ist Richard, und er ist neun Jahre alt«, gab ich zu. »Aber wieso sind Sie sich so sicher, dass es die Grippe ist und keine viel ernstere Krankheit?«
»Wenn es ernster wäre, hätten Sie gewiss darauf bestanden, den Jungen selbst in Augenschein zu nehmen.«
»Ihre Überlegungen sind bis dahin in jeder Hinsicht absolut logisch«, sagte ich. »Aber sie erklären nicht, woher Sie wussten, dass sich meine Gedanken genau in dem Moment auf den Jungen gerichtet hatten, als Sie Ihre einleitende Feststellung trafen.«
»Sie vergeben mir hoffentlich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie wie ein offenes Buch für mich sind, lieber Watson, und dass Sie mit jeder Lebensregung eine weitere Seite aufschlagen. Als Sie da so Ihren Tee tranken, sah ich, wie Ihre Blicke auf die Zeitung fielen, die neben Ihnen auf dem Tisch liegt. Sie lasen die Schlagzeile und drehten die Zeitung dann aufs Gesicht. Warum? Ich hatte sofort den Verdacht, dass es der Bericht über das Zugunglück letzte Woche in Norton Fitzwarren war, was Sie beunruhigte. Die ersten Untersuchungsergebnisse über den Tod der zehn Passagiere sind heute veröffentlicht worden, und das war verständlicherweise das Letzte, was Sie lesen wollten, nachdem Sie Ihre Frau gerade zum Bahnhof gebracht hatten.«
»Der Bericht hat mich tatsächlich an ihre Reise erinnert«, musste ich zugeben. »Aber die Krankheit des Jungen?«
»Von der Zeitung glitten Ihre Augen zu der Stelle neben dem Schreibtisch hin, wo Sie früher immer Ihre Arzttasche abgestellt haben, und Sie haben gelächelt. Da war ich mir sicher, dass die Reise Ihrer Frau mit einer Erkrankung zu tun haben musste.«
»Das sind doch alles Spekulationen, Holmes«, sagte ich. »Zum Beispiel nennen Sie Holborn Viaduct. Es hätte doch auch jeder andere Bahnhof in London sein können.«
»Sie wissen, dass ich Spekulationen verabscheue. Es ist zwar manchmal nötig, verschiedene Indizien mit Hilfe der Vorstellungskraft zu verknüpfen, aber das ist etwas völlig anderes. Mrs. Forrester wohnt in Camberwell, und die London Chatham & Dover Railway fährt regelmäßig in Holborn Viaduct ab. Ich hätte deshalb diesen Bahnhof auch dann als logischen Ausgangspunkt angesetzt, wenn Sie mir mit Ihrem Koffer, den Sie an der Tür abgestellt haben, keinen entscheidenden Hinweis gegeben hätten. Von meinem Sessel aus kann ich aber sehr deutlich den Anhänger von der Gepäckaufbewahrung in Holborn Viaduct sehen, der am Handgriff befestigt ist.«
»Aha. Und der Rest?«
»Die Tatsache, dass Sie Ihr Dienstmädchen eingebüßt und Ihr Haus in großer Eile verlassen haben? Die Spuren von schwarzer Schuhwichse an Ihrer Manschette sind ein klarer Beweis für diese Punkte. Sie haben sich selbst die Schuhe geputzt und waren dabei etwas sorglos. Obendrein haben Sie in der Eile Ihre Handschuhe vergessen –«
»Mrs. Hudson hat mir den Mantel abgenommen. Sie hätte auch meine Handschuhe nehmen können.«
»Wenn sie das getan hätte, warum sind dann Ihre Finger so kalt gewesen, als Sie mir die Hand gaben? Nein, Watson, Ihr gesamter Auftritt weist auf Verwirrung und Unordnung hin.«
»Alles, was Sie sagen, ist richtig«, musste ich zugeben. »Aber eine Frage habe ich doch noch. Wieso waren Sie sich so sicher, dass meine Frau den Zug verpasst hat?«
»Als Sie hier eintrafen, ist mir an Ihren Kleidern ein starker Geruch von Kaffee aufgefallen. Das war bemerkenswert; denn warum hätten Sie Kaffee trinken sollen, kurz bevor Sie zum Tee zu mir kamen? Die logische Schlussfolgerung war, dass Sie den Zug verpasst hatten und deshalb länger mit Ihrer Frau zusammenbleiben mussten, als Sie geplant hatten. Sie haben Ihren Koffer in der Gepäckaufbewahrung aufgegeben und sind mit ihr Kaffee trinken gegangen. Bei Lockhart’s vielleicht? Man hat mir gesagt, dort sei er besonders gut.«
Es entstand eine kurze Pause, dann brach ich in Lachen aus. »Nun, Holmes, ich sehe, dass ich mir ganz umsonst Sorgen um Ihre Gesundheit gemacht habe. Sie sind genauso scharfsinnig wie immer.«
»Das war doch ganz elementar«, erwiderte der Detektiv mit einer müden Handbewegung. »Aber jetzt tritt vielleicht etwas Interessanteres auf den Plan. Wenn ich nicht irre, hat es an der Haustür geklingelt …«
Und tatsächlich führte Mrs. Hudson kurz darauf einen Mann herein, der den Salon betrat, als ginge es um einen Auftritt in einem Theater im Westend. Er trug eine korrekte Abendgarderobe mit Frack, steifem Kragen und weißer Fliege, Weste, schwarzem Umhang und Lackschuhen. In der einen Hand hielt er einen Spazierstock aus Rosenholz mit silbernem Knauf und silberner Spitze, in der anderen ein Paar weißer Handschuhe. Sein dunkles, schwungvoll aus der hohen Stirn zurückgekämmtes Haar war erstaunlich lang, und er war glatt rasiert. Seine Haut war blass und sein Gesicht ein wenig zu lang, um wirklich gut aussehend zu sein. Sein Alter hätte ich auf ungefähr Mitte dreißig geschätzt, aber die Ernsthaftigkeit seines Auftretens und sein offensichtliches Unbehagen, sich in dieser Umgebung zu finden, ließen ihn älter erscheinen. Er erinnerte mich sofort an manche meiner Patienten, die einfach nicht glauben wollten, dass sie nicht gesund waren, bis der Druck der Symptome zu groß wurde. Das waren fast immer diejenigen, die am schwersten krank waren. Unser Besucher stand mit ähnlichem Widerwillen vor uns. Er wartete unter der Tür und sah sich mit nervösen Blicken um, während Mrs. Hudson dem Hausherrn seine Visitenkarte übergab.
»Mr. Carstairs«, sagte Holmes. »Bitte nehmen Sie doch Platz.«
»Sie müssen entschuldigen, dass ich auf diese Art hier hereinplatze … unerwartet und unangekündigt.« Er hatte eine knappe, eher trockene Redeweise. Seine Augen waren immer noch nicht ganz bereit, unserem Blick zu begegnen. »Eigentlich wollte ich gar nicht herkommen. Ich lebe in Wimbledon, ganz in der Nähe des Greens, und bin wegen der Oper in London – obwohl ich gerade nicht die geringste Lust auf Wagner habe. Ich komme eben aus meinem Club, wo ich meinen Steuerberater getroffen habe, den ich schon seit vielen Jahren kenne und mittlerweile als Freund betrachte. Als ich ihm von den bedrückenden Ereignissen erzählte, die mein Leben seit einigen Tagen belasten, erwähnte er Ihren Namen und riet mir dringend, Sie schleunigst zu konsultieren. Mein Club liegt zufällig ganz in der Nähe, und deshalb beschloss ich, Sie unverzüglich aufzusuchen.«
»Sie haben meine volle Aufmerksamkeit«, sagte Holmes.
»Und was ist mit diesem Gentleman?« Der Besucher wandte sich mir zu.
»Das ist Dr. John Watson, mein engster Berater. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie in seiner Gegenwart alles aussprechen können, was Sie mir vortragen wollen.«
»Nun denn. Mein Name ist Edmund Carstairs, wie Sie bereits wissen, und von Beruf bin ich Kunsthändler. Ich habe eine Galerie: Carstairs & Finch in der Albemarle Street. Seit sechs Jahren sind wir jetzt im Geschäft. Wir sind auf die großen Meister vom Ende des letzten und vom Anfang dieses Jahrhunderts spezialisiert: Gainsborough, Reynolds, Constable, Turner und so fort. Deren Gemälde sind Ihnen sicher vertraut, und ich kann Ihnen versichern, dass sie sehr gute Preise erzielen. Erst diese Woche habe ich einem privaten Kunden zwei Porträts von Anthony van Dyck verkauft, für 25000 Pfund. Unser Unternehmen ist sehr erfolgreich und gedeiht ganz hervorragend, trotz der vielen neuen – und ich muss sagen: minderwertigen – Galerien, die überall in der Umgebung aus dem Boden schießen. Im Lauf der Jahre haben wir uns einen guten Ruf erworben. Wir gelten als nüchtern und zuverlässig. Zu unseren Kunden gehören viele Angehörige des Adels, und unsere Bilder hängen in einigen der schönsten Herrenhäuser des Landes.«
»Und Mr. Finch ist Ihr Partner?«
»Tobias Finch ist deutlich älter als ich, aber wir sind gleichberechtigte Partner. Wenn es überhaupt Meinungsverschiedenheiten zwischen uns gibt, dann beruhen sie darauf, dass er noch konservativer und vorsichtiger ist als ich. So interessiere ich mich zum Beispiel sehr für die neuen Werke, die jetzt in Frankreich entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon von Monet gehört haben oder Degas? Erst vor einer Woche hat man mir ein Bild von Pissarro angeboten – eine Landschaft mit Schiffen, die ich ganz entzückend fand, farbenfroh. Aber mein Partner war äußerst ablehnend. Er behauptet, solche Bilder seien nichts als verschwommene Impressionen. Damit hat er nicht ganz unrecht, denn aus der Nähe betrachtet sind manche Umrisse nicht gut erkennbar. Ich habe ihn leider nicht davon überzeugen können, dass gerade darin die Pointe liegt. Aber ich will Sie nicht mit einem Vortrag über Kunst ermüden, meine Herren. Wir sind eine traditionelle Galerie, und das werden wir bis auf weiteres wohl auch bleiben.«
Holmes nickte. »Fahren Sie bitte fort.«
»Mr. Holmes, vor zwei Wochen wurde mir plötzlich bewusst, dass ich beobachtet werde. Ridgeway Hall – das ist der Name meines Hauses – steht an einer schmalen Straße, an deren anderem Ende sich auch ein paar Armenhäuser befinden. Obwohl sie in einiger Entfernung stehen, sind sie doch unsere nächsten Nachbarn. Die unmittelbare Umgebung meines Grundstücks ist Gemeindeland, und aus meinem Ankleidezimmer habe ich einen Blick auf den Dorfanger. Von dort aus habe ich an einem Dienstagmorgen auch diesen Mann gesehen. Er stand breitbeinig da, die Arme vor der Brust verschränkt, und was mir als Erstes auffiel, war seine außergewöhnliche Ruhe. Er war zu weit entfernt, als dass ich ihn deutlich hätte erkennen können, aber ich hatte den Eindruck, dass er ein Ausländer war. Er trug einen langen Gehrock mit gepolsterten Schultern, von einem Schnitt, der sicher nicht englisch war. Ich bin letztes Jahr in Amerika gewesen, und ich würde sagen, dass er aus diesem Land kam. Was mich aber – aus Gründen, die ich gleich erklären werde – besonders beschäftigte, war die Tatsache, dass er auch eine Mütze trug, eine flache Kappe von der Art, die gelegentlich auch Schiebermütze genannt wird.
Diese Mütze und die Art und Weise, wie er dastand, weckten meine Aufmerksamkeit und beunruhigten mich. Wenn er eine Vogelscheuche gewesen wäre, hätte er nicht bewegungsloser sein können. Ein leichter Regen fiel, den die Brise über den Rasen trieb, aber der Mann schien es nicht zu bemerken. Seine Augen waren starr auf mein Fenster gerichtet. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr dunkel waren und dass sie sich förmlich in mich hineinbohrten. Ich betrachtete ihn mindestens eine Minute lang, vielleicht sogar länger, dann ging ich zum Frühstück hinunter. Ehe ich zu essen begann, schickte ich aber noch meinen Küchenjungen hinaus, um in Erfahrung zu bringen, ob der Mann immer noch da war. Das war er nicht. Der Junge berichtete, das Green sei vollkommen leer.«
»Ein bemerkenswertes Ereignis«, stellte Holmes fest. »Aber Ridgeway Hall ist gewiss ein schönes Gebäude. Ein Besucher, der nach England kommt, könnte es besichtigen wollen.«
»Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ein paar Tage später habe ich ihn ein zweites Mal gesehen. Dieses Mal geschah es in London. Meine Frau und ich waren gerade aus dem Theater gekommen – wir waren im Savoy gewesen –, und da stand er wieder, auf der anderen Straßenseite. Wieder trug er denselben Mantel und wieder die flache Mütze. Vielleicht hätte ich ihn gar nicht bemerkt, Mr. Holmes, aber wie schon zuvor stand er vollkommen unbeweglich im Strom der Passanten, wie ein Felsen in einem rasch dahinfließenden Bach. Wieder konnte ich ihn nicht gut erkennen, denn obwohl er sich unmittelbar unter einer hell leuchtenden Laterne aufgestellt hatte, warf seine Mütze einen Schatten über sein Gesicht, der dichter war als ein Schleier. Ich fürchte fast, das war seine Absicht.«
»Aber Sie sind sich ganz sicher, dass es derselbe Mann war?«
»Daran konnte kein Zweifel bestehen.«
»Hat Ihre Frau ihn gesehen?«
»Nein. Und ich wollte sie auch nicht darauf hinweisen, um sie nicht zu beunruhigen. Wir hatten ein Hansom Cab, das auf uns wartete, und sind sofort weggefahren.«
»Das ist sehr interessant«, sagte Holmes. »Das Verhalten dieses Mannes erscheint vollkommen unsinnig. Erst stellt er sich mitten aufs Village Green, dann steht er unter einer hellen Laterne. Man hat den Eindruck, dass er sich größte Mühe gibt, von Ihnen gesehen zu werden. Andererseits macht er keinen Versuch, Sie anzusprechen oder sich Ihnen zu nähern.«
»Er hat Kontakt mit mir aufgenommen«, erwiderte Carstairs. »Schon am nächsten Tag, als ich früh nach Hause kam. Mein Freund, Mr. Finch, war in der Galerie und katalogisierte eine Sammlung von Zeichnungen und Radierungen von Samuel Scott. Dazu brauchte er mich nicht, und ich war ohnehin noch ganz durcheinander wegen der zwei Begegnungen mit diesem Mann. Ich kam kurz vor drei Uhr nachmittags nach Ridgeway Hall – und das war auch gut so; denn als ich ankam, ging dieser Bursche gerade auf unsere Tür zu. Ich rief ihn an, und er drehte sich um. Er sah mich und rannte sofort auf mich zu. Ich war sicher, dass er mich angreifen wollte, und hob sogar meinen Spazierstock, um mich zu schützen. Aber er plante offenbar keine Gewalt. Er trat direkt vor mich hin, und zum ersten Mal sah ich sein Gesicht: dünne Lippen, dunkelbraune Augen und eine weiße Narbe auf seiner Wange, die Hinterlassenschaft einer Kugel, wie es mir schien. Er hatte Schnaps getrunken – das konnte ich riechen. Er sagte kein Wort, sondern zog ein Stück Papier heraus, das er über seinen Kopf hob und mir dann mit Gewalt in die Hand drückte. Anschließend lief er davon, noch ehe ich Gelegenheit hatte, ihn anzuhalten.«
»Und der Zettel?«, fragte Holmes.
»Den habe ich hier.« Der Kunsthändler zog ein doppelt gefaltetes Blatt aus der Tasche und reichte es meinem Freund. Holmes schlug es vorsichtig auf. »Meine Lupe, bitte«, sagte er zu mir. Ich reichte ihm das Vergrößerungsglas, und er wandte sich wieder an Carstairs. »Ein Umschlag war nicht dabei?«
»Nein.«
»Das halte ich für äußerst bedeutsam. Aber lassen Sie sehen …«
Es standen lediglich sechs Worte in Blockschrift auf dem Papier: ST MARY’S CHURCH, MORGEN UM ZWÖLF.
»Das Papier ist englisch«, stellte Holmes fest. »Auch wenn der Besucher es nicht war. Sie sehen, dass er Blockbuchstaben benutzt, Watson. Was glauben Sie, zu welchem Zweck er das tut?«
»Um seine Handschrift zu verstellen?«
»Das wäre möglich. Andererseits hat er Mr. Carstairs bisher wahrscheinlich noch nie geschrieben und wird das wohl auch nicht so bald wieder tun, man könnte also davon ausgehen, dass die Handschrift nicht sonderlich wichtig ist. War das Blatt gefaltet, als er es Ihnen gegeben hat, Mr. Carstairs?«
»Nein, ich glaube nicht. Ich habe es später selbst gefaltet.«
»Das Bild wird von Minute zu Minute klarer. Diese Kirche, auf die der Mann sich bezieht, St Mary’s. Ich nehme an, die ist in Wimbledon?«
»An der Hothouse Lane«, erwiderte Carstairs. »Nur ein paar Schritte von meinem Haus entfernt.«
»Das Verhalten des Mannes ist vollkommen unlogisch, finden Sie nicht? Er will mit Ihnen sprechen. Er drückt Ihnen eine Nachricht mit diesem Wunsch in die Hand, spricht aber nicht. Er sagt kein einziges Wort.«
»Ich vermute, dass er ungestört mit mir allein sprechen wollte. Und tatsächlich kam meine Frau, Catherine, kurz darauf aus der Tür. Sie hatte im Esszimmer gestanden, von wo aus man die Einfahrt gut überblicken kann, und hatte gesehen, was gerade passiert war. ›Wer war das?‹, fragte sie.
›Ich habe keine Ahnung‹, erwiderte ich.
›Was wollte er?‹
Ich zeigte ihr den Zettel, und sie sagte: ›Das ist jemand, der Geld will. Ich habe ihn gerade durchs Fenster gesehen – ein rauer Bursche. Letzte Woche haben Zigeuner auf dem Anger kampiert. Bestimmt war er einer von denen. Edmund, du darfst da nicht hingehen.‹
›Keine Sorge, meine Liebe‹, erwiderte ich. ›Ich habe keinerlei Absicht, diesen Burschen zu treffen.‹«
»Sie haben Ihre Frau beruhigt«, murmelte Holmes. »Aber Sie sind am nächsten Tag trotzdem pünktlich zu dieser Kirche gegangen.«
»Ja, genau das habe ich getan – und ich hatte einen geladenen Revolver dabei. Aber der Mann war nicht da. Die Kirche wird wenig besucht, und es war elendiglich kalt. Ich bin eine Stunde lang auf und ab marschiert auf den Steinplatten, und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört und gesehen, aber vergessen kann ich ihn auch nicht.«
»Sie kennen den Mann«, sagte Holmes.
»Ja, Mr. Holmes. Sie haben den Kern der Sache getroffen. Ich glaube, die Identität dieses Menschen zu kennen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht weiß, was Sie zu diesem Schluss geführt hat.«
»Das erscheint mir ganz offensichtlich«, erwiderte Holmes. »Sie haben ihn nur dreimal gesehen. Er hat Sie um ein Treffen gebeten, ist dann aber nicht aufgetaucht. Nichts von dem, was Sie gesagt haben, würde erklären, warum dieser Mann Ihnen gefährlich werden könnte. Aber gleich zu Anfang haben Sie gesagt, dass Sie hierhergekommen sind, weil es bedrückende Ereignisse gibt, die Sie belasten. Und einer Begegnung mit diesem Mann wollten Sie sich nicht stellen, ohne einen Revolver mit sich zu führen. Außerdem haben Sie uns noch immer nicht gesagt, welche Bewandtnis es mit der flachen Mütze hat.«
»Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was er will. Ich bin entsetzt, dass er mir nach England gefolgt ist.«
»Aus Amerika?«
»Ja.«
»Mr. Carstairs, Ihre Geschichte ist hochinteressant. Wenn Sie noch genug Zeit haben, ehe Ihre Oper beginnt, oder ausnahmsweise sogar bereit sind, auf den Genuss der Ouvertüre heute einmal zu verzichten, sollten Sie uns jetzt vielleicht die ganze Geschichte erzählen. Sie haben erwähnt, dass Sie letztes Jahr in Amerika waren. Haben Sie den flachmützigen Mann damals kennengelernt?«
»Kennengelernt hab ich ihn nie. Aber ich war seinetwegen dort.«
»Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich mir eine Pfeife stopfe? Nein? Dann haben Sie doch bitte die Freundlichkeit, uns mit in die Vergangenheit zu nehmen und zu erzählen, was Sie auf die andere Seite des Atlantiks geführt hat. Ein Kunsthändler gehört doch normalerweise nicht zu den Leuten, die sich viele Feinde machen, nehme ich an. Aber jetzt scheint es so, als ob genau das der Fall wäre.«
»In der Tat. Mein Widersacher heißt Keelan O’Donaghue, und ich wünschte beim Himmel, dass ich den Namen niemals gehört hätte.«
Holmes griff nach dem persischen Pantoffel, in dem er seinen Tabak aufbewahrte, und begann, seine Pfeife zu füllen. Unterdessen holte Edmund Carstairs tief Luft. Dies ist die Geschichte, die er erzählte.
2 Die Flat Cap Gang
Vor anderthalb Jahren wurde ich einem höchst außergewöhnlichen Mann namens Cornelius Stillman vorgestellt, der sich am Ende einer langen Europareise in London aufhielt. Er war an der Ostküste der Vereinigten Staaten zu Hause und gehörte zu jener Kaste von vornehmen amerikanischen Familien, die als »Brahmanen von Boston« bekannt sind. Er hatte mit den Aktien der Calumet & Hecla Mines ein Vermögen verdient, aber auch in Eisenbahn- und Telefongesellschaften investiert. In seiner Jugend hatte er offenbar künstlerische Ambitionen gehabt, und ein wesentlicher Grund für seine Europareise war wohl der Wunsch gewesen, die großen Sammlungen in Paris, Florenz, Rom und London zu besuchen.
Wie so viele Amerikaner war er erfüllt von einem starken sozialen Verantwortungsbewusstsein, das ihm sehr zur Ehre gereichte. Er hatte im Gebiet der sogenannten Back Bay in Boston ein größeres Grundstück erworben und bereits mit dem Bau einer Gemäldegalerie begonnen, die er The Parthenon nennen wollte. Dieses Bauwerk gedachte er mit den besten Kunstwerken zu füllen, die er auf seinen Reisen erworben hatte. Ich lernte ihn bei einem Abendessen kennen und sah sofort, dass er ein regelrechter Vulkan war, der vor Energie und Ideen sprühte. Gekleidet war er recht altmodisch. Er trug einen Bart und sogar ein Monokel, erwies sich aber als gut informiert und sprach fließend Französisch und Italienisch, ja sogar ein paar Brocken Altgriechisch. Auch seine Kunstkenntnisse und sein ästhetisches Gespür unterschieden ihn deutlich von vielen seiner Landsleute. Halten Sie mich bitte nicht für unnötig voreingenommen, Mr. Holmes. Aber Mr. Stillman selbst hat mir von den vielen Defiziten erzählt, die das kulturelle Klima aufweist, in dem er heranwuchs. Dass zum Beispiel große Kunstwerke in unmittelbarer Nachbarschaft von Monstrositäten wie Meerjungfrauen und Zwergen ausgestellt werden. Er hatte Theaterstücke von Shakespeare gesehen, bei denen zwischen den Akten Schlangenmenschen und Seiltänzer auftraten. So war das in seiner Jugend in Boston. Das Parthenon sollte anders sein, sagte er. Es sollte, wie schon der Name besagte, ein Tempel der Kunst und Kultur sein.
Ich freute mich ungemein, als Mr. Stillman sich bereit erklärte, meine Galerie in der Albemarle Street zu besuchen. Mr. Finch und ich verbrachten viele Stunden in seiner Gesellschaft, zeigten ihm unseren Katalog und alle Bestände an Bildern, die wir kürzlich auf Auktionen und bei anderen Gelegenheiten im ganzen Lande gekauft hatten. Das Ergebnis war, dass er Werke von Romney, Stubbs und Lawrence erwarb, vor allem aber auch vier zusammengehörige Landschaftsbilder von Constable, der ganze Stolz unserer Sammlung. Es handelte sich um Ansichten aus dem Lake District, die aus dem Jahre 1806 stammten und ganz anders waren als der übliche Constable-Kanon. Sie waren von einer ganz außergewöhnlichen Beseeltheit und Stimmung, und Mr. Stillman versprach, dass sie einen eigenen, großen, gut beleuchteten Raum in seiner Kunstausstellung erhalten würden, der eigens dafür gebaut werden sollte. Wir trennten uns im besten Einvernehmen. Und im Licht der weiteren Ereignisse sollte ich wohl erwähnen, dass ich anschließend eine sehr nennenswerte Summe bei meiner Bank einzahlte. Mr. Finch erklärte sogar, dass dies wohl die erfolgreichste Transaktion unseres Lebens gewesen sein dürfte.
Jetzt ging es nur noch darum, die Gemälde nach Boston zu schicken. Sie wurden sorgfältig in mehrere Schichten von Papier und Stoff eingehüllt und in eine robuste Kiste gepackt und mit der White Star Line von Liverpool nach New York expediert. Eigentlich hatten wir sie mit der RMS Adventurer direkt nach Boston schicken wollen, aber einer jener schicksalhaften Zufälle, die im ersten Augenblick ganz unbedeutend erscheinen, einen später aber noch lange verfolgen, hatte bewirkt, dass wir die Abfahrt des Schiffes um wenige Stunden verpassten und ein anderes wählen mussten. Unser Agent, ein aufgeweckter junger Mann namens James Devoy, nahm die Sendung in New York in Empfang und begleitete sie auf ihrer Weiterreise mit der Boston & Albany Railroad – einer Strecke von zweihundertneunzig Meilen.
Aber die Bilder kamen nie an.
Es gab damals in Boston zahlreiche Banden, die vor allem im Norden der Stadt, in Charlestown und Somerville, aktiv waren. Viele von ihnen hatten fantasievolle Namen wie zum Beispiel Dead Rabbits oder Forty Thieves und stammten ursprünglich aus Irland. Es ist sehr traurig, wenn man sich vorstellt, dass sie den Willkommensgruß dieses herrlichen Landes mit Gewalt und Verbrechen erwiderten, aber so war es nun einmal, und die Polizei schien nicht in der Lage, sie vor Gericht oder wenigstens unter Kontrolle zu bringen. Eine der aktivsten und gefährlichsten Banden war die Flat Cap Gang, deren Anführer zwei irische Zwillinge waren, die Brüder Rourke und Keelan O’Donaghue, die ursprünglich aus Belfast stammten. Ich werde versuchen, Ihnen diese beiden Teufel so gut wie möglich zu beschreiben, denn sie stehen im Mittelpunkt dessen, was ich Ihnen berichten muss.
Die beiden traten immer zusammen auf, und niemand hatte den einen je ohne den anderen gesehen. Rourke war der größere von den beiden, breitschultrig und mit einem gewaltigen Brustkorb, immer bereit, seine schweren Fäuste zu heben und zuzuschlagen. Es hieß, dass er schon mit sechzehn einen Mann beim Kartenspielen zu Tode geprügelt hatte. Sein Zwillingsbruder stand weitestgehend in seinem Schatten, er war viel kleiner und stiller. Genau genommen sprach er fast überhaupt nicht – man hörte sogar das Gerücht, dass er stumm sei. Rourke war bärtig, Keelan war glatt rasiert. Beide trugen flache Mützen, und daher bezog die Bande den Namen. Es wurde immer wieder behauptet, sie hätten sich die Initialen des jeweils anderen in den Arm tätowieren lassen, und es war offensichtlich, dass sie in jeder Hinsicht absolut unzertrennlich waren.
Bei den anderen Bandenmitgliedern genügen vielleicht schon die Namen, um Ihnen alles zu sagen, was Sie von ihnen zu wissen wünschen. Da gab es einen Frank »Mad Dog« Kelly und einen Patrick »Razors« MacLean. Wieder ein anderer hieß »The Ghost« und wurde gefürchtet wie ein übernatürliches Wesen. Sie waren in jede denkbare Form des Verbrechens verwickelt, aber ihre Spezialitäten waren Einbrüche, Schutzgelderpressung und Straßenraub. Dennoch standen sie in hohem Ansehen bei vielen ärmeren Einwohnern der Stadt, die offenbar nicht sehen wollten, dass es sich um eine Pest und ein Krebsgeschwür der Gesellschaft handelte. Für sie waren es keine Verbrecher, sondern Außenseiter, die einem herzlosen System den Krieg erklärt hatten. Ich brauche Sie gewiss nicht darauf hinzuweisen, dass es solche Zwillinge schon seit Anbeginn aller Zeiten in der Mythologie gibt. Denken Sie nur an Romulus und Remus, Apoll und Artemis oder Castor und Pollux, die heute noch als Sternbild den nächtlichen Himmel zieren. Ein wenig von diesem Glanz muss auf die O’Donaghues abgefärbt haben. Es existierte der Glaube, dass sie niemals geschnappt werden, sondern mit jeder noch so dreisten Tat davonkommen würden.
Als ich die Gemälde in Liverpool abschickte, wusste ich nicht das Geringste von der Flat Cap Gang – ich hatte noch nie von ihnen gehört, aber die beiden Brüder hatten offenbar just zu diesem Zeitpunkt einen Tipp erhalten, dass eine große Summe Bargeld von der American Bank Note Company in New York zur Massachusetts First National Bank in Boston gebracht werden sollte. Es solle sich um einhunderttausend Dollar handeln, so hieß es, und der Transport solle mit der Boston & Albany Railroad erfolgen. Manche sagen, dass Rourke der Vater des Gedankens war, andere glauben, dass Keelan der führende Kopf bei allen ihren Verbrechen war. Auf jeden Fall kamen die zwei zu dem Entschluss, den Zug vor Erreichen der Stadt anzuhalten und sich mit dem Bargeld davonzumachen.
Raubüberfälle auf Züge waren im Wilden Westen Amerikas zwar immer noch an der Tagesordnung, in Gegenden wie Kalifornien und Arizona. Dass so etwas aber in den weitaus zivilisierteren Staaten der Ostküste stattfinden könnte, schien nachgerade undenkbar, und deshalb war auch nur ein einziger bewaffneter Wachmann an Bord, als der Zug den Grand Central Terminal in New York verließ. Die Banknoten befanden sich im Postwagen in einem Safe. Und durch einen elenden Zufall befand sich die Kiste mit den Gemälden im selben Waggon. Unser Agent, James Devoy, saß in der zweiten Klasse. Er war immer sehr eifrig in seiner Pflichterfüllung und hatte einen Platz gewählt, der den Gemälden so nahe wie möglich war.
Der Ort, den die Flat Cap Gang für ihren Überfall gewählt hatte, lag kurz vor Pittsfield. Hier führten die Geleise relativ steil bergauf. Es gab einen zweihundert Meter langen Tunnel, und nach den Vorschriften der Eisenbahngesellschaft musste der Lokführer am Tunnelausgang stark bremsen, denn danach ging es abwärts zu einer schmalen Brücke. Der Zug kam deshalb ziemlich langsam aus dem Tunnel heraus, und es war einfach genug für die Brüder O’Donaghue, auf das Dach des vordersten Wagens zu springen. Von hier aus kletterten sie über den Tender, und zur Überraschung des Heizers und des Lokführers erschienen sie plötzlich mit gezogenen Revolvern im Führerstand der Lokomotive.
Sie zwangen die Besatzung, auf einer Lichtung zu halten, wo sie von Weymouthkiefern umgeben waren, die einen natürlichen Schutzschirm für ihr Verbrechen bildeten. Kelly, MacLean und die anderen Bandenmitglieder warteten dort mit Pferden und Dynamit, das sie in einem Steinbruch gestohlen hatten. Natürlich waren alle bewaffnet. Der Zug hielt an, und im selben Augenblick schlug Rourke den Lokführer bewusstlos, was eine schwere Gehirnerschütterung verursachte. Keelan, der wie immer kein Wort gesagt hatte, zog ein Seil hervor und fesselte den Heizer an eine Metallstrebe. Mittlerweile hatte der Rest der Bande den Zug geentert. Sie befahlen den Passagieren, still sitzen zu bleiben, dann näherten sie sich von außen dem Postwagen und befestigten Sprengladungen an den fest verschlossenen Türen.
James Devoy hatte alles gesehen und ahnte, was kommen würde. Er dachte sich wohl, dass die Räuber nicht hinter den Constables her waren. Schließlich wusste ja kaum jemand, dass sie überhaupt existierten, und schon gar nicht, dass sie hier im Zug waren. Und selbst wenn jemand gebildet oder schlau genug gewesen wäre, um sie als Meisterwerke erkennen zu können, hätte er niemand gehabt, dem er sie verkaufen konnte. Während also die anderen Passagiere ängstlich auf ihren Sitzen klebten, verließ Devoy seinen Platz und stieg aus dem Zug, offenbar in der Absicht, mit den Bandenmitgliedern zu verhandeln. Ich vermute jedenfalls, dass er das wollte. Denn noch ehe er ein Wort sagen konnte, drehte sich Rourke O’Donaghue um und schoss ihn einfach nieder. Devoy wurde dreimal in die Brust getroffen und starb in seinem eigenen Blut.
Der Wachmann im Inneren des Postwagens hatte die Schüsse gehört, und ich kann mir lebhaft vorstellen, welche schreckliche Angst er gehabt haben muss, als er hörte, wie die Bande an der Türe hantierte. Ob er sie aufgesperrt hätte, wenn es die Bande verlangt hätte? Das werden wir niemals wissen. Denn im nächsten Augenblick erfolgte eine gewaltige Explosion, und die ganze Seitenwand des Waggons wurde aufgerissen. Der Wachmann war sofort tot. Der Safe mit dem Bargeld stand vor den Räubern.
Eine zweite, kleinere Ladung genügte, um ihn zu öffnen, und jetzt erst merkten die Brüder, dass man sie falsch informiert hatte. Lediglich zweitausend Dollar wurden der Massachusetts First National Bank geschickt, für diese Ganoven vielleicht ein Vermögen, aber weitaus weniger, als sie erhofft und erwartet hatten. Trotzdem griffen sie mit Jubelrufen und Gebrüll nach dem Geld, und es war ihnen völlig gleichgültig, dass sie zwei Tote zurückließen. Dass ihre Sprengsätze außerdem noch vier Gemälde zerstört hatten, die zwanzigmal mehr wert waren als ihre Beute, hatten sie gar nicht gemerkt. Die Vernichtung dieser und der anderen Bilder stellt einen unersetzlichen Verlust für die britische Kultur dar. Heute muss ich mich sehr gezielt daran erinnern, dass an jenem Tag ein pflichtbewusster junger Mann starb, aber ich müsste lügen, wenn ich leugnen wollte, dass ich, so beschämend es sein mag, den Verlust der Bilder zumindest genauso bedauere.
Mein Partner, Mr. Finch, und ich hörten mit Entsetzen von der Untat. Zuerst glaubten wir noch, die Bilder wären gestohlen worden, was uns viel lieber gewesen wäre, weil sich dann zumindest irgendwer daran erfreut und eine gewisse Aussicht bestanden hätte, die Werke zurückzubekommen. Aber ein solch unglückliches Zusammentreffen von Gier, Gewalt und Vandalismus! So viele herrliche Bilder wegen einer Handvoll läppischer Dollarscheine zerstört! Wie bitterlich bereuten wir, dass wir ausgerechnet diesen Versandweg gewählt hatten! Natürlich gab es auch finanzielle Aspekte. Mr. Stillman hatte eine große Anzahlung geleistet, aber dem Vertrag nach waren wir vollständig für die Bilder verantwortlich, bis sie ihm in Amerika übergeben wurden. Zum Glück waren wir bei Lloyd’s of London versichert, sonst wären wir bankrott gewesen, denn früher oder später hätten wir Mr. Stillman sein Geld zurückgeben müssen. Außerdem war da noch die Familie des jungen James Devoy. Erst nach seinem Ableben erfuhr ich, dass er eine Frau und ein kleines Kind hatte. Jemand musste sich um sie kümmern.
Es gab also mehrere Gründe, warum ich mich zu einer Reise in die Vereinigten Staaten entschloss. Ich verließ England innerhalb weniger Tage und begab mich zunächst nach New York, wo ich mit Mrs. Devoy zusammentraf und ihr eine Entschädigung für den Tod ihres Mannes versprach. Ihr Sohn war gerade neun Jahre alt, und ein lieberes, hübscheres Kind kann man sich kaum vorstellen. Dann reiste ich weiter nach Boston und von dort nach Providence, wo Mr. Stillman sein Sommerhaus hatte. Ich muss zugeben, dass ich trotz der vielen Stunden, die ich bereits in der Gesellschaft dieses Mannes verbracht hatte, nicht auf den Anblick gefasst war, der mich erwartete. Shepherd’s Point war ein gewaltiges Bauwerk, das der gefeierte Architekt Richard Morris Hunt im Stil eines französischen Château errichtet hatte. Allein die Gärten erstreckten sich über dreißig Morgen, und das Innere erstrahlte in einem Glanz, der alles übertraf, was ich mir hätte vorstellen können. Stillman bestand darauf, mir alles persönlich zu zeigen, und ich werde diesen Rundgang niemals vergessen. Die große Eingangshalle wurde von einer herrlichen Treppe aus edlem Holz beherrscht, die Bibliothek umfasste fünftausend Bände, das Schachspiel hatte einmal Friedrich dem Großen gehört, in der Kapelle stand eine alte Orgel, die Purcell einst gespielt hatte … als wir schließlich den Keller mit dem Swimmingpool und der Bowlingbahn erreicht hatten, war ich wie erschlagen. Und dann erst die Kunstwerke! Ich zählte Gemälde von Tizian, Rembrandt und Velasquez – und das noch ehe ich im Salon war. Als ich diesen gewaltigen Reichtum sah und an das grenzenlose Vermögen dachte, über das mein Gastgeber ohne Zweifel verfügte, formte sich eine Idee in meinem Kopf.
Beim Abendessen, das wir an einer riesigen mittelalterlichen Tafel einnahmen, während wir von schwarzen Lakaien in kolonialer Kleidung bedient wurden, schnitt ich die Frage an, wie Mrs. Devoy und ihrem Sohn geholfen werden könnte. Stillman versicherte mir, dass er die Stadtväter von Boston aufmerksam machen würde. Er sei zuversichtlich, dass sie sich der Sache annehmen würden, auch wenn Mrs. Devoy und ihr Sohn nicht in Boston ansässig waren. Das ermutigte mich, auch die Flat Cap Gang zur Sprache zu bringen. Ob er nicht einen Weg wüsste, um die Bande vor Gericht zu bringen, da die Polizei offenbar mit ihren Untersuchungen nicht vorankäme. Wäre es nicht möglich, sagte ich, eine ordentliche Belohnung für Informationen auszusetzen, die zu ihrer Ergreifung führten? Und sollte man nicht außerdem noch eine private Detektivagentur damit beauftragen, die Burschen zu stellen und zu verhaften? Auf diese Weise könnten wir den Tod von James Devoy rächen und sie zugleich für den Verlust der Gemälde bestrafen.
Stillman reagierte begeistert auf meine Idee. »Sie haben recht, Carstairs!«, rief er aus und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Genau das werden wir tun. Ich werde diesen Mistkerlen zeigen, dass es eine ganz schlechte Idee war, Cornelius T. Stillman in die Quere zu kommen!« Das war nicht seine übliche Redeweise, aber wir hatten bereits eine Flasche exquisiten Bordeaux geleert und wollten uns gerade dem Port nähern, und so war er in einer deutlich entspannteren Laune als sonst. Er bestand sogar darauf, die Kosten für das Detektivbüro und die Belohnung allein zu übernehmen, obwohl ich angeboten hatte, ebenfalls einen angemessenen Beitrag zu leisten. Wir schüttelten uns die Hände darauf, und er schlug vor, ich sollte so lange bei ihm wohnen, bis alle diese Dinge geregelt waren, eine Einladung, die ich nur allzu gern annahm. Kunst ist nun einmal mein Lebenselixier, ich bin Händler und Sammler zugleich, und in Stillmans Sommerhaus gab es genug davon, um mich monatelang zu verzaubern.
Aber die Dinge entwickelten sich weitaus schneller, als ich gedacht hatte. Mr. Stillman nahm Kontakt mit Pinkerton’s auf und engagierte einen Mann namens Bill McParland. Ich wurde nicht zu den Besprechungen hinzugezogen – Stillman war einer jener Menschen, die alles allein und auf ihre eigene Art machen müssen. Aber ich kannte Mr. McParlands Ruf gut genug, um zu wissen, dass er ein entschlossener Ermittler war, der nicht ruhen und rasten würde, ehe er die Flat Cap Gang dingfest gemacht hatte. Zur gleichen Zeit wurden Anzeigen im Boston Daily Advertiser veröffentlicht, die für Hinweise, die zur Ergreifung von Rourke und Keelan O’Donaghue und ihrer Komplizen führten, eine Belohnung von einhundert Dollar versprachen – eine beträchtliche Summe. Ich freute mich zu sehen, dass Mr. Stillman unter die Ankündigung nicht nur seinen, sondern auch meinen Namen hatte setzen lassen, obwohl das Geld ausschließlich von ihm kam.
Die nächsten Wochen verbrachte ich in Shepherd’s Point und in Boston, einer erstaunlich schönen und schnell wachsenden Stadt. Ein paar Mal fuhr ich auch zurück nach New York und benutzte die Gelegenheit, das Metropolitan Museum of Art aufzusuchen, einen ziemlich misslungenen Bau, der allerdings eine vorzügliche Sammlung enthält. Ich besuchte auch Mrs. Devoy und ihren Sohn. Tatsächlich hielt ich mich gerade in New York auf, als ich ein Telegramm von Mr. Stillman erhielt, der mich dringend nach Boston zurückrief. Die hohe Belohnung hatte ihr Ziel erreicht. McParland hatte einen Tipp erhalten, und das Netz um die Flat Cap Gang zog sich zu.
Ich kehrte sofort zurück und nahm mir ein Zimmer in einem Hotel an der School Street. Und dort hörte ich dann am Abend von Mr. Stillman, was passiert war.
Der Hinweis war vom Besitzer eines Dramshops – so nennen die Amerikaner eine Bar – im North End gekommen, einem eher ungesunden Stadtteil von Boston, wo viele irische Einwanderer leben. Die Donaghue-Zwillinge hatten sich in einem engen Mietshaus am Charles River verkrochen, einem dunklen, schmutzigen Gebäude mit drei Stockwerken, in dem sich Dutzende von Kammern zusammendrängten und wo es auf jedem Stockwerk nur einen Abort gab. Die Abwasserrinnen liefen durch die Korridore, und der Gestank wurde nur durch den Rauch der zahlreichen Holzkohlenöfen gemildert. Dieses Höllenloch war mit schreienden Babys, betrunkenen Männern und halbverrückten Frauen gefüllt, die pausenlos vor sich hin murmelten, aber im hinteren Teil gab es einen primitiven Anbau aus Brettern und Lehmziegeln, den die Zwillinge zu ihrer Wohnstatt gemacht hatten. Keelan hatte ein eigenes Zimmer. Rourke teilte sich einen etwas größeren Raum mit zwei von den Bandenmitgliedern. Die anderen hausten im dritten Raum.
Das aus dem Zug gestohlene Geld war längst verspielt und versoffen. Als an diesem Abend die Sonne unterging, hockten sie um den Ofen, spielten Karten und tranken Gin. Einen Wachtposten hatten sie nicht aufgestellt. Keine der Familien in der Nachbarschaft hätte gewagt, sie zu verraten, und sie waren fest überzeugt, dass die Polizei am Diebstahl der zweitausend Dollar längst das Interesse verloren hatte. Sie ahnten nicht, dass McParland und ein Dutzend bewaffneter Helfer das Gebäude umstellt hatten.
Die Agenten von Pinkerton hatten Befehl, sie nach Möglichkeit lebend zu fassen, denn Stillman hoffte sehr, sie vor Gericht zu bringen. Außerdem wohnten viele Unschuldige in der Nähe, und schon deshalb war es wünschenswert, ein Feuergefecht zu vermeiden. Als seine Männer in Position waren, ergriff McParland das blecherne Sprachrohr, das er mitgebracht hatte, und forderte die Bande auf, sich zu ergeben. Aber die Hoffnung, dass die Flat Cap Gang so ohne weiteres die Waffen strecken würde, erwies sich als Illusion. Eine ganze Salve von Schüssen antwortete ihm. Die Zwillinge hatten sich zwar überraschen lassen, aber ohne einen Kampf würden sie nicht aufgeben. Eine Kaskade von Blei prasselte hinaus auf die Straße, nicht nur durch die Fenster, sondern auch durch eilig in die Wände geschlagene Löcher. Zwei von den Pinkerton-Leuten wurden niedergeschossen und auch McParland wurde verletzt, aber die anderen feuerten ohne Zögern zurück. Sie leerten ihre Revolver direkt in die Bretterbude. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es da drin gewesen sein muss, als Hunderte von Kugeln durch das dünne Holz krachten. Es gab kein Verstecken und kein Entrinnen.
Als alles vorbei war, fand man im rauchgefüllten Inneren fünf in Stücke geschossene Männer, die alle dicht beieinander lagen. Der sechste Mann schien entkommen zu sein. Auf den ersten Blick schien das unmöglich, aber McParlands Informant hatte ihm versichert, die ganze Bande würde an diesem Abend versammelt sein, und während des Feuergefechts hatte er auch den Eindruck gehabt, dass sechs verschiedene Männer geschossen hatten. Die Räume wurden genauer durchsucht und das Rätsel gelöst. Eins der Bodenbretter war lose, und als sie es herausgenommen hatten, entdeckten sie einen Abwasserkanal, der unter dem Anbau zum Fluss führte. Keelan O’Donaghue war auf diesem Wege entkommen, obwohl es teuflisch eng gewesen sein muss, denn das Rohr war kaum groß genug für ein Kind, und keiner der Agenten von Pinkerton hatte Lust, es auszuprobieren. McParland ging mit ein paar Männern zum Fluss hinunter, aber mittlerweile war es stockdunkel und er wusste schon vorher, dass jede Suche vergeblich sein würde. Die Flat Cap Gang war vernichtet, aber einer ihrer Anführer war entkommen.
Dies war das Ergebnis, das Cornelius Stillman mir an diesem Abend in meinem Hotel mitteilte, aber es ist noch keineswegs das Ende dieser Geschichte.
Ich blieb noch eine weitere Woche in Boston, teils in der Hoffnung, dass Keelan O’Donaghue noch gefasst werden würde. Denn eine leichte Besorgnis war bei mir aufgekommen. Das heißt, vielleicht war sie schon vorher da gewesen, aber ich wurde mir dieser Befürchtung erst jetzt bewusst. Sie bezog sich auf diese verfluchte Anzeige, die ich bereits erwähnte und die auch meinen Namen trug. Stillman hatte damit öffentlich bekannt gemacht, dass ich eine der Parteien gewesen war, die zur Verfolgung der Flat Cap Gang aufgerufen hatte. Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung war ich durchaus stolz darauf gewesen, weil es ja um das Gemeinwohl ging und es mir zur Ehre gereichte, mit dem großen Mann zusammen erwähnt zu werden. Jetzt aber kam mir der Gedanke, dass es vielleicht nicht ganz ungefährlich gewesen war, einen Zwilling zu töten und den anderen weiterleben zu lassen, weil mich das zum potenziellen Ziel von Rachegelüsten des Überlebenden machte, besonders in einer Stadt, wo selbst die übelsten Verbrecher auf die Hilfe von Freunden und Bewunderern zählen konnten. Ich war deshalb ziemlich nervös, wenn ich mein Hotel verließ oder wieder betrat. In die wüsteren Teile Bostons wagte ich mich kaum noch, und nachts ging ich schon gar nicht mehr aus.
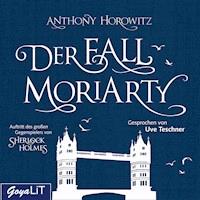

![Ein perfider Plan. Hawthorne ermittelt [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/49dd8a4c566f175bbb9d9450d3842e0f/w200_u90.jpg)

![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
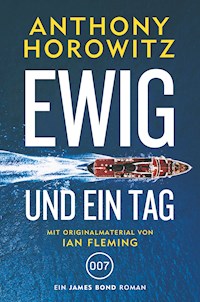
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Die Morde von Pye Hall. Susan Ryeland ermittelt [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6cf70dc1ef49249c857a955eadbfcf70/w200_u90.jpg)
![Mord stand nicht im Drehbuch. Hawthorne ermittelt [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/048a0a8d746eaaf2e78653d44c492732/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)









