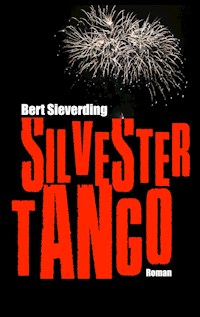Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten in der wichtigsten Besprechung des Jahres erreicht Karl Siemer die Nachricht vom Tod seines Vaters. Widerwillig kehrt er nach 20 Jahren in das Dorf seiner Kindheit zurück, um seinen Vater zu beerdigen und schnellstmöglich den Nachlass zu regeln. Dort angekommen muss er feststellen, dass sein Vater nicht allein gelebt hat und dass sich die Beisetzung nicht so einfach abwickeln lässt, wie ein Geschäftstermin. Am Tag der Beerdigung überschlagen sich die Ereignisse und Karls Leben gerät nachhaltig aus den Fugen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
1
Die Nachricht erreicht mich mitten in der Budgetverhandlung. Beim ersten Vibrationsalarm meines Handys schaue ich noch aufs Display, sehe aber nur die Nummer von Susanne. Ich drücke sie weg, wohlwissend, dass sie das nicht mag. Beim zweiten Klingeln oder besser gesagt beim Rattern des Geräts auf dem Tisch, drücke ich das kleine rote Symbol, ohne erneut auf die Anzeige zu schauen. Denn ich muss meinem tschechischen Kollegen, der via Telefonkonferenz am Meeting teilnimmt, gerade erläutern, warum ich für die Anpassungen meines IT-Systems anteilige 143.583 Euro von der tschechischen Konzerntochter brauche. Er argumentiert, im Vorjahr seien schon 154.000 Euro geflossen und so langsam müsste das System doch wohl fertig sein.
Ich mag diese Art von Besprechung nicht. Es liegt nicht am bilderlosen Besprechungsraum, obwohl der allen Anlass dazu böte. Er hat nämlich den Charme einer Gefängniszelle. Im ersten Obergeschoss liegend trennt nur ein Lichtschacht von drei Metern Breite das Gebäude vom Nachbargebäude. Fluchttreppen aus Stahlgitter über fünf weitere Stockwerke verschatten die Fenster derart, dass selbst bei praller Sonne ihre künstliche Neon-Verwandte leuchten muss. Der an der Decke vor sich hin brummende Beamer wandelt die ohnehin schon schlechte Luft binnen weniger Minuten in eine noch trockenere um und auch die lieblos herumstehenden Mineralwasserflaschen helfen nicht, unsere Kehlen zu wässern, klaut doch irgendwer regelmäßig den Flaschenöffner. Einige Teilnehmer versuchen, die Flaschen mittels der Tischkante zu öffnen – die Tische sehen entsprechend aus. Ich weiß, dass man mit zwei Flaschen eine Flasche aufbekommen kann. Doch bei mir spritzt es manchmal – deshalb tue ich es nicht. Die Freisprecheinrichtung des Telefons mit ihren Mikrofonen, deren immer zu kurze Kabel die Tische wie ein Spinnennetz verbinden, ist auch nicht der Grund für meine Abneigung. Nein, es liegt an den Menschen. Ich ertrage so viele Leute um mich herum nicht, zumindest bilde ich mir das ein. Ich bin lieber allein in meinem kleinen Büro mit seinen beigen Arbeitsmöbeln aus den Achtzigern des letzten Jahrhunderts, den abstrakten Bildern an der einzigen freien Wand, der Yucca-Palme gleich neben dem Fenster im Erdgeschoss, welches nicht mehr richtig schließt, und arbeite bevorzugt via Computer, Internet und Telefon mit Lieferanten und Kollegen zusammen. Allerdings arbeiten wir Kollegen nicht kollegial zusammen. Zwar gibt es Vorgaben von der IT-Leitung, wie viel Geld einzusparen, welche Firma nicht zu beauftragen und welche Basistechnologie einzusetzen sind, doch wir Kollegen sind Konkurrenten. Jeder hat sein System, welches er betreut und wir alle haben nur eins gemeinsam: zu wenig Geld. Klar, dass die Budgetrunden die wichtigsten Termine des Jahres sind. Denn hier wartet jeder auf das Scheitern des anderen. Früher fanden diese Diskussionen im Herbst, manchmal auch erst zu Beginn des Finanzjahres statt. Typischerweise ging man gegenüber Kunden in Vorleistung und im Laufe des Jahres rüttelten sich dann Angebot, Nachfrage und Geld zurecht, auch wenn der Jahresabschluss der Abteilung immer stressig war und man erst am 30. Dezember wusste, ob man eine Million zu viel oder 300.000 zu wenig in der Bilanz hatte. Doch das änderte sich, als das Controlling die Budgets des Folgejahres bereits Mitte Oktober festschrieb. Die Einkaufsverhandlungen mit den Lieferanten folgten bis Jahresende und zu Beginn des Jahres konnte man mit den Projekten starten. In Folge wurde das Aushandeln des Budgets immer weiter vorgezogen und so beginnen wir jetzt bereits nach Ostern.
Ich arbeite für einen international tätigen Konzern. Die Abteilung, der ich angehöre, führt IT-Projekte durch, meist kleinere Anpassungen von Systemen, manchmal Erweiterungen oder kleinere Neuprojekte. Typischerweise gibt die größte Marke die Anforderungen vor und meine Rolle besteht dann darin, den anderen Marken zu erläutern, warum auch sie diese Erweiterungen brauchen.
Einige Kollegen blühen in den Budgetrunden immer auf. Sie können bis auf den Cent genau berechnen, wie viel Geld sie im Folgejahr ausgeben werden und wofür. Dabei ist es erst Ende April. Die Osterferien sind gerade vorbei und bis zum Folgejahr, um dessen Finanzen es in der Runde geht, sind es noch acht lange Monate. Mein Problem ist, dass ich die Argumente meiner Kunden und meist auch die Argumente meiner Kollegen nachvollziehen kann, selbst aber nie überzeugend meine eigenen Bedürfnisse artikuliere. In Folge wird mein Projektbudget von Jahr zu Jahr geringer.
Meinem jungen Kollegen links neben mir fallen immer wieder die Augen zu. Er sei vor ein paar Monaten Vater geworden und nachts fände er kaum Schlaf, sagt er. Um sein Projekt muss er sich jedenfalls keine Sorgen machen. Jedes Jahr braucht er mehr Geld und bekommt es auch genehmigt, dabei ist sein System schon über zehn Jahre alt und es gibt durchaus Alternativen. Dem Chef ist das egal. Er sagt, es sei mein Projekt und ich müsse zusehen, dass ich die benötigten Gelder zusammenbekommen würde. Er sähe sich mehr in der Rolle des Moderators.
Zu Beginn der Sitzung hat der Chef eine lange Excel-Liste aufgelegt. In Summe stehen dort 35 Positionen, jeweils mit Titel, Begründung, Vorjahreswert und benötigtem Budget. Jede Vorgabe zur Senkung des Gesamtbudgets führt rasenmähermäßig zur Senkung aller Einzelpositionen, eine Budgetaufstockung hingegen nur zur Erhöhung einzelner Positionen. Meine drei Positionen stehen an zweiter Stelle. Die Sitzung ist mit vier Stunden Dauer angesetzt und wir sind in der zweiten. Es ist Viertel nach neun.
Mit den Tschechen diskutiere ich jedes Jahr aufs Neue und nach gleichem Muster. Das geht so: Zuerst leugnen sie, dass sie mein System überhaupt nutzen würden. Nachdem ich ihnen dann per Statistik nachgewiesen habe, dass dies der Fall ist, behaupten sie, man hätte keinerlei Erweiterungswünsche und der Funktionsumfang sei vollkommen ausreichend, ja eigentlich überdimensioniert. Gerade stelle ich dar, warum was wann gemacht worden und notwendig gewesen ist und wie auch sie davon profitiert hätten und sich alles binnen Jahresfrist amortisieren würde. Doch mein Chef ist diese Diskussion leid und würgt mich ab. Er will zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen und brummt mir als Hausaufgabe bis zur nächsten Sitzung auf, dem tschechischen Kollegen eine detaillierte Ausgabenplanung zuzusenden und bilateral mit ihm abzustimmen.
Eigentlich ist mein Chef ganz in Ordnung. Als guter Unterhalter erzählt er viel von seinen Projekten – damals –, von den Kunden und wie man mit obskuren Forderungen am besten umgeht. Und dann ist da noch seine Frau, die Ärztin mit ihren Abrechnungsproblemen gegenüber den Krankenkassen, die wir, seine Mitarbeiter, wahrscheinlich besser kennen als manche ihrer Mitarbeiterinnen in der Praxis. Er ist zehn Jahre jünger als ich. Oder anders ausgedrückt: Ich habe den Absprung nach oben versäumt und den zur Seite noch vor mir. Chef war mal Sportler – in jungen Jahren. Danach Förderer, ein Vereinsmensch, ganz früher bestimmt mal Klassensprecher. So einer, den sich jeder Personaler wünscht, sein Aussehen blendend, passend zu ihm als Blender. In den letzten Jahren sieht man ihm jedoch die ungesunden Currywürste an, auch wenn er manchmal die vegane Variante bevorzugt und dann vom vollkommen veganen Mittagessen, bestehend aus Currywurst und Pommes, schwärmt.
Einer seiner Mitarbeiter, also mein Kollege, ist ein richtiges Stehaufmännchen. Jedes Jahr aufs Neue setzt er ein Teilprojekt in den Sand, dennoch gelingt es ihm immer wieder, neues Budget zu allozieren. Allerdings ist er so jung und so naiv, dass es Außenstehende verwundert, warum er überhaupt Projektverantwortung trägt. Wenige kennen sein Geheimnis: Seine bildhübsche Frau ist Tochter des Leiters der Nachbarabteilung. Ich hingegen bin weich wie Butter und kann meinen Kunden die Probleme und Wünsche bereits ansehen, wenn sie mein Büro betreten. Also bin ich ein echter Dienstleister, unterwürfig, immer hilfsbereit und bemitleidet. Keine Ahnung, woher ich diese Eigenschaft habe. Von meinem Vater jedenfalls nicht.
Inzwischen weiß ich, dass der zweite Anruf nicht von Susanne war, denn die Sekretärin steht kurz danach hinter mir und berührt meine Schulter. Ich mag das nicht, mag nicht, wenn mich ein bestimmter Typ Frau berührt und sie gehört dazu. Sie weiß es, alle wissen es und an diesem Tag tut sie es extra oder denkt sie, die Nachricht besonders einfühlsam vermitteln zu müssen? Nur Personen, die mich nicht kennen, geben mir zur Begrüßung die Hand. Alle anderen wissen um meinen Tick und häufig klopfen sie an den Türrahmen oder auf die Tischplatte, wohlwissend, dass sie mir damit eine große Freude machen. Dabei ist diese meine Macke erfunden, denn ich habe nichts gegen Berührungen von fremden Menschen, nichts gegen das Händeschütteln und Schulterklopfen. Nur, wenn diese Aktion von einem bestimmten Typ Frau ausgeht, empfinde ich es als Angriff, was mir jahrelang nicht bewusst war.
Während des Studiums gab es kaum Kommilitoninnen und die wenigen waren in festen Händen und würdigten mich keines Blicks. Auch gab es genau diesen Typ Frau, mit dem ich Probleme habe, an der Uni nicht. Wohl aber in Restaurants, Bars und Geschäften und unbewusst ging ich ihnen dort aus dem Weg.
In der Firma wurde etwa fünf Jahre nach meinem Eintritt die Abteilung umstrukturiert und ich erhielt eine neue Kollegin. Sie neigte dazu, alle Kolleginnen und Kollegen zu herzen, weil sie ein paar Monate in den USA gelebt und dort die ›Free Hugs‹-Bewegung kennen und lieben gelernt hatte. Sie trug immer ein T-Shirt mit gleichnamiger Aufschrift und umarmte jede und jeden, selbst den Chef. Ihrer Meinung nach ließen sich so alle Projektprobleme lösen, da man sich ja näher kommen würde. Nachdem sie mich zum ersten Mal umarmt hatte, ging es mir danach so schlecht, dass ich nichts essen konnte und Schwierigkeiten hatte,zu atmen. Etwas bedrückte mich, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst am Abend bekam ich die Beklemmung mit einer heißen Dusche in den Griff. Ich machte in meiner Naivität das Wetter dafür verantwortlich. Doch ein paar Tage später schien die Sonne und die Kollegin lief mir wieder über den Weg und umarmte mich erneut mit beiden Armen. Wenig später saß ich wieder auf dem Klo und rang nach Luft. Ich bin der Typ Mann, über den sich jede Krankenversicherung freut, immer zahlend und nie krank. Der Hausarzt, den ich dann am späten Nachmittag aufsuchte, fand natürlich nichts – zugegeben, er gab sich auch keine große Mühe. Nur sagte er bei der Verabschiedung, ich solle mal in mich hineinhorchen, ob es Veränderungen im Arbeitsumfeld gegeben hätte, denn es seien wohl psychische Probleme. Als Grübler, der ich bin, fing ich an, eine Liste aller Veränderungen aufzuschreiben und im Kalender mit meinen Problemtagen abzugleichen. Einzig die neue Kollegin blieb als Problemquelle übrig. Um sicher zu sein, umarmte ich sie am nächsten Tag. Schon wenig später stellte sich die Beklemmung wieder ein. Ich fuhr nach Hause, duschte und schon ging es mir besser. Fortan mied ich die Kollegin und fand mich ein paar Wochen später beim Chef zu einer Unterredung wieder. Er sprach nicht lange drumherum und fragte, was ich für Probleme mit der Kollegin hätte. Diese hätte sich über mich beschwert. Ich war sprachlos. Ich wollte aber die Besprechung nicht einfach so abbrechen und erfand aus dem Stegreif eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich behauptete, dass es früher auf dem Dorf eine Tierärztin gegeben hätte, die immer bei schwierigen Kalbgeburten gerufen worden sei. Erst hätte sie mit ihren bloßen Händen nach dem Kalb gesucht, aus meiner damaligen Sicht als Kind, im Arsch der Kuh herumgerührt. Nach der Geburt des Kalbs hätte sie mich dann, vor Freunde über die vollbrachte Leistung, mit denselben ungewaschenen Händen umarmt, mir auf die Schulter geklopft und mir die Hand gegeben, als sei ich der Pate gewesen. Dieses sei mehrfach passiert und hinterher hätte ich immer gekotzt und schlecht geschlafen und hätte seitdem ein Problem damit, wenn mich jemand berühren würde und am schlimmsten sei eine Umarmung. In meinem Erzählfluss steigerte ich mich in die Dramatik der Geschichte so hinein, dass ich gleich mit erfand, dass ich auch Probleme hätte, wenn mir ein Mann auf die Schulter klopfen würde oder ich einem Unbekannten die Hand schütteln müsste. Der Chef kam nicht vom Lande, sonst hätte er meine Lüge sofort enttarnt, denn damals gab es weit und breit keine Tierärztinnen. Doch er glaubte mir und schon bald hatte sich meine Geschichte herumgesprochen.
Beate, die Frau, die gerade meine Schulter berührt, ist die Sekretärin und wohl drei Jahre älter als ich. Sie ersetzt so ein junges Ding im Vorraum des Chefs, nachdem dieser auffallend viele Dienstreisen in Begleitung der jungen Frau unternommen hatte. Beate ist eigentlich ganz nett – so sagen meine Kollegen. Ihr Gesicht ist faltenlos glatt, der Hals zu kurz und ihre aschblonden, ja fast grauen Haare wippen bei jedem Schritt ihres inzwischen der Konfektionsgröße 44 gerade noch gehorchenden, nicht taillierten Körpers, der von den zwei staksigen Beinen nur mühsam getragen wird, weil sie für ein schlankeres Oben geschaffen worden sind. Um ihre Einssechzig auszugleichen, trägt Beate immer Schuhe mit mindestens acht Zentimeter Absatz und ihre kleinen Brüste haben nie einen Kindsmund gefühlt. Ich bin kratzig zu ihr und sie zur mir, denn sie ist das Ebenbild der ›Free Hugs‹-Frau.
Beate schiebt mir einen Zettel zu. ›Erhielt gerade einen Anruf, durchgestellt von der Telefonzentrale: Dein Vater ist gestorben.‹ Dann legt sie den Arm um mich und flüstert mir leise ein herzliches Beileid ins Ohr. Ich schüttele ihren Arm ab und muss mich für den Rest des Tages dort kratzen, wo sie mich berührt hat. Auch reibe ich mir das Ohr, welches ihre Lippen zwar nicht berührten, welches aber dennoch brennt, als hätte sie einen Flammenwerfer draufgehalten.
Was ist die normale Reaktion auf so eine Nachricht in dieser Situation? Ich weiß es nicht. Mag sein, dass Menschen in Tränen ausbrechen oder laut aufschreien. Mag sein, dass mancher an das Erbe denkt oder einfach nur traurig ist. Ich jedenfalls bin wütend, wütend, insbesondere über den Zeitpunkt. Und so schlage ich den Deckel meines Laptops zu, nehme mein Handy und schmeiße beides in meine Tasche. Dann notiere ich auf einem PostIt folgende Nachricht für meinen Chef: ›Vater gestorben. Bin Einzelkind, muss mich um alles kümmern und nehme Urlaub.‹ Kaum erhebe ich mich, schauen alle Teilnehmer mich fragend an. Der Tscheche, der am anderen Ende der Telefonleitung zum wiederholten Mal die zu hohen IT-Kosten beklagt, kann es nicht sehen und redet wasserfallartig weiter. Die fragenden Blicke meiner Kollegen durchbohren mich. Nie habe ich bisher wegen eines privaten Ereignisses vorzeitig eine Besprechung verlassen. Schließlich bin ich Single und mein Job ist mein Leben, auch wenn ich den Scheiß an manchen Tagen hasse. Hinter ihren Fassaden sehe ich meine Kollegen schon jubeln. Ich spüre ihre heimliche Freude, meine Positionen in meiner Abwesenheit um ein paar Prozente kürzen zu können. Ich lege meinem Chef wortlos das PostIt hin und verlasse, ohne mich umzusehen, den Raum.
2
Warum zum Donner habe ich den Anruf nicht persönlich entgegengenommen? Dieses Drama mit Beate. Ich wäre dann still im Meeting sitzengeblieben, hätte abgewartet und aufgepasst, dass keine Position gestrichen wird. Ist doch egal, ob ich um zwei oder vier Uhr im Elternhaus ankomme. Doch jetzt ist es zu spät. Schon bald werden alle vom Tod meines Vaters wissen und noch während des Meetings werden sie die Messer wetzen und an meinem Kuchen herumknabbern. Und weil ich das Gespräch nicht angenommen habe, weiß ich nicht mal, wer angerufen hat. Wo ist Vater überhaupt gestorben? Zu Hause oder im Krankenhaus? Oder hatte er einen Autounfall und man hat die Reste seines Körpers womöglich von der Straße gekratzt? Ist er vom eigenen Trecker überrollt worden? Ich ziehe mein Handy heraus und wähle die Nummer meines Elternhauses, die ich auswendig kann, auch wenn ich seit Weihnachten nicht mehr angerufen habe und seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr da gewesen bin. Das Tuten des Festnetzanschlusses widerhallt im Lautsprecher meines Smartphones. Niemand meldet sich.
Ich muss was Dunkles anziehen, kann im Dorf nicht mit einer hellen Hose und einem blauen Hemd rumlaufen. Ich bin der Sohn, der Einzige. Ich muss Trauer tragen, den dunklen Anzug mit weißem Oberhemd, dazu die schwarze Krawatte und schwarze Halbschuhe. Habe ich überhaupt eine schwarze Krawatte? Ist das weiße Oberhemd überhaupt noch weiß oder durch das Liegen im Schrank inzwischen grau oder beige geworden? Zum Waschen habe ich keine Zeit mehr. Also muss ich nochmals kurz in die Stadt, dort in ein Bekleidungsgeschäft gehen und kaufen, was man mit zunehmenden Alter immer öfter braucht: ein Outfit für Beerdigungen.
Komisch, ist es die Verdrängung oder warum gehen mir nur Formalien durch den Kopf? Wer erwartet mich? Was habe ich als einziger Nachkomme jetzt zu tun? Warum kann ich nicht wie andere Mittfünfziger beim Eintritt in den Waisenstand ganz einfach traurig sein? Kann ich überhaupt traurig sein oder Gefühle zeigen? Man sagt, ich sei ein emotionsarmer Mensch. Ich kann mich für die Prozessprobleme eines Kunden mehr begeistern als für eine Brünette, deren 172 Zentimeter, wohlproportioniert verteilt in Zara-Klamotten der Größe 34, vorbei stolzieren und dabei unaufhörlich das Signal aussenden: ›Ich kann es besser‹. So eine Brünette ist Susanne. Sie hat morgens im Meeting angerufen, was nach den Ereignissen des gestrigen Abends nicht verwundert, schließlich habe ich mich mal wieder voll daneben benommen. Jetzt denken Sie bestimmt: Dieser Typ ist doch wie jeder andere auch und steigt bei erstbester Gelegenheit mit jedem willigen jungen Ding in die Kiste. Nein, das bin ich nicht, zumindest fühle ich mich nicht so. Ja, manchmal glaube ich sogar, mehr das Opfer zu sein. Ich werde Susanne auf jeden Fall während der langen Fahrt zum Elternhaus zurückrufen, mich für mein Verhalten entschuldigen und ihr die Lüge auftischen, die ich schon vielen erzählt habe und die fast immer zum Abbruch einer Freundschaft führte. Bis auf die wenigen Male, in denen sie beim Empfänger Mitleid auslöste und ich danach ein neues Problem bekam.
Wie gesagt, ich bin vor zirka zwanzig Jahren das letzte Mal im Elternhaus gewesen. Damals war meine Mutter gestorben und ich hatte meinen Vater besucht, um mit ihm der Testamentseröffnung beizuwohnen – nein, besser gesagt, diese zu wiederholen. Mutter hatte mir einen abgewetzten alten Ring, genauer einen 333er Goldring mit der Auflage hinterlassen, diesen an meine Frau, sofern ich mal heiraten würde, weiterzugeben. Dazu ist es bis jetzt nicht gekommen und inzwischen habe ich ein Alter erreicht, in dem man, wenn überhaupt, entweder aus Mitleid oder wegen des Geldes geheiratet wird. Meine Mutter starb von heute auf morgen. Schlaganfall. Soll erblich sein, so sagt man. Auch ihr Bruder starb ein paar Jahre später so. Ich war damals für ein paar Monate in Brasilien. Die Firma hatte mich dort hingeschickt, um die IT-Systemlandschaft an die Konzernstandards anzupassen. Sonderlösungen raus, Standards rein. Das Los fiel auf mich, denn niemand wollte dorthin. Mein Kollege, der wegen seiner Portugiesischkenntnisse am ehesten in Frage gekommen wäre, weigerte sich strikt und drohte sogar mit Kündigung. Keine Ahnung, warum. So traf es mich und ich war ziemlich sauer über dieses Los. Zwar bin ich Single und war gerade ohne eigenes Projekt, doch, was mich störte, war, drei Winter hintereinander erleben zu müssen. Sie schickten mich aus dem deutschen Frühling in den brasilianischen Herbst und ich versäumte meine heiß geliebten Volksläufe. Ich war sauer und nutzte danach jede Gelegenheit, mich an der Firma zu rächen. Ich meine in Bezug auf die kleinen Dinge des Lebens: Größe und Lage des Hotelzimmers, Dienstwagen und freies Tanken, Reisen auf Kosten der Firma am Wochenende. Als meine Mutter starb, hatte ich mir gerade ein paar Tage Urlaub genommen und war im Land unterwegs gewesen. Mein Ziel war es, Blumenau zu besuchen, jene Stadt in Brasilien, in der man immer noch Deutsch spricht und das Oktoberfest im Frühjahr feiert. Ein Firmenhandy hatte ich nicht und als mein damaliger Chef versuchte, mich zu erreichen, um mir die Todesnachricht zu übermitteln, war ich nicht im Büro. Als ich am Montag meine Mails durchschaute, fand ich eine kurze Mitteilung des Chefs. Er nannte den Beerdigungstermin, der am Freitag der Vorwoche liegend inzwischen verstrichen war. Zwar rief ich sofort meinen Vater an, der aber sagte nur einen kurzen Satz, ohne meine Entschuldigung anzuhören: Komm du mir mal wieder nach Hause! Es war der Tiefpunkt einer Beziehung zwischen Vater und Sohn, die bis dahin nur durch die Schlichtung meiner Mutter ohne Handgreiflichkeiten verlaufen war. Nach ihrem Tod stumpfte ich ab, entzog mich der Außenwelt noch mehr als sowieso schon. Ich war traurig und wütend. Ich hatte meine letzte Bezugsperson verloren und ihre Beerdigung versäumt. Wütend war ich natürlich auf mich selbst, auf die Firma, auf den blöden Aufenthalt in diesem gelbgrünen Land, in dem der Ficus Benjamin an den Straßen wie Unkraut wächst, die Leute ihre Autos mit Alkohol betanken, weil das Wetter den Zuckerrohrbauern immer gnädig ist und man die ganze Ernte nicht als Pitú versaufen kann. Nach meiner Rückkehr aus Brasilien fand ich im überquellenden Briefkasten meiner Wohnung einen Brief des Nachlassgerichts, eine Vorladung zur Testamentseröffnung. Natürlich war auch dieser Termin längst verstrichen. Ich machte mich dennoch auf, meinen Vater zu besuchen, der mich alters- oder witwenmilde aufnahm, nicht schimpfte, sondern immer nur sagte, dass er es ja so gewollt hätte. Von wegen in der Wirtschaft erfolgreich zu sein und richtig Kohle zu machen, statt ihm ein Leben lang auf der Tasche zu liegen. Und so begleitete ich ihn zum Notar, um das Testament meiner Mutter erneut verlesen zu lassen. Der Notar händigte mir den hinterlegten Ring aus und sprach salbungsvolle Worte. Als ich durch ihn den Willen meiner Mutter ein letztes Mal hörte, musste ich heulen. Darauf war der Notar vorbereitet, denn auf dem schweren Eichentisch stand eine Kleenex Box. Erst nach der Verkündung sprach mich der Notar an, ob ich ihn wiedererkennen würde. Wir seien zusammen zum Gymnasium gegangen und hätte ich nicht in der Neunten eine Ehrenrunde gedreht, hätten wir uns sicher beim Abitreffen zwischenzeitlich mehrfach gesehen. Ich erinnerte mich dunkel an seinen Namen, aber nicht an seine Person. Die vom vielen Schweinefleisch aufgedunsenen 120 Kilo, der prächtige Bauchumfang und seine Quadratlatschen der Größe 47, all das war mir fremd und hatten nichts mit dem smarten Jungen zu tun, mit dem ich mal einen Tisch auf der Penne geteilt hatte. Ich erinnere mich noch, wie ich damals dachte, ob Bauchträger wie er eigentlich beim Pinkeln noch ihr Glied sehen könnten und warum kein Badausstatter bisher die Marktlücke Pissoir mit eingebautem Spiegel besetzt hätte. Das Foto auf seinem Eichentisch zeigte mir jedenfalls, dass der Bauch ihn nicht an der Vermehrung seiner selbst gehindert hatte. Es zeigte drei prächtige Buben im geschätzten Alter von 9, 11 und 14 und deren Mutter, die, braunhaarig und sonnengebräunt, gleichgroß mit ihrem Ältesten, ihrem Mann nur bis zur Brust reichte und mehr als zweimal mit seinem Körpervolumen hätte aufgewogen werden können. Ich hatte von meiner Mutter kein Erbe erwartet und es war mir so peinlich, ihre Beerdigung versäumt zu haben, dass ich es seitdem mied, das Elternhaus und das Dorf aufzusuchen. Hatte Vater mir doch ein gutes Argument an die Hand gegeben: erfolgreich zu sein und Kohle zu machen. Und so erzählte ich bei all seinen und meinen wenigen Anrufen immer nur von meiner Arbeit, abstrakt natürlich, und vom Geld und wie ich es in Schiffsfonds angelegt hätte und von deren guter Rendite. Nie aber erzählte ich von einer Frau an meiner Seite, denn es gab ja keine. Vater hingegen berichtete zu Weihnachten, wenn wir den günstigen Feiertagstarif der Telekom ausnutzten, dass er die Schweine verkauft und das Land verpachtet hätte, bis auf ein kleines Stück, einen halben Hektar, auf dem er Gemüse anbauen würde, um es auf dem Wochenmarkt der Kreisstadt zu verkaufen. So gingen die Jahre ins Land. Mal baute er Möhren, mal Gurken, mal Zucchini an – nie klagte er übers Alleinsein, nie forderte er mich auf, ihn zu besuchen.
Bei Peek & Cloppenburg kaufe ich ein weißes Hemd von der Stange und einen einfachen schwarzen Schlips. In der Wohnung packe ich alles, was man für ein paar Tage unterwegs braucht, und natürlich meine Laufsachen in die Reisetasche und lege auch den Firmenlaptop dazu. Weil ich glaube, dass ich ein paar Tage weg sein werde, gieße ich meinen Kaktus. Ich bin unaufmerksam und gieße ihn zu viel. Auch gönne ich mir am späten Vormittag auf dem Parkplatz des Supermarkts eine Bratwurst, die ich sonst nie esse, schließlich bin ich Sportler, weiß um die Schädlichkeit der ungesunden Fette und vertrage diese auch nicht so gut. Doch mein Vater ist gestorben und irgendeine Ecke in meinem Kopf oder ist es doch nur der Magen, braucht Trost.
Ich fahre einen VW Golf, Benziner mit Turbomotor und 140 PS. Ich fuhr immer schon Golf. Mein erstes Auto während der Studentenzeit war ein roter Diesel mit 54 PS, gebraucht gekauft. Den ersten Neuen, einen Golf IV in Dunkelgrün, gönnte ich mir von meinem ersten Weihnachtsgeld und dem Ersparten, ein Jahr nach Antritt meines Jobs in der Firma. Klar hat der Golf VII, bei dem ich in der Zwischenzeit angekommen bin, ein Navi, als extra teuer bezahlt. Selbst ein iMac ist billiger als dieses Stück Technik, das sein Eigenleben hat, so dass ich manchmal glaube, es sei eine Sonderanfertigung extra nur für mich. Immerhin, das Navi kennt das Dorf. Den Namen der Straße kenne selbst ich nicht. Als ich das Dorf verließ, gab es keine Straßennamen. Jeder wusste, wo wer wohnt. Aber ich kenne die Strecke zum Elternhaus auch ohne Navi. Es hat immer zweieinhalb Stunden über die Autobahn oder drei über die Dörfer gedauert. Doch mein Navi zeigt mir an, dass der Weg über die Dörfer schneller wäre. Inzwischen gibt es rund um Nienburg, Sulingen und Diepholz Ortsumgehungen und außerdem ist die A7 bei Schwarmstedt und die A1 bei Bremen verstopft. Als Grund nennt der Verkehrsfunk den Osterferienrückreiseverkehr nach Nordrhein-Westfalen. Also wähle ich die Strecke über die Dörfer und möchte die neuen Ortsumgehungen kennenlernen und natürlich möglichst bald beim Elternhaus sein. Auf der A2 ist ebenfalls dichter Verkehr. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, muss an das Dorf denken, an die Nachbarn und versuche, mich verzweifelt an die Riten und Gewohnheiten zu erinnern. Der erste Nachbar heißt Beckerkamp, der zweite ist Berding. Bis zu Berding sind es 300 Meter, Beckerkamp ist weiter weg. Muss der erste Nachbar das Totengebet in der Friedhofskapelle sprechen oder ist dies die unausgesprochene Pflicht des zweiten? Muss ich sie dazu auffordern, sie einladen mit einem Umtrunk, um den Schmerz zu mindern oder kommen sie zu mir? Ich weiß es nicht. Warum bloß habe ich Angst, etwas falsch zu machen? Nach der Beerdigung werde ich sofort zurückfahren, mein Leben in der Firma wieder aufnehmen, als wäre ich nur ein paar Stunden, nicht ein paar Tage weggewesen. Doch was soll ich mit dem Hof anfangen, der mir zufallen wird. Wie sieht das alte Haus überhaupt aus? Bekomme ich noch Geld dafür oder muss ich zuzahlen, um es abreißen zu lassen?
Ich spüre das Vibrieren des Handys zuerst, dann schaltet das Autoradio um und zeigt einen Anruf – von Susanne. Klar, musste ja so kommen. Ich drücke das grüne Symbol und obwohl ich weiß, dass sie es ist, melde ich mich mit »Siemer«, meinem Nachnamen. »Karl, endlich erreiche ich dich. Ich habe gerade gehört, was los ist. Bist du schon zu Hause, ich meine bei deinem verstorbenen Vater? Mensch, Karl, das tut mir ja so Leid. Herzliches Beileid.« Ich will gerade dazwischen sprechen, ihr sagen, dass ich noch im Auto sitze und noch ein paar Stunden fahren muss und dass ich mir eine schwarze Krawatte gekauft habe. Doch Susanne lässt mich gar nicht zu Wort kommen, kaum, dass ich »Ähh…« gesagt habe. »Hör mal, ich will nicht lange stören. Wahrscheinlich hast du gestern Abend an deinen Vater gedacht, es soll ja sowas wie Gedankenübertragung geben. Wollte nur sagen, ist nicht so schlimm, ich bin dir nicht böse, wir holen das nach, wenn du wieder im Lande bist – versprochen. Bis bald.« Sie legt auf. Buh, das ging ja noch mal gut und reicht jetzt auch. Sonst ruft noch Chef an und erzählt von der Budgetrunde. Ich stelle das Handy auf ›bitte nicht stören‹.
Die Sache mit Susanne ist nicht so einfach erklärt. Dass ich mich mit Beate, der Sekretärin des Chefs, nicht so gut verstehe, habe ich ja bereits gesagt. Der Hintergrund ist, dass irgendwann in meiner Jugend etwas passiert sein muss, was mein Verhalten Frauen gegenüber nachhaltig gestört hat. Da ist der Typ ›Free Hugs‹ und Beate ist eine von ihnen. Ihnen gegenüber bin ich schnell reizbar und meide ihre Nähe. Jüngeren Frauen gegenüber verhielt ich mich anfangs indifferent. Wenn ich mal mit einer beruflich etwas zu tun hatte, so behandelte ich sie wie jeden anderen Kollegen auch. Nie gab es meinerseits ein Kompliment über die Haare, die Figur oder die Kleidung. Nur: Was für Probleme hast du und wie kann ich dir helfen? Meine Kommentare waren ehrlich, aber nie verletzend. Den Tratsch in der Firma über mein Verhalten können Sie sich vorstellen. Eins der Gerüchte besagte, ich könne nur mit Männern. Ein anderes erfand eine Wochenendbeziehung mit einer deutlich älteren Frau in Oberbayern, nur weil ich an Wochenenden häufig zu Volksläufen, Marathons oder Triathlons fuhr.
Ich lebe allein, habe keine Freunde. Mein Leben gilt dem Beruf und wenn ich am frühen Abend nach Hause komme, so warten meine Laufschuhe, mein Rennrad oder das Schwimmbad auf mich. Im Anschluss koche ich ein gesundes Essen mit Zutaten aus dem Biomarkt. Klar gibt es in meiner Wohnung einen Fernseher und einen Computer, es gibt auch Bücher, doch ein anderes Hobby fesselt mich seit Kindestagen – der Modellbau. Stundenlang konnte ich mich mit dem Bau und der Reparatur von Flugzeugmodellen beschäftigen. Manchmal dauerte der ferngesteuerte Flug nur wenigen Minuten und endete mit einem Absturz, doch dann hatte ich wieder tagelang etwas zu tun. Inzwischen bin ich auf Drohnen umgestiegen, die man mit dem Handy steuern kann. Ich finde die Dinger faszinierend. Die Kombination aus Flugzeugmodellbau und Computerbastelei ist ein ideales Spielzeug für Nerds, wie ich einer bin.
Inzwischen wertschätzen mich die jüngeren Frauen in der Firma und die männlichen Kollegen schneiden mich. Warum? Dazu muss ich ein wenig ausholen. Nach meinem Studium habe ich zwei Jahre bei einer kleinen Klitsche gearbeitet. Leider standen die Zeichen auf Konkurs. Daher bewarb ich mich im Sommer 1989 beim Konzern. Zu diesem Zeitpunkt war Deutschland noch geteilt. Als ich zum 1. Januar 1990 anfing, war die Grenze bereits offen. Und so durchlebte ich in den ersten Jahren alle Phasen des Zusammenwachsens und natürlich auch die Expansion nach Osten. Die Treuhand verscherbelte die staatseigenen Betriebe und die westliche Industrie bediente sich. Sie kaufte ganze Firmen für eine symbolische Mark, übernahm danach alle Liegenschaften und machte die Fabriken im Osten zu. In Folge strömten immer mehr junge Arbeitskräfte in den Westen und die Personalchefs sahen sich gezwungen, diese einzustellen, obwohl sie die ostdeutschen Zeugnisse nicht lesen konnten und Russisch als zweite Fremdsprache nur in wenigen Firmen von Nutzen war. Vanessa war 22, als sie als Trainee anfing. Sie hatte ein klasse Zeugnis, konnte ein paar Brocken Englisch mehr als ihre Mitbewerber und sie war ehrgeizig. Ein richtiger Streber und damit hatte sie das, was den satt gefressenen, verwöhnten Westgören fehlte. Kaum in der Firma durchlief sie im ersten Jahr vier Abteilungen der IT, jeweils für drei Monate. Dort avancierte sie schnell zur unentbehrlichen Hilfskraft, denn sie konnte improvisieren und organisieren, im Sinne von ›schnell mal ein Pfund Kaffee auftreiben‹, ohne das Firmengelände zu verlassen.
Ich lehrte sie das Scheitern und wie man damit fertig wird. Mein damaliger Chef wusste nichts mit ihr anzufangen und suchte einen Mitarbeiter, der sie von Oktober bis Dezember betreute. Das Los fiel wieder mal auf mich. Ich setzte Vanessa vor einen Computer und forderte sie auf, eine Schulung auszuarbeiten. Das Problem an der Sache war, dass es keine Unterlagen gab, nur das System und ein dürftiges Handbuch, erstellt vom Entwickler, voller Rechtschreibfehler. Sie war völlig überfordert, so allein in einem Einzelbüro von der Größe einer Besenkammer sitzend. Schon nach zwei Tagen kam sie frustriert zu mir und beklagte sich lautstark. Sie wollte irgendein anderes Schulungshandbuch, eine Art Vorlage zum Abschreiben. Daher schickte ich sie in der zweiten Woche als stille Zuhörerin in eine andere Schulung. Erst als sie nach drei Wochen damit drohte, alles hinzuschmeißen, setzten wir uns zusammen und erstellten die Schulungsziele und eine vernünftige Gliederung, die sie zu füllen hatte. Ihre nächste Aufgabe bestand darin, die Schulung selbst zu halten. Sie hatte nie unterrichtet und war in keinster Weise dafür qualifiziert. Ich wollte, dass sie ihre Grenzen kennenlernte. Gleich am ersten Tag schlotterten ihr so die Knie, dass ich ihr einen heimlich in die Firma geschmuggelten Cognac einfößte, um sie zu beruhigen. Ich selbst nahm nicht an der Schulung teil, sondern überließ sie ihrem Schicksal. Am späten Nachmittag berichtete sie heulend vom erlebten Fiasko. Da tat sie mir leid. Ja, ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen. Am Folgetag unterstützte ich sie, mahnte die Teilnehmer zur Rücksichtnahme und sorgte dafür, dass ihre Schulung ein Erfolg wurde. Seitdem habe ich ein Helfersyndrom und kann nicht Neinsagen, wenn junge Frauen eine Bitte äußern. Als wir uns am 23. Dezember verabschiedeten, schenkte ich ihr die angebrochene Flasche Cognac und sie mir einen Kaktus, genau den Kaktus, der jetzt in meiner Wohnung steht. Sie hatte mit einer Zange einige Stacheln herausgezupft, ihm so mein Gesicht verpasst – als ein Symbol: Ich bändigte den Kaktus.
Wir sahen uns zwei Jahre lang nicht. Eines Tages rief sie mich an und bat um ein Treffen. Sie wollte mich zu einem Kaffee nach der Arbeit einladen, ich schlug ein Mittagessen in der Kantine vor. Ihr Problem war, dass ihr Chef ihr Anliegen ablehnte, Führungskraft zu werden. Angeblich entspräche sie nicht dem Anforderungsprofil und hätte im Assessment keine Chance. Ich sah das anders, hatte ich ja nicht umsonst von ihr einen Kaktus bekommen. So wurde ich ihr Coach – meinen Kollegen sagte ich nichts. Wir trafen uns mehrmals die Woche zum Mittagessen oder in einem leeren Besprechungsraum und ich erklärte ihr typische Verhaltensmuster der Wessis. Vanessa bestand das Assessment mit Auszeichnung und wechselte im Anschluss zur Konzerntochter nach Polen. Vanessas Erfolg sprach sich herum. Sie verwies gerne auf mich und so kamen in den Folgejahren häufig junge Mitarbeiterinnen zu mir, um sich Tipps abzuholen. Meine männlichen Kollegen wurden neidisch, wenn wieder mal eine gutaussehende junge Frau in meinem Büro saß und wir uns völlig zwanglos unterhielten. Und für weibliche Kolleginnen wurde ich dadurch attraktiver. Alle wussten, dass ich Single bin und nie hatte mich jemand mit einer Frau gesehen. Dank des Sports war ich drahtig dünn, wenn auch das kantige Gesicht Attraktivität vermissen ließ. Schließlich wurde ich zur Herausforderung, manche machten sich einen