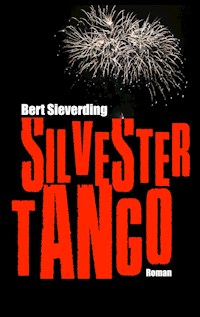Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hannes Macke ist Softwareentwickler in einem deutschen Großunternehmen. In seiner introvertierten und ehrgeizigen Art übererfüllt er gerne die Anforderungen seiner Kunden, sehr zum Leidwesen des Managements, welches das von Hannes entwickelte System gerne durch Standardsoftware ersetzen möchte. Doch Hannes legt nach: Sein Internet-Ausschreibungsmodul verspricht hohe Einsparungspotentiale und gefährdet gleichzeitig Tausende von Arbeitsplätzen. Hannes erhält eine letzte Chance sein System zu retten: Er soll mit der neuen Software die Effizienz der brasilianischen Niederlassung verbessern. Dort trifft er auf verkrustete Strukturen, eingefahrene Abläufe und auf Regina, die ihm bereits bei seinem letzten Besuch vor 17 Jahren den Kopf verdrehte. Nach einer ereignisreichen Nacht kommt es zu einem Vorfall. Bereits nach 29 Stunden wird er zur Zentrale zurück beordert ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ahnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen waren zufallig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
1
»Herzlich willkommen an Bord, Herr Hannes Macke. Sie haben Sitzplatz 5D, gleich hier vorne rechts.« Der Purser liest in Windeseile meine Bordkarte, erkennt meine Nationalitat, errat meine Muttersprache und begrüßt mich jetzt sehr freundlich und persönlich mit Namen. Wahrscheinlich spricht der Lockenkopf vier bis fünf Sprachen. Ein wenig Neid steigt auf. Nicht nur wegen seiner Sprachkenntnisse, sondern auch wegen seiner dunkelbraunen Haare. Die hatte ich auch gerne. Stattdessen laufe ich schon seit 10 Jahren mit einem 6-Millimeter-Stoppelhaarschnitt herum. Aus Veranlagung? Oder ist der Job schuld? Dieses ewige Hinterherrennen, in der Gewissheit, nie zur vollen Zufriedenheit des eigenen Anspruchs zu funktionieren. Wie alt ich inzwischen geworden bin, zeigt ein Blick in meinen Führerschein. Es handelt sich um den grauen ›Waschlappen‹, mit der Schreibmaschine ausgefüllt und mit Tinte unterschrieben, das Foto eingestanzt. Es zeigt mich als 18-Jahrigen. Ich trage mein dünnes blondes Haar lang bis zu den Schultern, schaue irgendwo in eine entfernte Ecke des Fotostudios, den Mund halb offen ‒ in der Hoffnung, man könne dies als Lacheln interpretieren. Dazu eine Pilotenbrille und ein Oberhemd mit furchtbar langem Kragen, weiß-rot kariert, wie das damals Mode war. Lege ich dieses Dokument bei einer Autovermietung vor, verzieht sich der sonst meist grimmige Mund der Mitarbeiter zu einem Lacheln. Weibliche Mitarbeiter schmunzeln deutlicher, mitunter gackern sie sogar leicht. Viele denken dann wohl: ›Der sah aber süß aus!‹ Dann schauen sie mich an und fragen sich, wie ein Gesicht im Laufe der Jahre so verbittern kann. Jeder Versuch scheitert, mein jetziges Außeres mit dem Bubigesicht auf dem Foto zu vergleichen. Meist lege ich daher gleich meinen Personalausweis bei, um glaubhafter zu erscheinen.
Mit einer Boeing 777 bin ich noch nie geflogen. Der Flugzeugbauer Boeing bezeichnete sein Großraumflugzeug mal als Nachfolger der dreistrahligen MD-11. Bei meinem letzten Flug nach Brasilien saß ich in einer MD-11 von der Swissair. Die 777, in der ich jetzt einchecke, gehört der KLM. Wir müssen alle KLM fliegen, weil das interne Reisebüro des VASSAG Konzerns besondere Konditionen ausgehandelt hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir mit Lufthansa von Frankfurt aus fliegen durften. Daher steige ich jetzt in Amsterdam in diese KLM. Der Firmensitz der VASSAG ist nicht weit vom Flughafen Hannover entfernt, von wo ich nach Amsterdam startete.
In der Businessclass befinden sich pro Reihe zwei Sitze links und rechts und in der Mitte drei Sitze nebeneinander. Mir ist die letzte Sitzreihe zugedacht worden, ein Platz am Gang ‒ am linken Gang, genau genommen. Die Ablagefacher reichen tief nach unten. Es sind nicht einfach nur Klappen vor Fachern, in die man sein Handgepack hineinwuchtet. Manner haben dabei meist weniger Probleme als Frauen. Zumindest habe ich weniger Probleme, kein Wunder mit fast 1,90. Doch hier in der Businessclass klappt das ganze Fach nach unten. Da hat sich ein Ingenieur bei Boeing mal was richtig Geschicktes überlegt und sich ein Hebelscharnier ausgedacht, das auch für nicht so großgebaute Fluggaste ganz leicht beladbar ist. Denn das Fach lasst sich fast spielerisch mit einer Hand hochklappen und springt ganz oben in die Verriegelung. Vorteilhaft ist auf jeden Fall, dass beim Öffnen wahrend des Flugs nicht das halbe Gepack der Sitznachbarn auf den Boden fallt und man mühsam alles wieder hineinstopfen muss.
Ich greife in die Innentasche meines Jacketts. Auf Dienstreisen trage ich immer meinen grauen Ingenieursnerz, dazu ein graues Hemd, keine Krawatte. Ich liebe graue Hemden ‒ warum? Ich weiß es nicht. Blau würde mir besser stehen, weil es besser mit meiner Augenfarbe harmonieren würde, doch ich muss mich ja nicht selbst ansehen. Mein Reisepass ist noch da. Ich nehme ihn raus und lege mein Flugticket hinein. Mein Firmenausweis ‒ der steckt in der kleinen Tasche des Jacketts vorne links. Hat die eigentlich einen Namen? Bestimmt, doch ich kenne ihn nicht. Die Tasche am Herzen, sage ich mal. Mein Firmenausweis ist wichtig, da ist der PKI-Chip drauf. Ohne den klappt kaum noch was am Computer.
Ich öffne meinen Handgepackkoffer und lege meinen Personalausweis und Firmenausweis in das kleine Fach mit Reißverschluss. Viel ist nicht im Handgepack. Mein kleiner Koffer, kaum größer als eine Aktentasche, enthalt Schreibblock und Stift, ausgedruckte Unterlagen der Firma, meinen Wollpullover, ein T-Shirt Größe XL, schwarz, eine Unterhose Größe 7, meinen Firmenlaptop, viel zu schwer und unhandlich, aber das Einheitsmodell der VASSAG. Mit einem eingebauten Kartenlesegerat für den Firmenausweis ‒ der ist bei einem Firmenlaptop wichtiger als Größe, Schönheit oder Gewicht. Ein Apple Mac-Book Air, wie ich es zu Hause nutze, hatte in der Firma keine Chance. Seit ein paar Flügen nehme ich immer Unterwasche mit ins Handgepack, was ich früher nie gemacht habe. Aber seitdem ich vor einigen Monaten eine halbe Nacht auf dem Flughafen in Detroit verbringen musste und nach 30 Stunden völlig verschwitzt in Amsterdam ankam, packe ich Wechselwasche ein. Mir hatte man damals auf dem Flughafen in Amsterdam zwar eine Dusche angeboten, nicht aber frische Wasche als Entschadigung für die 12-stündige Verspatung, ja, man überhaufte mich sogar mit Vorwürfen: ›Sie müssen mit sowas rechnen und Unterwasche ins Handgepack packen!‹ Seitdem wende ich diese Strategie tatsachlich an. Klar ist ein wenig Aberglauben dabei, dass ich die Wasche gar nicht brauchen werde, weil der Flieger ja sowieso pünktlich ankommt.
Ich nehme den Wollpullover und ein Taschenbuch aus dem Koffer ‒ ›Die Frühlingsfrau‹, ausgeliehen aus der Stadtbibliothek und gerade richtig für 2 Stunden, bis ich versuchen werde, ein wenig Schlaf zu finden. Auf meinem Sitz liegt eine eingeschweißte blaue Decke und ein kleines Taschchen für Langstreckenflüge. Mal sehen, was die KLM dort so reinsteckt: Ohrstöpsel, Socken, Kamm, Zahnbürste, Zahncreme und einen Fettstift für die Lippen. Ich nehme die Ohrstöpsel, den Fettstift und die Socken, den Rest brauche ich nicht. Hinsetzen, Schuhe aus, Socken an, Pullover an, denn meist wird es frisch auf Langstreckenflügen. Die Speisekarte: Fisch oder Geflügel. Nun, ich hatte vegetarisch geordert, mal sehen, ob der Fluggesellschaft mein Wunsch übermittelt wurde. Es musste ja alles so schnell gehen ‒ auf einmal.
Die Stewardess kommt. Schnieke sieht sie aus in ihrem blauen Dress und lachelt und lachelt und lachelt. Kann sie ihr Lacheln anschalten? Wer weiß? Sie fragt, ob ich Sekt oder O-Saft möchte ‒ nein danke, weder noch. Einer meiner Transatlantikflüge war zugleich der letzte Flug der Swissair. Beim Start in Zürich war die Welt noch in Ordnung und die Stewardess lachelte mich lieb an. Wir scherzten wahrend des Flugs und ich fühlte mich richtiggehend sonderbehandelt. Nach der Landung hatte sie Tranen in den Augen und schluchzte ohne Unterlass. Grund war, dass die Swissair, just in den paar Stunden, die wir unterwegs gewesen waren, Konkurs angemeldet hatte und meine Stewardess urplötzlich buchstablich auf der Straße stand. Beim Aussteigen wusste sie nicht, wie sie wieder nach Hause kommen sollte.
Ich habe die fünfte Reihe nicht für mich allein. Die Businessclass ist voll. Ich bin der letzte Fluggast. Ich hasse es, in der Schlange beim Check-in den Privilegierten raushangen zu lassen und stelle mich lieber zusammen mit den Normalos an. Rechts neben mir sitzt ein Mann, so um die 50. Er tragt eine beige Cargohose und ein kariertes Hemd, eher ungewöhnlich in dieser Beförderungsklasse. Offensichtlich reist er gerne bequem. Aber seine Brille, so ein sündhaft teures Titanding, und sein perfekter Kurzhaarschnitt verraten seine Stellung. Neben ihm sitzt eine junge Frau, so circa 35, vollschlank ‒ oder wie nennt man diese Form, bei der die Beine ein wenig zu kurz sind, der Hintern ein wenig zu dick ist und der dazu passende Oberkörper mit einer weiten Bluse kaschiert wird? Egal, jedenfalls kommen beide aus Süddeutschland. Bayern, Franken? Eher Franken. Sie redet die ganze Zeit auf ihren Chef ein. Er ist wohl eher nach seinem Studium nach Franken gezogen, gebürtig kann er nicht von dort sein ‒ er redet zu wenig. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass die beiden wie selbstverstandlich miteinander ins Bett gehen. Da ist mehr als das typische Buckeln dem Chef gegenüber. Welche Branche? Noch weiß ich es nicht, doch ich werde es schon rauskriegen. Sie jedenfalls redet immer von ihren Projekten, so, als sei deren Leitung das Wichtigste und nicht deren fachlicher Inhalt. Typisch für diese Sorte Mitarbeiter: BWL-Abschluss, Trainee, Assistenz, Besetzungscouch und dann Abteilungsleitung? Jetzt holt sie ihr iPhone raus und zeigt ihm ein Eisbergmodell. Über dem Wasser ist das, was man im Projekt schon erreicht hat, unter dem Wasser liegt das, was ein Risiko darstellt. Schöner Vergleich.
Mir ist reines Projektmanagement zu wenig ‒ ohne wirklich Ahnung von den Dingen zu haben, nur Mitarbeiter und Externe hin- und herschieben. Gehetzt vom Kunden, unwissend im Detail, verarscht von externen Vertriebsmitarbeitern, die immer nur nachkobern müssen. Und dann das ewige Gemaule der eigenen Leute, die den Termindruck nicht ertragen können und sich auf Urlaubsansprüche und Krankheitsquoten zurückziehen. Noch schlimmer sind aber die Übereifrigen, die einfach mehr machen und dann den Projektleiter in Verlegenheit bringen, wenn dieser zum Auftraggeber sagen muss, dass man dieses und jedes nicht fertigbekommen hat, dass aber eine jetzt umgesetzte Funktion viel mehr Features enthalt als gefordert. Kommt nicht gut an. Lasst man die Features vom Entwickler zurückbauen, ist dieser meist sauer, macht einen auf ›Dienst nach Vorschrift‹ und liebaugelt mit einem Nachbarprojekt, welches ihm angeblich mehr Freiheit zur Selbstverwirklichung lasst.
Es geht los. Anschnallen. Ich vertiefe mich in ›Die Frühlingsfrau‹. Wo war ich vor dem Check-in stehen geblieben? Seit ein paar Jahren arbeite ich auf geschaftlichen Flügen nicht mehr. Früher habe ich mal ein Projekt gerettet, weil mir auf dem Flug nach Barcelona die zündende Idee kam und ich sie kurzerhand in ein paar Powerpoints verewigte, um sie 3 Stunden spater wie selbstverstandlich als lang ausgearbeitete Lösung zu prasentieren. Überhaupt war es damals eine interessante Zeit in Barcelona, wenn auch nicht für meine Frau. Mehrere Wochen verbrachte ich dort, konnte weder Catalan noch Spanisch und ernahrte mich zum Schluss nur noch von Bocadillos ›jamón y queso‹, nachdem ich in einem Restaurant, per Zufallsprinzip gewahlt, Fischcarpaccio in Öl schwimmend, ohne Brot hatte herunterschlingen dürfen. Abends lief ich ziellos durch die Straßen. Als ich dabei einer alteren Frau zum dritten Mal begegnete, fragte sie mich, ob ich Hilfe brauchte. Sie hielt mich für einen Schweden und hatte mich gerne an ihrer Seite gesehen ‒ keine Ahnung, ob nur des Geldes oder der blonden Haare wegen.
Wir befinden uns in der Luft. Der Purser spricht mich auf das vegetarische Essen an. Na also, hat doch geklappt. Der Mann auf der anderen Gangseite, Sitz 5C links neben mir nimmt Tomatensaft ‒ ein Getrank, das wohl nur auf Flügen getrunken wird. Oder wo sonst bestellt jemand Tomatensaft? Der Cargohosenmann rechts neben mir, auf 5E, nimmt Whisky, sie Rotwein. Egal, vor morgen Abend kommen sie eh nicht zusammen ins Bett. Für mich nur Wasser ohne. Jetzt packt der Tomatensaftmann seinen Laptop aus. Wie will er denn jetzt essen? Essen und Arbeiten geht auch in der Businessclass nicht gleichzeitig. Er öffnet eine Prasentation und dazu Excel. Das Firmenlogo kenne ich nicht. Muss sich um eine brasilianische Firma handeln. Nun, er hat etwas von einem Portugiesen ‒ könnte hinkommen.
›Die Frühlingsfrau‹ heißt Susanne, ist 52 und arbeitet in einer Hamburger Werbeagentur. Einen Mann gibt es in ihrem Leben wohl nicht oder nicht mehr und so trottet sie als Gefangene ihrer Gefühle dahin. Ihr Pitch für eine neue Kampagne ist gut, den Chefs aber zu altbacken. Ihre junge Kollegin bekommt den Zuschlag für ein beklopptes, offensichtlich zeitgemaß hippes Werbevideo, für meinen Geschmack völlig an der Zielkundschaft vorbeigeschossen. Susanne fliegt raus, von heute auf morgen. Ich halte inne. Könnte mir das auch passieren? Nicht mehr den Zeitgeschmack treffen, nur noch Lösungen erarbeiten, die zwar auch funktionieren, nicht aber hip sind? Schon der Klappentext reichte aus, um mich im Regal der aktuellen Empfehlungen der Stadtbibliothek nach diesem Buch greifen zu lassen. Ist doch die Protagonistin etwa in meinem Alter. Ob die Autorin auch so alt ist? Leider sagt der Buchdeckel nichts über sie. Zunehmend stelle ich auch bei mir im Beruf Altersveranderungen fest. War ich früher sofort für jede noch so waghalsige Harakiri-Aktion zu haben, so handele ich jetzt überlegter, auch wenn ich manchmal immer noch die Welt an einem einzigen Wochenende verandern möchte. Und die Gefahr droht von den Jungen. Wild sind die Jungen heutzutage ja nicht mehr. Ihr BWL-Studium lasst sie allesamt nüchtern handeln. Da wird bereits in jungen Jahren ein viel zu großes Auto gekauft, dessen Farbe in Anbetracht des zu erzielenden Wiederverkaufswerts ausgewahlt wurde. Sie wissen, was der Kunde hören möchte, haben von den eingefahrenen Prozessen eines Unternehmens keine Ahnung, meinen jedoch, alle Anwender würden eine kleine, neue und gut gestaltete IT-Funktion sofort akzeptieren. Ganz schlimm wird es, wenn so ein Junger dann Chef wird und meint, das Unternehmen mit ein paar Handy-Apps modernisieren zu können. Anfangs vertraut man seiner Erfahrung und versucht, mit langen Diskussionen Schaden abzuwenden. Doch bald kapiert man, dass es wirklich eine funktionierende Option ist, wenn man beschleunigt und eine neue Systemlösung ganz schnell mit hohem Tempo gegen die Wand setzt ‒ eine Option, die tatsachlich in vielen Fallen wirtschaftlicher ist, als sich jahrelang mit etwas abzufinden und ein neues System an einen Prozess anpassen zu lassen.
Das Essen ist wie immer maßig. Zwar bekommt man in dieser Klasse immer im Glas und auf Porzellan serviert, was die Zutaten für die Speisen jedoch nicht verbessert. Typische Großküche. Und vegetarisch heißt wohl für die meisten Köche immer nur Kase. Jedenfalls sind meine Penne mit derart viel Kase überbacken, dass es ›Kase mit Penne‹ hatte heißen müssen und nicht umgekehrt.
Ich lege ›Die Frühlingsfrau‹ zur Seite, stelle den Sitz auf Liegen um und kuschle mich in die blaue Fleecedecke, soweit das bei meiner Körpergröße überhaupt möglich ist. Zwar sind meine Augen jetzt zu, aber die Ohren weit offen. Die beiden Franken zur Rechten diskutieren gerade über ihr Projekt. Der Geschaftsführer der Dependance Brasilien erfüllt sein Target nicht. Aus meiner Sicht kein Wunder, bei der Krise, die dort gerade herrscht. Die Franken sind anderer Meinung. 20 Prozent plus waren vorgegeben. Zurzeit liegt er bei minus zehn, was mir hoch erscheint, verglichen mit unseren miserablen Absatzzahlen. So wie es sich anhört, soll er gehen. Ist ja auch nur einer aus dem Land und offensichtlich hat sie, also die Dame auf Platz 5F rechts neben mir, gute Aussichten auf den Job. Ach ja, im Frankenland wird dann eine Stelle frei. Vorstandsassistenz? Habe ich richtig gehört? Der Typ zur Rechten, der aussieht, als flöge er zum Camping, ist also im Vorstand. Na, ansehen kann man ihm das nicht. Ich bin zu müde, um herauszufinden, ob er bereits eine Neue in Aussicht hat, nehme die Ohrstöpsel aus der kleinen KLM-Langstreckenflugtasche und tauche ab ins Reich der Traume. Die Uhr des KLM-Entertainmentsystems zeigt Mitternacht.
2
Der Flieger ist gelandet. Ich habe das Einreiseformular wahrend des Frühstücks ausgefüllt. Wieso Frühstück? Ich bin bezüglich der Zeit ziemlich durcheinander. Zwar habe ich geschlafen, aber in meinem Kopf ist es nicht 5 Uhr früh, wie die Monitore es anzeigen. Es müsste doch langst Vormittag sein, doch draußen ist es noch dunkel.
Wie an jedem Flughafen folgen drei Stationen, die nur Zeit kosten. Zuerst die Passkontrolle, sozusagen die Einreise, dann das Gepack und zum Schluss der Zoll. Nach den geanderten Bestimmungen im Zuge von 9/11 stecken meine Zahnbürste und der Rasierschaum in meinem Koffer ‒ und der befindet sich noch im Bauch der 777. Die Gange durch das neue Terminal in São Paulo sind endlos. Als ich das letzte Mal hier war, es muss vor mehr als 15 Jahren gewesen sein, da ging alles ganz schnell. Aussteigen, um drei Ecken gehen und ab in die Gepackhalle. Jetzt gibt es infolge der Fußball-WM ein neues schönes Terminal, internationaler Standard aus Alu und Glas. Warum können die Brasilianer das in der vorgegebenen Zeit hinbekommen und wir Deutschen brauchen dazu, wie in Berlin, weit über 10 Jahre? Gibt es in São Paulo keinen Brandschutz? Egal, die Gange sind jedenfalls lang, sehr lang. Mich nervt es, wenn die ersten Passagiere ihre Handys bereits anschalten, nachdem die Vorderrader des Fliegers die Rollbahn berührt haben. Und immer hört man zuerst diesen SMS-Ton, der doch bei allen Handys irgendwie gleich klingt: drei kurze Töne für das erste ›S‹, zwei lange Töne für das ›M‹ und wieder drei kurze Töne für das zweite ›S‹. Das Handy morst ›SMS‹.
Auf den Plakattafeln werben Telefongesellschaften. Vodafone scheint es überall zu geben. Oi ist in Brasilien billiger, nur leider muss man eine Meldebescheinigung vorweisen, um eine SIM-Karte kaufen zu können. Ich glaube, ich bin der Einzige aus der Businessclass, der sein Handy nicht in der Hand halt. Möchte mal zu gerne wissen, ob die jetzt mit Ehefrau, Sekretarin, Freundin, Chef oder Kollegen telefonieren. ›Bin gerade angekommen‹, ›recht warm hier, obwohl doch Winter in Brasilien herrscht‹ ‒ teures Geschwafel.
Ich erinnere mich an eine Geschichte aus der Zeit vor dem Handy. Ein Techniker einer Firma, die Kopierer herstellte, reiste den ganzen Tag von Kunde zu Kunde, um am damals noch sündhaft teuren Gerat den Toner oder Heizstab zu wechseln. Sein erster Gang bei jedem Kunden führte ihn ins Sekretariat. Dort bat er, ein kurzes Gesprach führen zu können und rief in seiner Firma an. Sein Spruch lautete jedes Mal in etwa ›Ich bin jetzt bei XYZ, ihr könnt mich unter der Telefonnummer 123 erreichen‹. So wusste seine Firma immer Bescheid. Es kam jedoch nie vor, dass ihn jemand tatsachlich sprechen wollte.
Alle rennen jetzt die Gange entlang, als erhielte der Erste ein Preisgeld. Ich betrete die Halle mit der Passkontrolle und jetzt wird mir klar, warum alle so rennen. Wer hat bloß diese Absperrgurte erfunden? Jeder kennt diese Pfosten: Ein Gurt kann ausgerollt werden und an drei Seiten eines anderen Pfostens eingehakt werden. Schnell baut man damit ein Labyrinth auf ‒ jener Zickzack, durch den die Horde der Einreisewilligen getrieben wird oder sich selbst treibt. Stehen bleiben, einen Schritt gehen, ein wenig drangeln, stehen bleiben. Vor mir liegen circa 150 Meter aus Menschen. Nebeneinander, hintereinander. Ich war zwar schnell raus aus der Maschine, trotzdem sind bereits Hunderte an mir vorbeigerannt. Zwar habe ich lange Beine, gehe aber nicht gerne schnell. Und außerdem müssen hier ja alle durch, auch die Passagiere der anderen Flieger. Wer weiß, von wo die alle herkommen.
Ganz vorne bekommt man von einem Dispatcher eine Kabine zur Passkontrolle zugewiesen. Ich bin noch lange nicht dran. Zwei Kehren muss ich noch. Links kommt mir eine Reihe entgegen, rechts ebenfalls. So sieht man Leute mehrmals ‒ nach jeder Kehre erneut. Da vorne steht ja mein Sitznachbar, der Vorstand in der Cargohose, und daneben sie. Jetzt wieder nur mit Bluse. Ihre Jacke, die sie heute Nacht wahrend des Flugs trug, hat sie ausgezogen. Sie redet immer noch, nur nicht mehr so schnell und auch nicht mehr über Projekte. Man hat sich wohl ausgesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird erst einmal ins Hotel müssen. So kann er unmöglich in die Firma fahren. Ihr wird es recht sein. Ach, bin ich wieder gehassig. Warum denke ich denn sowas? Bin ich etwa frauenfeindlich? Denke ich so nur, weil mir meine Arbeitskollegin das damals angetan hat, was sie mir angetan hat? Würde ich auch so denken, wenn da so ein gestriegelter Speichellecker neben dem Vorstand in Cargohosen stehen würde? Wahrscheinlich nicht ‒ ich würde dann wohl neidisch auf seinen Armani sein, dabei könnte ich mir auch so ein Ding leisten, wenn ich nur wollte. Ich will aber nicht. Und was ware, wenn der Vorstand eine Frau ware? Wahrscheinlich ist die Frau von 5F eine klasse Mitarbeiterin und hat neben Können auch noch die Eigenschaften, die Manner haufig vermissen lassen: Ehrlichkeit, Treue, Sparsamkeit, Verlasslichkeit und Selbstlosigkeit.
Die Kontrolle ist lasch, zumindest verglichen mit den Prozeduren bei einer Einreise in die USA. Ein prüfender Blick, ein Stempel in den Reisepass ‒ fertig. Der Koffer wartet schon. Er fahrt mit vielen anderen Gepackstücken seit gefühlt einer Stunde immer im Kreis herum. Ich schnappe mir das kleine Ding aus Lkw-Plane, an seinen roten Streifen leicht zu erkennen. Ein paar Abriebstreifen sind dran, doch die gehen auch wieder ab. Erst mal auf die Toilette ‒ rasieren und Zahne putzen.
Ich fühle mich besser, als ich in Richtung Zoll gehe. Bei meinem letzten Besuch hier gab es eine Zufallsampel. Grün bedeutete: ohne Kontrolle durchgehen, rot: sich filzen lassen müssen. Diesmal werden die Reisenden getrennt. Einheimische links, Auslander rechts. Am Zoll steht ein Beamter, schaut den Leuten in die Augen und verteilt sie. Ich habe Pech, mein Gepack muss ein weiteres Mal durch die Durchleuchtung. In Mexiko gab es jahrelang auch so ein Zufallssystem. Hatte man Pech, das heißt eine rote Ampel, dann musste man vor den Augen aller den gesamten Kofferinhalt ausleeren. Einmal hatte ein Mitarbeiter eines Automobilherstellers einen Koffer Schrauben dabei. Offensichtlich konnte der lokale Anbieter nicht liefern und so gab die Zentrale einfach einem Dienstreisenden einen Koffer mit. Keine Ahnung, ob man Tausende Schrauben verzollen muss oder nicht. Für den Mitarbeiter war das Gefilztwerden, so glaube ich, peinlicher als das Vorzeigen von Pornomagazinen. Da stand er dann ohne Worte da mit den Schrauben. Angeblich soll es bei weiblichen Reisenden ja manchmal vorkommen, dass ein Dildo im Gepack auftaucht. Ich halte das für Mannerfantasien und einem Film entsprungen, dessen Regie ebenfalls nur ein Mann geführt haben kann.
In der Empfangshalle erwartet mich niemand. Ich bin zu unwichtig und die Firma kann sich keine Fahrer mehr leisten. Das hatte ich mir schon gedacht. Also zum Taxistand. Glücklicherweise sind die Ausschilderungen auf allen internationalen Flughafen gleich ‒ gleich einfach zu lesen.
Draußen schlagt mir ein lauer Wind entgegen. Es ist 6 Uhr morgens, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Dennoch sind es geschatzt 18 Grad. Und das im Juli, wo doch hier Winter ist. Es regnet nicht. Irgendwas hat sich auch hier verandert. Was sind das für Autos, die hier als Taxi eingesetzt werden? Nur so weiße Kisten unbekannter Herkunft. Japaner, Koreaner oder Chinesen? Bei meinem letzten Besuch sah man fast nur Ford und VW.
Eine lange Schlange von Taxis wartet. Und eine lange Schlange von Reisenden auch. Von der anderen Straßenseite aus winkt mir ein Fahrer zu. Ich kenne die Gerüchte, man solle niemals bei so einem einsteigen. Immer schön die offizielle Schlange nehmen. Ich gehe trotzdem hin. Der Fahrer nimmt meinen Koffer, packt ihn in den Kofferraum des Nissan, das Polster der Rücksitzbank ist durchgesessen ‒ egal. Mein Hintern berührt bereits das Blech. Unangenehm kriecht die Blechkalte durch die Hose nach oben. Ich setze mich in die Mitte, jedoch nicht lange, denn der Fahrer gibt mir zu verstehen, dass ich mich gefalligst entweder nach links oder nach rechts setzen soll. Okay, dann muss ich wohl mit der Kalte leben. Jedenfalls war diese Karre nicht als Taxi gedacht, als sie hergestellt wurde. Jedoch scheint hier unter den Taxifahrern ein derartiger Konkurrenzkampf zu herrschen, dass man alles, was vier Rader hat, als Taxi verwendet. Auch neu ist, dass sich Weiß als Autofarbe durchgesetzt zu haben scheint. Wo ist das bunte Brasilien geblieben?
»VASSAG, São Bernardo, Anchieta, última salida!« Ich kann kein Portugiesisch, nur sehr wenig Spanisch, hoffe aber, dass der Taxifahrer versteht, was ich meine. Der Taxifahrer nickt. Also, wer sagts denn?
Ich schalte mein Handy ein. Mal sehen, wie viele Kollegen ihr Sprüchlein auf die Mailbox gesprochen haben. Kein Netz. War wohl doch die falsche Entscheidung, meinen alten Sony-Ericsson-Knochen einzustecken. Offensichtlich gibt es in Brasilien eine andere Mobilfunkfrequenz ‒ eine, die das alte Ding nicht kann. Warum bin ich auch so ein Sturkopf und verwende geschaftlich immer noch dieses alte Ding lieber als ein Blackberry wie alle meine Kollegen? Nur weil mein Chef mich mal gezwungen hatte, ein Handy selbst zu kaufen ‒ damals in der letzten großen Krise des Unternehmens? Kann man so nachtragend sein? Oder ist es die Weigerung, etwas anderes als das Original ‒ also ein iPhone ‒ als Smartphone anzuerkennen? So nach dem Motto: ›Jedes iPhone ist ein Smartphone, aber nicht jedes Smartphone ist ein iPhone.‹ Egal, das Ding geht nicht. Im Koffer ist mein iPhone. Ich muss wohl die SIM-Karte tauschen ‒ spater. Solange habe ich jetzt meine Ruhe. Werde meine Mails checken, sobald ich im Firmenintranet bin. Ach ja, das Geld. Ich habe noch kein Geld gewechselt und nur 200 Euro in bar dabei. Musste ja alles so schnell gehen. Hoffentlich akzeptiert der Taxifahrer die Euros. Und wenn nicht? Na ja, wenn ich erst einmal angekommen bin, dann kann er mich ja nicht mehr rausschmeißen.
Die Sonne geht auf. Die sechsspurige Schnellstraße vom Flughafen GRU nach São Paulo ist noch nicht völlig verstopft. Was doch eine Stunde ausmacht. Links reiht sich Rodizio-Restaurant an Rodizio-Restaurant. Die Fahrbahn liegt leicht erhöht. Abends könnte man den Leuten auf den Teller gucken. Kann man sich dort vor Autolarm überhaupt noch unterhalten? Und schmeckt das Fleisch vor lauter Abgasen? Den Park zur Linken kenne ich nicht. In der Sitztasche vor mir klemmt ein Stadtplan. Der ist zwar nicht mehr der Jüngste, und hier bauen sie alle 3 Jahre alles um, aber der Park ist drauf. Dann müsste das dort das ›Museu de Arte Contemporânea‹, kurz MAC, sein ‒ einer der wenigen Bauten im Park. Ob dort überhaupt noch Kunst hangt oder steht oder ob man vor lauter Krise dafür gar kein Geld mehr hat? Schade, dass ich auch dieses Mal keine Zeit haben werde, es zu besuchen. Sowieso habe ich mit diesem Moloch von Stadt so meine Probleme. Gibt es eigentlich sowas wie ein historisches Zentrum? Eine Altstadt oder überhaupt ein Zentrum? Oder sind hier alte und neue Viertel und Straßenzüge so verwoben, dass man nur noch Stadt hat und es überall gleich gut oder gleich schlecht aussieht? Die Straßen scheinen jedenfalls überall gleich schlecht zu sein und das Fahrwerk eines jeden Autos immer auf den Prüfstand zu stellen. Fahrt man hier zur Werkstatt und sagt: ›Einmal Ölwechsel und neue Stoßdampfer bitte?‹ So ein richtiges Autobahnnetz scheint es auch noch nicht zu geben. Wir befinden uns gerade eindeutig in einem Wohngebiet. Warum fahrt mein Taxifahrer hier entlang? Normalerweise geht es vom Flughafen auf einen Verhau von Autobahnen und Schnellstraßen und kurz bevor man da ist, biegt man ab. Hier ist es ganz schön hügelig. Klar, dass die Straßen voller Schlaglöcher sind, jetzt, wo der Staat mal wieder fast pleite ist. Die Ampel springt auf Rot. Ich schaue aus dem Fenster. Das ist ja lustig! Da parkt ein Fiat Uno mitten im Lokal. Rechts ein Tresen, dahinter im Regal Getranke, wahrscheinlich Pitú. Dort, wo normalerweise die Gaste sitzen, steht der Fiat. Das Rolltor wird gerade nach oben geschoben. Wahrscheinlich fahrt der Besitzer seinen Wagen erst raus, parkt ihn an der Straße und raumt dann die Stühle und Tische rein.
Die Fahrt geht weiter. Ja, ja, die Kriminalitat. Darüber habe ich schon viel gehört. Zur Straße hin sehen die Wohnhauser deshalb auch aus wie Festungen. Hohe Gitterzaune oder Mauern mit Stacheldraht oben drauf. Im Innenhof oder Garten soll es dann sehr schön sein. Keine Ahnung, ich war noch nie in sowas, immer nur in Hotels und die sehen alle irgendwie gleich aus. Da steht ein alter VW Gol, in der Parkbucht zwischen Straße und Haus. Damit das Gittertor zugeht, hat man den unteren Teil des Tors ausgebuchtet, passend für den Kofferraum des Autos. Ein größeres Auto darf der Hausbesitzer sich nicht kaufen, denn das jetzige passt auf den Zentimeter genau. Der Gol ist noch aus der zweiten Generation, ganz schön kantig. Sieht aus wie ein kleiner Golf 1. Die Ausfallstraße ›Anchieta‹ erkenne ich auch nicht wieder. Da sind ja jetzt zwei Autobahnen. Eine vierspurige innen, dann links und rechts nochmals drei Spuren. Am Anfang und am Ende kann man zwischen den Autobahnen wechseln. Innen kommt man schneller voran, weil keine Auf- und Abfahrten stören. Aber wenn dort Stau ist, dann ist man gefangen. Sowas gabe es bei uns in Deutschland nicht ‒ undenkbar. Allein die Schneise, die diese Straße durch die Stadt reißt, ist doch locker 200 Meter breit. Wie viele Hauser mussten dafür verstaatlicht und abgerissen werden?
Rechts fliegt Mercedes vorbei. Das heißt, das Taxi fahrt am Mercedes-Benz-Werk an der ›Anchieta‹ vorbei. Bald kommt die letzte Ausfahrt, dann bin ich da. Abbiegespur, eine Kehre. Das Taxi halt, das Taxameter, welches nach Kilometern abrechnet, zeigt 140 Brasilianische Real an. Der Taxifahrer nennt mir den Preis von 200 BRL. Ich gucke ihn verdutzt an. Er zeigt auf eine Infotafel und erklart in gebrochenem Englisch, dass Fahrten über die Stadtgrenze São Paulos hinweg 50 Prozent Zuschlag kosten. Ich gebe ihm 100 Euro. Der Wechselkurs ist eins zu vier. Meine Erwartung, jetzt 200 BRL zurückzubekommen, wird enttauscht. Der Taxifahrer erklart mir, er könne nicht wechseln und müsse erst einmal den offiziellen Wechselkurs erfragen. Meine Kinnlade gleitet nach unten. Er muss es mir ansehen, denn nun spricht er ganz anders, schnell. Wie aus einer Maschinenpistole rattert er los ‒ auf Portugiesisch, dass es ja meine Schuld sei. Ich hatte mich an der offiziellen Schlange am Flughafen anstellen müssen. Zumindest glaube ich, dies aus seinem Gerede heraushören zu können. Schließlich nimmt er seine Visitenkarte, drückt sie mir in die Hand und sagt: »My name is Flavio. This is my mobile number. Call me at any time.«
3
Ich betrete das kleine Pförtnergebaude unserer Niederlassung in Brasilien. Es ist erst halb acht und entsprechend niedrig steht die Sonne. In meinem Kopf ist Mittag oder zumindest die Zeit zwischen dem Aufstehen und Mittagessen. Mein Ansprechpartner ist Herr Gerber, ich kenne ihn nicht persönlich, nur sein Foto. Deutscher Name, doch er ist Brasilianer. Wahrscheinlich ist sein Großvater irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts ausgewandert. São Paulo ist voll von Deutschstammigen. Ich melde mich auf Englisch an der Wache, zeige dem Wachmann meinen Firmenausweis und nenne den Namen und die Telefonnummer meines Ansprechpartners vor Ort. Er notiert meinen Namen und wahlt die besagte Nummer, um nach gefühlt zwanzigmal Klingelnlassen wieder aufzulegen. Ein Wortschwall Portugiesisch trifft mich. Ich verstehe alles ‒ aus seinen Gesten. Er zeigt auf seine Armbanduhr, dreht mit dem Zeigefinger den großen Zeiger symbolisch auf die volle Stunde und zeigt mir einen Platz zum Warten. In der Schlange sitzen bereits fünf Frauen ‒ Mulattinnen. Sie schwatzen und warten wohl auf eine Art Vorarbeiter. Wahrscheinlich Zeitarbeiterinnen zum Putzen. Eine Schande, was sich die moderne Industriegesellschaft alles ausdenkt, um Kosten zu drücken. Warum putzt der Angestellte nicht gleich selbst? Das bisschen Schreibtischwischen? Na ja, einen Feudel darf ein Angestellter ja aus versicherungstechnischen Gründen nicht anfassen. Überhaupt hasse ich Ausreden, die mit der Versicherung begründet werden. Niemand kennt die genauen Versicherungsbedingungen, aber jeder argumentiert, als hatte er sie gerade geschult bekommen. Da darf man nicht langer als 10 Stunden arbeiten, weil sonst die Berufshaftpflicht nicht zahlt. Da muss man soundso viel Pause machen, da darf man sich nicht allein im Gebaude aufhalten, nicht mit einem Externen zusammen im Büro, darf auf dem Weg zur Arbeit keinen Abstecher zum Supermarkt fahren. Wenn was passiert, wird die Versicherung schon einen Grund finden, warum sie nicht zahlen muss oder zumindest nicht den vollen Satz oder warum sie infolge des Vorfalls, den man aber nicht anerkennen kann, die Jahrespramie hochsetzen muss. Ich glaube, wir lassen uns da ganz schön verarschen. Klar, dass es jede Menge Leute gibt, die glauben, sie könnten ja ab und an ein wenig von ihren gezahlten Beitragen zurückbekommen. Und nur, weil es ein paar schwarze Schafe gibt, tut die Branche so, als waren wir alle Betrüger und nur das Versicherungsunternehmen der reinste Sozialverein.
Ich warte. Acht Uhr hat der Wachmann gesagt. Viel Zeit zum Nachdenken. Was ist mein Auftrag? Was soll ich hier? Warum muss jetzt alles so schnell gehen und wer bestimmt eigentlich, wo es langgeht? Die Zentrale der VASSAG? Die Unternehmenstochter in Brasilien? Ist schon komisch, wenn man nach Brasilien geschickt wird, nicht, weil die Firmentochter ein Problem hat, sondern weil man in der Zentrale einen Beweis dafür haben möchte, ob etwas wirklich so funktioniert wie versprochen und weil man nicht den Mumm besitzt, es im eigenen Laden auszuprobieren.
Ich schaue auf die große Uhr, die an der Wand hangt. Es ist fünf vor acht. Ich gehe erneut zum Wachmann. Er schaut mich groß an. Ich lege ihm wieder die Telefonnummer meines Ansprechpartners vor. Er grinst. Dann zeigt er mir ein Telefon in der Ecke und erzahlt mir, ohne, dass ich ein Wort verstehe, dass ich doch bitte selbst anrufen könne. Kann ich. Wieder kein Erfolg. Na ja, das Meeting soll um 8:15 Uhr losgehen. Dann kommt noch das brasilianische akademische Viertel dazu. Ich setze mich und sinne erneut nach. Als ich das letzte Mal hier war, wurde ich gefahren. Der Fahrer hat mich bis zum Verwaltungsgebaude gebracht. Ich habe mir den Weg also nicht gemerkt. Warum kenne ich eigentlich die Gebaude- und Büronummer nicht? Warum verlasse ich mich darauf, dass man mich abholt? Ich hatte doch bloß vorher nachfragen brauchen oder die Adressangaben mit dem Werksplan abgleichen müssen.
Acht Uhr fünfzehn. Ich wahle erneut. Und nochmals und nochmals. Niemand meldet sich. Mir wird ein wenig mulmig. Wie soll ich rechtzeitig da sein? Oder hat man es sich anders überlegt und man braucht mich gar nicht mehr? Wahrscheinlich hat man mir langst eine Nachricht auf die Mailbox meines Handys gesprochen, die ich ja jetzt, aufgrund meiner eigenen Dummheit, nicht abhören kann. Selbst schuld! Was mache ich bloß, wenn man mich nicht mehr braucht? Umbuchen, zurückfliegen, dem Chef irgendwas erzahlen? Soll ich hier vor allen Leuten anfangen, in meinem Koffer nach dem iPhone zu suchen? Dann eine Büroklammer erbetteln, um den SIM-Schacht zu öffnen und versuchen, meine Dienst-SIM-Karte zum Laufen zu bekommen?
Ich wahle erneut. Es ist jetzt 8:30 Uhr. Niemand nimmt ab. Ich wahle erneut. Und erneut und erneut. Mit reicht es. Ich nehme meinen Rollkoffer und das Handgepack und verlasse die Wache. Da ist Halle 1. Die kenne ich noch. Das Gebaude der IT liegt dahinter ‒ aber wo genau? In der ersten Reihe ist es nicht. So viel erkenne ich wieder. Verdammt, ist das warm hier. Ich ziehe meine Jacke aus, falte sie und lege sie auf den Rollkoffer. Jetzt geht es auch noch den Hügel hoch. Ich nehme den nachsten Eingang und dort das erste Sekretariat. Die Sekretarin sieht deutsch aus. »Hallo, können Sie mir sagen, wo ich Herrn Gerber finde?«
»Herrn Gerber? Kenne ich nicht. Warten Sie mal. Wen meinen Sie? Den Herrn Gerber aus der IT oder den aus der Logistik?«, fragt sie, nachdem sie ihren Computer durchforstet hat.
»Ich meine den Herrn Gerber aus der IT«, antworte ich.
»Den finden Sie im Gebaude 21, das ist in der übernachsten Straße, dort das letzte Gebaude, Eingang rechts.«