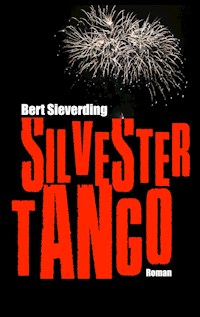Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Unfall wirft Felix Müller aus der Bahn - buchstäblich und im Leben. Fern der Heimat, irgendwo am rumänischen Ufer der Donau, strandet er mittellos in einem abgelegenen Hotel. Ohne Papiere, ohne Plan - nur mit zu vielen Fragen im Gepäck. Dort trifft er auf eine Gruppe von Tangotänzern, die ausgerechnet an diesem Ort Zuflucht suchen vor dem Lärm der Welt. Zwischen Musik, Schweigen und der Weite des Flusses beginnt für Felix eine Reise zu sich selbst. Eine Geschichte über Verlust, Nähe - und den Tanz als Sprache der Heilung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen
Felix Müller (52): Informatiker
Maria (32): Rezeptionistin
Tina Warnke (57): Tangotänzerin
Tessa (42): Arbeitskollegin von Felix
Ellen (50): Arbeitskollegin von Felix
Thomas Kröger (55): Chef von Felix
Nea (6): Tochter von Maria
Carlos (66): Tangolehrer
Barbara (55): Tanzpartnerin von Carlos
Flavia & Ricardo: Tanzpaar
Stefanie & Andreas: Tanzpaar
Evi & Herbert: Tanzpaar
Alwine & Claas: Tanzpaar
Renate & Günter: Tanzpaar
Sabine & Ralf: Tanzpaar
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
1
Don’t Be That Way
Benny Goodman
Der Kaffee war schuld. Vielleicht auch der stressige Job mit zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol und zu wenig Wasser. Tessa sagte mal, Männer über 50 müssten häufiger, könnten aber nicht mehr so oft. Nun, ich bin schon über 50 und ich muss häufiger und ob ich noch im Sinne von Tessa ›kann‹, weiß ich nicht. Ach ja, Tessa ist eine Arbeitskollegin und ein Lästermaul dazu.
Jedenfalls: Ich musste dringend. Bei der letzten Tankstelle hatte ich meinem Passat frisches Benzin, meinem Magen schwarzen Kaffee und meinem Kopf etwas Linderung verpasst. Mein Portemonnaie hatte ich nach dem Tanken auf das Armaturenbrett geworfen, mein Smartphone spielte über das Autoradio ›Don’t Be That Way‹, Jazz von Benny Goodman. Wunderschön und passend zum herrlichen Herbstwetter. Doch nun wollte die Flüssigkeit heraus, aber mit Macht. Die Landstraße war eng. Vielleicht nur vier Meter breit. Links türmten sich steil die Felswände auf und rechts unten floss die Donau, die an dieser Stelle aufgestaut wurde und enorm breit war. Leitplanken schienen in dem Land etwas für Pessimisten zu sein, zumindest stellenweise. Eine Parkbucht übersah ich, da just beim Passieren ein Lastwagen entgegenkam und mir die Sicht auf die bergseitig gelegene Bucht versperrte. Als ich links einen kleinen Vorsprung im Fels sah, stoppte ich den Passat, hielt rechts scharf am Abhang und mit dem halben Auto auf der Fahrbahn. Eigentlich sollte man auf dieser Strecke nicht anhalten. Doch es musste sein. Ich musste. Obwohl es Herbst war, war es warm und ich hatte das Fenster geöffnet, da ich für die Wartung der Klimaanlage zu geizig gewesen war. Klar hätte ich einen schnieken Dienstwagen fahren oder auch fliegen können, doch ich hatte Angst vorm Fliegen und die Dienstwagen durfte man im Unternehmen nur dienstlich nutzen, was ich für Schwachsinn hielt und daher lieber die Kilometerpauschale für meinen 12 Jahre alten Volkswagen abrechnete. Die Kiste war schon reichlich alt und hatte über 300.000 Kilometer auf dem Zähler, doch sie lief gut, der Benzin- und Ölverbrauch hielt sich in Grenzen und ich liebte es, Dinge aufzutragen oder zu nutzen, bis es wirklich nicht mehr ging. Mit Ausnahme von Computer-Technologie war mir nichts mehr zuwider als Mode und Fast Fashion. Außerdem lenkte das lange Fahren von meiner Einsamkeit ab, die mich nach dem tragischen Unglück befallen hatte.
In der Felsspalte stehend, konnten die anderen Verkehrsteilnehmer mich nicht sofort sehen. Es waren aber auch nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Bevor ich das Unglück kommen sah, hörte ich das Dröhnen eines schweren Diesels. Ich guckte über die Schulter und sah einen langen Holzlaster mit viel zu hoher Geschwindigkeit vorbeirauschen. Der Platz zwischen Felswand und meinem Auto reichte so gerade eben für das 2,5 Meter breite Ungetüm. Doch ich Idiot hatte in einer Linkskurve geparkt; einer Kurve, die auch der Laster nehmen musste. Tessa hatte wohl doch recht, als sie sagte, dass es bei älteren Männern nicht mehr so zügig fließt, denn immer noch pinkelnd sah ich den LKW vorbeirauschen und die lang überragenden Baumstämme meinen geliebten Passat, getrieben durch die Beschleunigung der Linkskurve, den Abhang hinab drücken. Einen winzigen Moment hörte ich nur das abklingende Geräusch des Lasters. Dann ein lautes Krachen, als wenn ein abgesägter Baum krachend zu Boden schlägt. Zum Abschütteln blieb keine Zeit. Ich rannte über die Straße. Dort lag mein Auto, immer noch schwankend im Geäst eines Baumes, den zu bestimmen mir so schnell nicht möglich war. Schlagartig wurde mir klar, was da gerade passiert war. Weg! Alles weg. Im Auto befanden sich meine Papiere, das Geld, das Handy, mein Gepäck – einfach alles. Am Körper hatte ich nur meine Kleidung, ausreichend für einen warmen Herbsttag. Das Autoradio dudelte noch, also war das via Bluetooth gekoppelte Smartphone noch heile. Und auf dem befanden sich Kopien des Ausweises und der Bankkarten. Von der Straße bis zum Auto unten waren es vielleicht drei Meter, bis runter zum Donauufer noch weitere fünf. Ich musste zum Auto runter, zumindest mein Smartphone, meine Papiere und meinen Laptop retten, denn auf den Laptop war mein Lebenswerk, zumindest der Teil seit der letzten Datensicherung vor ein paar Tagen. Es gab keine andere Wahl. Ich musste absteigen. Und versuchte es. Der erste Schritt klappte. Zwanzig Zentimeter waren geschafft. Der zweite auch. Aber, mein nächster Schritt löste eine Steinlawine aus. Ich konnte mich gerade noch festhalten, doch die Steine polterten in die Tiefe, trafen den Wagen, der sich, derart angetriggert von der Übergriffigkeit der Äste befreite und mit Wucht ganz unten am Flussufer zum Aufprall kam. Wieder war es ganz still. Aber nur wenige Sekunden. Dann gab es einen ohrenbetäubenden Knall und der Wagen stand in Flammen. Eine sengende Hitze stieg auf. Ich musste weg von dieser Stelle, ganz schnell sogar. Mit letzter Kraft kraxelte ich über die Felskante. Oben angekommen sah ich das ganze Drama. Sah, wie die Flammen den Lack abtrugen und nacktes Blech zurückließen. Sah, wie die Sitze kokelten. Hilflos glotzte ich auf mein Schicksal. Meine Flüche möchte ich hier nicht wiedergeben.
Nachdem ich vor Wut noch ein paar Steine auf die Karosse gepfeffert hatte, wurde mir klar, dass dieses Unglück wohl eine berufliche Wende bedeuten würde. Ich prüfte meine Hosentaschen, hoffend, darin etwas von Wert zu finden. Doch außer meinem Haustürschlüssel und einem Euro, den ich für Einkaufswagenschlösser bereit hielt, fand sich nur ein Stofftaschentuch, das auch schon bessere Tage gesehen hatte.
Während ich noch auf das Wrack starrte, waren bereits einige Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeigesaust. Da die Stelle aber nicht nach Unfall aussah, sondern dort nur ein großer, straßenköterblonder Deutscher auf die Donau glotzte, hatten sie ihre Fahrt ohne Halten fortgesetzt. Wenn sie genauer hingeschaut hätten, dann hätten sie gesehen, dass der Mann ungefähr 1,85 groß war, ein hellblaues Oberhemd zu einer grauen Jeans trug, dunkle Halbschuhe mit flacher Sohle anhatte und in dem Moment sehr, sehr mürrische Gesichtszüge aufwies, die ihren norddeutschen Ursprung nicht leugnen konnten.
Noch einmal blickte ich prüfend nach unten, ob irgendein wichtiger Gegenstand das Feuer überlebt haben könnte. Doch ich konnte nichts erkennen und auch nichts mehr tun an diesem Ort. Ich musste schnellstens telefonieren.
Das dritte Auto hielt schließlich auf mein drängendes Winken hin an. Es war ein alter DACIA Kombi. Der freundlich lächelnde Herr am Steuer verstand kein Deutsch und auch kein Englisch und ich sein Rumänisch nicht. Mit Gesten machte ich ihm klar, dass ich gerne irgendwo telefoniert hätte. Nach zwei Kilometern Fahrt hielt er an einem Hotel und verabschiedete mich mit einem Schwall freundlicher Worte, die ich nicht verstand.
Es war ein schöner Ort und gerne hätte ich diesen unter anderen Umständen kennengelernt. Zwar führte die Straße auf der Nordseite am Haus vorbei, doch grenzte das Hotel direkt an die Donau. Ein großer Parkplatz befand sich auf der anderen Straßenseite. Von außen wirkte das zweistöckige Haupthaus mit seinen schmalen Fenstern unscheinbar: Ein Urlaubshotel, geschätzt zehn Jahre alt. An der ganzen Straßenfront gab es nur eine Eingangstür und einen bescheidenen Halteplatz für ein Auto. Dort stand ich nun mit nichts.
Natürlich werden Sie sich fragen, was mich an einem Donnerstag im Herbst an die Donau trieb? Ich hatte in Belgrad zu tun gehabt, war dazu am Sonntagmorgen gestartet und als ich Montagfrüh beim Kunden in Serbien ankam, lag die Nachricht von meinem Chef bereits im Posteingang. Er sei verhindert und ich müsse am Freitag einem Kunden in Pite ti den neuesten Stand unserer Software vorführen und dabei Erfolg haben, denn für unsere Firma sei dieser Auftrag sehr wichtig. Sicher sei es für mich kein Problem, die Arbeiten in Belgrad bis Mittwochabend abzuschließen und dann am Donnerstag die lächerlichen 500 Kilometer bis zur rumänischen Walachei zurückzulegen. Schließlich führe ich ja gerne Auto, spottete er in seiner Mail. Zumindest hatte er die Adresse des Kunden und eine Hotelbuchung angehängt. Letztere hatte Ellen, das Herz der Abteilung vorgenommen, denn solche Tätigkeiten überließ Chef gerne dem Personal.
In der Tat war ich am Mittwochabend, das heißt in der Nacht zu Donnerstag mit den Arbeiten fertig geworden. Mein Ansprechpartner in Belgrad empfahl mir die kürzeste Strecke an der Donau entlang und einen Grenzübergang, der nur wenig frequentiert sei und damit wäre die Strecke inklusive Kontrolle schneller. Auch sei sie landschaftlich sehr schön und so hätte ich zumindest eine schöne Aussicht an einem herrlichen Herbsttag. Jetzt hatte ich einen herrlichen Herbsttag und eine schöne Aussicht auf den an dieser Stelle aufgestauten und daher sehr breiten Fluss, doch würde ich den Termin in Pite ti nicht wahrnehmen können, wenn nicht noch ein Wunder geschah. Und selbst wenn, ich hatte keine Unterlagen. Die hatten mit dem Laptop zusammen ihr Digitalleben ausgehaucht.
2
Nightmare
Artie Shaw
Ich trat durch die Eingangstür des Hotels mit dem passenden Namen Septembrie direkt auf eine Holztreppe zu. Die mittleren Stufen führten nach oben, wohl zu den Gästezimmern. Links und rechts gingen die Stufen geländerlos nach unten. Durch das angrenzende Fenster ergoss sich mein Blick auf eine mit Liegestühlen und Sonnensegeln bestückte Terrasse, die nahtlos an die Donau grenzte. Ein wunderbarer Ausblick. Unter anderen Umständen wäre ich geneigt gewesen, hier Urlaub zu machen. Ein Gang zur Linken führte zur Rezeption. Es war gegen Mittag und diese nicht besetzt. Ich machte mich bemerkbar, drückte sogar mehrfach auf die kleine Klingel, die man in fast keinem Hotel mehr vorfindet. Ich hatte es eilig. Warum war hier niemand? Nervös tippelten meine Finger auf dem Tresen herum. Nach ein paar Minuten trudelte endlich die Rezeptionistin ein, eine schlanke gut aussehende Dame, die ich auf zirka 30 schätzte, und begrüßte mich auf Rumänisch, was ich nicht verstand, denn ich war noch nie in Rumänien gewesen. Ich antwortete auf Englisch, erzählte von meinem Unglück und dem Wunsch, den Unfall der Polizei zu melden. Maria, so stand es auf ihrem Namensschildchen, schaute mich fragend an. Ich dachte, sie hätte mich vielleicht nicht richtig verstanden und wiederholte meine Forderung, schilderte meinen Unfall, worauf sie erschrak und fragte, ob ich verletzt oder weitere Personen verunglückt seien. Ich konnte sie beruhigen, worauf sie etwas stammelte, was ich als »Gott sei Dank« interpretierte, obwohl sie kein Deutsch gesprochen hatte. Dann endlich griff sie zum Telefon und wählte die Nummer der Polizei. Ihre Schilderung war kurz und knapp und beinhaltete primär die Adresse des Hauses, glaubte ich zumindest. Ich wollte draußen vor der Tür warten, dem Hotel keine Umstände machen. Doch Maria lud mich ein, auf der Terrasse zu warten, denn sicherlich hätte ich genug von vorbeirasenden Autos. Im Untergeschoss, es lag tiefer als die Straße, auf dem Niveau der Donau, führte rechts ein durch Torbogenfenster erhellter Gang zu einem Veranstaltungsraum und den Toiletten, links zum Restaurant, einem offenen Raum, dessen Holzfußboden nahtlos in die Terrasse überging. Ein Tresen grenzte den Küchenbereich ab. Eine Kühlvitrine zeigte herrliche Kuchenstücke, was mein Magen hörbar kommentierte. Hier könne ich auf die Polizei warten, sagte sie und fragte beiläufig, ob ich einen Kaffee oder ein Wasser wolle, was ich als äußerst liebevoll und freundlich empfand und dankend bejahte. Es tat mir leid, dass ich Maria, wenn auch nur in Gedanken, so abgekanzelt hatte. Daher bat ich sie mit meiner weichsten und freundlichsten Stimme darum, telefonieren zu dürfen. Worauf sie mir lächelnd das hinter dem Tresen stehende Telefon anbot. Selten hatte mich in einem Hotel eine derart freundliche Person begrüßt. Als Maria ging, schaute ich ihr hinterher.
Zuerst wählte ich die Nummer von Ellen, eine Festnetznummer, die ich auswendig kannte, denn Ellen organisierte den Laden, wie ich unsere Abteilung abschätzig nannte, sie war sozusagen die Person für alles. Obwohl sie vor ein paar Wochen ihren 50sten gefeiert hatte, sah sie sportlich fitt aus; ich glaube, sie wanderte gerne. Doch das Telefon nahm sie nicht ab, war wahrscheinlich unterwegs. Dann wählte ich die Festnetznummer meines Chefs. Nach zehn Freizeichen gab ich auf. Jetzt war Tessa meine letzte Chance.
Tessa sieht aus, wie Lara Croft, na ja fast und meine Arbeitskollegen nennen sie so. Sie ist geschätzt 1,65 groß. Ihre Haare sind von Natur aus braun und werden regelmäßig rot gefärbt. Im Sommer kommt sie schon mal im Lara Dress, also in einem ausgeschnittenen Top und einer engen kurzen Hose, daher ihr Spitzname. Auf der rechten Wange hat sie ein Muttermal, und zwar genau an der gleichen Stelle, wo ich eins auf der linken Wange trage. Dies ist ihr auch schon aufgefallen und sie macht sich gerne über ihren Spiegelbruder lustig.
Mein Chef Thomas Kröger hatte aus einem verpfuschten Projekt gelernt und wollte einen gemachten Fehler auf keinen Fall wiederholen, nämlich das fehlende und schlechte Marketing gegenüber Geschäftsführung und Kunden. Alle meine Kollegen waren ebenfalls Ingenieure und Informatiker. Wir konnten Spezifikationen schreiben und Software entwickeln, bekamen aber Werbeprospekte oder Handbücher nicht zustande und sahen deren Notwendigkeit auch gar nicht ein. Auch aus diesem Grunde verbrachte einer von uns fast die gesamte Zeit der Systemeinführung beim Kunden. Die Lösung hieß Tessa. Sie hatte Marketing studiert und sich auf Informationstechnologie spezialisiert. Programmieren konnte sie nicht, was sich zu ihrem Vorteil entwickelte, da sie die Welt aus der Sicht der Anwender sah, genau wie der Kunde. Tessa ist 10 Jahre jünger als ich und war, bevor sie zu uns kam, bei einem Computer-Hersteller beschäftigt. Ihre Dokumentation versteht jeder sofort. Beim zweiten Kunden, bei dem wir unsere Mustererkennung in die Produktion brachten, halbierte sich die Einführungszeit. Meine Kollegen spotteten trotzdem über sie. Kann ja nicht programmieren. Ich schätzte sie sehr und wenn möglich fuhren wir gemeinsam zum Kunden. Tessa hat jedoch die Eigenschaft, dass sie sich für jede Gefälligkeit bezahlen lässt, nicht mit Geld, sondern mit Gegengefälligkeiten. Kommt man ihr nicht entgegen, wird sie pampig und geißelt mit bissigen Kommentaren.
Während ich den von einer Bedienung servierten Espresso schlürfte und Tessas Nummer wählte, traten zwei Polizisten in den Raum und begrüßten mich in gebrochenem Englisch. Tessa musste warten. Ich schilderte ihnen mein Unglück wortstark und mit fuchtelnden Händen. Einer der beiden schüttelte ungläubig den Kopf. Der andere meinte nur, ich solle mitkommen und ihnen die Stelle zeigen.
Ich hatte Mühe, den Ort wiederzuerkennen. Zum einen hatte ich die Straße in der entgegengesetzten Richtung befahren, zum anderen saß ich hinten im Polizeiauto und konnte nur wenig von der Straße sehen. Schließlich konzentrierte ich mich auf die Felsspalte, in der ich gestanden hatte und gab den beiden ein Zeichen, als das Auto die Stelle passierte. Klar, dass auch das Polizeiauto dort kaum halten konnte, doch der Fahrer schaltete das Blaulicht ein und wählte eine kleine Parkbucht einige hundert Meter weiter. Die Bucht lag auf der Bergseite. Ich hatte auf meiner Fahrt die Gegenrichtung genommen und die Bucht wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs nicht beachtet. Trotzdem ärgerte ich mich in diesem Moment erneut über meine Blödheit. Warum hatte ich ausgerechnet in dieser Scheißkurve halten müssen?
Der Passat lag verkohlt am Ufer. Die Blätter des Baums, in dem er zuerst hängen geblieben war, waren verkohlt und die Äste abgeknickt. Es war ein Wunder, dass der Baum das schwere Auto anfangs überhaupt hatte tragen können. Der kleinere der beiden Polizisten, beide trugen Uniform und hatten dunkle Haare, schoss mit seinem Smartphone Fotos und markierte die Unfallstelle auf Google Maps. Der andere Polizist, offenbar der Ranghöhere, redete in einem Wortschwall aus Rumänisch und Englisch auf mich ein, machte mir Vorwürfe an dieser Stelle gehalten zu haben. Er sagte, es sei Naturschutzgebiet und das Wrack müsse geborgen werden und er hoffe, dass kein Öl ausgetreten und den Boden verseucht hätte, dann würde es richtig teuer werden. Er fragte nach meinem Namen, meiner Anschrift und dem Kennzeichen des Autos, trug diese Daten in sein Notizheftchen ein. Dann notierte er Dinge, von denen ich glaubte, dass sie mich entlasten könnten, zum Beispiel, dass die Leitplanke an dieser Stelle fehlte. Ich sah seine flinken Finger eine Skizze anfertigen. Die Straße machte eine Linkskurve, genau hier fehlte die Leitplanke. Der Polizist zeichnete meine Fahrtrichtung ein und dann den Ort, wo das Auto vom Baum aufgefangen worden war. Erst im Nachherein fiel mir auf, dass er keine Notizen über die Stelle anfertigte, die ich zum Wasserlassen benutzt hatte, überhaupt interessierte ihn meine Schilderung des Holzlasters kaum.
Zurück im Hotel, machte der Ranghöhere mir die Auflage, Kontakt mit der deutschen Botschaft aufzunehmen, um einen neuen Ausweis zu erhalten und mir von Bekannten Bargeld zusenden zu lassen, da er die Strafe, die ich zahlen müsse, gerne in bar kassiert hätte. Am Folgetag, also Freitag, käme er mit dem Unfallprotokoll zur Unterschrift vorbei. Ich hatte auf Hilfe gehofft. Nun drohte mir eine Strafe – wofür? Was konnte ich dafür, dass dieser Holzlaster mein Auto zerstört hatte? Daher intervenierte ich sofort, erzählte nochmals vom Holzlaster und dass dieser der Verursacher des Unfalls sei. Der ranghöhere Polizist holte darauf sein Notizheft hervor und schrieb ein paar Sätze in Rumänisch auf eine leere Seite. Dann gab er mir die Anweisung, das Hotel nicht zu verlassen, bis sie den Vorfall geklärt hätten. Bevor er ging, sprach er noch kurz auf Rumänisch mit Maria, die mich dabei die ganze Zeit streng anschaute und gleichzeitig dem Polizisten zunickte. Nachdem die Polizisten gegangen waren, meinte Maria, es gäbe ein Problem. Ich hätte keinen Ausweis und auch keine Kreditkarte. Eigentlich dürfte sie mich nicht beherbergen. Aber sie würde eine Ausnahme machen, ich müsse nur Stillschweigen bewahren. Sobald ich einen neuen Ausweis und Geld hätte, könnte sie alles nachtragen und abrechnen. Bis dahin böte sie mir ein Bedienstetenzimmer an, das jetzt außerhalb der Saison frei sei. Außerdem solle ich morgen auf eine Quittung bestehen und mich nicht von den Polizisten übers Ohr hauen lassen. Nicht alle seien ehrlich in diesem Land. Ihre schönen Augen lächelten, als sie das sagte. Ich war ihr dankbar und fragte mich die ganze Zeit, warum sie überhaupt so liebenswert freundlich zu mir war und ich anfangs in Gedanken so grob?
Maria hatte an der Rezeption zu tun und ich konnte endlich Tessa anrufen. Sie war tatsächlich noch im Büro und ich froh, endlich eine bekannte Stimme zu hören. Nachdem ich ihr mein Malheur geschildert hatte, erkundigte ich mich nach unserem Chef.
»Chef hat Urlaub. Kommt erst Dienstag zurück. Montag ist Feiertag, zumindest hier. Du kannst gerne arbeiten. Ich habe frei!«
Ach ja, der Feiertag. Dritter Oktober. Dieses Jahr ein Montag. So so, Chef verhindert, weil Urlaub. Und drückt mir den wichtigen Kunden in der Walachei auf! Meine immerzu schon vorhandene latente Wut auf meinen Vorgesetzten kam wieder hoch.
»Tessa, du musst mir helfen. Bitte suche auf dem Server die vom Chef erstellte Präsentation für den Kunden in Pite ti. Dort hat Chef den Namen und die Telefonnummer des Kunden vermerkt. Ich muss dort anrufen und absagen.«
»Das wird Ärger geben. Chef hat in der Abteilungsrunde am Dienstag gesagt, wenn aus dem Geschäft mit den Rumänen nichts wird, dann scheitert die Fusion mit den Amis. Die Folgen kannst du dir denken. Unser Wert sinkt, wir gehen Pleite, zu Weihnachten gibt es keine Prämie und du kannst dir zum Jahreswechsel einen neuen Job suchen.«
Diese Information war mir in dieser Detaillierung neu. Ich kannte nur den Flurfunk, hatte aber die Sprüche der Schwarzseher nicht ernst genommen. Ich nannte Tessa die Mailadresse des Hotels und bat um die Präsentation, jedoch zip-verschlüsselt unter Angabe des aktuellen Datums und meiner Initialen als Passwort. Ihr stummes Nicken, ein Zeichen, dass ihr dieser Auftrag nicht genehm war, wie ihr nie etwas genehm war, was nicht von ihrer eigenen Initiative ausging, konnte ich weder sehen noch hören, aber erahnen. Vielleicht hätte ich sie nicht überfallen oder erst die Bitte nach Geld vorbringen sollen. So war sie angepisst, als ich sie mit zartester Stimme anbettelte: »Tessa, ich brauche Geld. Kannst du mir 500 Euro überweisen? Also nicht per Banküberweisung, denn ich habe ja keine Karte mehr, sondern bar, per Western Union?«
»Nee Felix! Wir arbeiten zusammen - aber, dass ich dir Geld gebe, so weit kommt es noch. Hilf dir selbst!«
»Tessa, bitte! Ich habe nichts! Es ist alles verbrannt!«
»Nein! Du bist ein Eigenbrötler und lässt dir nie in die Karten gucken! Nun sieh zu, dass du mit dem Schlamassel selbst klarkommst!« Darauf legte sie auf.
Natürlich war ich sauer auf Tessa. Doch ich kannte sie nicht anders. Sie hatte ihren eigenen, dicken Kopf und mit einem solchen hatte ich sie in Projekten kennengelernt. Privat war sie anders. Nachdem wir einmal auf einer Geschäftsreise beim Kunden schneller fertig wurden, als geplant, hatten wir unerwartet einen Nachmittag Zeit. Klar hätten wir sofort zurückfahren können, doch unser Zug war für den Vormittag des nächsten Tages gebucht und die Plätze reserviert. Wir nutzten die Zeit, besichtigten die Stadt und beim Bummeln entdeckten wir ein Café, das gemütlich im Wiener Stil eingerichtet war. Wir setzten uns an einen Zweiertisch, gönnten uns Kaffee und ein Stück Fruchttorte. Wir hatten Zeit und sie erzählte ihre Geschichte. Es dauerte nur eine Stunde und ich wusste, dass Tessa überzeugter Single war und sich nicht binden wollte. Ihr Vater hatte ihre Mutter nämlich über Jahrzehnte bevormundet. Es war ihr erst nicht aufgefallen, schließlich wächst man in der Familie damit auf. Ein Schüleraustausch führte sie für ein halbes Jahr in die USA. Hier erlebte sie in einer Familie, bestehend aus zwei berufstätigen Fachkräften und Zwillingstöchtern, beide etwas älter als Tessa, wie Familie auch anders gehen kann. Alle Entscheidungen wurden quasi basisdemokratisch getroffen. Nur wenn eine Person partout dagegen war und sehr triftige Gründe hatte, zählte die andere Mehrheit nicht, sondern es wurde ein Kompromiss gesucht. Die erste Abstimmung, die Tessa miterlebte, fühlte sich wie ein Streit zwischen Mutter und Töchter an. Doch es war eine Diskussion zwischen den Parteien, in der zum Schluss Vorschläge zur Abstimmung eingebracht wurden. Als man Tessa gleichberechtigt mit einschloss, erkannte sie darin den demokratischen Prozess, den sie zu Hause nie erlebt hatte. Hinzu kam, dass die beiden Töchter ein sehr liberales Liebesleben führten. Freunde kamen zu ihnen nach Hause, wurden von den Eltern herzlich begrüßt und blieben über Nacht. Nie hörte man Vorwürfe oder Klagen. Lieber unter unserem Dach, als heimlich im Auto, war die Devise der Gasteltern. Tessa war damals sechszehn. Es dauerte nicht lange, bis sie sich in einen Jungen aus der Schule verliebte. Als sie davon erzählte, fuhr die Gastmutter mit ihr zum Arzt und kaufte ihr Verhütungspillen, etwas, was in Tessas Familie nie passiert wäre. Zwar wurde aus dem Sex mit dem Jungen nichts, weil Tessa ihn mit ihren sehr konkreten Vorstellungen überforderte und er einen Rückzieher machte. Doch dieses Erlebnis machte ihr klar, welche Macht sie als Frau ausüben konnte, wenn sie nur entschlossen genug auftrat. Zurück in Deutschland kam es prompt zum Streit mit dem Vater. Doch Tessa wollte nicht zurück in seine patriarchische Welt. Mit 18 zog sie in eine WG und sah ihre Eltern erst zur Abi-Feier wieder. Ihre Eigensinnigkeit sprach sich schnell herum und damit hatte sie in unserer Firma Erfolg.
In dem im Wiener Stil eingerichteten Café tranken wir Sekt auf unseren Erfolg. Nachdem wir die winzigen Gläser geleert hatten, lockerte sich Tessas Zunge und sie nannte unverhohlen ihr Ziel, eine Projektleitung zu übernehmen. Sie hatte weder Informatik noch Ingenieurwesen studiert, keine Projektleiterausbildung erhalten. Nichts sprach für sie. Doch sie war von ihrem Ziel überzeugt und fragte mich, nach dem besten Vorgehen auf dem Weg dorthin. Ich gab ihr ein paar Tipps, wir sprachen über den formalen Weg einer Ausbildung, sie erwägte die Möglichkeiten eines Privatcoaching. Dann kanzelte sie den Chef ab. Er hätte ihr schon mehrfach Avancen gemacht, doch sie fände das einfach nur peinlich. Eher würde sie dreimal pro Jahr die Firma wechseln, als sich hochzuschlafen. Sicher hätte er bei anderen mehr Erfolg.
Am liebsten hätte ich nach Tessas Abfuhr meinen Frust mit Alkohol ertränkt. Stattdessen tobte in meinem Kopfkino das Fusionsgespenst: Im Zuge der Globalisierung gab es mehrfach Gerüchte um eine Fusion unserer Firma mit Mitbewerbern. Das Ziel war, ein größeres Stück bei weniger Konkurrenz ergattern zu können. Jedes Mal sprach der Flurfunk von geplanten Entlassungen nach der Fusion. Es wurden sogar schon Abteilungen benannt, die angeblich wegrationalisiert werden würden. Zwar mag es hinter vorgehaltener Hand oder auf dem Golfplatz Gespräche gegeben haben, Realität wurde es jedoch bis dato nicht.
Erneut probierte ich es im Sekretariat bei Ellen unter der Festnetznummer. Vergeblich. Dann versuchte ich, ihre Handynummer zu rekonstruieren und schrieb die Rufnummer auf einen Zettel. Bei einer Ziffer war ich mir nicht sicher, probierte es trotzdem. Der erste Versuch scheiterte. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Mit einer neun statt der sechs klappte es. Ellen meldete sich. Offenbar saß sie im Auto, und zwar auf dem Beifahrersitz, denn der Hall einer Freisprechanlage fehlte, doch Fahrgeräusche waren deutlich vernehmbar. Ohne meine Begrüßung abzuwarten, fiel sie mir ins Wort: »Felix Müller! Erst die Absage, dann seit Tagen kein Wort von dir. Und jetzt rufst du an. Jetzt! Heute! Wo es mir überhaupt nicht passt. Ich geb dir 20 Sekunden.«
»Ellen! Ich hatte einen Unfall. Das Auto ist kaputt, alle Sachen sind verbrannt. Bitte überweise mir Bargeld. Dringend. Ich sitze in Rumänien fest!«
»Wo denn in der Walachei? Nein mein Lieber. Das geht jetzt nicht. Ich bin unterwegs. Ruf Dienstagnachmittag wieder an!« Und damit beendete sie das Gespräch.
Stinksauer knallte ich etwas zu heftig den Hörer auf die Telefongabel. Gerade von Ellen hatte ich mehr Verständnis erwartet. Ich nahm mir vor, sie zukünftig wieder zu siezen.
Bei dieser Gelegenheit muss ich erwähnen, dass Chef sich von Tessa mehr Unterstützung bei formalen und organisatorischen Dingen gewünscht hatte. Ein Anrecht auf eine Assistenzkraft, früher nannte man es Sekretärin, hatte Chef nicht, wollte aber gerne wie seine Kollegen eine Dame im Vorzimmer sitzen haben – schon des Prestiges wegen. Doch Tessa wurde sofort von den Projekten absorbiert und nahm nie ihren vom Chef zugedachten Platz im Vorzimmer ein. Ein paar Jahre später gelang es ihm, im Zuge einer Umorganisation eine Assistenzstelle zu akquirieren, musste dafür aber eine Entwicklerstelle abtreten. Sein Plan war, diese Stelle mit einer jungen Schönheit zu besetzen, um es seinen Abteilungsleiterkollegen gleichzutun. Doch die Leitung der Personalabteilung durchschaute seine Pläne und setzte Ellen als erfahrene Kraft durch. Ellen war im Zuge einer Umorganisation frei geworden. So verlor Chef einen Entwickler und erhielt im Gegenzug eine Dame im Vorzimmer, die etwa gleichalt wie ich und zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung noch verheiratet war.
Meine letzte Hoffnung war die deutsche Botschaft. Maria hatte die Telefonnummer der Botschaft in Bukarest herausgesucht. Ich wählte. Sofort sprang der Telefoncomputer an und vertröstete mich auch rumänisch und deutsch. Es folgte ›Bitte warten!‹ und Beethoven! Laut! Viel zu laut! Ich musste den Hörer vom Ohr nehmen. Es war nicht zu ertragen. Nach drei bis vier Minuten meldete sich eine weibliche Stimme auf Rumänisch. Ich stammelte mein Sprüchlein, so von wegen, deutscher Staatsbürger, Unfall, alle Papiere verbrannt, kein Geld, säße an der Donau in der Nähe von E elni a fest. Natürlich konnte ich den Namen des Ortes beim Ablesen von der Hotelvisitenkarte nicht richtig aussprechen und verhaspelte mich mehrfach.
»Ich verbinde…«, piepste sie.
Wieder Beethoven. Wieder eine kleine Ewigkeit, dann eine kurze Unterbrechung und wieder Beethoven. Schließlich eine männliche Stimme, die sich mit Namen und Botschaftsassistenz meldete. Den Namen hatte ich bereits vergessen, nachdem er ihn gesagt hatte. Ich stammelte erneut mein Sprüchlein herunter und erhielt zur Antwort:
»Sie müssen nach Bukarest kommen, zu uns in die Botschaft. Morgen haben wir keine freien Termine und Montag ist auch bei uns Feiertag. Kommen Sie am Dienstag.«
»Aber wie soll ich zu Ihnen kommen? Ich habe keine Papiere, keine Kreditkarten, kein Bargeld?«
»Lassen Sie sich von Freunden oder Verwandten Bargeld schicken. Die Botschaft ist kein Geldinstitut!« Und legte auf.
Maria hatte die letzten Sätze mitbekommen und berührte verständnisvoll meine Schulter. Bisher hatte ich sie als Teil des Hotels gesehen. Ich erinnere mich, abgesehen von einem Typen in Basel, der mich vor die Tür setzte, nie an Hotelpersonal. Es sind Menschen, wie du und ich, aber sie prägen sich mir nicht ein. So war es mir beim Betreten des Hotels an der Donau auch ergangen. An der Rezeption hatte eine uniformiert gekleidete Frau mein Anliegen bearbeitet. Im Restaurant sah ich sie im anderen Kontext, hatte einen anderen Blick auf sie geworfen, hatte ihre welligen blonden Haare bewundert. Jetzt, wo sie mich berührte, entstand eine Nähe, die ich lange nicht genossen hatte. Petra war früher auch immer sehr mitfühlend gewesen. Maria gab mir in diesem Moment, wo ich mein Lebenswerk über mich zusammenbrechen sah, den Halt den ich brauchte. Ja, obwohl sie viel jünger war, erinnerte sie mich an meine Mutter, die auch sofort alle Sorgen ihres Sohnes erahnt und mit aufmunternden Worten gelindert hatte. Maria war etwa einen halben Kopf kleiner als ich. Ihr Körper hatte die Frische einer jungen Mutter. Frauen verändern sich, wenn sie Mutter werden. Man spürt es, zumindest spürte ich es bei Maria, doch es dauerte noch einige Tage, bis ich ihr Kind kennenlernte. Ich schaute ihr ins Gesicht, das bei jedem Lächeln Grübchen warf und in ihre graublauen Augen, als sie leise und in gebrochenem Deutsch sagte: »Wir haben deutsche Gäste. Sie kommen spät am Abend. Vielleicht können sie Ihnen helfen.«
»Woher können Sie so gut Deutsch?«, fragte ich erstaunt zurück.
»Ich kann es nicht gut. Meine Oma ist eine Schwäbin, eine Banat-Schwäbin. Von ihr haben meine Mutter und ich Deutsch gelernt. Ich habe hier ein Übernachtungspaket: Rasierer, Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch und Seife. Und, im Restaurant steht Essen für Sie!«