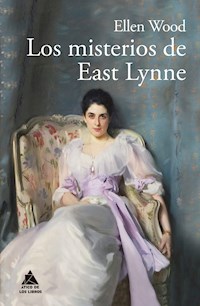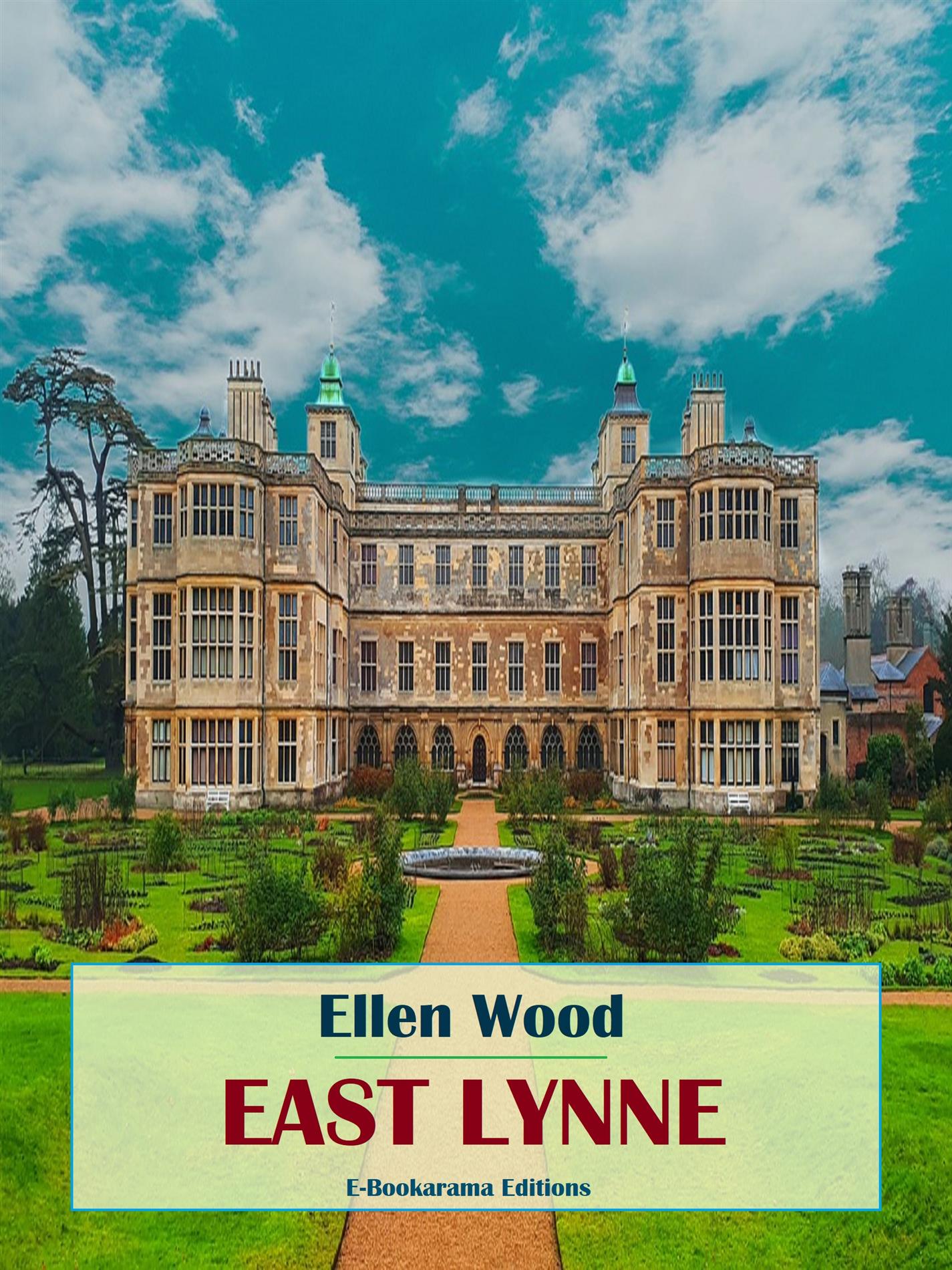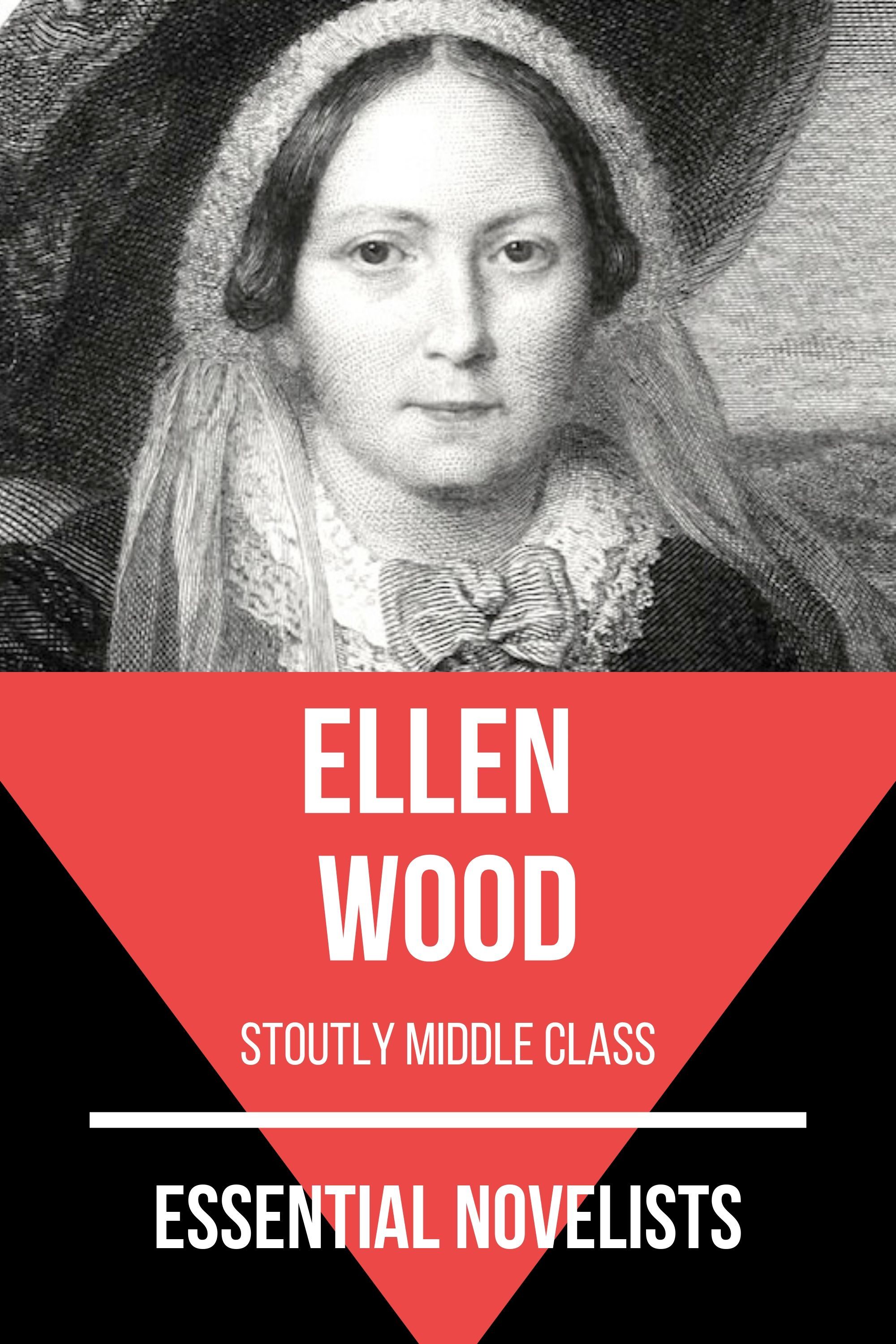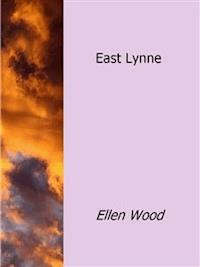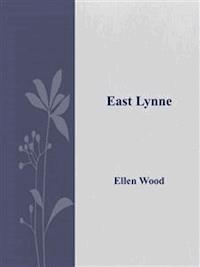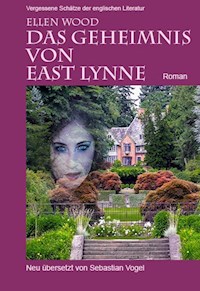
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Earl of Mount Severn verarmt stirbt, ist seine mittellose Tochter Isabel froh, dass der angesehene Anwalt Archibald Carlyle sie heiratet. Die beiden bekommen drei Kinder, aber dann wird das Familienglück getrübt: Mr. Carlyle trifft sich immer wieder mit der hübschen Barbara Hare. Die Gespräche sind allerdings rein beruflicher Natur: Barbaras Bruder wurde fälschlich wegen Mordes verurteilt, und der Anwalt will ihn rehabilitieren. Aber Isabel wittert Ehebruch und lässt sich in ihrer Eifersucht von dem windigen Francis Levison verführen, mit ihm durchzubrennen. Von der geliebten Frau geschieden, heiratet Mr. Carlyle seine Mandantin Barbara. Levison lässt Isabel in Frankreich im Stich, und sie verzehrt sich in der Sehnsucht nach ihren Kindern. Nachdem sie bei einem Eisenbahnunglück bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet wurde, fasst sie einen tollkühnen Entschluss... In ihrem berührenden, 1861 erstmals erschienenen Roman Das Geheimnis von East Lynne erzählt Ellen ("Mrs. Henry") Wood eine tragische und gleichzeitig spannende Geschichte von Verbrechen, Ehebruch und Reue. Die Handlung wurde im 20. Jahrhundert mehrmals für Theater, Film und Fernsehen bearbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1081
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ellen Wood
Das Geheimnis von East Lynne
Ellen Wood
Das Geheimnis von
East Lynne
Roman
Aus dem Englischen neu übersetzt von Sebastian Vogel
Unter dem Titel East Lynne
erstmals erschienen 1861.
Übersetzung © 2021 Sebastian Vogel
Umschlaggestaltung © Sebastian Vogel
Umschlagbild: pixabay.com
Die Übersetzung wurde gefördert durch ein Stipendium aus dem Kulturstärkungspaket des Landes Nordrhein-Westfalen.
Verlag: Sebastian Vogel
Erikaweg 5
50169 Kerpen
www.uebersetzungen-vogel.de
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
ISBN 978-3-754113-26-4
Inhalt
Kapitel 1: Lady Isabel
Kapitel 2: Das zerbrochene Kreuz
Kapitel 3: Barbara Hare
Kapitel 4: Ein Gespräch im Mondschein
Kapitel 5: Mr. Carlyles Kanzlei
Kapitel 6: Richard Hare, der Jüngere
Kapitel 7: Hausherrin Miss Carlyle
Kapitel 8: Mr. Kanes Konzert
Kapitel 9: Lied und Totenklage
Kapitel 10: Die Wächter des Toten
Kapitel 11: Der neue Lord und die Banknote
Kapitel 12: Leben auf Castle Marling
Kapitel 13: Ein Spaziergang im Mondschein
Kapitel 14: Das Erstaunen des Earl
Kapitel 15: Heimkehr
Kapitel 16: Häusliche Schwierigkeiten
Kapitel 17: Der Besuch der Familie Hare
Kapitel 18: Miss Carlyle und die unglückliche Isabel
Kapitel 19: Captain Thorn in West Lynne
Kapitel 20: Fern von zuhause
Kapitel 21: Der Gefahr entgangen
Kapitel 22: Mrs. Hares Traum
Kapitel 23: Captain Thorn und die Rechnung
Kapitel 24: Richard Hare an Mr. Dills Fenster
Kapitel 25: Liebenswürdige Folgen
Kapitel 26: Für immer allein
Kapitel 27: Barbaras Vergehen
Kapitel 28: Ein unerwarteter Besucher in East Lynne
Kapitel 29: Eine nächtliche Invasion in East Lynne
Kapitel 30: Barbaras Herz kommt zur Ruhe
Kapitel 31: Mr. Dill und das bestickte Vorhemd
Kapitel 32: Die Begegnung von Lady Isabel und Afy
Kapitel 33: Sehnsüchte eines gebrochenen Herzens
Kapitel 34: Ein Abgeordneter für West Lynne
Kapitel 35: Ein Missgeschick mit der dunklen Brille
Kapitel 36: Ein russischer Bär in West Lynne
Kapitel 37: Mr. Carlyle wird zur Gänseleberpastete eingeladen
Kapitel 38: Die Welt steht Kopf
Kapitel 39: Mrs. Carlyle in großer Toilette, und Afy auch
Kapitel 40: Das Gerichtszimmer
Kapitel 41: Standhaft!
Kapitel 42: Der Prozess
Kapitel 43: Das Sterbezimmer
Kapitel 44: Lord Vane und der Aufschub
Kapitel 45: „Daraus wird nichts, Afy!“
Kapitel 46: Bis zur Ewigkeit
Kapitel 47: I. M. V.
Kapitel 1Lady Isabel
In einem Sessel der geräumigen, hübschen Bibliothek seines Wohnhauses saß William, Earl of Mount Severn. Seine Haare waren grau, die Glätte seiner breiten Stirn wurde durch vorzeitige Runzeln verunstaltet, und sein einstmals attraktives Gesicht trug die blassen, unverkennbaren Spuren der Ausschweifung. Einer seiner Füße ruhte, in Leinentücher gehüllt, auf dem weichen Samt der Ottomane und sprach so deutlich von Gicht, wie jemals ein Fuß davon gesprochen hatte. Wenn man den Mann ansah, wie er dort saß, hatte es den Anschein, als sei er vor der Zeit gealtert. So war es auch. Er zählte knapp neunundvierzig Jahre, aber in allem außer den Jahren war er ein alter Mann.
Eine bekannte Gestalt war er gewesen, der Earl of Mount Severn. Er war zwar weder ein angesehener Politiker noch ein großer General oder ein herausragender Staatsmann, ja nicht einmal aktives Mitglied im Oberhaus; all das waren nicht die Gründe, warum der Name des Earl in aller Munde gewesen war. Vielmehr kannte die Welt den Lord Mount Severn als Leichtsinnigsten unter den Leichtsinnigen, als Verschwenderischsten unter den Verschwendern, als größten aller Spieler und Lebenslustigsten, der die Lebenslustigen übertraf. Man sagte, seine Schwächen seien die in seinem Kopf; ein besseres Herz oder eine großzügigere Seele habe nie in einem menschlichen Körper gewohnt; und darin steckte viel Wahres. Für ihn wäre es gut und richtig gewesen, hätte er einfach als William Vane gelebt und sein Leben beendet. Bis zu seinem fünfundzwanzigsten Jahr war er fleißig und beständig gewesen, war seinen Verpflichtungen in der Juristenschule nachgekommen und hatte von früh bis spät studiert. Der nüchterne Fleiß von William Vane war unter den angehenden Anwälten in seiner Umgebung zu einem geflügelten Wort geworden; den Richter Vane nannten sie ihn ironisch; und vergeblich strebten sie danach, ihn in den Müßiggang und das Vergnügen zu locken. Der junge Vane war ehrgeizig und wusste, dass er sich mit seinem Aufstieg in der Welt auf seine eigenen Begabungen und Bestrebungen verlassen musste. Er kam aus einer guten, aber armen Familie und zählte den alten Earl of Mount Severn zu seinen Verwandten. Der Gedanke, dass er die Nachfolge in der Grafenwürde antreten könnte, kam ihm nie: Zwischen ihm und dem Titel standen drei gesunde Leben, zwei davon jung. Und doch waren diese weggestorben – einer am Gehirnschlag, einer in Afrika am Fieber, der dritte beim Bootfahren in Oxford; und so fand sich William Vane, der junge Student aus dem Temple, plötzlich als Earl of Mount Severn wieder, und als rechtmäßiger Bezieher von sechzigtausend im Jahr.
Als erstes kam ihm der Gedanke, er werde nie in der Lage sein, das Geld auszugeben, ja man könne gar nicht Jahr für Jahr eine solche Summe verbrauchen. Es war ein Wunder, dass die Beweihräucherung ihm nicht von vornherein den Kopf verdrehte, denn alle Klassen, von einem königlichen Herzog an abwärts, umschwärmten, umschmeichelten und hätschelten ihn. Er wurde zum attraktivsten Mann seiner Zeit, zum Löwen in der Gesellschaft; denn unabhängig von seinem frisch erworbenen Wohlstand und Titel war er von distinguiertem Aussehen und faszinierenden Manieren. Aber leider ließ die Klugheit, die William Vane, dem armen Studenten der Rechtswissenschaft, in seinen einsamen Kammern im Temple innegewohnt hatte, den jungen Earl of Mount Severn völlig im Stich, und er nahm seine Laufbahn mit einer solchen Geschwindigkeit in Angriff, dass alle biederen Menschen sagten, er werde sich Hals über Kopf ruinieren und zum Teufel gehen.
Aber als Angehöriger des Hochadels, dessen Erträge bei sechzigtausend pro Jahr liegen, ruiniert man sich nicht von einem Tag auf den anderen. Jetzt, in seinem neunundvierzigsten Jahr, saß der Earl in seiner Bibliothek, und der Ruin war immer noch nicht eingetreten – das heißt, er hatte ihn nicht überrollt. Aber die Verlegenheiten, in denen er sich befand und die sowohl zur Zerstörung seiner Seelenruhe geführt hatten als auch das Verderben seiner Existenz gewesen waren – wer kann sie beschreiben? Die Öffentlichkeit wusste recht gut darüber Bescheid, seine privaten Freunde kannten sie noch besser und seine Gläubiger am besten; aber niemand außer ihm selbst wusste oder konnte auch nur ahnen, welche beunruhigenden Qualen sein Los waren und ihn beinahe in den Wahnsinn trieben. Hätte er den Dingen vor Jahren geradewegs ins Gesicht gesehen und gespart, er hätte seine Position wiedergewinnen können; aber er hatte getan, was die meisten Menschen in solchen Fällen tun, hatte den Tag der Wahrheit auf unbestimmte Zeit vertagt und seine ungeheure Liste der Schulden weiter verlängert. Jetzt rückte die Stunde der Offenbarung und des Ruins unaufhaltsam heran.
Vielleicht dachte der Earl das auch selbst angesichts einer riesigen Masse von Papieren, die sich vor ihm über den Bibliothekstisch verteilten. Seine Gedanken weilten in der Vergangenheit. Es war eine törichte Verbindung gewesen, eine Gretna-Green-Verbindung der Liebe wegen, töricht, soweit die Klugheit reichte; aber die Gräfin hatte ihm als liebevolle Ehefrau zur Seite gestanden, hatte seine Torheiten und seine Nachlässigkeit ertragen, war für ihr einziges Kind eine bewunderungswürdige Mutter gewesen. Nur ein Kind hatten sie bekommen, und in dessen dreizehntem Jahr war die Gräfin gestorben. Wären sie mit einem Sohn gesegnet gewesen – über die langjährige Enttäuschung stöhnte der Graf noch heute –, er hätte vielleicht einen Ausweg aus seinen Schwierigkeiten gefunden. Sobald der Junge volljährig gewesen wäre, hätte er in gemeinsamer Anstrengung mit ihm die Kosten reduziert, und …
„Mylord“, sagte ein Diener, der gerade den Raum betreten hatte und die Luftschlösser des Earl einriss, „ein Gentleman möchte mit Ihnen sprechen.“
„Wer denn?“ rief der Earl schneidend, wobei er die Karte, die der Mann ihm brachte, nicht beachtete. Kein Unbekannter, selbst wenn er die äußeren Würden eines ausländischen Botschafters trug, wurde jemals kurzerhand zu Lord Mount Severn vorgelassen. Jahrelange Mahnungen hatten die Bediensteten Vorsicht gelehrt.
„Hier ist seine Karte, Mylord. Es ist Mr. Carlyle aus West Lynne.“
„Mr. Carlyle aus West Lynne“, seufzte der Earl, dessen Fuß gerade einen schrecklichen Schmerzstich spüren ließ. „Was will er? Führen Sie ihn herein.“
Der Bedienstete tat wie geheißen und führte Mr. Carlyle ins Zimmer. Sehen wir uns den Besucher gut an, denn er wird in dieser Geschichte seine Rolle zu spielen haben. Er war ein sehr großer Mann von siebenundzwanzig Jahren und bemerkenswert edler Erscheinung. Ein wenig hatte er die Tendenz, den Kopf zu neigen, wenn er mit jemandem sprach, der kleiner war als er selbst. Es war eine eigenartige Gewohnheit, fast könnte man von einer Gewohnheit zur Verbeugung sprechen; auch sein Vater hatte sie bereits besessen. Wenn man ihn darauf ansprach, lachte er und sagte, er sei sich dessen nicht bewusst. Seine Gesichtszüge waren angenehm, sein Teint blass und klar, die Haare dunkel, und die vollen Augenlider hingen ein wenig über den tiefgrauen Augen. Insgesamt war es eine Haltung, die Männer und Frauen gern betrachteten – das Zeichen eines ehrbaren, aufrichtigen Wesens; man hätte es weniger ein hübsches als vielmehr ein angenehmes und vornehmes Gesicht genannt. Zwar war er nur der Sohn eines Kleinstadtanwalts und immer dazu bestimmt gewesen, auch selbst Anwalt zu werden, aber er besaß die Ausbildung eines Gentleman, war in Rugby erzogen worden und hatte seinen Abschluss in Oxford gemacht. In der geradlinigen Art eines Geschäftsmannes ging er sofort auf den Earl zu – es war die Art eines Mannes, der in Geschäften kam.
„Mr. Carlyle“, sagte der Earl und streckte die Hand aus – er hatte immer als der liebenswürdigste Adlige seiner Zeit gegolten – „ich freue mich, Sie zu sehen. Wie Sie bemerken werden, kann ich nicht aufstehen, zumindest nicht ohne große Schmerzen und Unbequemlichkeit. Mein Feind, die Gicht, hat wieder von mir Besitz ergriffen. Nehmen Sie Platz. Wohnen sie hier im Ort?“
„Ich bin gerade von West Lynne gekommen. Es war der wichtigste Zweck meiner Reise, Eure Lordschaft zu sprechen.“
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte der Earl unbehaglich. Ihm war der Verdacht durch den Kopf gegangen, Mr. Carlyle könne für einen seiner vielen lästigen Gläubiger tätig sein.
Mr. Carlyle zog seinen Stuhl näher zum Earl und sagte leise:
„Mylord, mir ist ein Gerücht zu Ohren gekommen, wonach East Lynne zum Verkauf steht.“
„Einen Augenblick, Sir“, rief der Earl mit einer gewissen Zurückhaltung, um nicht zu sagen Hochnäsigkeit in der Stimme, „sprechen wir hier vertraulich als Ehrenmänner miteinander, oder verbirgt sich dahinter etwas anderes?“
„Ich verstehe Sie nicht“, sagte Mr. Carlyle.
„Mit einem Wort – entschuldigen Sie, dass ich deutlich werde, aber ich muss wissen, wo ich stehe – sind Sie im Auftrag eines meiner niederträchtigen Gläubiger hier, um mir Informationen aus der Nase zu ziehen, die Sie ansonsten nicht bekämen?“
„Mylord“, entgegnete der Besucher, „zu einer so unehrenhaften Handlungsweise wäre ich nicht in der Lage. Ich weiß, dass man einem Anwalt zutraut, nur sehr lockere Vorstellungen von dem Begriff der Ehre zu haben, aber Sie können mich kaum verdächtigen, dass ich mich schuldig gemacht hätte, unter der Hand gegen Sie zu arbeiten. Soweit ich mich erinnere, habe ich mich nie in meinem Leben eines niederträchtigen Kunstgriffs bedient, und ich glaube auch nicht, dass dies in Zukunft geschehen wird.“
„Verzeihen Sie mir, Mr. Carlyle. Wenn Sie nur die Hälfte der Tricks und Listen kennen würden, mit denen man mir mitgespielt hat, würden Sie sich nicht wundern, dass ich die ganze Welt im Verdacht habe. Fahren Sie mit Ihren Ausführungen fort.“
„Ich habe gehört, dass East Lynne privat zum Verkauf steht; Ihr Rechtsbeistand hat so etwas im Vertrauen mir gegenüber durchblicken lassen. Wenn es stimmt, wäre ich gern der Käufer.“
„Für wen?“, erkundigte sich der Earl.
„Für mich selbst.“
„Für Sie!“, lachte der Earl. „Rechtsanwalt kann wahrhaftig nicht so ein schlechter Beruf sein, Carlyle.“
„Das ist er auch nicht“, gab Mr. Carlyle zurück, „jedenfalls wenn man so umfangreiche, erstklassige Beziehungen hat wie wir. Aber man muss daran denken, dass mein Onkel mir ein schönes Vermögen hinterlassen hat, und von meinem Vater war es ein großes.“
„Ich weiß. Ebenfalls Einnahmen aus der Anwaltstätigkeit.“
„Nicht nur. Meine Mutter hat ein Vermögen mit in die Ehe gebracht, und damit konnte mein Vater erfolgreich spekulieren. Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Anwesen, in das ich mein Geld investieren könnte, und East Lynne wäre für mich geeignet, vorausgesetzt, ich bekomme das Vorkaufsrecht und wir können uns über die Konditionen einigen.“
Lord Mount Severn grübelte einen Augenblick, bevor er etwas sagte. „Mr. Carlyle“, setzte er an, „meine Angelegenheiten stehen sehr schlecht, und irgendwo muss ich schnelles Geld auftreiben. Nun ist East Lynne nicht an die Familie gebunden, und es ist auch nicht annähernd bis zu seinem Wert mit Hypotheken belastet, aber letztere Tatsache ist, wie Sie sich vorstellen können, der Welt nicht allgemein geläufig. Als ich es vor achtzehn Jahren zu einem guten Preis kaufte, waren Sie, soweit ich mich erinnere, der Anwalt der Gegenpartei.“
„Mein Vater“, lächelte Mr. Carlyle. „Ich war damals noch ein Kind.“
„Natürlich, ich hätte sagen sollen, Ihr Vater. Wenn ich East Lynne verkaufe, bekomme ich ein paar tausend in die Hand, nachdem die Ansprüche daran befriedigt sind; ich habe kein anderes Mittel, um Wind in meine Segel zu bekommen, und deshalb habe ich mich entschlossen, mich davon zu trennen. Aber eines müssen Sie verstehen: Wenn allgemein bekannt wird, dass East Lynne nicht mehr mir gehört, habe ich die Hornissen um die Ohren; das Ganze muss also vollkommen diskret ablaufen. Verstehen Sie das?“
„Vollkommen“, erwiderte Mr. Carlyle.
„Ich nehme an, Sie würden es ebenso schnell kaufen wie irgendein anderer, falls wir uns, wie Sie sagen, auf die Konditionen einigen können.“
„Was erwarten Eure Lordschaft dafür – als grobe Schätzung?“
„Was die Einzelheiten angeht, muss ich Sie an meine geschäftlichen Vertreter Warburton & Ware verweisen. Nicht weniger als siebzigtausend Pfund.“
„Zu viel, Mylord“, rief Mr. Carlyle entschieden.
„Das ist noch nicht einmal sein Wert“, gab der Earl zurück.
„Bei solchen Notverkäufen wird nie der wahre Wert erzielt“, antwortete der Anwalt unverblümt. „Bevor mir Beauchamp den Hinweis gab, hatte ich gedacht, East Lynne sei für die Tochter Eurer Lordschaft vorgesehen.“
„Für sie ist nichts vorgesehen“ antwortete der Earl, wobei sich das Runzeln seiner Stirn deutlicher zeigte. „Das kommt von euren gedankenlosen Weglauf-Ehen. Ich habe mich in die Tochter von General Conway verliebt, und sie ist mit mir weggelaufen wie ein Trottel; das heißt, was die Unannehmlichkeiten angeht, waren wir beide Trottel. Der General hatte etwas gegen mich und sagte, ich müsse mir die Hörner abstoßen, bevor er mir Mary geben könne; also habe ich sie mit nach Gretna Green genommen, und sie wurde ohne Ehevertrag zur Gräfin von Mount Severn. Wenn man alles zusammennimmt, war es eine unglückselige Affäre. Als der General erfuhr, dass sie durchgebrannt war, hat es ihn umgebracht.“
„Umgebracht!“, warf Mr. Carlyle ein.
„Ja, wirklich. Er war herzkrank, und die Aufregung hat zur Krise geführt. Von diesem Augenblick an war meine arme Ehefrau nie mehr glücklich; sie machte sich selbst für den Tod ihres Vaters verantwortlich, und ich glaube, das führte dazu, dass auch sie starb. Sie war jahrelang krank; die Ärzte nannten es Schwindsucht; aber es war eher ein gefühlloses Dahinschwinden, und die Schwindsucht war in ihrer Familie nie vorgekommen. Weglauf-Ehen sind nie vom Glück gesegnet; das ist mir seither in vielen, vielen Fällen aufgefallen; so etwas wendet sich immer zum Schlechten.“
„Man hätte auch nach der Eheschließung noch einen Vertrag schließen können“, warf Mr. Carlyle ein, denn der Earl schwieg und schien seinen Gedanken nachzuhängen.
„Ich weiß; aber es geschah nicht. Meine Frau und ich besaßen kein Vermögen; ich war in meiner Laufbahn der Ausschweifungen schon weit vorangekommen, und keiner von uns dachte daran, für zukünftige Kinder vorzusorgen; oder wenn wir daran dachten, taten wir es nicht. Ein altes Sprichwort, Mr. Carlyle, sagt: Was man jederzeit tun kann, wird nie getan.“
Mr. Carlyle verbeugte sich.
„Mein Kind ist also mittellos“, fuhr der Earl mit einem unterdrückten Seufzen fort. „Wenn ich in ernster Stimmung bin, geht mir immer wieder der Gedanke durch den Kopf, wie peinlich es für sie sein könnte, wenn ich sterbe, bevor sie im Leben ihren Platz gefunden hat. Sie wird gut heiraten, daran gibt es wenig Zweifel, denn sie besitzt Schönheit in seltenem Maße und ist ohne Leichtsinn oder Ziererei aufgewachsen, wie es sich für ein englisches Mädchen gehört. In den ersten zwölf Jahren ihres Lebens wurde sie von ihrer Mutter erzogen, und die war abgesehen von der törichten Handlung, zu der ich sie überredet habe, die Güte und Vornehmheit selbst; danach gab es eine bewundernswerte Gouvernante. Keine Angst, sie wird nicht nach Gretna Green flüchten.“
„Sie war ein sehr liebenswertes Kind“, stimmte der Anwalt zu. „Daran erinnere ich mich.“
„Jaja; Sie haben sie in East Lynne zu Lebzeiten ihrer Mutter gesehen. Aber kommen wir zurück aufs Geschäftliche. Wenn Sie der Käufer des Anwesens East Lynne werden, Mr. Carlyle, muss es unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschehen. Das Geld, das es mir bringt, nachdem ich die Hypothek abgelöst habe, muss ich, wie ich Ihnen gesagt habe, für meine privaten Zwecke nutzen; und Sie wissen, dass ich keinen Farthing davon sehen werde, wenn die breite Öffentlichkeit das Geringste von der Transaktion erfährt. In den Augen der Welt muss Lord Mount Severn der Eigentümer von East Lynne sein – zumindest noch für kurze Zeit danach. Vielleicht haben Sie dagegen keine Einwände.“
Mr. Carlyle dachte nach, bevor er antwortete; dann wurde das Gespräch wieder aufgenommen und man einigte sich darauf, dass er am nächsten Morgen als Erstes bei Warburton und Ware vorsprechen und sich mit ihnen beraten würde. Als er sich erhob und gehen wollte, war es schon spät.
„Bleiben Sie und essen Sie mit mir zu Abend“, sagte der Earl.
Mr. Carlyle zögerte und blickte an seiner Kleidung herunter – einem einfachen, eines Gentlemans würdigen Morgenanzug, der aber sicher nicht das richtige Gewand für ein Abendessen am Tisch eines Adligen war.
„Ach, das macht nichts“, sagte der Earl. „Wir werden ganz allein sein, abgesehen von meiner Tochter. Mrs. Vane vom Castle Marling wohnt bei uns. Sie ist gekommen und hat mein Kind mit in den Salon gebracht, aber soweit ich gehört habe, wird sie heute auswärts essen. Wir werden also ganz unter uns sein. Gestatten sie mir zu läuten, Mr. Carlyle.“
Der Diener trat ein.
„Fragen Sie, ob Mrs. Vane zu Hause speist“, sagte der Earl.
„Mrs. Vane speist außer Haus, Mylord“, lautete die sofortige Antwort des Mannes. „Der Wagen steht schon vor der Tür.“
„Sehr gut. Mr. Carlyle bleibt hier.“
Um sieben Uhr wurde das Abendessen angekündigt, und der Earl rollte ins Nachbarzimmer. Als er mit Mr. Carlyle durch die eine Tür hereinkam, trat jemand anderes auf der gegenüberliegenden Seite ein. Wer – was – war es? Mr. Carlye sah hin und war sich nicht ganz sicher, ob er ein menschliches Wesen vor sich hatte – fast dachte er, es sei ein Engel.
Eine leichte, grazile, mädchenhafte Gestalt; ein Gesicht von überragender Schönheit, einer Schönheit, wie man sie nur selten sieht, außer in der Fantasie eines Malers; dunkle, glänzende Locken, glatt wie die eines Kindes, fielen über Hals und Schultern. Helle, zarte, mit Perlen geschmückte Arme und ein fließendes Gewand mit kostbaren weißen Bändern. Der ganze Anblick wirkte auf den Anwalt, als käme er aus einer besseren Welt.
„Meine Tochter, Mr. Carlyle, die Lady Isabel.“
Sie nahmen ihre Plätze am Tisch ein. Lord Mount Severn saß trotz seiner Gicht und seines Fußschemels am Kopf, die junge Dame und Mr. Carlyle einander gegenüber. Mr. Carlyle hatte sich selbst nie für einen besonderen Bewunderer weiblicher Schönheit gehalten, aber die außergewöhnliche Anmut der jungen Frau vor ihm raubte ihm fast die Sinne und die Selbstbeherrschung. Und doch faszinierte ihn weniger der vollkommene Umriss der außergewöhnlichen Züge oder das Damastweiß der zarten Wangen oder die üppig fallenden Haare; nein, es war der liebenswürdige Ausdruck der weichen, dunklen Augen. Nie in seinem Leben hatte er so angenehme Augen gesehen. Er konnte den Blick nicht von ihr wenden, und als er sich mit ihrem Gesicht vertraut gemacht hatte, wurde ihm klar, dass in ihrem Charakter ein trauriger, bekümmerter Zug lag; man bemerkte ihn nur hin und wieder, wenn die Gesichtszüge entspannt waren, und dann vorwiegend in den Augen, die er so bewunderte. Ein solcher unbewusst bekümmerter Ausdruck zeigt sich nur dann, wenn er ein sicheres Kennzeichen für Kummer und Leid ist; aber das verstand Mr. Carlyle nicht. Und wer würde Kummer schon mit der voraussichtlich glänzenden Zukunft von Isabel Vane in Verbindung bringen?
„Isabel“, bemerkte der Earl, „was bist du herausgeputzt!“
„Ja, Papa. Ich wollte die alte Mrs. Levison nicht auf den Tee warten lassen. Sie nimmt ihn gern früh, und Mrs. Vane musste sie bis zum Abendessen vertrösten. Es war halb sieben, als sie von hier abgefahren ist.“
„Ich hoffe, du kommst heute Abend nicht zu spät, Isabel.“
„Das hängt von Mrs. Vane ab.“
„Dann wird es sicher spät. Wenn die jungen Damen in dieser unserer modischen Welt die Nacht zum Tage machen, ist das schlecht für ihre frische Röte. Was sagen Sie dazu, Mr. Carlyle?“
Mr. Carlyle sah die frische Röte auf den Wangen gegenüber am Tisch; sie sah so leuchtend aus, dass sie nicht schnell verblassen konnte.
Als das Abendessen zu Ende war, trat ein Dienstmädchen ein. Sie hatte einen weißen Kaschmirmantel in der Hand, legte ihn über die Schultern der jungen Dame und sagte, der Wagen stehe bereit.
Lady Isabel ging zum Earl. „Auf Wiedersehen, Papa.“
„Gute Nacht, mein Liebes“, antwortete er, zog sie an sich und küsste ihr liebliches Gesicht. „Sage Mrs. Vane, ich möchte nicht, dass du bis zum frühen Morgen ausgehst. Du bist noch ein Kind. Mr. Carlyle, würden Sie läuten? Mir ist es verwehrt, meine Tochter zum Wagen zu begleiten.“
„Wenn Eure Lordschaft mir gestatten würden – wenn Lady Isabel es mir verzeiht, dass jemand sie begleitet, der es kaum gewohnt ist, jungen Damen aufzuwarten, wäre es mir ein Vergnügen, sie zum Wagen zu bringen“, war seine ein wenig verwirrte Antwort auf Mr. Carlye, während er die Glocke betätigte.
Der Earl dankte ihm und die junge Dame lächelte. Mr. Carlye führte sie durch das breite, erleuchtete Treppenhaus hinunter, stand barhäuptig an der Tür der luxuriösen Kutsche und half ihr beim Einsteigen. Sie streckte in ihrer geradlinigen, angenehmen Art die Hand aus und wünschte ihm eine gute Nacht. Die Kutsche rollte davon, und Mr. Carlyle kehrte zum Earl zurück.
„Nun, ist sie nicht ein hübsches Mädchen?“, wollte er wissen.
„Hübsch ist nicht das richtige Wort für eine solche Schönheit“, antwortete Mr. Carlyle mit leiser, warmer Stimme. „Ich habe nie ein Gesicht gesehen, das auch nur halb so schön gewesen wäre.“
„Sie hat letzte Woche im Salon ziemliches Aufsehen erregt – jedenfalls habe ich das gehört. Diese ewige Gicht hält mich die ganze Zeit hier drinnen fest. Übrigens ist sie so gut, wie sie schön ist.“
Der Earl übertrieb nicht. Lady Isabel war von der Natur auf wundersame Weise beschenkt worden, und das nicht nur in Geist und Charakter, sondern auch im Herzen. Eine modische junge Dame war sie so wenig, wie es überhaupt möglich war, zum Teil weil man sie bisher von der weiten Welt abgeschirmt hatte, zum Teil aber auch wegen ihrer gewissenhaften Erziehung. Zu Lebzeiten ihrer Mutter war sie gelegentlich in East Lynne gewesen, meist aber auf Mount Severn, dem größeren Landsitz des Earl in Wales. Nachdem ihre Mutter gestorben war, hatte sie sich ausschließlich auf Mount Severn aufgehalten, und zwar unter der Obhut einer umsichtigen Gouvernante in einem sehr kleinen Haushalt, der für sie unterhalten wurde, wobei der Earl ihnen nur gelegentlich spontane, flüchtige Besuche abstattete. Sie war großzügig und wohlwollend, bis zu einem gewissen Grade furchtsam und sensibel und zu allen freundlich und rücksichtsvoll. Man sollte nicht darüber nörgeln, dass sie so gepriesen wird – bewundern und lieben wir sie lieber, denn jetzt, in ihrer arglosen Mädchenhaftigkeit, hat sie es verdient; die Zeit wird kommen, da solches Lob fehl am Platze wäre. Hätte der Earl vorhersehen können, welches Schicksal dieses Kind ereilen würde, er hätte es vorgezogen, sie in seiner Liebe so, wie sie vor ihm stand, totzuschlagen, statt zu dulden, dass sie es auf sich nahm.
Kapitel 2Das zerbrochene Kreuz
Lady Isabels Kutsche setzte ihren Weg fort und brachte sie zum Wohnsitz von Mrs. Levison. Die Dame war fast achtzig Jahre alt und in Sprache und Betragen sehr ernst oder, wie Mrs. Vane es ausdrückte, „griesgrämig“. Als Isabel eintrat, sah Mrs. Levison aus wie der Inbegriff der Ungeduld: Ihre Haube war schief aufgesetzt, und sie nestelte an ihrem schwarzen Satinkleid. Mrs. Vane hatte sie beim Abendessen warten lassen, und Isabel hielt sie vom Tee ab; so etwas verträgt sich nicht mit den Alten, mit ihrer Gesundheit oder ihrer Laune.
„Ich fürchte, ich komme spät“ rief Lady Isabel aus, während sie auf Mrs. Levison zuging, „aber heute hat ein Gentleman mit Papa zu Abend gegessen und uns etwas länger am Tisch festgehalten.“
„Du bist fünfundzwanzig Minuten über die Zeit“, rief die alte Dame streng, „und ich will meinen Tee. Emma, bestelle ihn.“
Mrs. Vane läutete und tat, wie man sie geheißen hatte. Sie war eine kleine Frau von sechsundzwanzig Jahren mit sehr schlichtem Gesicht, aber elegant in ihrer Erscheinung, sehr verfeinert und eitel bis in die Fingerspitzen. Ihre verstorbene Mutter war Mrs. Levisons Tochter gewesen, und ihr Ehemann Raimond Vane war der mutmaßliche Erbe des Adelsgeschlechts von Mount Severn.
„Möchtest du nicht diese Pelerine ablegen, Kind?“, fragte Mrs. Levison; von den neumodischen Namen für solche Kleidungsstücke – Mäntel, Burnusse und dergleichen – verstand sie nichts; Isabel warf den Mantel ab und setzte sich neben sie.
„Der Tee ist noch nicht zubereitet, Großmutter!“, rief Mrs. Vane in erstauntem Tonfall, als die Dienerin mit dem Tablett und der Silberkanne erschien. „Du willst ihn doch sicher nicht im Zimmer zubereiten lassen.“
„Wo soll ich ihn denn sonst zubereiten lassen?“, erkundigte sich Mrs. Levison.
„Es ist doch viel bequemer, ihn fertig hereinbringen zu lassen“, sagte Mrs. Vane. „Es ist so embarrassée, ihn zuzubereiten.“
„Ach, wirklich!“, war die Antwort der alten Dame; „und dann schwappt er in den Untertassen über und ist kalt wie Milch! Du warst immer faul, Emma – und du neigst dazu, diese französischen Wörter zu verwenden. Ich für mein Teil würde mir ein gedrucktes Etikett ‚Ich spreche Französisch‘ auf die Stirn kleben und es so die ganze Welt wissen lassen.“
„Wer macht dir im Allgemeinen den Tee?“, fragte Mrs. Vane und warf Isabel hinter dem Rücken ihrer Großmutter einen verächtlichen Blick zu.
Aber Lady Isabel senkte furchtsam die Augen, und auf ihren Wangen erschien ein leuchtendes Rosa. Sie mochte es nicht, wenn es aussah, als würde sie sich von Mrs. Vane, ihrer Aufsichtsperson und dem Gast ihres Vaters, unterscheiden, aber ihr Inneres lehnte sich gegen den Gedanken auf, gegenüber einem betagten Familienmitglied Undankbarkeit oder Spott zu zeigen.
„Harriet kommt und bereitet ihn für mich zu“, erwiderte Mrs. Levison. „Ja, und sie setzt sich auch zu mir und trinkt ihn mit mir, wenn ich allein bin, was recht oft vorkommt. Was sagen Sie dazu, Madame Emma – Sie, mit Ihren feinen Vorstellungen?“
„Wie es dir beliebt, natürlich, Großmutter.“
„Und da steht der Teewagen neben deinem Ellenbogen, und die Kanne dampft, und wenn wir heute Abend noch Tee trinken wollen, sollte man ihn besser zubereiten.“
„Ich weiß nicht, wie viel ich hineingeben soll“, murrte Mrs. Vane. Sie hatte die größte Abscheu davor, ihre Hände oder die Handschuhe zu beschmutzen; kurz gesagt, hegte sie eine ganz besondere Abneigung dagegen, irgendetwas Nützliches zu tun.
„Soll ich ihn zubereiten, liebe Mrs. Levison?“, fragte Isabel und erhob sich voller Eifer. „Früher habe ich den Tee ebenso oft gemacht wie meine Gouvernante in Mount Severn, und ich mache ihn auch für Papa.“
„Tuʼ das, Kind“, erwiderte die alte Dame. „Du bist so viel wert wie zehn von der da.“
Isabel lachte vergnügt, legte die Handschuhe ab und setzte sich an den Tisch; in diesem Augenblick schlenderte ein junger, eleganter Mann ins Zimmer. Mit seinen scharf geschnittenen Gesichtszügen, den dunklen Augen, den rabenschwarzen Haaren und den weißen Zähnen musste man ihn als gut aussehend bezeichnen; für den aufmerksamen Beobachter hatten diese Eigenschaften allerdings keinen anziehenden Ausdruck, und die dunklen Augen hatten die starke Eigenart, wegzusehen, wenn er mit jemandem sprach. Es war Francis, Captain Levison.
Er war ein Enkel der alten Dame und Cousin ersten Grades von Mrs. Vane. Die wenigsten Männer waren in ihrem Betragen zu allen Zeiten und Gelegenheiten in Gesicht und Gestalt so faszinierend, die wenigsten gewannen so vollständig in den Ohren ihrer Zuhörer, und die wenigsten waren in ihrenm tiefsten Inneren so herzlos. Die Welt lag ihm zu Füßen, die Gesellschaft ehrte ihn; aber obwohl er ein rücksichtsloser Verschwender war – und dass er es war, wusste man –, würde er vermutlich zum Erben des reichen, alten Sir Peter Levison werden.
Die betagte Dame ergriff das Wort: „Captain Levison, Lady Isabel Vane.“ Beide nahmen die Vorstellung zur Kenntnis; und Isabel, die in den Angelegenheiten der großen Welt noch ein Kind war, wurde dunkelrot unter den bewundernden Blicken, die der junge Gardist ihr zuwarf. Seltsam – seltsam, dass sie die Bekanntschaft dieser beiden Männer am gleichen Tag machte, ja fast zur gleichen Stunde; der beiden, die unter allen Angehörigen des Menschengeschlechts den größten Einfluss auf ihr zukünftiges Leben haben sollten!
„Das ist ein hübsches Kreuz, mein Kind“, rief Mrs. Levison, als Isabel neben ihr stand, nachdem die Teestunde vorüber war und sie im Begriff stand, nach dem abendlichen Besuch mit Mrs. Vane abzufahren.
Damit meinte sie ein goldenes Kreuz mit sieben eingelegten Smaragden, das Isabel um den Hals trug. Es war von leichter, zarter Machart und hing an einer dünnen, kurzen Goldkette.
„Ist es nicht hübsch?“, erwiderte Isabel. „Meine liebe Mama hat es mir geschenkt, kurz bevor sie gestorben ist. Warten Sie, ich nehme es für Sie ab. Ich trage es nur bei besonderen Gelegenheiten.“
Und dies hier, ihr erster Auftritt bei der Großherzogin, schien dem einfach erzogenen, unerfahrenen Mädchen eine ganz besondere Gelegenheit zu sein. Sie öffnete den Verschluss der Kette und legte sie mit dem Kreuz in Mrs. Levisons Hände.
„Nun, ich stelle fest, du trägst keinen Schmuck außer diesem Kreuz und ein paar armseligen Perlenarmbändern!“, sagte Mrs. Vane zu Isabel. „Ich hatte dich noch gar nicht genau angesehen.“
„Beides hat mir Mama geschenkt. Die Armbänder hat sie selbst oft getragen.“
„Du altmodisches Kind! Dass deine Mama dieser Armbänder vor Jahren getragen hat – ist das ein Grund, dass auch du sie trägst?“, gab Mrs. Vane zurück. „Warum legst du nicht deine Diamanten an?“
„Ich … hatte … meine Diamanten angelegt. Aber ich … habe sie wieder ausgezogen“, stammelte Isabel.
„Warum um alles in der Welt?“
„Ich wollte nicht zu fein aussehen“, antwortete Isabel mit einem Lachen und errötete. „Sie haben so geglitzert! Ich habe gefürchtet, man könnte denken, ich hätte sie nur angelegt, um fein auszusehen.“
„Aha! Du willst dich also offensichtlich in die Klasse von Menschen einordnen, die so tun, als würden sie Schmuck verabscheuen“, bemerkte Mrs. Vane. „Das ist die höchste Verfeinerung der Affektiertheit, Lady Isabel.“
Der Spott klang in Lady Isabels Ohren harmlos. Sie glaubte einfach, irgendetwas habe Mrs. Vane die Laune verdorben. Das stimmte sicher auch; und dieses Etwas war – auch wenn Isabel es kaum vermutet hätte – die offenkundige Bewunderung, die Captain Levison ihrer frischen, jungen Schönheit entgegenbrachte; sie nahm ihn ganz in Anspruch und machte ihn sogar nachlässig gegenüber Mrs. Vane.
„Hier, Kind, nimm dein Kreuz“, sagte die alte Dame. „Es ist sehr hübsch; an deinem Hals ist es hübscher als Diamanten es wären. Du brauchst keine Verschönerung; machʼ dir nichts daraus, was Emma sagt.“
Francis Levison nahm ihr das Kreuz mit der Kette aus der Hand und gab es an Lady Isabel weiter. Ob er ungeschickt war oder ob sie die Hände voll hatte – sie musste ihre Handschuhe und das Taschentuch festhalten, außerdem hatte sie gerade den Mantel abgelegt – jedenfalls fiel es zu Boden; und in seinem zu schnellen Versuch, es aufzufangen, gelang es dem Gentleman, mit dem Fuß darauf zu treten. Das Kreuz war entzweigebrochen.
„Da! Wer ist denn nun daran schuld?“, rief Mrs. Levison.
Isabel antwortete nicht; es ging ihr zu Herzen. Sie nahm das zerbrochene Kreuz, und die Tränen liefen ihr aus den Augen; sie konnte es nicht verhindern.
„Warum denn das! Du weinst doch wohl nicht über so ein lächerliches Kreuz!“, sagte Mrs. Vane und unterbrach damit Captain Levisons Ausdruck des Bedauerns über seine Ungeschicklichkeit.
„Du kannst es löten lassen, mein Liebes“, warf Mrs. Levison ein.
Lady Isabel schluckte die Tränen herunter und wandte sich mit fröhlichem Blick Captain Levison zu. „Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe“, sagte sie gutmütig; „es war ebenso gut meine Schuld wie Ihre; und wie Mrs. Levison schon sagte, kann ich es löten lassen.“
Während sie sprach, löste sie den oberen Teil des Kreuzes von der Kette und legte sich diese um den Hals.
„Du wirst doch nicht diese dünne Goldkette und sonst nichts umlegen!“, meinte Mrs. Vane.
„Warum nicht?“, gab Isabel zurück. „Wenn die Leute etwas sagen, kann ich ihnen erklären, dass mit dem Kreuz ein Missgeschick passiert ist.“
Mrs. Vane brach in spöttisches Gelächter aus. „Wenn die Leute etwas sagen!“, wiederholte sie in einem Tonfall, der zum Lachen passte. „Sie werden nicht ‚etwas sagen‘, sondern annehmen, dass die Tochter von Lord Mount Severn an einem unglückseligen Mangel an Schmuck leidet.“
Isabel lächelte und schüttelte den Kopf. „Im Salon haben sie meine Diamanten gesehen.“
„Wenn du mir etwas so Ungeschicktes angetan hättest, Frank Levison“, platzte die alte Dame heraus, „wären meine Türen dir einen Monat lang verschlossen geblieben. Emma, wenn du gehen willst, dann gehst du besser; ausgehen und den Abend um zehn Uhr in der Nacht beginnen! Zu meiner Zeit sind wir um sieben ausgegangen; aber heutzutage ist es Sitte, die Nacht zum Tag zu machen.“
„Damals, als George der Dritte um ein Uhr nachts gekochten Hammel und Rüben aß“, warf der schamlose Captain ein; er brachte seiner Großmutter sicher keine größere Verehrung entgegen als Mrs. Vane.
Während er sprach, wandte er sich zu Isabel, um sie die Treppe hinunter zu begleiten. So wurde sie zum zweiten Mal in dieser Nacht von einem Fremden zu ihrer Kutsche gebracht. Mrs. Vane ging allein hinunter, so gut sie konnte, und dabei besserte sich ihre Laune nicht.
„Gute Nacht“, sagte sie zu dem Captain.
„Ich werde nicht Gute Nacht sagen. Sie finden mich dort fast sobald Sie dort sind.“
„Sie haben mir gesagt, sie würden nicht kommen. Irgendeine Junggesellenfeier sei dazwischen gekommen.“
„Ja, aber ich habe es mir anders überlegt. Leben Sie einstweilen wohl, Lady Isabel.“
„Wie wirst du denn aussehen, mit nichts um den Hals außer einer Schulmädchenkette!“, setzte Mrs. Vane an und kehrte damit zu dem Missstand zurück, während sie mit der Kutsche davonfuhren.
„Ach, Mrs. Vane, was hat das zu bedeuten? Ich kann an nichts anderes denken als an mein zerbrochenes Kreuz. Das ist doch sicher ein schlechtes Omen.“
„Ein schlechtes – was?“
„Ein schlechtes Omen. Mama hat mir das Kreuz geschenkt, als sie im Sterben lag. Sie hat mir gesagt, es soll mein Glücksbringer sein, und ich soll es immer sorgfältig aufbewahren; und wenn ich Kummer hätte oder einen Rat bräuchte, solle ich es ansehen und mich daran zu erinnern versuchen, was sie mir geraten hätte, um dann entsprechend zu handeln. Und jetzt ist es zerbrochen – zerbrochen!“
Eine flackernde Gaslaterne warf einen Lichtblitz in die Kutsche und genau in Isabels Gesicht. „Ich stelle fest, du weinst schon wieder!“, sagte Mrs. Vane. „Eines sage ich dir, Isabel: Ich werde keine roten Augen zur Herzogin von Dartfort begleiten. Wenn du also nicht aufhören kannst, werde ich den Kutscher anweisen, dich nach Hause zu fahren, und dann allein hingehen.“
Isabel trocknete sich kleinlaut die Augen ab und seufzte dabei tief. „Ich glaube schon, dass man die Stücke wieder zusammensetzen kann, aber für mich wird es nie wieder dasselbe Kreuz sein.“
„Was hast du mit den Stücken gemacht?“, fragte Mrs. Vane gereizt.
„Ich habe sie in das Seidenpapier eingewickelt, das Mrs. Levison mir gegeben hat, und sie in mein Röckchen gesteckt. Hier ist es“, sagte sie, wobei sie sich an den Körper fasste. „Ich habe keine Tasche dabei.“
Mrs. Vane ließ ein Stöhnen hören. Sie war selbst nie ein Mädchen gewesen – schon mit zehn Jahren war sie eine Frau; sie beglückwünschte Isabel dazu, dass die kaum besser sei als eine Schwachsinnige. „In mein Röckchen gesteckt!“, stieß sie mit beißendem Spott hervor. „Und du willst achtzehn Jahre alt sein! Ich hatte mir vorgestellt, du hättest die ‚Röckchen‘ im Kinderzimmer gelassen. Schämʼ dich, Isabel!“
„Ich wollte sagen, in mein Kleid“, korrigierte sich Isabel.
„Du wolltest sagen, du bist ein dummes Baby!“, lautete der unausgesprochene Kommentar von Mrs. Vane.
Einige Minuten später hatte Isabel ihren Kummer vergessen. Die prächtigen Räumlichkeiten waren für sie wie eine verzauberte Szene aus einem Traumland; ihr Herz befand sich im Frühling der ersten Frische, und die Sättigung mit Erfahrungen hatte sich noch nicht eingestellt. Wie konnte sie an Schwierigkeiten oder sogar an das zerbrochene Kreuz denken, als sie sich den Huldigungen zuneigte, die ihr entgegengebracht wurden, und die honigsüßen Worte in sich aufsaugte, die man ihr in die Ohren träufelte?
„Hallooo!“, rief ein Student aus Oxford mit Aussicht auf eine lange Einkünfteliste, der sich an die Wand drückte, um den Tänzern nicht im Wege zu sein. „Ich dachte, Sie hätten es aufgegeben, an solche Orte zu kommen?“
„Das hatte ich auch“, erwiderte der angesprochene flotte Adlige, der Sohn eines Marquis. „Aber ich bin auf der Suche, und deshalb muss ich wieder herkommen. Für mich ist ein Ballsaal das Langweiligste auf der Welt.“
„Auf der Suche wonach?“
„Nach einer Ehefrau. Mein alter Herr hat mir die Unterstützung gestrichen und bei seinem Bart geschworen, keinen Schilling mehr herauszurücken und keine Schulden zu bezahlen, bis ich mich gebessert habe. Als ersten Schritt in diese Richtung besteht er auf einer Ehefrau, und ich versuche, mich für eine zu entscheiden, denn ich stecke tiefer in den Schulden, als Sie sich vorstellen können.“
„Dann nehmen Sie doch die neue Schönheit.“
„Wer ist sie?“
„Lady Isabel Vane.“
„Verbindlichsten Dank für den Vorschlag“, erwiderte der Earl. „Aber man möchte doch gern einen respektablen Schwiegervater haben, und Mount Severn wird vor die Hunde gehen. Er und ich, wir sind zu sehr auf der gleichen Linie und könnten auf lange Sicht zusammenrasseln.“
„Man kann nicht alles haben; die Schönheit des Mädchens geht über das Übliche hinaus. Ich habe gesehen, wie dieser Wüstling Levison sich an sie herangemacht hat. Er bildet sich ein, er könnte alle anderen ausstechen, wenn es um Frauen geht.“
„Das schafft er oft“, war die leise Antwort.
„Ich mag den Burschen nicht! Er ist so von sich eingenommen mit den gelockten Haaren und den blitzenden Zähnen und der weißen Haut; und er ist herzlos wie eine Eule. Was war das für eine vertuschte Angelegenheit mit Miss Charteris?“
„Wer weiß das schon? Levison hat sich aus der Affäre gezogen wie ein Aal, und die Frau hat sich beklagt, andere würden sich an ihm mehr versündigen als er sich an anderen. Drei Viertel von allen haben ihr geglaubt.“
„Und sie ist ins Ausland gegangen und gestorben; da kommt Levison ja schon! Und die Tochter von Mount Severn mit ihm.“
Im gleichen Augenblick kamen Francis Levison und Lady Isabel näher. Zum zehnten Mal an diesem Abend brachte er sein Bedauern über das unangenehme Missgeschick mit dem Kreuz zum Ausdruck. „Ich habe das Gefühl, als könne ich das nie wieder gutmachen“, flüsterte er. „Mir ist, als würde die aus tiefsten Herzen kommende Huldigung meines ganzen Lebens als Ausgleich nicht ausreichen.“
Er sprach in einem Tonfall der mitreißenden Herzlichkeit – angenehm für das Ohr, aber gefährlich für das Herz. Lady Isabel blickte auf und begegnete seinen Augen, die sie voller tiefster Zärtlichkeit anblickten – in einer Sprache, die ihr noch nie begegnet war. Wieder breitete sich auf ihren Wangen eine lebhafte Röte aus, ihre Augenlider senkten sich, und ihre angstvollen Worte starben im Schweigen dahin.
„Vorsicht, Vorsicht, meine junge Lady Isabel“, murmelte der Oxforder halblaut, als sie an ihm vorübergingen. „Dieser Mann ist so falsch, wie er hübsch ist.“
„Ich glaube, er ist ein Schuft“, bemerkte der Earl.
„Das ist mir bekannt; ich weiß ein paar Dinge über ihn. Er würde ihr Herz um der Eroberung willen ruinieren, einfach weil sie eine Schönheit ist, und dann würde er es gebrochen wegwerfen. Er hat nichts, was er für das Geschenk zurückgeben könnte.“
„Ebenso viel wie mein neues Rennpferd“, schloss der Earl. „Sie ist wirklich sehr schön.“
Kapitel 3Barbara Hare
West Lynne war ein Ort von einer gewissen Bedeutung, insbesondere nach seiner eigenen Einschätzung, denn da es weder eine Industriestadt noch Bischofssitz war, ja noch nicht einmal die Hauptstadt der Grafschaft, war es, was Sitten und Gebräuche anging, ein wenig primitiv. Außerhalb der Stadt, in östlicher Richtung, kam man an mehreren freistehenden Landhäusern vorüber. In deren Nachbarschaft stand die Kirche St. Jude, die, was ihre Gemeinde anging, aristokratischer war als die anderen Kirchen von West Lynne. Die Häuser verteilten sich über ungefähr eine Meile, und die Kirche lag am Anfang der Reihe nicht weit vom belebten Teil des Ortes. Nochmals eine Meile weiter gelangte man zu dem wunderschönen Anwesen, das East Lynne genannt wurde.
Zwischen den erwähnten Herrenhäusern und East Lynne war die Straße auf einer Meile sehr einsam und größtenteils von Bäumen überschattet. Ein Haus stand dort ganz allein ungefähr eine dreiviertel Meile bevor man nach East Lynne gelangte. Es lag auf der linken Seite, ein klobiges, hässliches rotes Backsteinhaus mit einem Wetterhahn auf dem First, das in einer gewissen Entfernung von der Straße erbaut war. Davor erstreckte sich ein flacher Rasen, und in der Nähe des Lattenzaunes, der ihn von der Straße trennte, wuchs ein eine Baumgruppe von einigen Yards Tiefe. Der Rasen wurde in der Mitte von einem schmalen Kiesweg unterteilt, über den man Zugang zur Eingangsveranda des Hauses erhielt. Von dort trat man in eine große, geflieste Diele mit je einem Empfangszimmer rechts und links und dem breiten Treppenhaus auf der Rückseite; neben dem Treppenhaus gelangte man zu den Wohnungen und Arbeitsräumen der Dienstboten. Das Haus wurde The Grove genannt; es war Eigentum und Wohnsitz von Richard Hare, Esq., der allgemein Richter Hare genannt wurde.
Der Raum, der beim Eintreten zur Linken lag, war das allgemeine Wohnzimmer; der andere war größtenteils mit lavendelfarbenen und braunen Leinentapeten geschmückt und wurde nur bei besonderen Gelegenheiten geöffnet. Der Richter und Mrs. Hare hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Anne, das Ältere der Mädchen, hatte frühzeitig geheiratet; Barbara, die Jüngere, war jetzt neunzehn; und Richard, der Älteste – auf ihn werden wir später zu sprechen kommen.
An einem frostigen Abend Anfang Mai, wenige Tage nach dem Besuch von Mr. Carlyle bei dem Earl of Mount Severn, saß Mrs. Hare in diesem Wohnzimmer. Die blasse, kränkliche Frau war zwischen Decken und Kissen begraben – aber tagsüber war es warm gewesen. Am Fenster saß ein hübsches Mädchen, sehr liebreizend mit blauen Augen, blonden Haaren, einem blühenden Teint und kleinen, scharf geschnittenen Gesichtszügen. Sie blätterte lustlos in einem Buch.
„Barbara, jetzt ist doch sicher schon Zeit für den Tee.“
„Die Zeit vergeht dir anscheinend sehr langsam, Mama. Erst vor knapp einer Viertelstunde habe ich dir gesagt, dass es zehn Minuten nach sechs ist.“
„Ich habe solchen Durst!“, verkündete die arme Kranke. „Sieh doch noch einmal auf die Uhr, Barbara.“
Barbara Hare erhob sich mit einer Geste unverhohlener Ungeduld, öffnete die Türe und warf einen Blick auf die große Uhr in der Diele. „Es fehlen noch neunundzwanzig Minuten bis sieben Uhr, Mama. Du könntest eigentlich tagsüber deine Armbanduhr anlegen; seit dem Essen hast du mich schon viermal weggeschickt, damit ich auf die Uhr sehe.“
„Ich habe solchen Durst!“, wiederholte Mrs. Hare mit einer Art Schluchzen. „Wenn es doch bloß sieben Uhr schlagen würde! Ich komme um ohne meinen Tee!“
Nun könnte man meinen, dass eine Lady in ihrem eigenen Haus, die „ohne ihren Tee umkommt“, doch sicher die Anweisung geben könnte, ihn zu servieren, auch wenn die übliche Stunde noch nicht geschlagen hat. Nicht so Mrs. Hare. Seit ihr Ehemann sie vor vierundzwanzig Jahren zum ersten Mal in dieses Haus gebracht hatte, hatte sie es nie gewagt, ihren eigenen Willen zum Ausdruck zu bringen; kaum einmal hatte sie aus eigener Verantwortung eine Anweisung gegeben. Der Richter Hare war streng, gebieterisch, halsstarrig und selbstgefällig; sie war furchtsam, sanftmütig und unterwürfig. Sie hatte ihn von ganzem Herzen geliebt, und ihr Leben war eine einzige lange Unterwerfung ihres Willens unter den Seinen gewesen; eigentlich hatte sie keinen eigenen Willen; immer galt der Seine. Dennoch war sie weit davon entfernt, die Knechtschaft als Joch zu empfinden – manche Charaktere haben solche Gefühle nicht. Und um Mr. Hare Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: Sein machtvoller Wille, wonach alles sich ihm beugen musste, war ein Fehler, aber seine Freundlichkeit stand außer Frage. Er wollte zu seiner Frau nie unfreundlich sein. Von seinen drei Kindern hatte allein Barbara seine Willensstärke geerbt.
„Barbara“, setzte Mrs. Hare noch einmal an, als sie glaubte, es müsse mindestens eine Viertelstunde verstrichen sein.
„Ja, Mama?“
„Läute und sage ihnen, sie sollen alles in Bereitschaft halten, damit keine Verzögerung eintritt, wenn es sieben schlägt.“
„Du liebe Güte, Mama! Du weißt doch, dass immer alles bereitsteht. Und wir haben keine Eile, denn Papa ist wahrscheinlich nicht zu Hause.“ Dennoch erhob sie sich, betätigte mit einer verdrießlichen Bewegung die Glocke, und als der Dienstbote eintrat, sagte sie ihm, er solle pünktlich den Tee servieren.
„Wenn du wüsstest, mein Liebes, was ich für einen trockenen Hals habe und wie ausgedörrt mein Mund ist, hättest du mehr Geduld mit mir.“
Barbara schlug mit einem Ausdruck der Lustlosigkeit ihr Buch zu und wandte sich lustlos zum Fenster. Sie wirkte müde, aber nicht vor Erschöpfung, sondern wegen des Zustandes, den die Franzosen mit dem Wort ennui ausdrücken. „Da kommt Papa“, sagte sie kurz darauf.
„Ach, da bin ich aber froh“, rief die arme Mrs. Hare. „Vielleicht macht es ihm nichts aus, sofort Tee zu trinken, wenn ich ihm sage, welchen Durst ich habe.“
Der Richter trat ein. Er war ein mittelgroßer Mann mit wichtigtuerischen Gesichtszügen, wichtigtuerischem Gang und einer flachsblonden Perücke. In seiner Adlernase, den zusammengepressten Lippen und dem spitzen Kinn mochte man vielleicht eine Ähnlichkeit mit seiner Tochter erkennen; allerdings hatte er nie auch nur halb so gut ausgesehen wie die hübsche Barbara.
„Richard“, ergriff Mrs. Hare in dem Augenblick, in dem er die Tür öffnete, zwischen ihren Decken das Wort.
„Ja?“
„Darf ich jetzt bitte den Tee bringen lassen? Würde es dir sehr viel ausmachen, ihn heute Abend ein wenig früher zu trinken? Ich habe wieder Fieber, und meine Zunge ist so trocken, dass ich nicht mehr weiß, wie ich sprechen soll.“
„Ach, es ist ja kurz vor sieben; du musst nicht mehr lange warten.“
Mit dieser überaus liebreizenden Antwort auf die Bitte einer Kranken verließ Mr. Hare das Zimmer und knallte die Tür zu. Er hatte nicht unfreundlich oder grob gesprochen, sondern einfach nur voller Gleichgültigkeit. Aber noch bevor Mrs. Hares schwacher Seufzer der Enttäuschung vorüber war, öffnete sich die Tür erneut, und die flachsblonde Perücke wurde wieder hereingestreckt.
„Es macht mir nichts aus, ihn jetzt zu trinken. Es wird eine schöne Mondnacht, und ich werde mit Pinner zu Beauchamp gehen und dort eine Pfeife rauchen. Lassʼ ihn kommen, Barbara.“
Der Tee wurde zubereitet und eingenommen, und nachdem Squire Pinner am Tor vorgesprochen hatte, machte der Richter sich auf den Weg zu Mr. Beauchamp. Dieser Gentleman bewirtschaftete große Ländereien und war auch der Agent oder Verwalter des Lord Mount Severn für East Lynne. Er wohnte ein Stück weiter die Straße entlang in kurzer Entfernung hinter East Lynne.
„Mir ist so kalt, Barbara“, schauderte Mrs. Hare, während sie zusah, wie der Richter den Kiesweg hinunterging. „Ob dein Papa es wohl töricht finden würde, wenn ich ihnen sage, sie sollten ein wenig Feuer machen?“
„Lassʼ es anzünden, wenn du magst“, erwiderte Barbara und läutete. „Papa wird ohnehin nichts davon erfahren, denn er wird erst nach der Zubettgehzeit nach Hause kommen. Jasper, Mama friert und möchte, dass ein Feuer angezündet wird.“
„Viele dünne Stöcke, Jasper, damit es schnell brennt“, sagte Mrs. Hare mit bettelnder Stimme, als seien es nicht ihre Stöcke, sondern die von Jasper.
Mrs. Hare bekam ihr Feuer, zog ihren Stuhl davor und legte die Füße auf das Kamingitter, um die Wärme aufzufangen. Barbara begab sich, immer noch lustlos, in die Diele, nahm dort einen Wollschal vom Ständer, warf ihn sich über die Schulter und ging hinaus. Sie schlenderte den geraden, herrschaftlichen Weg hinunter, blieb an dem eisernen Tor stehen und blickte darüber hinweg auf die öffentliche Straße, die allerdings an dieser Stelle und zu dieser Stunde nicht sehr öffentlich war, sondern so einsam, wie man es sich nur wünschen konnte. Es war eine stille, angenehme Nacht, wenn auch etwas kalt für Anfang Mai, und der Mond stieg am Himmel in die Höhe.
„Wann kommt er wohl nach Hause?“, murmelte sie, während sie den Kopf an das Gitter lehnte. „Ach, was wäre das Leben ohne ihn? Wie elend waren diese paar Tage! Was hat ihn wohl dorthin geführt? Was hält ihn ab? Corny sagt, er sei nur für einen Tag weggegangen.“
Aus der Ferne drang das schwache Echo von Schritten an ihre Ohren. Barbara zog sich ein wenig zurück und versteckte sich unter den Bäumen – von einem zufälligen Passanten wollte sie nicht gesehen werden. Als die Schritte aber näher kamen, ging plötzlich eine Wandlung mit ihr vor; ihre Augen leuchteten auf, ihre Wangen färbten sich dunkelrot, und ihre Adern pulsierten in einem Übermaß von Begeisterung: Sie kannte diese Schritte nur allzu gut und liebte sie.
Vorsichtig spähte sie wieder über das Tor und blickte die Straße hinunter. Eine stattliche Gestalt, deren Größe und Kraft eine Anmut in sich trugen, ohne dass sich ihr Besitzer dessen bewusst gewesen wäre, kam aus der Richtung von West Lynne schnell auf sie zu. Wieder schreckte sie zurück; wahre Liebe ist stets furchtsam; und welche Qualitäten Barbara Hare sonst auch besitzen mochte, ihre Liebe zumindest war wahrhaftig und tief. Aber das Tor öffnete sich nicht mit der energischen, schnellen Bewegung, die für die sie ausführende Hand charakteristisch war, sondern die Schritte schienen vorüberzugehen und sich nicht in ihre Richtung zu wenden. Barbaras Herz sank. Wieder stahl sie sich an das Tor und sah mit sehnsuchtsvollem Blick nach draußen.
Ja, natürlich ging er weiter. Er dachte nicht an sie, kam nicht zu ihr; in der Enttäuschung und aus dem Impuls des Augenblicks rief sie ihn:
„Archibald!“
Mr. Carlyle – denn kein anderer war es – wandte sich auf dem Absatz um und kam zum Tor.
„Sie sind es, Barbara! Halten Sie Ausschau nach Dieben und Wilderern? Wie geht es Ihnen?“
„Wie geht es Ihnen?“, gab sie zurück und hielt das Tor auf, damit er eintreten konnte. Während sie sich die Hand gaben, bemühte sie sich, ihre Aufregung zu zügeln. „Wann sind Sie zurückgekommen?“
„Gerade erst, mit dem Achtuhrzug. Er hatte Verspätung, weil er an den Bahnhöfen unverzeihlich lange getrödelt hat. Sie hatten nicht daran gedacht, dass ich darin saß, das verrieten mir ihre Blicke, als ich ausgestiegen bin. Ich war noch nicht zu Hause.“
„Nein! Was wird Cornelia sagen?“
„Ich war für fünf Minuten in der Kanzlei. Aber ich habe ein paar Worte mit Beauchamp zu reden und gehe sofort hin. Danke, ich kann jetzt nicht hereinkommen; ich habe vor, es auf dem Rückweg zu tun.“
„Papa ist zu Mr. Beauchamp gegangen.“
„Mr. Hare! Wirklich?“
„Er und Squire Pinner“, fuhr Barbara fort. „Sie sind hingegangen, um eine Runde zu rauchen. Wenn Sie dort auf Papa warten, wird es zu spät, um noch hereinzukommen, denn er wird sicher nicht vor elf oder zwölf zurück sein.“
Mr. Carlyle senkte nachdenklich den Kopf. „Ich glaube, dann nützt es nichts, wenn ich weitergehe“, sagte er, „denn meine Geschäfte mit Beauchamp sind privater Natur. Ich muss sie auf morgen verschieben.“
Er nahm ihr das Gartentor aus der Hand, schloss es und legte ihre Hand auf seinen Arm, um mit ihr zum Haus zu gehen. Das Ganze geschah auf eine nüchterne, realistische Art und Weise; Romantik oder Gefühle schwangen darin nicht mit; und doch fühlte sich Barbara Hare, als wäre sie im Paradies.
„Und wie ist es Ihnen in den letzten Tagen ergangen, Barbara?“
„Ach, sehr gut. Aus welchem Anlass sind Sie so plötzlich abgereist? Sie haben nie gesagt, dass Sie wegfahren würden, und sind auch nicht zu uns gekommen, um sich zu verabschieden.“
„Sie haben es gerade zum Ausdruck gebracht, Barbara – ‚plötzlich‘. Eine geschäftliche Angelegenheit hat sich plötzlich ergeben, und dafür musste ich plötzlich etwas tun.“
„Cornelia hat gesagt, Sie wären nur einen Tag fort.“
„Hat sie das gesagt? Wenn ich in London bin, gibt es immer viel zu tun! Geht es Mrs. Hare besser?“
„Es ist immer gleich. Ich glaube, Mamas Leiden sind zumindest zur Hälfte nur eingebildet; wenn sie sich aufraffen würde, ginge es ihr besser. Was ist in diesem Paket?“
„Das zu fragen, steht Ihnen nicht zu, Miss Barbara. Es geht Sie nichts an. Es geht nur Mrs. Hare etwas an.“
„Haben Sie Mama etwas mitgebracht, Archibald?“
„Natürlich. Zum Besuch eines Landbewohners in London gehört es, dass er Geschenke für seine Freunde kauft; zumindest war das früher so, in der guten alten Zeit.“
„Als die Leute ihr Testament gemacht haben, bevor sie abgereist sind, und dann für die Reise vierzehn Tage in einer Kutsche gebraucht haben“, lachte Barbara. „Solche Geschichten hat uns Großvater erzählt, als wir Kinder waren. Aber ist es wirklich etwas für Mama?“
„Habe ich so etwas gesagt? Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.“
„Ach! Was denn?“, platzte sie heraus. Ihr Gesichts nahm mehr Farbe an, und sie fragte sich, ob er im Scherz oder im Ernst gesprochen hatte.
„Das ist aber ein ungeduldiges Mädchen! ‚Was denn?‘ Warten Sie einen Augenblick, dann werden Sie es sehen.“
Er legte das Päckchen, das er bei sich trug, auf einen Gartenstuhl und fing an, in seinen Taschen zu suchen. Er sah in allen Taschen nach, aber scheinbar vergeblich.
„Barbara, ich glaube, es ist weg. Ich muss es irgendwo verloren haben.“
Ihr Herz pochte, während sie dort stand und ihn im Mondlicht schweigend ansah. Was war verloren gegangen? Was war es gewesen?
Aber bei einer zweiten Suche stieß er auf etwas in der Tasche seines Rockschoßes. „Ah, da ist es; wie ist es denn dorthin gekommen?“ Er öffnete eine kleine Schachtel, nahm eine lange Goldkette heraus und legte sie ihr um den Hals. Daran war ein Medaillon befestigt.
Das Rot auf ihren Wangen kam und ging; ihr Herz schlug schneller. Sie brachte kein Wort des Dankes hervor; Mr. Carlyle griff wieder nach dem Päckchen und ging weiter zu Mrs. Hare.
Barbara folgte ihm wenige Minuten später. Ihre Mutter stand und sah in freudiger Erwartung Mr. Carlyles Bewegungen zu. Es waren keine Kerzen im Zimmer, aber der Kamin erleuchtete es hell.
„Nun, lachen Sie mich nicht aus“, sagte er, wobei er die Schnur um das Päckchen löste. „Es ist keine Rolle Samt für ein Kleid, und auch keine Pergamentrolle, die Ihnen zwanzigtausend Pfund im Jahr verspricht. Vielmehr ist es – ein aufblasbares Kissen!“
Es war genau das, wonach die arme Mrs. Hare, die des Sitzens und Liegens so überdrüssig war, sich oft gesehnt hatte. Sie hatte gehört, man könne solche Luxusartikel in London kaufen, aber sie konnte sich nicht erinnern, jemals eines gesehen zu haben. Fast gierig griff sie danach, wobei sie Mr. Carlyle einen dankbaren Blick zuwarf.
„Wie soll ich Ihnen dafür danken?“, murmelte sie unter Tränen.
„Wenn Sie mir überhaupt danken, werde ich Ihnen nie wieder etwas mitbringen“, rief er fröhlich. „Ich habe Barbara schon gesagt, dass es zu einem Besuch in London dazugehört, Geschenke für Freunde mitzubringen. Sehen Sie, wie hübsch ich sie gemacht habe?“
Hastig nahm Barbara die Kette ab und legte sie vor ihrer Mutter hin.
„Was für eine wunderschöne Kette“, murmelte Mrs. Hare überrascht. „Archibald, Sie sind einfach zu gütig, zu großzügig! Das muss doch eine Menge gekostet haben; das ist keine Kleinigkeit.“
„Unsinn!“, lachte Mr. Carlyle. „Ich will Ihnen beiden sagen, wie es dazu kam, dass ich es gekauft habe. Ich bin zu einem Juwelier gegangen, weil meine Armbanduhr in letzter Zeit auf höchst ungenierte Weise nachgegangen ist, und da sah ich eine ganze Auslage mit hängenden Ketten; manche waren gewichtig genug für einen Sheriff, andere leicht und elegant genug für Barbara. Ich sehe am Hals einer Dame nicht gern eine dicke Kette. Mir kam der Gedanke an die Kette, die sie an dem Tag verloren hat, an dem sie und Cornelia mit mir nach Lynneborough gefahren waren. Barbara erklärte hartnäckig, der Verlust sei meine Schuld, weil ich sie zur Besichtigung durch die Stadt geschleppt hätte, während Cornelia einkaufen ging – und dabei ist ihr die Kette abhanden gekommen.“
„Aber das habe ich doch nur im Scherz gesagt“, warf Barbara ein. „Natürlich wäre es auch geschehen, wenn Sie nicht bei mir gewesen wären; die Kettenglieder sind schon immer gerissen.“
„Nun ja, diese Ketten in dem Laden in London riefen mir Barbaras Missgeschick wieder in Erinnerung, und so habe ich eine ausgesucht. Dann brachte der Verkäufer ein paar Medaillons und verbreitete sich darüber, wie bequem man darin die Haare verstorbener Angehöriger unterbringen könne, ganz zu schweigen von den Haaren eines Geliebten. Schließlich habe ich ihm gesagt, er solle eines an die Kette hängen. Ich dachte, es könne dieses Stück Haar aufnehmen, das das Sie so schätzen, Barbara“, schloss er, wobei er die Stimme senkte.
„Welches Stück?“, fragte Mrs. Hare.
Mr. Carlyle blickte sich im Zimmer um, als fürchtete er, die Wände könnten sein Flüstern hören. „Das von Richard. Barbara hat es mir einmal gezeigt, als sie ihren Schreibtisch aufgeräumt hat, und dabei hat sie gesagt, die Locke habe man ihm während dieser Krankheit abgeschnitten.“
Mrs. Hare sank in ihren Sessel zurück, verbarg das Gesicht in den Händen und zitterte sichtbar. Die Worte hatten offensichtlich eine schmerzliche Quelle tiefen Kummers berührt. „Ach, mein Junge! Mein Junge!“, wimmerte sie – „Mein Junge, mein unglücklicher Junge! Mr. Hare wundert sich über meine schlechte Gesundheit, Archibald; Barbara macht sich darüber lustig; aber dort liegt die Ursache meines ganzen Elends, des seelischen wie des körperlichen. Ach, Richard! Richard!“
Eine quälende Pause trat ein. Das Thema erlaubte weder Hoffnung noch Trost. „Legen Sie Ihre Kette wieder an, Barbara“, sagte Mr. Carlyle nach einiger Zeit. „Ich wünsche Ihnen die Gesundheit, um sie lange zu tragen. Gesundheit und Läuterung, junge Dame!“
Barbara lächelte und sah ihn mit ihren hübschen blauen Augen an, die so voller Liebe waren. „Was haben Sie für Cornelia mitgebracht?“, nahm sie das Gespräch wieder auf.
„Etwas Prächtiges“, antwortete er mit gespielt ernstem Gesicht; „ich hoffe nur, man hat mich nicht hereingelegt. Ich habe ihr einen Schal gekauft. Die Verkäufer haben mir geschworen, es sei echter Pariser Kaschmir. Ich habe achtzehn Guineen dafür bezahlt.“
„Das ist eine Menge“, erklärte Mrs. Hare. „Da muss es schon ein sehr guter Schal sein. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mehr als sechs Guineen für einen Schal ausgegeben.“
„Und Cornelia, das wage ich zu behaupten, nie mehr als halb so viel“, lachte Mr. Carlyle. „Nun, ich wünsche Ihnen einen Guten Abend und werde zu ihr gehen; wenn sie weiß, dass ich schon so lange zurück bin, bekomme ich einen Vortrag zu hören.“
Er schüttelte beiden die Hand. Barbara begleitete ihn bis zur Haustür und trat mit ihm nach draußen.
„Sie werden sich eine Erkältung holen, Barbara. Sie haben Ihren Schal drinnen gelassen.“
„Ach nein, das werde ich nicht. Sie gehen so schnell wieder. Sie sind kaum zehn Minuten geblieben.“
„Sie vergessen, dass ich noch nicht zu Hause war.“
„Sie waren auf dem Weg zu Beauchamp, und dann wären sie erst in einer oder zwei Stunden zu Hause gewesen“, erwiderte Barbara in einem Ton unverhohlenen Unmuts.
„Das war etwas anderes; das war geschäftlich. Aber Barbara, ich finde, Ihre Mutter sieht ungewöhnlich krank aus.“
„Sie wissen, dass sie leidet und dass schon Kleinigkeiten sie aufregen. Gestern Abend hatte sie einen ihrer Träume, wie sie es nennt“, antwortete Barbara. „Sie sagt, es sei eine Warnung, dass etwas Schlimmes geschehen wird, und dann war sie den ganzen Tag in dem unglücklichsten Fieberzustand, den man sich vorstellen kann. Papa war sehr verärgert darüber, dass sie so schwach und nervös ist, und erklärte, sie müsse sich mit ihren ‚Nerven‘ zusammennehmen. Natürlich wagen wir es nicht, ihm von dem Traum zu erzählen.“
„Er handelte von … dem …“
Mr. Carlyle hielt inne. Barbara blickte sich mit einem Schaudern um und rückte näher zu ihm, während sie flüsterte. Dieses Mal hatte er ihr nicht seinen Arm angeboten.