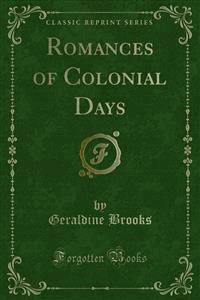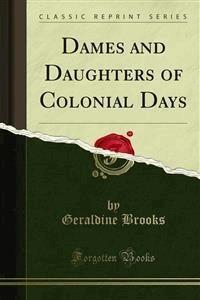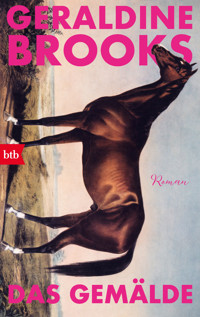
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große New-York-Times-Bestseller – von der Autorin des Welterfolgs »Das Pesttuch«
Washington, D.C., 2019: Jess, eine junge australische Wissenschaftlerin, und Theo, ein nigerianisch-amerikanischer Kunsthistoriker, finden sich durch ihr gemeinsames Interesse an einem Pferd unerwartet verbunden. Jess untersucht die Knochen des Hengstes nach Hinweisen auf seine Kraft und Ausdauer – Theo will die verlorene Geschichte des unbekannten schwarzen Trainers aufdecken, der für seinen Rennerfolg entscheidend war.
New York City, 1954: Martha Jackson, eine Galeristin, die für ihr Gespür bekannt ist, entdeckt ein Ölgemälde eines Pferdes aus dem 19. Jahrhundert von unbekannter Herkunft.
Kentucky, 1850: Ein versklavter Junge namens Jarret und ein braunes Fohlen schmieden ein Band der Verständigung, das das Pferd zu Rekordsiegen im Süden Amerikas führen wird. Als der Bürgerkrieg ausbricht, wird auch ein junger Künstler, der sich mit Gemälden des Rennpferdes einen Namen gemacht hat, zu den Waffen gerufen. In einer gefährlichen Nacht trifft er auf den Hengst und seinen Reiter Jarret, weit entfernt vom ehemaligen Glanz der Rennstrecke.
Basierend auf der wahren Geschichte des siegreichen Rennpferds Lexington ist »Das Gemälde« ein Roman über Kunst und Wissenschaft, Liebe und Besessenheit und unsere offene Rechnung mit alltäglichem Rassismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Washington, D. C., 2019: Jess, eine junge australische Wissenschaftlerin, und Theo, ein nigerianisch-amerikanischer Kunsthistoriker, finden sich durch ihr gemeinsames Interesse an einem Pferd unerwartet verbunden. Jess untersucht die Knochen des Hengstes nach Hinweisen auf seine Kraft und Ausdauer – Theo will die verlorene Geschichte des unbekannten schwarzen Trainers aufdecken, der für seinen Rennerfolg entscheidend war.
New York City, 1954: Martha Jackson, eine Galeristin, die für ihr Gespür bekannt ist, entdeckt ein Ölgemälde eines Pferdes aus dem 19. Jahrhundert von unbekannter Herkunft.
Kentucky, 1850: Ein versklavter Junge namens Jarret und ein braunes Fohlen schmieden ein Band der Verständigung, das das Pferd zu Rekordsiegen im Süden Amerikas führen wird. Als die Nation in einen Bürgerkrieg eintritt, wird auch ein junger Künstler, der sich mit Gemälden des siegreichen Rennpferdes einen Namen gemacht hat, zu den Waffen gerufen. In einer gefährlichen Nacht trifft er auf den Hengst und seinen Reiter Jarret, weit entfernt vom ehemaligen Glanz der Rennstrecke.
Basierend auf der wahren Geschichte des siegreichen Rennpferds Lexington ist »Das Gemälde« ein Roman über Kunst und Wissenschaft, Liebe und Besessenheit und unsere offene Rechnung mit alltäglichem Rassismus.
Zur Autorin
Geraldine Brooks wurde 1955 in Sydney geboren und bereiste elf Jahre lang als Auslandskorrespondentin des Wall Street Journal die Welt. 2006 erhielt sie für ihren Debütroman »Auf freiem Feld« den Pulitzerpreis. »Das Pesttuch« avancierte zum internationalen Bestseller und wurde in 25 Sprachen übersetzt. Auch ihr neuer Roman »Das Gemälde« stand auf Anhieb auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Geraldine Brooks lebt auf Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Geraldine Brooks
Das Gemälde
Roman
Aus dem Englischen von
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Horse« bei Viking, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Geraldine Brooks
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © Superstock / Bridgeman Images
Satz und E-Book-Konvertierung:GGPMedia GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29780-0V007
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Tony
Es wird die Vergangenheit sein, und wir werden gemeinsam dort leben.
Patrick Philips, Heaven
Er war allen Pferden überlegen, die es vor ihm gab, so wie der gleißende Schein der Tropensonne dem schwachen und kaum wahrnehmbaren Schimmer des entferntesten aller Sterne überlegen ist.
Joseph Cairn Simson, Turf, Field and Farm
Nach ihm gab es nur noch andere Pferde.
Charles E. Trevathan,The American Thoroughbred
THEO
Georgetown, Washington, D. C.
2019
Die trügerisch reduktiven Formen seiner künstlerischen Arbeit täuschen über die Dichtheit von Bedeutung hinweg, die durch eine gespaltene Existenz entstand. Diese Glyphen und Ideogramme schicken uns Zeichen vom Scheideweg: Freiheit und Sklaverei, Weiß und Schwarz, ländlich und urban.
Nein. Auf gar keinen Fall. Das ging überhaupt nicht. Es roch nach Doktorarbeit. Dabei sollte es für ganz normale Leute verständlich sein.
Theo drückte auf »Löschen« und sah zu, wie die Buchstaben einer nach dem anderen verschwanden. Dann war nur noch der blinkende Cursor übrig, der wie ein ungeduldiger Finger auf sich aufmerksam machte. Er seufzte und wandte den Blick ab. Durch das Fenster über seinem Schreibtisch bemerkte er, dass die ältere Frau, die in dem heruntergekommenen Reihenhaus auf der anderen Straßenseite lebte, eine Hantelbank zum Straßenrand schleppte. Während die Metallbeine über den Gehweg schepperten, hob Clancy erschrocken den Kopf und legte die Pfoten auf den Schreibtisch unter Theos Laptop. Seine großen Ohren zuckten. Zusammen sahen Theo und der Hund dabei zu, wie sie die Bank zu dem übrigen Plunder schob, den sie am Straßenrand aufgetürmt hatte. Ein handgeschriebenes Schild lehnte daran: ZUVERSCHENKEN.
Theo fragte sich, warum sie nicht versucht hatte, die Sachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Für die Hantelbank hätte bestimmt jemand etwas bezahlt. Sogar für den unechten marokkanischen Fußschemel. Erst als sie einen Armvoll Herrenbekleidung herausbrachte, fiel Theo ein, dass all diese Dinge vermutlich ihrem Mann gehört hatten. Vielleicht wollte sie einfach alles loswerden und jede Spur von ihm im Haus tilgen.
Darüber konnte Theo nur Spekulationen anstellen, da er sie eigentlich gar nicht kannte. Sie gehörte zu den schmallippigen, einsilbigen Nachbarinnen, die nicht zu Plaudereien aufgelegt waren und erst recht nichts von sich preisgaben. Und ihr Ehemann hatte durch seine Körpersprache signalisiert, was er von einem dunkelhäutigen Nachbarn hielt. Als Theo vor ein paar Monaten in das Studentenwohnheim für Doktoranden der Georgetown University gezogen war, hatte er bewusst eine kleine Vorstellungsrunde in der Nachbarschaft gemacht. Die meisten hatten ihn mit einem freundlichen Lächeln willkommen geheißen. Doch der Typ auf der anderen Straßenseite hatte ihm nicht einmal in die Augen geschaut. Das einzige Mal hatte Theo seine Stimme gehört, als er seine Frau anschrie.
Es war eine Woche her, dass mitten in der Nacht der Krankenwagen gekommen war. Wie die meisten Städter schaffte es Theo ohne Probleme, Sirenengeheul, das sich näherte und dann langsam wieder entfernte, zu überschlafen, doch damals hatte es sich eher angehört wie ein Schluckauf, der urplötzlich aufhörte. Theo schreckte hoch, als blaues und rotes Licht über seine Wände zuckte. Er sprang aus dem Bett, bereit zu helfen, wenn er konnte. Doch am Ende standen er und Clancy nur da und sahen zu, wie die Sanitäter den Leichensack hinaustrugen, das Blaulicht ausschalteten und davonfuhren.
Im Haus seiner Großmutter im nigerianischen Lagos war bei jedem Todesfall in der Nachbarschaft ausgiebig gekocht worden. Wenn er als Kind in den Schulferien zu Besuch war, hatte er oft die Aufgabe bekommen, den Hinterbliebenen dampfende Platten mit Essen zu überbringen. Und so hatte er auch jetzt, am Tag nach dem Tod des Nachbarn, ein Schmorgericht zubereitet, eine Beileidskarte geschrieben und alles über die Straße getragen. Als niemand an die Tür kam, hatte er es am Eingang stehen lassen. Eine Stunde später stand es wieder vor seiner eigenen Tür, dazu eine säuerliche Nachricht: Danke, aber ich mag kein Huhn. Theo schaute Clancy an und zuckte die Achseln. »Ich dachte, Huhn mag jeder.« Sie hatten sich das Essen geteilt. Es war köstlich, durchdrungen vom Aroma gegrillter Paprika und seiner hausgemachten, lange auf dem Herd geköchelten Brühe. Was Clancy, dem australischen Kelpie, egal war. In der geradlinigen Sorglosigkeit seiner abgehärteten Art fraß er alles, was er in den Napf bekam.
Bei dem Gedanken an den Eintopf lief Theo das Wasser im Mund zusammen. Er blickte auf die Uhrzeit, die in der Ecke seines Displays angezeigt wurde. Vier Uhr nachmittags. Zu früh, um Feierabend zu machen. Während er weitertippte, drehte sich Clancy unter dem Schreibtisch einmal um die eigene Achse und ließ sich dann auf seinen Füßen nieder.
Bei diesen faszinierenden fesselnden Bildern handelt es sich um die einzigen erhaltenen Werke eines Künstlers, der in die Sklaverei als Sklave geboren wurde. Nach einem Leben Nach seinem Überleben im Bürgerkrieg und dem Weggangder Flucht aus der Tyrannei der Plantage in ein ärmliches Leben in der Stadt sah er sich offenbar gezwungen, seine eigene Realität abzubilden, die paradoxerweise prekär und reich zugleich war.
Schrecklich. Es las sich immer noch wie eine Seminararbeit und nicht wie ein Artikel für eine Zeitschrift.
Er blätterte in den Bildern auf seinem Schreibtisch. Voller Selbstbewusstsein bildete der Künstler das ab, was er kannte – die dicht belebte, pulsierende Alltagswelt der Schwarzen im neunzehnten Jahrhundert. Er musste den Text unbedingt so einfach und direkt halten, wie es diese Bilder waren.
Bill Traylor, als Sklave geboren, hat uns die einzigen
Eine Bewegung auf der anderen Straßenseite lenkte seinen Blick vom Bildschirm weg. Die Nachbarin versuchte, einen sperrigen Liegesessel nach draußen zu ziehen. Auf ihrer obersten Treppenstufe geriet er in eine gefährliche Schieflage, und sie konnte ihn nur mit Mühe halten.
Sie brauchte Hilfe. Rasch blickte er an sich hinunter. Shorts – ja. T-Shirt – ja. Wenn er in seiner nur notdürftig eingerichteten Wohnung arbeitete, verbrachte Theo manchmal den ganzen Tag nur in Unterwäsche und bemerkte seine spärliche Bekleidung erst dann, wenn er den fragenden Blick eines Typen von FedEx sah.
Er kam gerade auf die andere Straßenseite, als die Schwerkraft siegte und ihr der Sessel aus den Händen rutschte. Theo sprang die Treppe hoch und verhinderte mit einem Satz Schlimmeres. Sie dankte es ihm mit einem Brummen und dem kurzen Anheben des Kinns. Dann bückte sie sich und griff wieder unter den Stuhl, Theo nahm eine der Armlehnen. Zusammen bewegten sie sich wie Krebse rückwärts, an die Straßenkante.
Die Frau richtete sich auf, schob ihr dünnes, strohblondes Haar nach hinten und rieb sich mit den Fäusten den Rücken. Mit einer Handbewegung in Richtung Trödel sagte sie: »Wenn Sie etwas davon wollen …« Dann drehte sie sich um und stieg die Treppe hoch.
Theo konnte sich nicht vorstellen, dass er etwas von dem traurigen Plunder haben wollte. Seine Wohnung war nur spärlich möbliert: ein Schreibtisch aus den Fünfzigerjahren, ein Ausziehsofa, das er in einem Secondhandladen gekauft hatte. Den restlichen verfügbaren Raum nahmen hauptsächlich Kunstbücher ein, untergebracht auf flachen Regalen aus Brettern und Obstkisten, die er schwarz angesprüht hatte.
Doch eines der Gebote, mit denen Theo, der Sohn von zwei Diplomaten, aufgewachsen war, lautete, dass schlechte Manieren eine Todsünde waren. Er musste wenigstens einen Blick darauf werfen. In einer Bierkiste lagen ein paar alte Taschenbücher. Ihn interessierte es immer, was die Leute lasen. Er bückte sich, um die Titel zu entziffern.
Und dann sah er das Pferd.
JESS
Smithsonian Museum Support Center, Maryland
2019
Jess war sieben gewesen, als sie den Hund ausgebuddelt hatte. Damals war er ein Jahr tot. Sie und ihre Mum hatten ihn mit einer kleinen Trauerfeier unter dem blühenden roten Eukalyptus im Garten begraben, und sie hatten beide geweint.
Ihre Mutter hätte am liebsten wieder geweint, als Jess sie für die Knochen, die sie gerade exhumiert hatte, um mehrere große Tupperdosen bat. Im Allgemeinen hätte Jess’ Mutter ihrer Tochter sogar erlaubt, das Haus in Brand zu setzen, solange sie dabei etwas über das Verhältnis zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff lernen konnte. Doch in diesem Fall spielte Angst eine Rolle: War das Ausgraben eines verstorbenen Haustieres und das Zerteilen seines Körpers ein Zeichen dafür, dass die Kleine psychopathische Neigungen hatte?
Jess tat ihr Bestes, um ihrer Mutter klarzumachen, dass sie Milo ausbuddeln wollte, weil sie ihn liebte und weil sie deshalb sehen musste, in welchem Zustand sein Skelett war. Schön würde es aussehen, das wusste sie: der Schwung des Brustkorbs, die Rundung der Augenhöhlen …
Jess liebte die Innenarchitektur von Lebewesen. Rippen, ihr schützender Radius, und wie sie empfindliche Organe ein ganzes Leben lang mit ihrer Umarmung behüteten. Oder Augenhöhlen: Kein Handwerker hatte jemals ein eleganteres Behältnis für ein so kostbares Objekt wie das Auge erschaffen. Milos Augen hatten die Farbe von Rauchquarz gehabt. Wenn Jess mit dem Finger über die kleinen Einbuchtungen rechts und links seines zarten Schädels fuhr, konnte sie seine Augen wieder sehen: den liebevollen Blick ihres allerersten Freundes, der es nicht erwarten konnte, mit ihr zu spielen.
Sie war in einer der belebten Straßen von Sydney mit Bungalows aus rötlichem Backstein aufgewachsen, die sich beim ersten Wachstumsschub der Stadt im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts nach Westen ausgedehnt hatten. Hätte sie irgendwo auf dem Land gelebt, so hätte ihre Faszination vermutlich überfahrenen Kängurus, Wombats oder Wallabys gegolten. Doch als Großstadtkind aus Sydney freute sie sich schon über eine tote Maus oder vielleicht einen Vogel, der gegen ein Glasfenster geflogen war. Bislang war ihr bestes Versuchstier ein Flughund gewesen, der einen Stromschlag erlitten hatte und verendet war. Sie hatte ihn auf dem bewachsenen Streifen unter der Starkstromleitung gefunden und eine ganze Woche damit verbracht, ihn auseinanderzunehmen: die papierartige Membran seines Flügels, die sich vor ihr auffächerte wie der gefaltete Balg eines Akkordeons. Die Mittelfußknochen, wie menschliche Knochen, nur leichter – Knochen, die nicht zum Greifen und Halten gedacht waren, sondern um sich durch die Luft zu schwingen. Als sie fertig war, hatte sie den Flughund an die Lampenhalterung unter ihrer Schlafzimmerdecke gehängt. Dort, sauber von allem befreit, was verwesen konnte, sah sie ihn, wie er für immer durch endlose Nächte flog.
Im Laufe der Zeit war ihr Zimmer zu einer Art Naturgeschichtemuseum in Miniaturform geworden und hatte sich mit Skeletten von Eidechsen, Mäusen und Vögeln gefüllt, die auf Sockeln aus ausgedienten Garnspulen oder Fadenröllchen steckten und mit sorgfältig in Tinte geschriebenen lateinischen Namen versehen waren. Bei der Schar halbwüchsiger Mädchen, die mit ihr auf die Highschool gingen, machte sie das nicht allzu beliebt. Die meisten ihrer Klassenkameradinnen fanden ihre Besessenheit von nekrotischer Materie abstoßend und unheimlich. Sie wurde zu einem einzelgängerischen Teenager, was vielleicht zu ihrem hervorragenden Abschneiden in drei Fächern bei den bundesstaatlichen Abschlussprüfungen beitrug. Auch während des Studiums tat sie sich hervor und war schließlich mit einem Stipendium nach Washington gekommen, um ihren Master in Zoologie zu machen.
Das war etwas, das Australier gern taten: ein oder zwei Jahre im Ausland studieren, um sich den Rest der Welt anzuschauen. In ihrem ersten Semester hatte das Smithsonian sie als Aushilfskraft angestellt. Als man dort erfuhr, dass sie bereits mit dem Säubern von Knochen vertraut war, schickte man sie zum Präparieren von Gebeinen ans Museum of Natural History. Es stellte sich heraus, dass sie durch ihre Arbeit an kleinen Spezies sehr geschickt geworden war. Das Skelett eines Blauwals mochte das Museumspublikum vielleicht beeindrucken, doch Jess und ihre Kollegen wussten, dass ein Prachtstaffelschwanz wesentlich schwerer zu artikulieren war.
Sie liebte den Ausdruck »artikulieren«, weil er so zutreffend war: Ein wirklich gut aufgebautes Skelett erlaubte es einer Spezies, ihre eigene Geschichte zu erzählen, zu zeigen, wie es gewesen war, als das Tier noch atmete und lief, tauchte oder flog. Manchmal wünschte Jess, in viktorianischer Zeit gelebt zu haben, als Handwerker sich gegenseitig darin überboten, Bewegung abzubilden – wenn man ein Pferd zeigte, das sich aufbäumte, bedurfte es einer absoluten Balance im Innengerüst, und bei einem Esel, der das Bein hob, um sich an der Flanke zu kratzen, brauchte der Bildhauer einen ausgeprägten Sinn für Krümmung. Solche Innengestelle anfertigen zu lassen, war wie ein Fieber unter den wohlhabenden Männern der Zeit gewesen, die danach strebten, Präparate von besonders großer Schönheit und Kunstfertigkeit herzustellen.
In den zeitgenössischen Museen war der Raum dafür knapp. Wenn man Knochen neu zusammenfügte, zerstörte man damit Material – indem man Metall hinzugab oder Gewebe wegnahm –, weshalb nur sehr wenige Skelette überhaupt artikuliert wurden. Die meisten Knochen wurden präpariert, nummeriert und dann einzeln in Schubladen abgelegt, um später größenmäßig verglichen zu werden oder für die Entnahme von DNA-Proben zu dienen.
Wenn Jess diese Art von Arbeit machte, geriet ihre Nostalgie für die Handwerker der Vergangenheit in den Hintergrund, und die Faszination für die Wissenschaft überwog. Jedes einzelne Fragment erzählte eine Geschichte. Es war ihr Job, den anderen Wissenschaftlern dabei zu helfen, jedem auch noch so kleinen Fossil sein Vermächtnis zu entringen. Oft kamen die Proben rein durch Zufall ins Museum, ebenso oft aber auch als das Ergebnis tagelanger und akkurater wissenschaftlicher Arbeit. Vielleicht war ein Hobbyarchäologe auf das Schienbein eines Mammuts gestoßen, das in einem heftigen Schneesturm freigelegt worden war. Oder ein Paläontologe hatte den winzigen Zahn einer Wühlmaus gefunden, nachdem er wochenlang mühsam Erde gesiebt hatte. Jess druckte ihre Etiketten auf einem Laserprinter und vermerkte anhand der GPS-Koordinaten genau, wo die Probe gefunden worden war. In der Vergangenheit hatten Kuratoren eine persönlichere Note hinterlassen, ihre Kärtchen waren in sepiabrauner Tinte handgeschrieben.
Diese Präparatoren des neunzehnten Jahrhunderts waren ohne Kenntnis von DNA und all den vitalen Daten, die man später daraus gewinnen konnte, ihrem Handwerk nachgegangen. Jess fand den Gedanken aufregend; wenn sie an einem Tag die Schublade mit einer neu angelegten Probe schloss, dann würde diese möglicherweise erst fünfzig oder hundert Jahre später von einem Wissenschaftler wieder geöffnet werden, auf der Suche nach Antworten auf die Fragen, die Jess noch gar nicht zu stellen vermochte, und das unter Anwendung von Analysemethoden, die sich vollkommen ihrer Vorstellungskraft entzogen.
Eigentlich hatte sie gar nicht in Amerika bleiben wollen. Doch Berufswege können manchmal ebenso von Zufällen abhängig sein wie Unfälle auf Straßen. Gerade als sie ihren Abschluss machte, bot das Smithsonian ihr einen viermonatigen Vertrag an, mit dem sie nach Französisch-Guyana reisen konnte, um Proben im Regenwald zu sammeln. Nicht viele Mädchen aus der Burwood Road im Westen von Sydney bekamen die Chance, nach Südamerika zu fliegen und in einem Jeep durch den Regenwald zu rumpeln, mit Skorpionproben, die kreuz und quer wie Wäsche zum Trocknen aufgehängt waren. Ein weiteres Angebot folgte: Diesmal ging es nach Kenia, wo sie am Kilimandscharo Spezies der Gegenwart mit denen verglich, die Theodore Roosevelts Expedition ein Jahrhundert früher gesammelt hatte.
Am Ende dieser Reise packte Jess ihre wenigen Habseligkeiten zusammen, bereit, nach Hause zu fliegen und mit dem weiterzumachen, was sie immer noch als ihr eigentliches Leben betrachtete, als das Smithsonian ihr eine feste Anstellung anbot; es war die Tätigkeit als Geschäftsführerin ihres Testlabors für Knochenkunde von Wirbeltieren am Museum Support Center in Maryland. Dabei handelte es sich um eine brandneue Einrichtung, und dass die Stelle frei war, kam unerwartet. Der Manager, der das Labor eingerichtet hatte, litt plötzlich an einer Allergie gegen die weichen, staubartigen Exkremente der Speckkäfer. Diese Käfer galten als das bevorzugte und beste Mittel zur Knochensäuberung, und wer nicht mit ihnen arbeiten konnte, ohne einen Nesselausschlag zu bekommen, musste zwangsläufig seinen Beruf wechseln.
Der Spitzname des Smithsonian war »der Dachboden Amerikas«. Und das Support Center war der Dachboden des Dachbodens: eine riesige Anlage mit zwölf Meilen Lagerräumen, in denen unschätzbare wissenschaftliche und künstlerische Sammlungen untergebracht waren. Jess hatte sich nicht vorstellen können, da draußen in der Vorstadt zu arbeiten, so weit vom öffentlichen Gesicht des Museums entfernt. Doch als sie zum ersten Mal den breiten Verbindungskorridor entlangging, der als »die Straße« bekannt war und das Zickzack aus metallverkleideten, klimatisierten Gebäuden miteinander verband, in denen alle möglichen Arten von Naturwissenschaften ihren Platz hatten, wusste sie, dass sie im Epizentrum ihres Berufes angelangt war.
Nach dem Vorstellungsgespräch gingen sie und der Direktor über einen begrünten Campus, der von den Treibhäusern der botanischen Fakultät flankiert wurde. Er zeigte ihr einen neu errichteten Block, der der Lagerung diente und fensterlos über den Treibhäusern emporragte. »Den haben wir gerade erst eröffnet, und er beheimatet die sogenannte Feuchtkollektion«, sagte er. »Nach dem 11. September wurde uns bewusst, dass es nicht sehr klug ist, fünfundzwanzig Millionen biologische Proben in leicht entzündlichen Flüssigkeiten in einem Keller zu lagern, der nur ein paar Blocks vom Kapitol entfernt liegt. Deshalb sind sie jetzt hier.«
Das Labor für Knochenkunde war noch weiter entfernt; es war in einem eigenen Gebäude an der Seite des Campus untergebracht, das dem Highway am nächsten lag. »Wenn Sie, sagen wir mal, ein Elefantengerippe aus dem National Zoo bekommen, stinkt es zum Himmel«, erklärte der Direktor. »Deshalb haben wir Ihr Labor auch so weit es nur ging von den Menschen weg platziert.«
Ihr Labor. Es wäre Jess gar nicht in den Sinn gekommen, sich selbst als ehrgeizig zu bezeichnen, doch ihr wurde auf einmal klar, wie sehr sie sich diese Verantwortung gewünscht hatte. Drinnen war das Labor blitzsauber und funkelnd: Da gab es mehrere zusammenhängende Räume für die Nekropsie mit einem hydraulisch betriebenen Tisch, einen Aufzug für ein Gewicht von zwei Tonnen, doppelte Glastüren, groß genug, um ein Walgerippe hindurchzumanövrieren, und eine ganze Wand mit Sägen und Messern, die einem Horrorfilm alle Ehre gemacht hätten. Es war weltweit die größte Einrichtung dieser Art, und zwischen ihr und dem kleinen, selbst eingerichteten Labor in der Waschküche an der Burwood Road lagen Galaxien.
Jess liebte es, dort zu arbeiten. Jeder Tag brachte etwas Neues im großen Fluss der Proben, der niemals versiegte. Die jüngste Errungenschaft: eine Sammlung von Sperlingsvögeln aus Kandahar. Die Vögel waren bereits draußen gereinigt worden, das meiste der Federn und des Fleisches war entfernt. Maisy, Jess’ Assistentin, stand tief gebeugt über einer Schachtel mit den winzigen Geschöpfen, jedes sorgfältig zusammengebunden, damit keiner der kleinen Knochen verloren ging.
»Ich fahre heute Abend den Walschädel abholen«, sagte Jess. »Hast du alles, was du brauchst, während ich in Woods Hole bin?«
»Klar. Nach diesen Sperlingsvögeln kommen die Unterkieferknochen der Rehe für DNA-Proben. Die wollen sie besonders eilig, ich habe also zu tun.«
Als Jess das Labor nach ihrem Arbeitstag verließ, war ihr bewusst, dass sie wahrscheinlich nicht besonders gut roch. Sie hatte beschlossen, nicht mehr den Shuttlebus mit den anderen Angestellten zurück nach D. C. zu nehmen, denn sie hatte bemerkt, dass der Platz neben ihr meistens leer blieb, selbst wenn der Bus voll besetzt war. Deshalb hatte sie eine Stange Geld für ein gutes Fahrrad ausgegeben – ein Trek CrossRip mit ergonomisch tiefen Griffen – und war dankbar für den Radweg, der vom Support Center bis zurück in die Stadt führte. Sie zwirbelte ihren langen Pferdeschwanz zu einem Knoten zusammen und stopfte ihn unter den Helm.
Der Radweg war marode; immer wieder musste Jess Abfall und Schlaglöchern ausweichen oder sich unter den üppig wachsenden Frühlingszweigen ducken. In Sydney war der Wechsel der Jahreszeiten immer ganz allmählich vor sich gegangen; man merkte es an der Luft, die ein wenig wärmer oder kühler wurde, daran, dass die Tage immer ein Stückchen kürzer oder länger wurden, an der Qualität des Lichts. In Washington waren die Jahreszeiten wie ein Schlag vor den Kopf: die suppentopfheißen Sommer; die extravaganten Farborgien der herbstlichen Bäume; die berauschende Explosion von Blüten, Vogelgezwitscher und Duft im Frühling. Selbst der heruntergekommene Radweg war üppig begrünt, und wenn die Sonne tief im Westen stand, schimmerte der Anacostia River wie aufpoliertes Silber.
Jess bog nach rechts in Richtung South Capitol ab und fuhr durch eine ruhige Gegend mit alten, hohen Reihenhäusern, die durch breite Gärten von der Straße zurückgesetzt waren. Um diese Zeit des Jahres leuchteten die Tulpen und Azaleen in den Blumenbeeten in einer Palette von Magenta, Koralle und Lila. Jess hatte gezögert, als man ihr etwas anbot, das als Souterrainwohnung bezeichnet wurde, weil ihr australisches Herz Licht begehrte. Doch das Reihenhaus war renoviert und bot einen durchgehenden unteren Stock mit zwei großen Fenstern auf die Straße hinaus sowie einem großzügigen Oberlicht nach hinten, durch das immer die Sonne schien. Über den Sommer hatte das Licht im Inneren einen wässrig grünen Schein gehabt, was vom Geißblatt und den Trompetenblumen kam, die wild über die hintere Wand wucherten.
Sie schloss ihr Fahrrad ab (zwei Schlösser) und die Tür auf (drei Schlösser). Sie würde jetzt duschen, sich umziehen, eine kleine Reisetasche packen und sich dann ein paar Stunden hinlegen, bis sich der Verkehr beruhigt hatte. Etwa um zehn Uhr abends würde sie in der Garage des Smithsonian einen Transporter abholen und die Nacht hindurch zum Marine Biological Lab in Woods Hole fahren.
Sie war gerade auf dem Weg in die Dusche, als ihr Handy klingelte. »Tut mir leid, dass ich Sie auf Ihrer Privatnummer anrufe, aber hier ist Horace Wallis von Affiliates. Ihre Assistentin sagte, Sie seien ein paar Tage weg, deshalb dachte ich, ich melde mich besser gleich, bevor Sie fahren. Sie könnten mir vielleicht bei einem Problem helfen.« Jess kam die Stimme des Anrufers bekannt vor, sie konnte ihr jedoch kein Gesicht zuordnen.
»Klar«, sagte sie. »Was brauchen Sie?«
»Es ist ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin. Eine Forscherin vom Royal Veterinary College in England ist auf dem Weg hierher, um sich eines unserer Skelette aus dem neunzehnten Jahrhundert anzuschauen. Das Problem ist, wir können es nicht finden. 1878 war es im Castle, dann ging es ans American History Museum – warum man es dort wollte, ist nicht ganz klar. Jedenfalls sagen die, sie haben es nicht, zumindest nicht im Moment. Halten Sie es für möglich, dass es vielleicht bei Ihnen im Osteo Prep gelandet ist? Ich habe mir die Datenbank angeschaut. Nichts. Sie sind so ziemlich die letzte Stelle, die mir einfällt.«
»Ein artikuliertes Skelett, habe ich das richtig verstanden?«
»Ja.«
»Wir haben momentan keine artikulierten Skelette bei uns im Labor, aber Support hat achtundneunzig Prozent der Proben gelagert, deshalb werden Sie es dort höchstwahrscheinlich finden. Sie haben die Signatur, oder?«
»Ja, natürlich. Es ist …«
»Einen Augenblick. Ich muss mir was zum Schreiben suchen …« Jess kramte in den Unterlagen auf ihrem Schreibtisch. Alle Dokumente waren an den Rändern mit Zeichnungen von ihr geschmückt, ob es nun Jochbögen oder Halswirbel waren. Schließlich fand sie einen zerknitterten Boarding Pass, den sie nicht vollgekritzelt hatte.
»Ich werde gleich in meiner eigenen Datenbank nachschauen. Wenn es draußen in Support ist, bin ich mir sicher, dass ich es finde. Was ist es denn für eine Spezies?«
»Equus caballus. Ein Pferd.«
WARFIELDS JARRET
The Meadows, Lexington, Kentucky
1850
Sie war ein Pferd, das niemand als einfach bezeichnet hätte. Nicht bösartig, aber nervös. Was auf dasselbe hinauslaufen konnte, wenn man es recht betrachtete.
Jarret wusste, wie er auf sie zugehen musste. Ruhig und bedächtig. Weder sollte man zögern noch Unsicherheit zeigen, doch wenn man zu selbstherrlich war, ließ sie es auch nicht durchgehen. Dann drehte sie sich um, schnappte nach deinem Arm oder trat aus. Dr. Elisha Warfield hatte sie selbst gezogen und nach seiner Schwiegertochter Alice Carneal benannt. Im Stall wurde darüber gewitzelt, was er damit meinte und vielleicht seinem Sohn zu sagen versuchte.
Doch Alice Carneal hatte Jarret nie etwas getan. Kein Pferd hatte das. »Schau ihn dir doch an«, sagte Dr. Warfield manchmal und hob einen von Jarrets langen, mageren Armen hoch. »Der ist doch selbst noch ein halbes Fohlen.« Das nahm Jarret als Kompliment, denn wie sonst sollte er es nehmen? Und es stimmte auch, dass er seit seiner Kindheit ein Händchen für Pferde hatte. Die erste Schlafstatt, an die er sich erinnerte, hatte sich in einem Pferdestall befunden. Damals teilte er sich das Stroh mit den beiden Wallachen im Kutschenhaus, während seine Mutter im Herrenhaus schlief, denn sie war Kinderfrau bei dem Kleinen der Herrin. Jarret bekam sie kaum zu Gesicht. Seine erste Sprache waren die feinen Gesten und Geräusche der Pferde gewesen. Mit der menschlichen Sprache tat er sich anfangs schwer, doch die Pferde konnte er verstehen: ihre Stimmungen, ihr Verhältnis zueinander, ihre einfachen Bedürfnisse, ihre mannigfachen Ängste. Irgendwann merkte er, dass Pferde mit einer Unmenge an Ängsten lebten, und wenn man das begriffen hatte, bekam man auch eine klare Vorstellung davon, wie man mit ihnen umzugehen hatte.
Die beiden Wallache im Kutschenhaus waren ihm bessere Eltern gewesen, als seine Mutter dort im Herrenhaus es jemals sein konnte, ebenso wenig sein Vater Harry, der am anderen Ende der Stadt lebte und für Robert Burbridge Rennpferde trainierte. Harry hatte Jarret und seine Mutter einmal im Monat am Sonntag besucht. Jene Sonntage hatte Jarret geliebt. Er wusste, sein Vater war etwas Besonderes, denn er kam auf einem schönen Vollblüter angeritten und war gekleidet wie der Herr, in einem maßgeschneiderten Gehrock und Seidenkrawatte, und jeder im Kutschenhaus kuschte vor ihm. Jarret kam er selbst damals schon alt vor. Sein kurz geschorenes Haar war grau meliert, doch wenn er seinem Jungen zulächelte, schienen all die Linien und Fältchen in seinem Gesicht zu verschwinden. Jarret tat alles, um sich dieses Lächeln zu verdienen. Wenn sein Vater die Steigbügel kürzte und Jarret auf seinen Hengst setzte, lernte Jarret schnell, sein Gleichgewicht zu finden und keine Furcht zu zeigen. Und tatsächlich hatte er, kaum saß er da oben, keine Angst mehr. Obwohl das Pferd groß war und vor Kraft strotzte, war es freundlich, und Jarret spürte, wie es sich ganz bewusst bewegte und an dieses Leichtgewicht auf seinem Rücken gewöhnte, wie es ihn ruhig machte. Das war etwas, das er sich merkte: Ein gutes Pferd wird immer mit dir zusammenarbeiten, und es will dir nichts Böses.
Damals war er drei Jahre alt gewesen. Zwei Jahre später war seine Mutter krank geworden und gestorben. In jenem Jahr hatte er gelernt, was Angst bedeutete, verletzlich wie ein Fohlen ohne den Schutz der Mutter. Sein Vater, Harry Lewis, hatte all seine Ersparnisse aufgebraucht, um sich selbst freizukaufen, und folglich kein Geld mehr, um auch seinen Sohn zu befreien. Deshalb hatte er Dr. Warfield angefleht, seinen Jungen zu kaufen, damit er ihn in seiner Nähe haben und ihn aufwachsen sehen konnte. Zuerst hatte der Doktor protestiert; ein weiteres Kind sei das Allerletzte, was er auf seinem Anwesen brauchen konnte. Doch als Harry es schaffte, die Warfield-Pferde so gut zu trainieren, dass sie eine erstklassige Saison auf der Rennbahn hatten, gab der Doktor nach und kaufte Jarret den Todds ab.
Jetzt, mit dreizehn, schlief Jarret im Cottage seines Vaters, doch sobald er wach war, verbrachte er seine Zeit bei den Pferden. In den Scheunen der Warfields kannte er jedes Pferd, seinen Charakter, seine Angewohnheiten, seine Geschichte. Die guten wie die schlechten Eigenschaften. Die meisten Pferde wieherten leise, wenn sie ihn erblickten, pusteten warme Luft durch ihre samtigen Nüstern. Sie streckten ihre schimmernden Hälse aus, damit er sie streichelte.
Er wusste, dass er das von Alice Carneal nicht erwarten konnte. Die meiste Zeit blickte sie nicht einmal von ihrem Heu hoch. Doch als er an diesem Abend die Scheune betrat, um ein letztes Mal zu schauen, ob alles in Ordnung war, bewegte sie sich zusammen mit den anderen in ihrer Box zur Tür, die Ohren gespitzt statt angelegt, und schaute ihn mit ernsten, ruhigen Augen an.
Kaum war er bei ihr angelangt, legte sie den Kopf auf seine Schulter. Jarret stand lange still, nahm diese seltene Geste entgegen. Dann rollte er ganz langsam – wie immer langsam – die Tür ihrer Box zurück und trat ein. »Bewege dich, als wäre die Luft Melasse«, hatte sein Vater ihn angewiesen, und das tat er, hob träge die Hand und strich ihr über den Widerrist, spürte das weiche Fell, das immer noch Reste des dickeren Winterfells hatte. Sie lehnte sich gegen ihn, ließ sich seine Zärtlichkeit gefallen, und so fuhr er mit der Hand weiter nach hinten, zu ihrem angeschwollenen Bauch, und als sie ihre feuchten Lippen an seinen Hals schmiegte, ging er in die Hocke, um sie zu untersuchen.
Wie erwartet harzte sie; das kleine, weiße, tränenförmige Netz bildete sich bereits über dem Euter, damit es nicht zu früh Milch gab. Jarret stand wieder auf und fuhr langsam mit beiden Händen in Richtung ihrer Kruppe. Genau dort, zwischen der Hüfte und dem Sprunggelenk, lag die Lieblingsstelle der Stute. In der Scheune mochten es die freundlichen Stuten, wenn er über diese Stelle strich, sie ließen die Köpfe sinken und bekamen einen weichen Blick, als wären sie in einen Tagtraum versunken. Bei Alice Carneal nahm er sich diese Freiheit gewöhnlich nicht heraus, denn für sie war es eine ungewollte Liebkosung, die sie zum Drehen und Stampfen brachte. Doch jetzt ließ sie es zu, dass er mit den Fingern weit bis zu ihrer Schweifrübe fuhr, um zu prüfen, wie biegsam sie war. Sie lehnte sich sogar noch schwerer an ihn.
Diese liebenswerte Stute hatte rein gar nichts mit dem Derwisch zu tun, den er vor einem Jahr nur mit größter Mühe in den Zuchtstall der Nachbarn geführt hatte, wo Alice Carneal sich aufbäumte und ausschlug. Es war die erste Saison gewesen, in der man Jarret erlaubt hatte, seinem Vater dort zu helfen – vor seinem dreizehnten Lebensjahr war er dazu nicht kräftig genug gewesen. Sie hatte sich gewehrt, bis zu dem Moment, als sie ihr die Nasenbremse anlegten. Und dann, in den paar Minuten, als sie auf den Hengst warteten, konnte man den Angstschweiß der Männer riechen. Selbst erfahrene Männer – auch Jarrets Vater Harry – waren schweißgebadet.
Ungestüm. Das war es, was man über Boston sagte, und es war schon das ganze Leben des Hengstes so gewesen; jeder wusste das, von dem Jungen, der seinen Kot wegschippte, bis zu dem vornehmen Besitzer, der bei seinen Rennen die Gewinne einsteckte. Niemand konnte ihn reiten – nur die Sklavenjungen, die sich nicht dagegen wehren konnten, mussten es versuchen. Nachdem er einen von ihnen abgeworfen hatte und auf ihm herumgetrampelt war, bis er zerbrochen wie ein Kienspan auf dem Boden liegen blieb, hatte der Trainer dem Besitzer gesagt, er solle ihn entweder kastrieren oder erschießen lassen, und er sei höchstpersönlich dazu bereit, dies zu tun. Doch beides geschah nicht, denn als Boston dann das erste Rennen machte, wurde klar, dass er ebenso schnell wie stürmisch war. Innerhalb von sieben Jahren war er fünfundvierzig Mal an den Start gegangen und hatte vierzig Rennen gewonnen, viele von ihnen über die anspruchsvolle Distanz von vier Meilen und die meisten von ihnen ohne eine anständige Ruhepause dazwischen. Es gab viele Männer wie Dr. Warfield, die bereit waren, die beträchtliche Gebühr dafür zu zahlen, dass dieser Hengst eine ihrer Stuten deckte, auch wenn er mittlerweile längst erblindet war und man ihm ansah, wie hart man ihn herangenommen hatte. Doch sein armseliger Zustand hatte seinem Temperament keinen Abbruch getan, ja, es hatte ihn sogar noch reizbarer und gefährlicher gemacht.
Es waren nur ein paar Minuten dort im Schuppen gewesen. Da waren Männer und Seile und ein kastanienbrauner Hengst, der seine Pflicht erfüllte. Ein Stoßen, ein Schauder. Und als man danach den Hengst wegführte, hatte sich Harry mit dem Ärmel die Stirn abgewischt und dem immer noch zitternden Jarret die Hand auf die Schulter gelegt. »Was wir da in diesem Schuppen gerade gemacht haben, ist genau das, woran sich entscheidet, ob wir gewinnen oder verlieren.«
Es war Harry gewesen, der diesen Deckakt vorgeschlagen hatte. Von allen Stuten auf Meadows hatte er Alice Carneal immer besonders bewundert, obwohl sie in ihrer kurzen Karriere nur ein einziges Rennen gewonnen hatte. Zu Hause auf Meadows war sie schnell gewesen, doch schon auf dem Weg zwischen dem vertrauten Stall und der Rennbahn hatte sie vollkommen die Form verloren. Stand das Rennen kurz bevor, begann sie zu schwitzen, musste sich entleeren, zitterte am ganzen Leib und war inmitten der vielen Menschen und des Lärms fast unmöglich zu führen. Doch darüber schaute Harry hinweg. Er mochte die Kombination von Tiefe im Gurtbereich und Länge der Hinterhand, die dem Pferd den Raum für kräftige Lungen und im Galopp ein Maximum an Schubkraft gaben. »Die Probleme, die sie hat, sind im Kopf und nicht in der Hinterhand«, sagte er.
Er hatte mit harten Bandagen kämpfen müssen, um die hohe Decktaxe in einem ansonsten mauen Jahr zu begründen. Doch er überzeugte Dr. Warfield, dass die Zeit knapp sei: dass Boston nicht besonders gut aussehe und vielleicht keine weitere Saison mehr seinen Mann stehen würde. »Das könnte auch uns beiden passieren, nicht nur dem Hengst«, sagte der Doktor mit einem ironischen Grinsen. Er war damals bereits über siebzig und von Zipperlein geplagt. Doch Harry ließ sich nicht abwimmeln.
In jenem Winter fanden sie Boston tot im Stall. Bis zu seinem letzten Atemzug hatte er gegen die Welt gewütet: Die Wände seiner Box waren voller Blut, weil er sich so heftig gegen den Tod gewehrt hatte. Alice’ Fohlen würde einer der allerletzten Nachkommen des berühmten Hengstes werden.
Und dieses Fohlen würde jetzt bald zur Welt kommen. Jarret griff nach einer Mistgabel und machte die Box gründlich sauber, legte ein tiefes Bett aus frischem Stroh aus. Die ganze Zeit schaute ihm Alice ruhig zu. Er tätschelte sie ein letztes Mal. Rasch schaute er sich die anderen Boxen an – kein Pferd hatte sich hingelegt, in den Eimern war genügend Wasser –, und dann trat er aus der Scheune und in die Frühlingsnacht hinaus.
Der Himmel war klar, die Sterne funkelten wie Glassplitter. Kein Mond. Hätte Alice in der Wildnis abgefohlt, hätte dieser pechschwarze Himmel sie in den ruhigsten Stunden der Nacht, vor oder nach Mitternacht, verborgen. Stuten besaßen die Fähigkeit, eine Geburt so zu verlangsamen, dass das Fohlen die dunkelsten Nachtstunden nutzen konnte, um auf die Füße zu kommen, und bei Morgengrauen dazu bereit war, vor einem möglicherweise lauernden Raubtier davonzulaufen. Tautropfen lagen dick und rund auf dem frischen Frühlingsgras. Jarret spürte, wie die Feuchtigkeit die Säume seines Overalls durchnässte, während er das ungemähte Feld überquerte. Tief atmete er die Frische der frühen Veilchen inmitten des dumpfen Geruchs modernder Blätter ein. Als er in Trab fiel, hüpfte das Licht seiner Laterne wie ein gelber Ball über dem Gras.
Seine besten Erinnerungen waren mit Meadows verbunden. Dr. Warfield hatte dieses Land nördlich der Stadt gekauft, nachdem seine angegriffene Gesundheit ihn dazu veranlasst hatte, seine Tätigkeit als Geburtshelfer mit ihren unvorhersehbaren Arbeitszeiten aufzugeben. Doch der Doktor hatte seine Pensionierung nicht bereut. Er errichtete ein Backsteinherrenhaus mit sechzehn Zimmern und widmete sich fortan vielen geschäftlichen Aktivitäten und seiner allerersten Liebe, den Pferden. Er war Begründer des ortsansässigen Jockeyclubs und stand dem Bau von dessen erster Rennbahn vor. Davor hatten die Leute einfach die Hauptstraße von Lexington für Rennen ihrer Quarter Horses benutzt, und manchmal konnte man auch heute noch diese rasanten Veranstaltungen vom Balkon der Stadtwohnung von Dr. Warfield aus sehen, die über seinem beliebten Kurzwarenladen an der Hauptstraße lag.
Jarret war froh gewesen, die Stadt hinter sich lassen zu können. Er mochte weder das Geratter der eisenbeschlagenen Räder der Kutschen noch die kantigen, bulligen Backsteingebäude, dicht an dicht in der Stadt, und ebenso wenig all die Leute, von denen er nicht wusste, wie sie hießen. Wenn er für eine Besorgung hier war, konnte er es kaum erwarten, sie zu erledigen und schnell zurück nach Meadows zu kommen. Es gab jede Menge Nachrichten und Waren, die zwischen Meadows und der Stadt hin- und hergingen. Weil Jarret derjenige war, der von allen am wenigsten dazu neigte, in der Stadt zu trödeln, wurde er besonders oft geschickt anstelle der Jungs, die es liebten, in die Stadt zu gehen und dort ein wenig zu bummeln und zu glotzen. Für ihn schien das Leben immer so zu laufen – gegen den Strom.
Jarret sah die Lichter, die zwischen den Bäumen blinkten. Sie waren im großen Haus also immer noch am Essen. All diese Kerzen, und Mrs. Warfield bestand darauf, dass es jeden Tag frische gab. Die heruntergebrannten Stummel kamen in die Sklavenquartiere, und das war ein Segen für all diejenigen, die sich neben ihrem Tagwerk und den vom Herrn, dem Marse, auferlegten Aufgaben etwas in die eigene Tasche dazuverdienten. Die meisten von ihnen waren die Männer seines Vaters, die Stallburschen und Knechte. Harry war ein guter Verwalter, der jedem Mann die Aufgaben zuteilte, die er am besten bewältigen konnte, der seine Fähigkeiten nutzte, ohne den Bogen zu überspannen. Er wusste, wie sehr sich die Leute danach sehnten, sich freizukaufen, so wie er selbst es getan hatte, und ermunterte deshalb diejenigen, die ihre Arbeit als Zaumzeugflicker oder Sattler anbieten wollten, dies zu tun. Dr. Warfield hatte nie etwas dagegen, solange sein eigener Haushalt vorzüglich geführt wurde.
Es war ruhig auf den Wegen, die meisten Leute lagen bereits im Bett. Nur den Webstuhl hörte er in der dunklen Hütte von Blind Jane rattern, während sie mit kundiger Hand das Schiffchen durch die Kettfäden zog und das entstehende Gewebe mit einem leisen Klopfen festzurrte. Das Tageslicht hatte für sie keinerlei Bedeutung mehr; sie würde weben, bis die Müdigkeit sie übermannte.
Jarrets Vater arbeitete gern für Dr. Warfield, weil er die gesamte Zeit über ein freier Mann war und Dr. Warfield ihn auch entsprechend behandelte und Harry gerne dafür lobte, dass er ihre Gewinne auf der Rennbahn verdoppelt hatte. Als der Doktor hinfälliger wurde, hatte er Harry die Organisation der Pferdeställe überlassen und seinen Lohn auf fünfhundert Dollar im Jahr erhöht, was mehr war, als so mancher weiße Trainer verdiente.
Harrys frühere Stellung als Trainer für Mr. Burbridge war deutlich gefahrvoller gewesen. In den zehn Jahren, die er ihm gedient hatte, hatte sein Herr ihn nie vergessen lassen, dass er »Burbridges Harry« war, wie man einen Sklaven eben nannte. In den allerletzten Tagen des alten Mannes hatte sich Burbridge für einen Pharao gehalten, mit einem Bowiemesser herumgefuchtelt und verkündet, Harry müsse ihn ins Jenseits begleiten, um dort seine Pferde zu trainieren.
Von diesem Kram aus alten Zeiten wusste Jarret nichts – damals lebte er noch bei den Todds. Doch er hatte gesehen, wie das Gesicht seines Vaters aschfahl wurde, wenn er sich daran erinnerte. Alles nur erdenkliche Unheil kann entstehen, wenn ein schwarzer Mann und ein weißer Mann mit einem Messer im selben Raum sind, auch wenn kein einziger Blutstropfen vergossen wird.
Ihre Hütte stand etwas abseits neben dem Hauptweg und hatte einen kleinen Vorgarten. Sein Vater musste Jarrets Laterne gesehen haben, denn die Tür ging auf, noch bevor er am Tor war. Warmes, gelbes Licht fiel auf ihn, gefolgt von dem köstlichen braunen Duft nach gebratenen Zwiebeln und Speck.
Jarret trat am Türabsatz aus seinen Stiefeln und schüttelte die feuchten Erdklumpen ab, die daran hingen. »Alice bekommt ihr Fohlen«, sagte er. »Sie harzt und ist ungewohnt freundlich.«
Harry nickte. »Das ist bei ihr so. Immer schon. Na, dann geh, wasch dich, und iss etwas. Sie hat keine großen Probleme mit dem Abfohlen, aber man weiß ja nie, und sie ist ja schon über vierzehn Jahre alt. Könnte eine lange Nacht werden.«
Jarret goss sich Wasser aus dem Krug über Hände und Handgelenke, wusch sich den weichen Pferdeduft ab und ersetzte ihn durch den scharf-bitteren der Lauge. Dann ging er an den Herd. Ein Topf mit cremigen Bohnen stand auf der Platte, eine Pfanne mit frisch gerösteten Maisfladen auf dem Untersetzer. Jarret füllte sich eine Schüssel randvoll und aß mit großem Appetit, wischte die Schale mit einem Stück Fladen aus.
Harry zündete zwei Laternen an und reichte eine davon seinem Sohn. Während sie zur Scheune zurückgingen, legte Harry den freien Arm um die Schultern seines Sohnes. Er musste sich ein wenig strecken, und ein starkes Gefühl der Zufriedenheit durchströmte ihn. Jarret war noch nicht ganz so groß wie er, aber bald würde er ein stattlicher junger Mann sein.
Harry war dieses Glück verwehrt gewesen. Er war erst fünf Jahre alt, ein für sein Alter kleiner und schmächtiger Junge, als sie ihn zum ersten Mal auf einen Vollblüter gesetzt hatten. Jedes Mal, wenn er herunterfiel, hatte es Schläge gegeben, weshalb Harry schnell lernte, oben zu bleiben. Wenn er an Gewicht zunahm, kürzten sie seinen sowieso knappen Speisezettel auf eine einzige Rübe zum Abendessen und einen Krug Milch zum Mittagessen. Sollte er trotz dieser spartanischen Mahlzeiten nicht abnehmen, verpassten ihm die Trainer einen strammen Zehnmeilenmarsch, den er am Ende seiner Schicht zu bewältigen hatte, und wenn auch das nicht funktionierte, kam er ins Schwitzbad. An den heißesten Tagen des Hochsommers bis ans Kinn in einen großen Haufen dampfenden Mist gesteckt, spürte er, wie sein ohnehin dürftiges Fleisch dahinschmolz. Er verbrachte seine Jugend mit ewigem Grollen im Bauch und einem Schwindel im Kopf. Wer einmal so viel Hunger gehabt hat, vergisst nie, wie weh das tut, auch wenn genau dieser Hunger das Geld vermehrt, mit dem man sich später die Freiheit erkaufen kann. Siegreiche Jockeys bekamen ihre Prämie bar auf die Hand, und Harry sparte jede einzelne. Er schaute sich vieles von den Trainern ab, lernte von den Besten, was er zu tun hatte, und beobachtete bei den Schlechtesten, was es zu unterlassen galt. Irgendwann machte ihn dieses Wissen wertvoller am Boden, als er es zu Pferd je gewesen war.
Er hatte sich geschworen, dass sein Sohn keinen Tag erleben sollte, an dem er hungern musste, ganz gleich, wie gut er ritt. Und er hielt sich daran, auch als Jarret irgendwann auf dem Pferd saß, als wären Junge und Tier ein und dasselbe Geschöpf. Jarret ritt mit natürlicher Anmut, selbst bei den mörderischen Viermeilenrennen, die Pferd und Reiter gleichermaßen auf die Probe stellten und bei denen man Schnelligkeit, Durchhaltevermögen und strategisches Denken benötigte. Es gab Jahre, in denen viele mit Engelszungen auf Harry eingeredet hatten, seinen Jungen zum Jockey zu machen. Doch Harry war dagegen gewesen, und Dr. Warfield bestand nicht darauf. Selbst als Dreikäsehoch hatte der Junge wundervoll lange Knochen in Armen und Beinen, und der Doktor sagte bereits jetzt einen Wachstumsschub voraus, der ihn vermutlich genau dann wieder aus dem Sattel befördern würde, wenn er sich einen Namen in der Branche gemacht hätte. Eines Tages, sobald er das Geld dafür zusammenhatte, plante Harry, den Jungen zu kaufen, damit er endlich von niemandes Meinung mehr abhängig war, was seinen Werdegang betraf. Außerdem war Jarret bereits jetzt erwachsen genug, um jegliches Gerede zum Schweigen zu bringen. Er ritt immer noch jeden Tag, bildete die Pferde aus und würde schon bald in Harrys Fußstapfen als Trainer treten.
Als sie in die Scheune kamen, ging Alice unruhig in ihrer Box hin und her, ihr Fell glänzte vor Schweiß. Harry und Jarret nahmen ihre Plätze ein, wo sie für die Stute unsichtbar waren. Harry sprach in einer leisen, wohlklingenden Stimme zu ihr, fast einer Art Summen, sagte ihr, was für ein gutes Pferd sie sei, und was für ein wundervolles Fohlen sie auf die Welt bringen würde. Es war ein beruhigender Singsang, und während die Stunden verstrichen, döste Jarret ein.
Er wurde wieder wach, als das Fruchtwasser der Stute abging. Sie gab ein leises Ächzen von sich und legte sich dann vorsichtig in das für die Geburt vorbereitete Stroh. Harry kniete neben ihr, als die Fruchtblase sich nach außen wölbte. Die winzigen Sicheln der Hufe waren durch die perlweiße Membran deutlich sichtbar, elegant übereinanderliegend, die Sohlen nach unten, was die korrekte Position für eine unkomplizierte Geburt war. Und prompt folgte, als die Vorderbeine bis zu den Knien draußen waren, ein glänzend feuchtes Maul – das Fohlen lag in bester Position, angeordnet wie eine Pfeilspitze. »Jetzt kommt der schwierigste Teil«, murmelte Harry. Die Schultern, dort, wo das Fohlen am breitesten war. Er summte weiter, um Alice Mut zu machen. Er sah, wie die kleinen weißen Hufe in der Fruchtblase strampelten. Ein paar Minuten später riss die Blase, und das Fohlen flutschte heraus. Ein winzig kleines Pferd glitt auf das Stroh, wie ein Geschenk, von seiner Verpackung befreit.
Es war ein Hengst, braun wie seine Mutter, mit Stern und Schnippe auf dem Gesicht und vier weißen Beinen oder auch Stiefeln, wie man sagte. Harry reichte Jarret über die Box hinweg ein Tuch, und gemeinsam rieben sie den glitschigen kleinen Körper des Fohlens trocken. Dann schob Alice die beiden beiseite und leckte ihren kleinen Sohn ab. Nach einer Weile richtete sie sich vorsichtig auf und zerriss die Nabelschnur. Das Hengstfohlen war bereits aufrecht und stand auf wackeligen, zitternden Beinen.
»So was habe ich noch nie gesehen«, sagte Harry. »Dass das Fohlen steht, noch bevor die Mutter es tut.« Nur wenige Minuten später legte sich Alice wieder hin und stupste mit dem Maul ihre Flanken, bis die Nachgeburt kam. Harry und Jarret saßen schweigend bei ihr und betrachteten Alice, die ihr Fohlen beleckte und beschnupperte. Dann hatte der Hengst ihre Zitze gefunden, sein kleiner Schweif wedelte hin und her, als er die reichhaltige Vormilch kostete. Nach etwa einer Stunde, und ohne sich anzustrengen, gab er den klebrigen, rostfarbenen Dung von sich, der zeigte, dass mit seinen Eingeweiden alles in Ordnung war.
Harry setzte sich auf seine Fersen zurück und gab ein zufriedenes Seufzen von sich. »Jetzt ist unsere Arbeit getan, so wenig es auch war. Ein bisschen schmal ist er schon, aber wir werden sehen, was aus ihm wird.«
»Und was ist mit den weißen Stiefeln? Bedeuten die nicht Unglück?«
Harry lächelte, als er die Lappen einsammelte. »Es gibt Menschen, die an solchen Blödsinn glauben. Leute, die mit Rennen zu tun haben, neigen zu Aberglauben. Das kannst du nutzen, wenn du es geschickt anstellst. Man kann die Wetten manipulieren, indem man in den Rennställen ein bisschen munkelt. So wie ich es sehe, hängt es nicht von der Farbe ab, wie gut ein Pferd ist. Es ist sein Inneres, auf das es ankommt.«
Harry gähnte und wandte sich zur Tür.
»Ich glaube, ich bleibe noch«, sagte Jarret. »Ich möchte gern noch ein bisschen auf sie aufpassen.«
»Ist mir recht, Sohn«, sagte Harry. »Aber du weißt ja, lass sie jetzt in Ruhe. Das ist die Zeit, in der sie sich aneinander gewöhnen. Und schau, dass du ein bisschen Schlaf bekommst, was von der Nacht eben übrig ist. Die anderen Pferde schlafen schon. Und morgen früh, wenn du mit ihnen arbeitest, sind sie frisch, also sieh zu, dass du auch ausgeruht bist.«
Jarret beobachtete das Fohlen, das seine Mutter beschnupperte. Die Bohlen der Scheune knarzten. Ein Huf schlug gegen die Wand einer Box. Das leise Schnaufen von weichen Lippen und feuchten Nüstern. Er fühlte sich warm und leicht, müde und auch wieder nicht müde. In der Scheune roch es nach frischem Heu, aber es lag auch der mineralische Duft einer kürzlich erfolgten Geburt in der Luft. Er drehte den Docht seiner Laterne herunter und machte sich ein wohlriechendes Bett aus Wiesenlieschgras und Klee, zog die alte Decke über sich. Er war fast eingeschlafen, als er im Heuboden über sich etwas rascheln hörte. Eine Katze beim Mausen, dachte er und rollte sich herum. Doch dann hörte er ein Husten.
Er sprang auf, griff nach der Laterne, vergaß, dass er das Licht gerade gelöscht hatte.
»Wer ist da?«, fragte er und spähte die Leiter hoch in den dunklen Heuboden.
»Nur ich, Jarret. Mary Barr. Bitte sei nicht böse.«
»Ob ich böse bin oder nicht, sollte nicht Ihre Sorge sein. Miss Clay, was machen Sie hier? Sie haben hier nichts verloren mitten in der Nacht. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, wenn Ihre Grandma das erfährt.«
Mary Barr Clay, elf Jahre alt, kam barfuß und im Nachthemd die Leiter heruntergeklettert. »Ich dachte, dass Alice heute Nacht vielleicht ihr Fohlen bekommt. Sie war so lieb vorhin. Ganz anders als sonst. Deshalb habe ich mich, als alle zu Abend gegessen haben, hierhergeschlichen, und als ich dann gehört habe, wie dein Dad und du reinkamt, habe ich mich oben versteckt. Als dein Daddy dem Pferd vorgesungen hat, bin ich eingeschlafen.« Sie zupfte Heuhalme aus dem Spitzenbesatz ihres Nachthemdes und ging zur Box hinüber, stützte sich mit ihren blassen Armen auf der Tür ab und schaute sich das Fohlen an, kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit etwas zu erkennen. »Das ist aber ein schönes Pferdchen, oder?«
Mary Barr fand jedes Fohlen schön, aber Jarret wollte in dieser Hinsicht nicht mit ihr streiten, denn er dachte genau das Gleiche. Was auch immer sein Vater über den Winkel von Kniescheiben, über Kuhhessigkeit oder Spat sagte, für Jarret waren alle Pferde schön und gut. Man musste nur die richtige Anwendung für sie finden.
»Sie sollten eigentlich wissen, dass man besser nicht barfuß in eine Scheune geht, Miss Clay«, sagte Jarret und versuchte, den gestrengen Ton eines Erwachsenen anzuschlagen.
»Ich weiß«, sagte sie und wandte sich ihm mit einem reumütigen Gesichtsausdruck zu. »Aber ich wollte nicht, dass mich jemand hört. Einen großen Splitter habe ich mir schon rausgezogen.« Sie hob einen schmutzigen Fuß und zeigte ihm die Stelle. »Du wirst mich doch nicht verraten, oder?«
»Sollte ich schon«, sagte er. »Aber ich werde es nicht tun, wenn Sie jetzt auf der Stelle zurück ins Haus gehen.«
»Danke, Jarret. Und wenn ich erwischt werde, sage ich nicht, dass du mich gesehen hast.«
Er blickte ihr hinterher, einer schmalen, weißen Gestalt in der Dunkelheit, die die Anhöhe zum Haus hochlief. Statt die flachen Steinstufen zum großen Haupteingang zu nehmen, schlüpfte sie über die seitliche Veranda hinein. Als er sah, wie der weiße Fleck im Küchenbereich verschwand, wusste er, dass sie es geschafft hatte. Annie, das Küchenmädchen, schlief dort in einem Alkoven neben dem Lagerraum, wo die Kleine unbemerkt über eine Treppe hoch in ihr Schlafzimmer konnte. Jarret wusste, dass Annie auf das Clay-Mädchen, Dr. Warfields Enkelin, aufpasste. Von ihrem Vater, Cassius Clay, sagte man, er sei ein furchterregender Zeitgenosse, der sogar gegen den Westwind ankämpfte, wenn ihm gerade der Ostwind lieber war. Vielleicht war das auch der Grund, warum das Mädchen und seine Mutter so oft auf Meadows waren und nicht in einem ihrer beiden schönen Häuser – White Hall, dem großen Anwesen der Clays, oder dem eleganten Stadthaus in Lexington. Mr. Clay gab eine Zeitung heraus, die sich gegen die Sklaverei aussprach, und hatte allen Sklaven, die er geerbt hatte, die Freiheit geschenkt. Das war in Kentucky etwas ebenso Sonderbares wie Seltenes und könnte noch ein Grund dafür sein, dass Annie einen Narren an der kleinen Clay gefressen hatte. Jarret verstand jedoch nicht viel von all dem, weil Harry es nicht gern hatte, wenn über die Kämpfer gegen die Sklaverei und ihr Anliegen gesprochen wurde. Doch Jarret konnte nicht anders, als sich zu fragen, warum ein Mann wie Cassius Clay sich gegen eine Welt und eine Familie stellte, die auf genau dem, was er ablehnte, ihren Reichtum aufgebaut hatte. Jarret kehrte in sein kleines Nest im Heu zurück und verbrachte die letzten Stunden der Nacht, ganz ähnlich wie die Pferde, halb schlafend und halb wachend.
Als die Knechte kurz vor Morgengrauen in den Stall kamen, um die Pferde zu füttern, rappelte sich Jarret hoch und überprüfte die Box. Das Fohlen hörte auf zu trinken und hob den Kopf, die Ohren aufgestellt, die Nüstern gebläht. Fohlen und Mutter drehten sich gleichzeitig um und schauten ihn an. Das Fell des Fohlens war getrocknet. Als das erste Licht darauf fiel, glänzte es wie poliertes Messing. Jarret trat in den perlmuttfarbenen Dunst des frühen Morgens hinaus. Er reckte den Hals nach rechts und nach links, dehnte seine Schultern. Und dann lief er nach Hause, wo sein Vater bestimmt schon einen großen Teller Grießbrei mit Eiern für ihn hergerichtet hatte.
THEO
Georgetown, Washington, D. C.
2019
Theo begann, seinen Artikel auszudrucken. Er war zufrieden damit und hoffte, sein Redakteur würde es auch sein. Er hatte es endlich geschafft, sich seines akademischen Schreibstils zu entledigen, so wie man einen Anzug auszieht, um in ein Sweatshirt zu schlüpfen. Er wusste, die Zeitschrift wollte den Artikel noch vor der Eröffnung der Traylor-Ausstellung im American Art Museum herausbringen, deshalb war die Deadline so knapp gewesen. Aber er würde ihn nicht mailen. Er würde mit dem Fahrrad rüberfahren und ihn seinem Redakteur persönlich in die Hand drücken. Seine Eltern, die Diplomaten, hatten ihm eingetrichtert, wie wichtig persönliche Kontakte waren: Schreib niemals eine Mail, wenn du auch telefonieren kannst, und wenn du jemanden persönlich treffen kannst, ist das besser als jeder Anruf. Theo war scharf darauf, noch mehr Aufträge an Land zu ziehen. Zum einen war es erfrischend, für ein allgemeines Publikum zu schreiben statt für ein akademisches. Und zum anderen bezahlte das Magazin des Smithsonian anständige Honorare, und das Geld war ein willkommenes Zubrot zu seiner eher bescheidenen Bezahlung als wissenschaftliche Hilfskraft.
Er stand auf und streckte sich, während sich die Seiten aus dem Drucker schoben und zu einem ansehnlichen Stapel auftürmten. Er schaute aus dem Fenster. Der Haufen Sperrmüll auf dem Bürgersteig wurde nur langsam weniger. Passanten hatten den Stapel in alle Himmelsrichtungen auf dem Gehweg verteilt. Gerade eben griff ein Student in einem George-Washington-Shirt nach der Lampe mit dem geschwungenen Hals.
Mitten auf Theos Schreibtisch stand seine eigene Ausbeute: eine etwas schmuddelige Leinwand in einem zerborstenen Rahmen. Theo betrachtete das Gemälde. Es ergab durchaus Sinn, dass auf dem einzigen Kunstwerk in dem Haufen Sperrmüll ein Pferd abgebildet war. Es war kein Samstag vergangen, an dem der alte Mann nicht auf seiner Vordertreppe gesessen und dem Geplärr der Rennberichterstattung gelauscht hatte, neben sich stapelweise Bierdosen und Zigarettenstummel.
Das Gemälde war alt, mutmaßte Theo. Möglicherweise neunzehntes Jahrhundert. Auf der unteren Hälfte war kaum noch etwas zu erkennen, weil das Bild unter einer dicken Schmutzschicht lag. Doch was man auf der oberen Hälfte erkennen konnte, sah nach einem sehr gelungenen Gemälde aus. Er richtete den Kopf seiner Schreibtischlampe so, dass Licht direkt auf das Bild fiel. Der Kopf eines leuchtend kastanienbraunen Hengstfohlens schaute aus der Leinwand, der Ausdruck in den Pferdeaugen ungewöhnlich und eindringlich. Wer auch immer der Maler war, er hatte sicher einiges von Pferden verstanden. Theo suchte unter der Spüle in seiner Küche nach einer Plastiktüte und wickelte das Bild darin ein. Er würde es morgen mitnehmen. Bestimmt kannte der Redakteur beim Smithsonian Magazine jemanden im Bereich Restaurierung, der es sich einmal ansehen würde. Vielleicht ließ sich ja sogar ein Artikel daraus basteln: »Wie man herausfindet, ob ein Gemälde aus dem Sperrmüll irgendeinen Wert hat.«
Theos Kenntnisse in Sachen Malerei waren durchaus umfassend, aber als er sich sein Fundstück anschaute, wurde ihm klar, dass bei ihm eine große Lücke klaffte, was die künstlerische Darstellung von Pferd und Reiter in Amerika anging. Über die Briten – Stubbs, Landseer – wusste er alles. Wie bei den meisten Kids von Diplomaten hatte seine schulische Ausbildung im Ausland stattgefunden. Seine Eltern, Abiona, eine Nigerianerin vom Stamm der Yoruba, und sein kalifornischer Vater Barry hatten sich kennengelernt, als sie beide als junge Diplomaten ihren ersten Job bekleideten – sie in Kenia, er im Sudan – und in einer Strandbar in Mombasa ein wenig Ruhe und Entspannung suchten. Sie hatten zuerst eine Fernbeziehung und dann eine Fernehe geführt. Theo war schon vier gewesen, bevor sie zum ersten Mal einen gemeinsamen Posten in Canberra bekamen, und es wurden die glücklichsten Jahre, die er je erlebt hatte. Doch seine Eltern waren ehrgeizig und hatten sich später für Stellen beworben, bei denen sie sich mit den kniffligeren Seiten der Außenpolitik ihrer Länder befassen konnten.
Als sie nach London gezogen waren, wurde Theo gerade sieben. Er vermisste damals alles an Canberra: die langen, warmen Abende, den riesigen Garten, die multikulturelle Atmosphäre in den Klassenräumen, in denen sich Diplomatenkinder aus aller Herren Länder tummelten. Vor allem fehlten ihm die Ausritte am Samstag, die er an der Seite seines Vaters unternommen hatte. Sein Vater hatte in der Nähe von Ojai ein Internat besucht, das sich dem Reiten verschrieben hatte, und liebte Pferde, weshalb er Theo ein winziges Paar Blundstone-Reitstiefel gekauft und ihn in einen Sattel gesetzt hatte, so früh es nur ging. Jeden Samstag ritten sie zusammen zu einer Schaffarm, die nicht allzu weit weg von der Stadtgrenze war.
Auf einem lustlosen Pony durch einen Londoner Park zu zockeln war nicht mit dem Ritt auf einem robusten Arbeitspferd im australischen Busch zu vergleichen. Zu Beginn versprach sein Vater ihm, auf dem englischen Land einen besseren Stall aufzutreiben. Doch irgendwann war nicht mehr die Rede davon gewesen. An den meisten Wochenenden schien es immer dringliche Arbeiten an der großen Botschaft am Grosvenor Square zu geben.
Später, als er älter wurde, hatte Theo begriffen, dass sein Vater auch deshalb so selten zu Hause war, weil die Ehe seiner Eltern vor dem Scheitern stand. Ihr Haus an den Mayfair Mews wurde zu einem armseligen Gefängnis des Elends. Knappe Worte, zugeschlagene Türen. Schmale Lippen und plötzliche Tränen. An dem Abend, an dem sich seine Eltern mit ihm hinsetzten und ihm mitteilten, dass sie Posten an verschiedenen Orten angenommen hatten und sich scheiden lassen wollten, empfand Theo mehr Erleichterung als Bedauern. Seine größte Sorge war die, dass sie von ihm verlangen würden, sich für einen von beiden zu entscheiden. Doch Bedenken wären gar nicht nötig gewesen; sie hatten beide einen Posten angenommen, der »unbegleitet« war – sein Dad in Afghanistan, seine Mutter in Somalia –, und beschlossen, ihn aufs Internat zu schicken. Sein Vater hatte seine eigene Schule in Kalifornien vorgeschlagen, doch davon wollte Abiona nichts wissen.
»Eine amerikanische Schule? Wo sie in einem Kreis sitzen und über ihre Gefühle reden, statt Programmieren und Rechnen zu lernen?« Sein Vater war auf verlorenem Posten gewesen, als er versuchte, eine Lanze für Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung zu brechen, doch er hatte schon früher in seiner Ehe festgestellt, dass es sinnlos war, mit Abiona zu streiten; sie war bei allen Wettbewerben die Siegerin des nationalen Debattierclubs in Nigeria gewesen. Und so blieb Theo in England und besuchte das nur Jungs vorbehaltene Eliteinternat, das Abiona ausgesucht hatte.
Die Schule hielt viel auf ihre Traditionen, was eisige Schlafsäle und ebenso kühle zwischenmenschliche Beziehungen bedeutete. Einsam und geächtet zog es Theo wie magnetisch zu den Ställen. Dort traf er auf eine Clique von bleichhaarigen Jungs in persilweißen Polohosen, die verzwickte Doppelnamen und ein Zuhause ihr Eigen nannten, das schon vor der Schlacht von Azincourt uralt gewesen war. Theo fühlte sich nur im Sattel nicht als Außenseiter. Der Reitstil, den er sich in einem Paddock in Australien angeeignet hatte – mit schnellem Galopp und Rollbacks, bei denen das Pferd bei vollem Tempo eine Kehrtwende machte –, passte perfekt zum Polo. Er war einfach zu gut, um nicht ins Team aufgenommen zu werden, und wurde schon bald Kapitän.