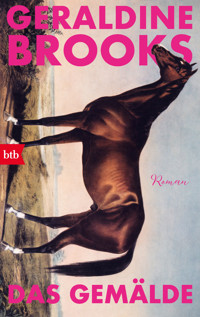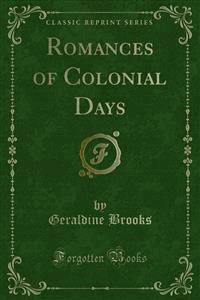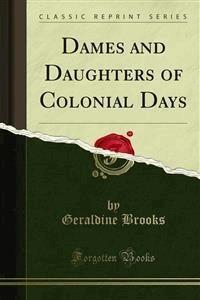3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen, die sich finden. Zwei Welten, die aufeinanderprallen
Nordamerika, 1660 – auf einer kleinen Insel, die heute Martha‘s Vineyard heißt: die 12-jährige Bethia wächst in einer puritanischen Siedlung auf. Ihr Vater ist Prediger, ein strenger Mann, dessen Mission es ist, seinen Glauben auf das Eiland vor Cape Cod zu bringen, das sich die englischen Siedler mit den Wampanoag-Indianern teilen. Doch Bethia fühlt sich fast magisch angezogen von diesen Fremden, die sie oft heimlich auf ihren Streifzügen durch die wilde Natur der Insel beobachtet. Eines Tages trifft sie auf Caleb, den Sohn eines Häuptlings. Auch er ist fasziniert von dem Mädchen mit den blauen Augen und dem wachen Verstand. Die beiden knüpfen ein zartes Band. Doch als sie heranwachsen, kommt der Moment, an dem sie gezwungen werden, für ihre Freundschaft und für ihren Platz im Leben zu kämpfen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
GERALDINE BROOKS wurde 1955 in Sydney geboren und bereiste elf Jahre lang als Auslandskorrespondentin des Wall Street Journal verschiedene islamische Länder, darunter Bosnien, Somalia und den Mittleren Osten. Ihr erster Roman »Das Pesttuch« wurde von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert und avancierte zum Bestseller. 2006 erhielt sie für »Auf freiem Feld« den Pulitzerpreis. Auch ihr neuer Roman »Insel zweier Welten« stand auf Anhieb auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Geraldine Brooks lebt in Virginia.
Geraldine Brooks
Insel zweier Welten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Judith Schwaab
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Caleb’s Crossing« bei Viking Penguin, New York.
Karte: Laura Hartmann MaestroCaleb Cheeshahteaumauks Brief an seine englischen Gönner (letzte Seite) veröffentlicht mit Erlaubnis der Royal Society, London
Deutsche Erstveröffentlichung August 2012,
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2011 by Geraldine Brooks
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Patrick Molnar/Gallery Stock; Mooney Green Photography/Getty Images; sundarksom/stocck.xchng
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
SL · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-07567-5V002
www.btb-verlag.de
Für Bizuayehu,der auch zwei Welten kennt
Anno 1660
Aetatis Suae 15
(Im Alter von fünfzehn Lenzen)
Great Harbor
I
Er kommt am Tage des Herrn. Obwohl mein Vater es nicht für nötig erachtet hat, mir das mitzuteilen, bin ich im Bilde.
Sie nahmen an, ich schliefe, so wie ich es jede Nacht tue, während mein Vater und Makepeace auf der anderen Seite des Vorhangs, der unsere Schlafkammern trennt, noch eine Weile miteinander flüstern. Meistens ist ihr leises Murmeln für mich ein tröstliches Geräusch, doch vergangene Nacht erhob Makepeace die Stimme und wurde so heftig und wütend, dass mein Vater ihn zurechtweisen musste. Vermutlich war es das, was mich aus dem Schlaf gerissen hatte, denn eigentlich verabscheut mein Bruder derart heftige Gefühlsausbrüche. Ich drehte mich auf meinem Lager herum und fragte mich, vom Schlaf benommen, was ihn wohl so aufgebracht hatte. Was mein Vater sagte, konnte ich nicht hören, doch dann erhob mein Bruder erneut die Stimme.
»Wie kannst du Bethia einer solchen Gefahr aussetzen?«
Natürlich war in dem Moment, als mein Name fiel, nicht mehr an Schlaf zu denken; ich war hellwach. Ich hob den Kopf und versuchte noch mehr aufzuschnappen, was auch nicht schwer war, weil Makepeace seine Zunge nicht zu zügeln vermochte, und obwohl ich nicht hören konnte, was mein Vater sagte, waren die Antworten meines Bruders deutlich zu vernehmen.
»Was hat es schon zu bedeuten, dass er betet? Es ist – soweit ich weiß − noch nicht einmal ein Jahr her, dass er dem Heidentum abgeschworen hat, und der Mann, der ihn lange in seiner Obhut hatte, ist ein Knecht Satans. Der Halsstarrigste und Gefährlichste von allen, wie du selbst oft genug gesagt hast …«
Vater fiel ihm ins Wort, doch Makepeace ließ sich den Mund nicht verbieten.
»Natürlich nicht, Vater. Ich will seine Fähigkeiten gar nicht in Frage stellen. Doch nur weil ihm das Lateinische leichtfällt, bedeutet das noch nicht, dass er weiß, welches Benehmen in einem christlichen Zuhause von ihm erwartet wird. Das Risiko ist einfach …«
In diesem Moment begann Solace zu schreien, und ich beruhigte sie. Die beiden merkten, dass ich wach war, und sagten nichts mehr. Doch es war schon genug gesagt worden. Ich wickelte Solace gut ein und zog sie auf dem Bett zu mir heran. Sie schmiegte sich an mich wie ein Vogelkind im Nest und schlief wieder ein. Ich lag wach, starrte in die Dunkelheit und strich mit der Hand über die raue Kante des Deckenbalkens, der in Armeslänge über meinem Kopf verlief. Noch fünf Tage, dann würden wir unter dem selben Dach leben.
Caleb wird bei uns wohnen.
Am nächsten Morgen sprach ich nicht über das, was ich mit angehört hatte. Das Lauschen – anders als das Sprechen – ist mir schon lange zur Natur geworden, und ich bin höchst geübt darin. Es war meine Mutter, die mich gelehrt hat zu schweigen. Als sie noch lebte, hat wohl kaum mehr als ein Dutzend Menschen in dieser Siedlung jemals ihre Stimme gehört. Es war eine angenehme Stimme, leise und weich, mit einem Hauch jenes Dialekts aus dem Dorf in Wiltshire, England, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte. Oft lachte sie, sang uns Kinderreime aus ihrer alten Heimat vor und erzählte uns von Dingen, die wir nie gesehen hatten: Kathedralen und Kutschen, breite Flüsse, so groß wie unser Hafen, und ganze Straßen voller Läden, in denen jeder, der genügend Geld in der Börse hatte, alle möglichen Waren erwerben konnte. Doch das geschah nur innerhalb des Hauses, wenn wir als Familie beisammen waren. Draußen hingegen sah man sie nur mit gesenktem Blick und versiegelten Lippen. Sie war wie ein Schmetterling: bunt und vibrierend, wenn sie beschloss, die Flügel auszubreiten, doch kaum sichtbar, wenn sie sie zuklappte. Ihre Bescheidenheit war wie ein Mantel, den sie sich umhängte, und wenn sie so, mit Demut und Bescheidenheit bekleidet, in der Welt umherging, schien sie von den Menschen gar nicht bemerkt zu werden, ja, bisweilen sprachen sie gar in ihrer Anwesenheit über sie, als wäre sie nicht da. Später, bei Tisch, wenn die Angelegenheit für Kinderohren taugte, berichtete sie über dies oder das, was ihr wichtig erschien, oder sie wartete mit allerhand Neuigkeiten über unsere Nachbarn auf. Oft war das, was sie zu berichten wusste, unserem Vater für sein geistliches Amt oder Großvater für seine Tätigkeit als Richter dienlich.
Im Lauschen und Beobachten eiferte ich meiner Mutter nach, und auf diese Weise erfuhr ich auch, dass ich sie verlieren würde. Unsere Nachbarin Goody Branch, die hiesige Hebamme, hatte mich in ihr Häuschen geschickt, um mich mehr von dem Wehentrunk holen zu lassen, mit dem sie das Kindbettfieber meiner Mutter zu kühlen hoffte. So groß auch mein Eifer war, ihr das Gewünschte zu holen, stand ich doch einige Minuten an der Tür und lauschte, als ich meine Mutter sprechen hörte. Sie redete von ihrem Tod. Ich wartete darauf, dass Goody Branch ihr widersprechen und ihr sagen würde, alles werde gut. Doch solche Worte fielen nicht. Stattdessen antwortete Goody Branch, sie würde sich schon um gewisse Angelegenheiten kümmern, die meiner Mutter am Herzen lägen, und sie solle diesbezüglich ganz ohne Sorge sein.
Drei Tage später trugen wir sie zu Grabe. Obwohl laut Kalender der Frühling bereits begonnen hatte, war der Boden noch nicht getaut. Und so entzündeten wir an der Stelle, die mein Vater ausgesucht hatte, zwischen den Gräbern meines Zwillingsbruders Zuriel, der im Alter von neun Jahren gestorben war, und dem meines anderen Brüderchens, das schon so früh von uns gegangen war, dass wir ihm nicht einmal einen Namen geben konnten, ein Feuer. Wir schürten es die ganze Nacht. Doch als mein Vater und Makepeace bei Morgengrauen zu graben begannen, klirrte die Schaufel noch immer in der eisenharten Erde, ein Geräusch, das mir bis heute in den Ohren klingt. Das Graben war so mühsam, dass mein Vater hinterher von der Anstrengung, unsere Mutter zur ewigen Ruhe zu betten, zitterte wie Espenlaub. Aber so ist das Leben hier auf dieser Insel: Wir haben die raue See im Auge und die Wildnis in unserem Rücken. Wie Adams Familie nach dem Sündenfall müssen auch wir alle Dinge selber verrichten, müssen töpfern und backen, Pillen drehen und Gräber schaufeln. Was auch immer wir zum Leben brauchen – wir müssen es selbst beschaffen oder darauf verzichten.
Seit dem Tod meiner Mutter ist jetzt fast ein Jahr vergangen, seither kümmere ich mich um Solace und führe den Haushalt. Ich vermisse meine Mutter und weiß, dass es auch Vater so geht, ebenso wie Makepeace auf seine Weise um sie trauert, obwohl er seine Gefühle nicht so deutlich zeigt wie wir. Auch sein Glaube scheint gestärkt zu sein, denn er hat gelernt, das hinzunehmen, was uns nach göttlichem Willen widerfährt. Wir alle haben schlimme Tage und Nächte verbracht, in denen wir unser Betragen prüften und in unseren Seelen lasen, um herauszufinden, für welche unserer Sünden und Verfehlungen der Schöpfer uns strafen wollte, als er sie so früh von uns nahm. Und auch wenn ich oft zusammen mit meinem Vater im Gebet bei dieser Frage verweile, so habe ich ihm doch nicht die ganze Wahrheit gesagt, so wie ich sie kenne.
Denn ich habe meine Mutter getötet. Ich weiß, mancher würde sagen, ich sei nur ein Kind gewesen, das zum Spielball des listenreichen Satans wurde. Doch im Angesicht der Seele zählen weder Jugend noch Alter. Die Sünde befleckt uns bereits bei unserer Geburt und liegt wie ein Schatten über jeder Stunde unseres Lebens. So wie die Heilige Schrift uns lehrt: Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten. Man verliert den Halt, so wie es mir geschah, und das Alter zählt dabei nicht. Kindliche Unschuld kann hier nicht gelten. Und meine Sünden waren nicht bloß eine durch Unreife entschuldbare Torheit: Sie sind auf ewig in die steinernen Tafeln tödlicher Verfehlung gemeißelt. Ich habe die Gebote gebrochen, Tag für Tag. Und ich tat es wissentlich. Ich bin die Tochter eines Pfarrers: Wie könnte ich es leugnen? Wie Eva dürstete mich nach verbotenem Wissen, und ich aß von der verbotenen Frucht. Für sie der Apfel, für mich der weiße Nieswurz – verschiedene Pflanzen aus ein und derselben Hand. Und genauso, wie jene Schlange im Paradies damals schön gewesen sein muss – ich sehe sie vor mir, ihre glänzenden Schuppen, die sich schimmernd wie Tautropfen über Evas Schultern ergossen, ihre Augen, wie blitzende Juwelen, die ihrem Blick begegneten –, kam Satan auch zu mir in Gestalt unwiderstehlicher Schönheit.
Brich Gottes Gesetze, und erdulde seinen Zorn. Nun, das ist es, was ich tue. Der Herr legt schwer seine Hand auf mich, und ich beuge den Rücken unter der Bürde, die ich jetzt trage – unter der meiner Mutter und meiner eigenen. Meine Aufgaben beginnen im dichten Grau der Morgendämmerung und enden beim Kerzenlicht der Nacht. Im Alter von fünfzehn Jahren habe ich die Pflichten eines Weibes übernommen und bin zur Frau gereift. Doch ich bin auch froh darüber. Denn nun habe ich nicht mehr die Zeit für die Sünden, die ich als Mädchen beging, wenn sich die Stunden vor mir ausbreiteten wie ein endloses Geschenk. Jene heißen Nachmittage, wenn sich der Strand, von salziger Gischt erfüllt, in einem langen, schimmernden Bogen bis zu den Klippen in der Ferne erstreckte. Jene Morgenstunden, in denen ich auf laubbedeckten, lehmigen Pfaden in den kühlen Talsenken der Gegend nach himmelblauen Beeren suchte und spürte, wie jede einzelne von ihnen in meinem Mund zerplatzte, saftig und süß. Ich eroberte mir die Insel, Meile um Meile, von der weichen, schlickigen Tonerde der regenbogenfarbenen Klippen bis zur rauen Kühle der Granitfelsen, die urplötzlich aus den Feldern aufragen und den Pflug aus seiner Bahn bringen. Ich liebe den Nebel, der uns alle in einen milchigen Schleier hüllt, und die Winde, die bei Nacht in den Schornsteinen ächzen und klagen. Selbst wenn die Strandlinie mit salzigem Eis verkrustet ist und es bei meinen Gängen durch den Wald unter meinen Holzpantinen knirscht, stehe ich gern in dem blauen Schimmer, der auf dem Schnee glitzert, und atme tief die kalte Luft ein. Ich liebe jede Bucht und jeden Felsen auf dieser Insel. Hier lernt man schon früh, die Natur als einen Gegner zu sehen, den man sich untertan machen muss. Ich jedoch huldige ihr und bete sie an. Man könnte sagen, diese Insel und ihre Schätze sind meine ersten falschen Götter geworden, der Sündenfall, der so viel Irrglauben nach sich zog.
Doch jetzt, in den wenigen Tagen, die mir bis zu Calebs Ankunft bleiben, habe ich beschlossen, meine Seele einem Tagebuch anzuvertrauen und von jenen Monaten zu berichten, in denen mein Herz sich so weit von Gott gelöst hat. Ich habe auch die kleinsten Fetzen Papier gesammelt, die ich aus dem Vorrat meines Bruders ergattern konnte, und beschlossen, jeden Moment zu nutzen, der sich mir bietet, bevor mich die Müdigkeit von den Mühen des Tages übermannt. Meine Handschrift ist unschön, da mein Vater mich nicht im Schreiben unterrichtet hat, doch dieser Bericht ist nur für meine Augen bestimmt, und so macht es keinen Unterschied. Da ich noch nicht sagen kann, ob ich den Mut aufbringen und eines Tages in der Versammlung aufstehen und der ganzen Gemeinde Rechenschaft ablegen werde, muss es vorerst damit genug sein. In meiner Not habe ich mich Gott zugewandt, doch noch habe ich kein Zeichen erhalten, dass er mich erlösen wird. Wenn ich mir meine Hände und Handgelenke anschaue, die voller kleiner Brandnarben von heißen Töpfen oder fliegender Asche sind, führt mir jeder rote Striemen und jedes weiße Pünktchen das Höllenfeuer vor Augen, und die sich windenden Massen der Verdammten, unter denen wohl auch ich bis in alle Ewigkeit darben werde.
Gott allein bestimmt, wer verdammt und wer erlöst wird, und auch die Tatsache, dass ich diesen Bericht verfasse, kann daran nichts ändern. Doch nun, da Caleb hierherkommen soll, den noch immer der Rauch jener heidnischen Feuer und der Duft jener wilden, von Visionen erfüllten Stunden umgibt, muss ich mit klarem Verstand und aufrichtigen Herzens darlegen, wo ich stehe, denn nur dann werde ich in der Lage sein, jenen Versuchungen zu widerstehen. Ich muss dies ebenso für ihn tun wie für mich. Dass Vater große Stücke auf Caleb hält, weiß ich. Er setzt, mehr als jeder andere hier, große Hoffnung in ihn und glaubt, er könne eines Tages seinem Volk ein Anführer sein. Sicher will Caleb das auch; niemand brütet so eifrig über seinen Büchern, und keiner hätte in den wenigen Monaten, die er zum Studieren hatte, eine so reiche Ernte an Wissen eingefahren wie er. Doch ich weiß auch noch etwas anderes: Calebs Seele ist so straff gespannt wie ein Seil beim Tauziehen, und an den Enden des Taus stehen mein Vater und Calebs Onkel, der pawaaw oder Medizinmann. Und ebenso wie mein Vater seine Hoffnungen hegt, tut dies auch jener Scharlatan. Caleb wird sein Volk lenken, das ist gewiss. Doch in welche Richtung? Bei dieser Frage bin ich mir alles andere als sicher.
II
Einmal, in einer stürmischen Winternacht vor zwei Jahren, kamen wir zum Haus zurück, nachdem wir uns bei Regen und Wind damit abgemüht hatten, die Boote an Land zu ziehen und sicher zu vertäuen. Eine glänzende Schicht Eis lag auf unseren Mänteln, und unser zu Strähnen gefrorenes Haar knisterte bei jedem Schritt. Unsere Hände waren taub vor Kälte, während wir den rasch angerührten Lehm zwischen die Ritzen und Fugen des Hauses schmierten und notdürftig das Ölpapier flickten, das der Wind von den Fenstern gerissen hatte. (Fensterscheiben hatten wir damals nicht.) Als ich später am Feuer saß und sich das geschmolzene Eis in einer Pfütze zu meinen Füßen sammelte, stellte Makepeace Vater die Frage, die damals auch in mir aufgekommen war: Aus welchem Grund hatte Großvater sich eigentlich ausgerechnet auf dieser Insel angesiedelt? Warum hatte er sieben Meilen gefährlichster Strömungen zwischen sich selbst und die anderen Engländer gebracht, zu einer Zeit, als es auf dem Festland für jeden, der sich dort niederlassen wollte, genügend Land gab?
Vater erwiderte, unser Großvater habe als junger Mann bei einem wohlhabenden Edelmann in Diensten gestanden, der ihm seine fleißige Arbeit nur mit unbegründeten Anschuldigungen vergütete. Zwar sei es Großvater gelungen, sich von jeglicher Schuld reinzuwaschen, doch die Erfahrung habe ihn verbittert, und so beschloss er, in Zukunft niemandem mehr Rechenschaft abzulegen. Nicht einmal mehr John Winthrop, dem Gouverneur der Kolonie von Massachusetts Bay, einem Mann, der durchaus angesehen war, der jedoch alle, deren Ideen nicht mit den seinen übereinstimmten, grausam bestrafte. Mehr als nur einem Mann hatte man die Ohren abgeschnitten oder die Nase aufgeschlitzt; eine aufsässige Frau war schwanger und mit einem Dutzend Kindern im Schlepptau in die Wildnis verstoßen worden. Und sie alle waren seine christlichen Brüder und Schwestern. Was man hingegen auf Winthrops Befehl hin den Pequot-Indianern angetan hatte, so mein Vater, sei für unsere Kinderohren nicht geeignet.
»Euer Großvater hatte das Gefühl, es besser machen zu können. Und so kaufte er diesen Grund und Boden hier, der außerhalb des Machtbereichs von Winthrop lag, und versammelte einige Männer mit ähnlicher Gesinnung um sich, die bereit waren, sich dem lockeren Zügel seiner Führung zu fügen. Mich schickte er im Jahre 1642 zum ersten Mal auf Überfahrt. Und so kann ich heute stolz darauf sein, mein Sohn, dass dein Großvater damals darauf beharrte, auch den hiesigen sonquem, den Häuptling, für seinen Grund und Boden auszuzahlen, obwohl er doch bereits die englischen Behörden dafür entlohnt hatte. Jede Hütte und jedes Haus, das wir hier auf diesem Land errichtet haben, wurden uns nach freiem Willen verkauft, und zwar nach Verhandlungen, die ich ehrenhaft geführt habe. Vielleicht wirst du hören, dass nicht alle Gefolgsleute des Häuptlings in dieser Angelegenheit einer Meinung mit ihrem Anführer waren, und einige sagen heute noch, er habe selbst nicht recht begriffen, dass wir sein Land für immer behalten wollen. Doch sei es, wie es ist, die Sache ist abgemacht, und dem Gesetz wurde dabei Genüge getan.«
Ohne es auszusprechen, dachte ich, Großvater habe wohl kaum erwarten können, dass die durchdachten Paragraphen englischen Besitzrechtes den etwa dreitausend Menschen, die vor unserem Eintreffen hier als Wilde gegolten hatten, allzu viel bedeuteten. Und wenn es bei diesem Plan einen Grund gab, stolz zu sein, dann doch wohl auf die Schlauheit unseres Großvaters, und auf den Mut und den Takt, mit dem unser Vater bei seiner Durchführung zu Werke gegangen war. Vater war damals, als er hierherkam, erst neunzehn Jahre alt gewesen. Vielleicht hatten ja gerade seine Jugend und sein sanftes Gemüt den sonquem davon überzeugt, dass von den »Mantelmännern«, wie sie uns nannten, keine Gefahr ausgehe. Und was konnten wir ihnen auch schon antun – nur eine Handvoll Familien, die sich in einer schmalen Bucht zusammendrängten, während sich Hunderte von Rothäuten auf der gesamten Insel verteilten, ganz gleich, wohin man blickte?
Vater nahm den Faden seines Gedankens wieder auf, als wollte er ein wirres Knäuel ordnen. »Ja, wir sind gute Nachbarn gewesen; davon bin ich fest überzeugt«, sagte er. »Und warum auch nicht? Es gibt keinen Grund, sich mit ihnen anzulegen, ganz gleich, welche Ränke die Familie Alden und ihre Anhänger schmieden. ›Du magst den Teufel aufstören oder ihm lästig werden, doch zu Christen bekehren wirst du hier niemanden‹ – das hat Giles Alden zu mir gesagt, als ich zum ersten Mal in den wetus, den Hütten, des Stammes predigte. Und wie sehr er sich doch geirrt hat! Mehrere Jahre schluckte ich den Staub in diesen Hütten, ich half den Menschen in alltäglichen Dingen, wo auch immer es mir möglich war, und war glücklich, auch nur bei einem oder zweien von ihnen Gehör zu finden, wenn ich über unseren Herrn Jesus Christus sprach. Und jetzt endlich beginne ich, ihrem Verstand den reinen Wein des Evangeliums einzuflößen. Ein Volk, das längst auf der breiten Straße der Verdammnis unterwegs war, zur Umkehr zu bewegen und dazu zu bringen, sein Gesicht dem Antlitz Gottes zuzuwenden … Das ist es, wonach wir streben müssen. In vieler Hinsicht sind sie ein bewundernswertes Volk, wenn man sich nur die Mühe macht, sie kennenzulernen.«
Wie sehr hätte ich ihn und meinen Bruder damals erstaunen können, hätte ich den Mund geöffnet und es gewagt, auf Wampanaontoaonk zu sagen, ich seies gewesen, die sich bemüht hatte, sie kennenzulernen; und dass ich sie in manchen Einzelheiten besser kannte als Vater, der ihr Missionar und ihr Pfarrer war. Doch wie ich bereits erwähnt habe, hatte ich schon früh den Wert des Schweigens erkannt und war nicht bereit, mein Innerstes preiszugeben. Und so stand ich vom Herdfeuer auf und machte mich daran, mit Hefe und Mehl einen Teig anzusetzen, den ich am nächsten Tag zu Brot backen wollte.
Unsere Nachbarn. Als Kind hatte ich sie nicht so gesehen. Ich denke, damals nannte ich sie wie alle anderen Wilde, Heiden, Barbaren, Ungläubige. Aber eigentlich dachte ich als Kind überhaupt nicht über sie nach. Damals hing ich zusammen mit meinem Zwillingsbruder Zuriel am Rockzipfel unserer Mutter, und was sie taten, ging uns nichts an. Man sagt, es habe über ein Jahr gedauert, bis sich überhaupt einer von ihnen in die Nähe unserer Pflanzungen wagte. Wenn mein Vater im Dienste meines Großvaters mit ihnen zu tun hatte, so besuchte er die eine oder andere ihrer Siedlungen, die sie otan nennen, ganz allein, und ich erfuhr nichts davon.
Irgendwann später – wann genau das war, bin ich mir nicht sicher –, nachdem die Gemeinde in Great Harbor ihr Versammlungshaus gebaut hatte, begann einer von ihnen, ein armer Teufel, an den streng von uns eingehaltenen Tagen der Sabbatruhe, die andere Christen den Sonntag heißen, bei uns herumzuschleichen. Von nur geringer Abstammung und wenig angenehmem Äußeren war er unter den Seinen ein Außenseiter, weil er zum Krieger nicht taugte und damit selbst das gemeine Recht verwirkt hatte, mit seinem sonquem zu jagen oder an den Zusammenkünften teilzunehmen, bei denen der Häuptling seine Leute großzügig mit Nahrungsmitteln und anderen Dingen beschenkte.
Dass mein Vater diesem Mann predigte, wusste ich, dachte aber nur wenig darüber nach. Es schien mir einfach ein Akt christlicher Nächstenliebe zu sein, so wie es in der Heiligen Schrift heißt: Was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast … Und doch war es genau dieses nicht sehr vielversprechende Erz, aus dem Vater sein Kreuz zu schmieden begann. Mutter war ziemlich entsetzt gewesen, als Vater diesen Mann, dessen Name Iacoomis lautete, an einem Sabbat als Gast an unserem Tisch begrüßte. Doch der Zufall wollte es, dass die so wenig einnehmende sterbliche Hülle dieses Mannes einen flinken Geist beherbergte. Er lernte begierig das Lesen und begann als Gegenleistung Vater die Sprache der Wampanoag beizubringen, damit dieser mit seiner Missionstätigkeit fortfahren könne. Während sich Vater mit der neuen Sprache schwertat, lernte auch ich sie, so wie eben ein Mädchen, das sein Leben nur am Herd und im Haus führt, manches von den Angelegenheiten der Erwachsenen aufschnappt. Ich lernte diese Sprache vermutlich so leicht, wie ich auch das Englische erlernte, denn mein Verstand war geschmeidig und nur allzu bereit, Neues aufzunehmen. Wenn Vater und Iacoomis dasaßen und über einem Satz brüteten, so hatte er sich oft längst in meinem Mund zurechtgelegt, bevor selbst Vater ihn erfasste. Während er sich allmählich die Sprache unserer Nachbarn aneignete, brachte er auch dem Schreiber meines Großvaters, Peter Folger, ein paar nützliche Vokabeln bei, welcher klug genug war, ihren Wert für geschäftliche Verhandlungen und für den Handel zu erkennen. Als Zuriel und ich noch sehr klein waren, machten wir uns ein heimliches Spiel daraus, die Sprache zu lernen, und benutzten sie, sozusagen als Geheimsprache, unter uns. Doch als Zuriel größer wurde, hielt er sich immer weniger am heimischen Herd auf und war mehr draußen unterwegs, wie es einem Jungen eben gestattet ist. So welkte auch unser Spiel dahin, und er vergaß die Sprache nach und nach, während ich immer größere Fortschritte darin machte. Ich frage mich oft, ob das, was später geschah, hier seine Wurzeln hatte: dass die indianische Sprache tief in meinem Herzen mit jenen frühen Erinnerungen an meinen Bruder verknüpft war und so auch jene zärtlichen und in mir schlummernden Gefühle geweckt wurden, als ich einem Gleichaltrigen begegnete, der diese Sprache sprach. Als ich Caleb damals kennenlernte, verfügte ich bereits über einen großen Schatz an gebräuchlichen Wörtern und Wendungen. Seit damals ist diese Sprache sogar diejenige, in der ich träume.
Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich klein war, das Wort »Wilde« verwendet hatte und mein Vater mich dafür tadelte. »Nenn sie nicht Wilde. Benutze den Namen, den sie selbst verwenden, Wampanoag. Das bedeutet: Menschen aus dem Osten.«
Armer Vater. Er war so stolz auf seine Bemühungen, diese schwierigen Wörter auszusprechen; Wörter, die so lang waren, als hätten sie bereits beim Turmbau zu Babel Wurzeln geschlagen und seien seither weitergewachsen. Dennoch hat Vater nie die richtige Betonung gelernt, die doch das wesentliche Merkmal ihrer Sprache ist. Auch begreift er nicht, wie sich die Wörter aufbauen, Laut um Laut, und dabei eigene Bedeutungen entwickeln. Zum Beispiel »Menschen aus dem Osten«: Als würden sie von Osten oder Westen sprechen, so wie wir es tun. Nichts in ihrer Sprache ist so schlicht und gewöhnlich. Wop, ihr Wort für »weiß«, birgt zum Beispiel etwas von jenem ersten milchigen Licht in sich, das den Horizont erhellt, bevor die Sonne aufgeht. Der Schlusslaut wiederum bezieht sich auf lebendige Wesen. Und so würde der Name, mit dem sie sich selbst bezeichnen, richtig in unsere Sprache übertragen lauten: »Volk des ersten Lichts«.
Seit ich hier geboren wurde, fühle auch ich mich mehr und mehr wie ein Mensch des ersten Lichts. Wir leben hier am äußersten Ende der neuen Welt und werden jeden Morgen Zeuge eines erwachenden Tages der auf unserer sich drehenden Weltkugel heraufdämmert. Für mich ist nichts Seltsames an dem Gedanken, dass jemand an einem einzigen Tag einen Sonnenaufgang und dann einen Sonnenuntergang über der See beobachten kann, obwohl Neulinge schnell mit der Bemerkung zur Hand sind, wie ungewöhnlich das ist. Wenn ich bei Sonnenuntergang in der Nähe des Wassers bin – und hier ist es schwerlich möglich, sich allzu weit davon zu entfernen –, halte ich inne, um zu beobachten, wie die herrliche Sonnenscheibe das Meer in Brand setzt und sich dann selbst in ihren flammenden Fluten ertränkt. Wenn es dann dunkel wird, denke ich an diejenigen, die in England zurückgeblieben sind. Es heißt, für sie rücke das Morgengrauen näher, wenn bei uns das Dunkel naht. Ich denke an diese Menschen, auf die ein neuer grauer Morgen und ein Tag unter dem Joch ihres verwerflichen Königs wartet. Bei unserer Versammlung las Vater uns das Gedicht eines unserer reformierten Brüder dort vor:
Auf Zehenspitzen gehen wir durchs Land,
Und träumen von Amerikas schönem Strand.
Früher habe ich oft ein Gebet für unsere englischen Brüder gesprochen und Gott darum gebeten, ihre Reise hierher zu beschleunigen, und dass ihr Morgen ihnen keine Furcht bringen möge, sondern den Frieden, den wir hier gefunden haben, von leichter Hand geführt durch meinen Großvater und die milde seelische Weisung meines Vaters.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir auf, dass es eine Weile her ist, seit ich dieses Gebet gesprochen habe. Denn Frieden empfinde ich hier nicht mehr.
III
Mein Niedergang begann vor drei Jahren, in jenem kargen Sommer meines zwölften Lebensjahres. Wie viele Neuankömmlinge an fremdem Ort hatten auch wir zu lange an alten Gebräuchen und Gewohnheiten festgehalten. Unsere Gerste gedieh hier nie besonders gut, dennoch pflanzten die Familien sie weiter an, einfach weil sie es immer getan hatten. Unter großem Kostenaufwand hatten wir ein Jahr zuvor Jungschafe vom Festland gekauft, die hauptsächlich zur Erzeugung von Wolle dienen sollten, denn es lag auf der Hand, dass wir unsere eigenen Kleider produzieren mussten, und Leinen war für die harten Winter hier nicht geeignet. Doch die Aussicht auf Lammbraten zu Ostern war allzu verführerisch, und so brachten wir den Widder zu früh zu den Auen. Dann gerieten wir in die Klauen eines allzu hartnäckigen Winters, der einfach nicht milder wurde, ganz gleich, was auf dem Kalender stand. Und obwohl wir alle versuchten, die neugeborenen Lämmer am Herdfeuer warm zu halten, raubten uns die bitterkalten Winde, die über die Salzwiesen fegten, und der anhaltende harte Frost, der jede Knospe zum Erfrieren brachte, mehr Jungtiere, als wir entbehren konnten. Damals war alles Gemeindeland, und wir hatten weder Scheunen noch anständige Pferche gebaut. Nach einem so langen Winter hatten wir kaum noch gepökeltes Fleisch und keinerlei Aussicht auf frisches, und so wurde das Fischen und Sammeln von allerhand Essbarem – darunter vor allem Muscheln – unser Hauptauskommen.
Da das Muschelsammeln keine sehr angesehene Tätigkeit war, sorgte Makepeace dafür, dass diese Aufgabe mir zufiel, denn er war der Älteste und, nach Zuriels Tod, auch der einzige Sohn und pochte gern auf seine Rechte. Wenn das nicht genügte, um sich vor einer ungeliebten Aufgabe drücken zu können, verwies er auf die großen Anforderungen, die die Schule an ihn stellte, eine Bürde, die, wie er sagte, »meine Schwester nicht tragen muss«. Diese letzte Bemerkung wurmte mich besonders, denn ich sehnte mich nach dem Unterricht, den Makepeace so beschwerlich fand, und das wusste er.
Wenn es ans Muschelsammeln ging, erlaubte mir Vater, unsere Stute Speckle zu nehmen, denn die besten Muschelgründe lagen weit draußen im Westen. Ich sollte zu meiner Tante Hannah reiten, die mich begleiten würde, denn es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich mich allein nicht mehr als eine Meile von unserer Siedlung entfernen durfte, ob nun zu Pferd oder zu Fuß. Doch meine Tante war durch all ihre anderen Aufgaben meist so überlastet, dass sie eines Tages, als zum ersten Mal seit langem ein laues, mildes Lüftchen meine Wangen streichelte, mehr als froh war, als ich mich anbot, Muscheln für sie mitzusammeln. Das war das erste Mal, dass ich das Gebot des Gehorsams brach, denn ich suchte mir keine andere Begleitung, wie sie mich gebeten hatte, sondern ritt auf einem neuen Weg alleine davon. Es war nicht leicht, immer unter Beobachtung zu stehen und nur das zu tun, was der Tochter des Pfarrers eben geziemte. Und so raffte ich, kaum hatte ich die Grenze unserer Siedlung erreicht, meine Röcke und galoppierte los, so schnell Speckle mich tragen wollte, einfach nur, um frei und ungebunden und allein zu sein.
Ich hatte die schöne, große Heide lieben gelernt, die dichten Wälder und die weiten, von Dünen geschützten Wasserflächen, wo ich ganz für mich war und mich frei fühlen konnte. Und so versuchte ich, jeden Tag ein wenig draußen zu sein, bis auf den Sabbat, den wir streng nach der Regel betend verbrachten, da mein Vater die Gebote genauestens befolgte – am siebten Tage sollt ihr ruhen – und nur den Besuch im Gemeindehaus, nicht aber die Erledigung anderer Aufgaben duldete.
So oft ich konnte, versteckte ich eines der Lateinbücher von Makepeace in meinem Korb, entweder seine Formenlehre, die er schon längst hätte auswendig können müssen, seinen Thesaurus oder die Sententiae Pueriles. Wenn es mir nicht gelang, eines dieser Bücher unbemerkt an mich zu nehmen, holte ich mir einen von Vaters Texten, in der Hoffnung, ihn halbwegs verstehen zu können. Abgesehen von der Bibel und den Märtyrer-Viten von Foxe stand Vater auf dem Standpunkt, für ein junges Mädchen sei es nicht erstrebenswert, allzu viel Zeit mit Lesen zu verbringen. Als mein Bruder Zuriel noch lebte, hatte Vater uns beide im Lesen unterrichtet. Für mich waren das schöne Zeiten gewesen, doch sie waren am Tage von Zuriels Unfall zu einem abrupten Ende gekommen. Damals hatten wir beide ein paar Stunden über unseren Büchern verbracht, und da Vater mit unseren Fortschritten zufrieden war, belohnte er uns mit einer Fahrt auf dem Heuwagen. Es war ein schöner Abend, und Zuriel war übermütiger Stimmung, zupfte Halme aus den Heuballen und kitzelte mich damit am Kragen. Ich wand mich und lachte fröhlich. In jenem Augenblick, als ich nach hinten griff, um einen juckenden Halm aus meinem Kleid zu ziehen, konnte ich nicht sehen, wie Zuriel auf dem Ballen das Gleichgewicht verlor, und konnte folglich auch nicht meinen Vater warnen, der den Wagen lenkte und uns den Rücken zukehrte. Noch bevor wir Zuriels Sturz bemerkten, war ihm der Wagen mit dem rechten Hinterrad, das aus Eisen war, über das Bein gefahren und hatte es bis auf den Knochen durchtrennt. Vater versuchte nach Kräften, die Blutung zu stillen, wobei er unablässig laut betete. Ich hielt Zuriels Kopf in meinen Händen, schaute in sein geliebtes Gesicht hinab und flehte ihn an, bei uns zu bleiben, doch es half nichts. Zuriel verblutete, und ich musste mit ansehen, wie er sein Leben aushauchte und langsam das Licht in seinen Augen erlosch.
Das war zur Erntezeit geschehen. Den ganzen Herbst und Winter hindurch taten wir nichts anderes, als um ihn zu trauern. Wir gingen unseren Pflichten nach, so wie es eben sein musste, und dann setzten wir uns zum Gebet nieder, obwohl mein Verstand vom Kummer und all den Erinnerungen so umnebelt war, dass ich oft nicht einmal das fertigbrachte. Erst im darauffolgenden späten Frühjahr dachte ich wieder an meinen Unterricht und fühlte mich endlich imstande, meinen Vater zu fragen, wann wir ihn wieder aufnehmen würden. Er jedoch sagte mir, er habe nicht die Absicht, mich weiter zu unterweisen, da ich den Katechismus schließlich bereits auswendig könne.
Doch was er nicht verhindern konnte, war, dass ich den Unterricht mit Makepeace belauschte. Und so hörte ich zu und lernte. Mit der Zeit sammelte ich auf diese Weise mein Wissen an: ein wenig Latein hier, ein bisschen Hebräisch da, ein Quäntchen Logik und einen Happen Rhetorik, immer dann, wenn mein Vater dachte, ich sei mit dem Schüren des Herdfeuers beschäftigt oder sitze am Webstuhl. Mir fiel es nicht schwer, all diese Dinge zu lernen, während sie Makepeace, der doch zwei Lenze mehr zählte als ich, eher gleichgültig waren. Mit seinen gut vierzehn Jahren hätte er durchaus bereits mit dem College in Cambridge beginnen können, doch Vater hatte beschlossen, ihn noch bei uns zu behalten, in der Hoffnung, ihn besser vorzubereiten. Ich glaube, Zuriels Tod hatte Vater in dieser Entscheidung noch bestärkt, doch mein älterer Bruder trug dadurch eine große Last, denn er wusste, dass nun alle Hoffnung seines Vaters auf dem einen Sohn ruhte, der mit Frömmigkeit und emsigem Lernen in seine Fußstapfen treten sollte. Es gab Zeiten, in denen ich mir um meinen Bruder Sorgen machte. Am Harvard College würden die Lehrer bestimmt nicht so nachsichtig mit ihm sein wie unser geduldiger Vater. Doch muss ich auch zugeben, dass mein Neid diese Sorge meistens überwog. Ich schätze, es war Hochmut, der mich irgendwann zu einem Fehler verleitete: Ich begann, mich keck einzumischen und Antworten auf Fragen zu geben, zu denen mein Bruder nicht in der Lage war.
Als ich zum ersten Mal eine lateinische Deklination zum Besten gab, war mein Vater amüsiert und lachte. Meine Mutter jedoch, die am Webstuhl saß, während ich Garn spann, zog scharf den Atem ein und schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Damals gab sie keinen Kommentar ab, doch später begriff ich, warum. Sie hatte gespürt, was mir in meinem Hochmut entgangen war: dass Vaters Vergnügen nur flüchtig war – so wie bei jemandem, der eine Katze auf den Hinterläufen gehen sieht und über diese Kuriosität lächelt, das Kunststückchen selbst jedoch plump und nicht besonders anziehend findet. Zuerst schüttelt man nur verwundert den Kopf, doch irgendwann beginnt man sich darüber zu ärgern, denn eine Katze, die auf den Hinterpfoten läuft, vernachlässigt ihre Pflicht, Mäuse zu fangen. Irgendwann, wenn die Katze wieder Anstalten macht, ihr Kunststückchen vorzuführen, wird man sie verfluchen und nach ihr treten.
Je mehr ich zu erkennen gab, dass ich all das gelernt hatte, wozu mein älterer Bruder nicht in der Lage war, desto größer wurde der Unmut meines Vaters. Seine sonst so nachsichtige Miene verzog sich zu einem finsteren Stirnrunzeln, wann immer ich mich einmischte. Mehrere Monate ging das so, doch ich begriff nicht, welche Lektion er für mich bereithielt. Bald darauf begann er nämlich, mich jedes Mal mit irgendwelchen Aufträgen außer Haus zu schicken, wenn er vorhatte, Makepeace zu unterrichten. Als ich merkte, dass dies in Zukunft immer so ablaufen würde, warf ich ihm einen Blick zu, der wohl mehr verriet, als ich eigentlich preisgeben wollte. Mutter sah es und schüttelte tadelnd den Kopf. Dennoch ließ ich die Tür laut hinter mir ins Schloss fallen. Vater folgte mir in den Hof hinaus. Er rief mich zu sich, und ich rechnete fest damit, gezüchtigt zu werden. Doch er streckte nur eine Hand aus, rückte meine etwas verrutschte Haube zurecht und streifte dabei zärtlich mit den Fingern meine Wange.
»Bethia, warum strebst du so sehr danach, den Platz zu verlassen, den Gott dir zugedacht hat?« Seine Stimme klang sanft, nicht verärgert. »Dein Weg ist nicht der gleiche wie der deines Bruders, und er kann es nicht sein. Frauen sind nicht so beschaffen wie Männer. Du läufst Gefahr, deinen Verstand zu verwirren, wenn du an gelehrte Dinge denkst, die dich doch gar nichts angehen. Ich sorge mich nur um dein gegenwärtiges Wohl und um dein zukünftiges Glück. Es ziemt sich einfach nicht für ein Eheweib, dass es mehr weiß als der eigene Gatte …«
»Eheweib?« Ich war so entsetzt, dass ich ihn unterbrach, ohne eigentlich etwas sagen zu wollen. Schließlich war ich gerade erst zwölf Jahre alt geworden.
»Ja, Eheweib. Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen, aber das ist es, was du sein wirst, und zwar in absehbarer Zeit. In deiner Demut und Bescheidenheit magst du, meine Tochter, es noch nicht bemerkt haben, aber jeder, der Augen im Kopf hat, sieht, dass aus dir einmal ein ansehnliches Frauenzimmer wird. Es ist bereits zur Sprache gekommen.« Ich glaube, bei diesen Worten wurde ich puterrot; und ganz gewiss brannte meine Haut so sehr, dass ich bis in die Haarspitzen das Gefühl hatte, lichterloh in Flammen zu stehen. »Mach dir keine Gedanken. Es ist nichts Unziemliches gesagt worden, und ich habe so geantwortet, wie es sich gehört, dass es nämlich noch Jahre dauern wird, bis es an der Zeit ist, über derlei Dinge nachzudenken. Doch es ist dein Schicksal, mit einem anständigen Mann aus unserer kleinen Gemeinschaft hier verheiratet zu werden, und ich würde dir keinen Gefallen tun, wenn ich dich dereinst zu ihm schicken und sich dann herausstellen würde, dass du ihm mit deinem fein geschliffenen Verstand in jedem Gespräch und jeder Angelegenheit des Alltags überlegen bist. Ein Mann muss der Herr im Hause sein, Bethia, so wie Gott über seine Gläubigen herrscht. Würden wir noch immer in England oder auch auf dem Festland leben, könntest du unter mehreren gebildeten Männern deine Wahl treffen. Doch hier auf dieser Insel geht das nicht. Du kannst recht gut lesen, das weiß ich, sogar ein wenig schreiben, genug, um ein Haushaltsbuch zu führen, wie es auch deine Mutter tut. Doch das genügt. Schon jetzt hebst du dich damit von den meisten anderen deines Geschlechts ab. Bereite dich auf deine hausfraulichen Pflichten vor, oder eigne dir etwas Kräuterwissen an, wenn dir so viel daran liegt, etwas zu lernen. Verwende deinen Verstand auf nützliche und ehrenwerte Dinge, so wie es sich für eine Frau geziemt.«
Tränen traten mir in die Augen. Ich schaute zu Boden, um es ihn nicht merken zu lassen, und fuhr mit meiner Holzpantine über den Boden. Seine Hand ruhte auf meinem gesenkten Kopf. Seine Stimme war sehr sanft. »Ist es denn so schrecklich, sich ein nützliches Leben vorzustellen, so wie es deine Mutter dir vorlebt? Sieh nicht hochmütig darauf hinab, Bethia. Es ist keine leichte Sache, ein geliebtes Eheweib zu sein, ein gottesfürchtiges Haus zu führen, Söhne großzuziehen …«
»Söhne?« Ich blickte zu Vater auf, und das Wort blieb mir im Halse stecken. Söhne wie Zuriel – ein gesunder, munterer Junge, den das Schicksal schon in frühen Jahren aus dem Leben gerissen hatte. Oder wie jener Säugling, der ebenfalls diesen Namen getragen hätte, wäre er länger am Leben geblieben als nur eine Stunde. Oder Söhne wie Makepeace, schwer von Begriff und arm an Gefühlen.
Mein Bruder war aus dem Haus getreten. Er stand hinter Vater, die Brauen zusammengezogen und die Arme über der Brust verschränkt. Trotz seiner finsteren Miene spürte ich, dass es ihm größtes Vergnügen bereitete, Zeuge meiner Zurechtweisung durch unseren Vater zu werden.
Vater sah auf einmal sehr erschöpft aus. »Ja. Söhne. Und auch Töchter, die, wie du sehr wohl weißt, ebenfalls damit gemeint sind. Gib dich zufrieden, darum ersuche ich dich. Wenn du unbedingt etwas lesen magst, so lies die Bibel. Besonders empfehle ich dir die Sprüche 31, Vers 10 bis 31 …«
»Du meinst Wem ein tugendsam Weib bescheret ist …?« Ich hatte die Passage bereits gehört, weil mein Vater sie meiner Mutter vorgetragen hatte, auf die sie geradezu maßgeschneidert war, denn Mutter war wahrlich ein tugendsames Weib, das den lieben langen Tag mit all den Aufgaben zubrachte, die in den Sprüchen beschrieben wurden. Vater hatte ihr ins Gesicht geschaut und zuerst den hebräischen Text aufgesagt, dessen harte Konsonanten mich an den grellen Sonnenschein auf den trockenen Mauern von Davids Stadt erinnerten. Anschließend wiederholte er die Worte auch auf Englisch.
Zwei Sünden, die des Stolzes und die des Zorns, überwältigten mich in diesem Moment. Sie ließen sich nicht mehr zügeln, und so erhob ich die Stimme und sagte bockig: »Eshet chayil mi yimtza v’rachok …«
Vaters Augen weiteten sich, als ich das tat, und seine Lippen wurden dünn. Doch in diesem Moment fuhr Makepeace dazwischen, und seine Stimme war laut und wütend. »Genug! Stolz ist eine Sünde, Schwester. Sei dir dessen bewusst. Denk daran, dass auch ein Vogel Laute nachahmen kann. Du kannst einen Spruch aufsagen: Na und? Denn genau in dem Moment zeigst du, dass du nichts von dem begriffen hast, was du da nachplapperst. Mit deinem Lärm bringst du die Stimme Gottes zum Verstummen. Lass Ruhe in deinen Verstand einkehren. Öffne dein Herz. Und schon bald wirst du deinen Irrtum einsehen.«
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging ins Haus zurück. Vater folgte ihm. Beide waren sie an jenem Tage wütend, doch nicht so wütend wie ich. Ich war so zerfressen von meinem Zorn, dass ich beim Buttermachen den Griff zerbrach, weil ich so fest damit stampfte. An meiner Hand ist bis heute die Narbe von den Holzsplittern zu sehen, die sich in mein Fleisch bohrten. Mutter verband mir die Hand und gab eine Salbe darauf. Als ich in ihre lieben, müden Augen blickte, schämte ich mich. Nicht um alles in der Welt hätte ich sie in dem Glauben wissen wollen, ich würde sie verachten, ob nun in Gedanken oder Worten. Und als hätte sie meine Gedanken gelesen, lächelte sie mich an und führte meine verbundene Hand an ihre Lippen. »Gott tut alles aus gutem Grunde, Bethia. Wenn er dir einen flinken Verstand geschenkt hat, dann will er ganz sicher auch, dass du ihn benutzt. Es ist deine Aufgabe zu entscheiden, wie du ihn einsetzen kannst, um seinen Ruhm zu mehren.« Die Worte: »… und nicht nur deinen eigenen« brauchte sie nicht hinzuzufügen, denn ich hörte sie laut und deutlich in meinem Herzen.
Aber ich verstand die Worte meiner Mutter als stillschweigendes Einverständnis, in meinen Studien insgeheim fortzufahren. Wenn das nun allein und ohne Unterstützung vonstatten gehen musste, umso schlimmer. Doch lernen wollte ich, bis mir vor Anstrengung die Augen tränen würden. Ich konnte einfach nicht anders.
Damit will ich gar nicht sagen, dass ich all meine dem Alltag abgerungenen Stunden über Büchern verbracht hätte. Ich lernte auch auf andere Weise. Mir fiel ein, was Vater bezüglich Kräuterheilkunde gesagt hatte, und ich begann, Goody Branch und andere Frauen, die in solchen Dingen kundig waren, danach zu fragen. Es gab eine ungeheure Menge an Wissen, nicht nur die jahrhundertelang überlieferten Kenntnisse über englische Kräuter, sondern auch über den Gebrauch unbekannter Wurzeln und Blätter aus unserer neuen Heimat. Goody Branch hatte mich gerne an ihrer Seite, wenn sie Pflanzen sammelte und daraus ihre Tränke braute. Auch erzählte sie mir alles darüber, wie ein Kind entsteht und im Bauch der Mutter heranwächst. Sie sagte, jede Frau solle klug und weise sein, wenn es um die Belange ihres Körpers gehe. Manchmal nahm sie mich zu einer Frau in der Nachbarschaft mit, die guter Hoffnung war. Wenn die Frau nichts dagegen hatte, ließ sie mich die Hände auf den geschwollenen Leib legen und zeigte mir, wie man den Umriss des kleinen Wesens ertasten konnte, das darin heranwuchs. Sie brachte mir bei, wie man aus seiner Größe die genaue Anzahl der Wochen bis zur Niederkunft errechnen konnte, damit sie sich bereithalten konnte, wenn man sie als Hebamme zur Geburt rief. Ich stellte mich recht geschickt an und schätzte mehrere Geburten bis auf die Woche genau ein. Sobald ich älter sei, sagte Goody Branch, würde sie mich vielleicht auch einmal als ihre Helferin an einer Geburt teilnehmen lassen.
Wenn die Fischerboote hinausfuhren, erbettelte ich mir oft einen Platz an Bord, um auch die weiter entlegenen Teile der Insel besser kennenzulernen, wo sogar das Wetter anders war als in Great Harbor, obwohl man sich nur wenige Meilen davon entfernt hatte. Auch die Pflanzen unterschieden sich, und wenn wir an Land gingen, sammelte ich ein, was ich konnte, um es zu untersuchen. Goody Branch meinte, wir müssten zu Gott beten, dass er uns seine Handschrift lesen lasse, die für die Frommen klar zu erkennen sei und oft deutliche Hinweise gebe, so wie zum Beispiel beim Leberblümchen, das schon mit der typischen Form seiner Blätter darauf hindeute, welche Leiden damit kuriert werden können.
Es gab auch andere Tage, an denen ich weder Goody Branch noch sonst jemanden aufsuchte, sondern einfach nur umherstreifte und versuchte, in den Erscheinungsformen der Insel zu lesen wie in einem Text, wobei ich immer wieder bei einer Pflanze oder einem Stein verweilte, um zu erraten, welche Botschaft sich darin für mich verbarg. An solchen Tagen vermisste ich Zuriel am meisten. Ich sehnte mich danach, ihn an meiner Seite zu haben, meine Entdeckungen mit ihm zu teilen und gemeinsam mit ihm über den Fragen zu brüten, die die Welt mir stellte.
Eines schönen und hellen Tages, als das Wetter sich beruhigt hatte und die Luft bereits mild war, ritt ich auf Speckle zur Südküste. Die Aussicht dort ist bemerkenswert, denn die weiten, weißen Strände erstrecken sich ununterbrochen über viele Meilen hinweg. Ich beobachtete die gewaltig anschwellenden, glasglatten Wellen, die, gewaltigen Garnspulen gleich, den Rand meiner Welt markierten. Ich stieg vom Pferd, schnürte meine Stiefel auf, zog auch meine gestrickte Kniehose aus und ließ meine Füße vom Meeresschaum benetzen. Ich führte die Stute an der Wasserlinie entlang, wanderte mit dem Blick über weiße Muscheln, die aussahen wie Engelsflügel, und über ausgeblichene, hauchzarte Knochen, die offenbar von einem Meeresvogel stammten. Dort im Sand lagen Muschelschalen in den verschiedensten Farben und Größen – warmes Rot und Gelb, kühle, getüpfelte Grautöne –, und ich grübelte über die Vielfalt in Gottes Schöpfung nach und fragte mich, was er wohl im Sinn gehabt hatte, als er von ein und derselben Sache so viele verschiedene Arten schuf. Wenn er Muscheln nur zu unserer Ernährung gedacht hatte, warum hatte er dann jede einzelne Muschel mit so schönen und besonderen Farben bemalt? Und warum hatte er überhaupt so viele verschiedene Dinge geschaffen, um uns zu ernähren, wo doch in der Bibel stand, einfaches Manna sei für das Volk Israel sein täglich Brot gewesen? Vielleicht hatte Gott uns ja absichtlich mit all unseren Sinnen ausgestattet, damit wir die Dinge seiner Welt genießen konnten, ein jedes mit seinem eigenen Geschmack und Aussehen, ein jedes in seiner ihm eigenen Beschaffenheit. Andererseits schien dies so vielen unserer Predigten zu widersprechen, die sich gegen Unmäßigkeit und Fleischeslust wandten. So in Gedanken verloren, war ich mit gesenktem Kopf ein ganzes Stück gegangen, ohne auf etwas anderes zu achten, als ich mit einem Mal aufschaute und sie in der Ferne sah: eine Gruppe von Rothäuten, die eigentümlich bemalt waren, wie sie es wohl taten, wenn sie in den Krieg zogen. Sie liefen vor mir den Strand entlang und kamen direkt auf mich zu. Ich packte Speckle am Zügel und lenkte sie hastig in die Dünen hinein, die so hoch und wellig waren, dass man sich gut darin verstecken konnte. Ich verfluchte mich für meinen Leichtsinn, ganz allein hierhergekommen zu sein, wo mir niemand helfen konnte und mein Pferd vom anstrengenden Ritt bereits erschöpft war. Meine Stiefel hatte ich mir an den Schnürsenkeln um den Hals gehängt, doch die Kniehose war aus meiner Hand gerutscht, als ich mich an dem Pferd zu schaffen machte, und so musste ich zusehen, wie mehrere Stunden Arbeit und einige Knäuel rares, gutes Garn ins Meer geweht wurden.
Im Schutz der Dünen, wo es windstill war, trug die Brise die Stimmen der Rothäute zu mir herüber. Sie lachten und riefen sich etwas zu. Es waren fröhliche Stimmen, nicht die Stimmen von Kriegern. Ich achtete darauf, dass Speckle gut verborgen blieb, ließ mich auf den Bauch fallen und kroch auf eine Lücke zwischen den sandigen Hügeln zu, von wo aus ich zurück zum Strand schauen konnte. Und ich sah, was mir im ersten Schreck entgangen war: Die Männer waren unbewaffnet und trugen weder Pfeil und Bogen noch ein Kriegsbeil. Ich hob eine Hand über die Augen, um sie vor der gleißenden Sonne zu schützen, und konnte jetzt einen kleinen Ball aus zusammengenähten Tierhäuten erkennen, den sie sich zukickten – offenbar eine Art Spiel. Doch ich musste den Blick gleich wieder abwenden, denn alle waren nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, bis auf einen kleinen Lendenschurz aus Fell, den sie an einem Band um ihre Taille befestigt hatten. Dennoch konnte ich nicht umhin, sie verstohlen zu beobachten. Sie waren alle im Alter von Makepeace, vielleicht ein wenig älter, aber von der Statur her ganz anders – ein vollkommen anderer Menschenschlag. Makepeace, der so wenig wie möglich auf dem Feld arbeitete und es sich nicht verkneifen konnte, ab und zu aus der Zuckerdose zu naschen, wenn er sich unbeobachtet fühlte, hatte eine milchweiße Haut und schmale Schultern, einen weichen Bauch und ein bedauernswert schlechtes Gebiss.
Diese jungen Männer jedoch waren alle sehr groß, mit straffen Muskeln, schmalen Hüften und breiter Brust, und ihr langes schwarzes Haar flatterte um ihre Schultern. Die Farbe, mit der sie sich die Körper bemalt hatten, musste viel Fett enthalten, denn sie glänzten und schimmerten im Sonnenlicht, und wenn sie rannten, sah man deutlich das Muskelspiel ihrer Oberschenkel.
Zum Glück waren sie so sehr mit ihrem Spiel beschäftigt, dass sie mich nicht bemerkten. Ich führte Speckle noch ein Stück weiter weg, bis ich sicher sein konnte, hinter den Dünen nicht mehr gesehen zu werden, wenn ich auf das Pferd stieg. Dann spornte ich sie mit den bloßen Fersen zu einem leichten Galopp an. Wir bewegten uns vom Strand weg und kamen am Rande eines der Gezeitentümpel vorbei, die sich vom Meer aus ein Stück weit ins Landesinnere erstrecken. Schließlich war ich nicht ohne Grund hergekommen und musste genügend Muscheln für unseren Suppentopf zusammensammeln. Als ich eine gewisse Entfernung zum Strand zurückgelegt hatte, band ich Speckle deshalb an ein Stück Treibholz, zog die Muschelharke aus der Satteltasche, raffte die Röcke und watete ins Wasser. Schon bald merkte ich, dass es sich um keinen besonders guten Muschelgrund handelte, denn in meiner Harke blieben nur wenige Meeresfrüchte hängen, die es wert waren, in meinem Korb zu landen. Gerade wollte ich aufgeben und es an einer anderen Stelle versuchen, als ich spürte, dass jemand seinen Blick auf mich heftete. Ich richtete mich auf, drehte mich um und sah ihn zum ersten Mal – den Jungen, den wir heute Caleb nennen.
Er stand in einem Dickicht aus hohem Strandgras, den Bogen über eine Schulter gelegt. In dem Beutel auf seinem Rücken hing schlaff ein erlegter Wasservogel. Etwas – vielleicht der Ausdruck auf meinem Gesicht, vielleicht auch mein hektisches Zupfen an meinem Rock, der sich zwar im Wasser ausbreitete und meine Schicklichkeit wahrte, dabei aber durch und durch nass wurde – schien ihn zu amüsieren, denn er lächelte. Er war, wie ich schätzte und wie sich später auch als zutreffend herausstellte, in meinem Alter und vielleicht zwei oder drei Jahre jünger als die Krieger, die am Strand mit ihrem selbst genähten Ball spielten. Im Gegensatz zu ihnen war er für die Jagd gekleidet und trug einen Lendenschurz aus Rehfell mit einem Gürtel aus Schlangenleder, an dem eine Fellüberhose befestigt war. Die Oberarme zierten eine Reihe von Armbändern, die geschickt aus lila und weißen Muschelperlen geflochten waren. Alles andere an ihm war nackt und bloß, bis auf drei glänzende Federn, die er zu einer Art Kopfschmuck gebunden und in sein dickes, pechschwarzes Haar gesteckt hatte, das sehr lang und streng aus dem kupferfarbenen Gesicht gestrichen war. Hinten hatte er es zu einer Art Pferdeschwanz gebunden. Sein Lächeln war offen, seine Zähne sehr gerade und schneeweiß, und etwas an seinem ganzen Gebaren machte es unmöglich, sich vor ihm zu fürchten. Dennoch hielt ich es für vernünftig, mein Pferd zu holen und so schnell wie möglich diesen Ort zu verlassen, an dem es offenbar von allen möglichen Wilden nur so wimmelte. Wer konnte schon sagen, was für sonderbare Gestalten hier noch auftauchen mochten?
Ich hob meinen durchnässten Rock an und lief ans Ufer. Dabei verfing sich mein Zeh jedoch unglücklich in einem Strang Seetang, und ich fiel ins Wasser, wobei ich auch noch die wenigen Muscheln, die ich gesammelt hatte, verlor und sowohl meine Ärmel als auch das Wams durchnässt wurden. Sie waren nun genauso tropfnass wie mein Rock. Mit wenigen langen Schritten war der Indianerjunge bei mir, packte mich mit einer harten, braunen Hand am Unterarm und zog mich aus dem Wasser.
Ich forderte ihn in seiner Sprache auf, mich loszulassen, und er zog prompt die Hand zurück. Tropfnass machte ich mich auf den Weg ans Ufer. Er blieb, offenbar vor Erstaunen, wie angewurzelt stehen. Nun war ich an der Reihe, mir ein Lächeln zu verkneifen. Ich glaube, es hätte ihn kaum mehr überrascht, wenn mein Pferd das Wort an ihn gerichtet hätte.
Nach kurzem Zögern folgte er mir aus dem Wasser und begann mit einer wahren Flut von Silben auf mich einzureden, von denen ich allerdings nur ein paar verstand. Mein Vater hatte mir gesagt, die Rothäute liebten jeden, der sich in ihrer Sprache ausdrücken könne. Dieser Junge rief unablässig und zu meinem großen Unbehagen: »Manitou, Manitou!«, was in ihrer Sprache das Wort für Gott oder für etwas Gottgleiches, Wundersames ist.
Ganz langsam, in meinen einfachen Worten, versuchte ich ihm zu erklären, es sei gar nichts so Außergewöhnliches an der Tatsache, dass ich ein paar Brocken von ihrer Sprache spräche. Ich nannte ihm meinen Namen, denn gewiss hatten mittlerweile alle Wampanoag von den betenden Indianern und ihrem Pfarrer, meinem Vater, gehört. Ich erklärte, ich hätte etwas von seiner Sprache gelernt, indem ich den Unterricht meines Vaters bei Iacoomis belauscht hätte.
Bei dieser letzten Aussage verzog der Junge das Gesicht, als hätte er in einen Gallapfel gebissen. Zischend gab er das Wort von sich, das die Indianer für die menschliche Notdurft verwenden und das auch für etwas Widerwärtiges, Stinkendes steht. Ich errötete, weil er einen hilfsbereiten Mann, den mein Vater so sehr liebgewonnen hatte, dermaßen verhöhnte.
Er schaute in meinen leeren Muschelkorb hinab.
»Poquauhock?«, fragte er. Ich nickte. Er schloss die Hand um die Finger der anderen Hand, winkte mir und wandte sich dem Strandgras zu, aus dem er zuvor aufgetaucht war.
Mir blieb es freigestellt, ihm zu folgen oder nicht, und ich wünschte, behaupten zu können, dass ich mehr mit mir gerungen hätte. Während ich Mühe hatte, mit seinen langen, schnellen Schritten mitzuhalten, sagte ich mir, es wäre schließlich großartig, einen besseren Muschelgrund zu finden, da ich dann meine Aufgabe in den nächsten Tagen zügiger erfüllen könnte und mehr Zeit für meine eigenen Beschäftigungen hatte.
Es sollte das erste von vielen Malen sein, die ich diesem federgeschmückten Kopf durch Seegras und über Sanddünen hinweg folgte, ob nun zu einer Lehmgrube oder zu einem See. Er zeigte mir, wo die wilden Erdbeeren in der Sonne besonders süß und saftig wurden, manche von ihnen mehr als fünf Zentimeter dick und so zahlreich, dass ich an einem Vormittag einen ganzen Scheffel pflücken konnte. Er lehrte mich, zu erkennen, wo die Blaubeersträucher im Sommer reiche Ernte brachten und die Moosbeerpflanzen im Herbst unzählige ihrer blutroten Juwelen an den Stängeln trugen.
Er bewegte sich durch die Wälder wie ein junger Adam, der der Schöpfung ihre Namen gibt, und ich brachte meinen Lippen bei, die Worte in seiner Sprache zu formen – sasumuneash für Moosbeere, tunockuquas für Frosch. So viele Dinge wuchsen und gediehen hier, die wir gar nicht kannten, weil es sie in England nicht gab, und wir benannten sie nach anderen Dingen, die es vorher hier nicht gegeben hatte: das Katzenkraut zum Beispiel, das auf Katzen eine besondere Anziehungskraft ausübt; oder die Schaf-Lorbeerrose für den flach wachsenden Lorbeer, der sich für einige unserer mühsam erworbenen Jungschafe als tödlich erwiesen hatte. Dabei waren sowohl Katzen als auch Lämmer erst von uns hierhergebracht worden. Und so hatte ich, als er mir den Namen für eine Pflanze oder ein Tier nannte, das Gefühl, zum ersten Mal deren wirklichen Namen zu hören.
Wir taten beide immer so, als hätten wir uns durch Zufall getroffen, und täuschten Erstaunen darüber vor, dass sich unsere Pfade gekreuzt hatten. Und doch ließ er es mich immer ganz beiläufig wissen, wenn er den Plan hatte, während der einen oder anderen Mondphase oder bei einem bestimmten Sonnenstand zu fischen oder zu jagen. Dann fand ich für mich selber einen Vorwand, warum meine Streifzüge durch die Umgebung mich just zu dieser Zeit an diesen Ort führten, und kaum hielt ich mich in der Nähe auf, war es für ihn ein Leichtes, mich aufzuspüren, denn ich hinterließ, wie er sagte, eine Spur, die leichter zu erkennen war als die einer Herde laufender Rehe.
Die Stunden, die ich mit ihm verbrachte, rechtfertigte ich mit den Körben voller Köstlichkeiten, die ich von meinen Ausflügen nach Hause brachte. War es denn nicht meine Pflicht, zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen? Während ich dabei zusehen konnte, wie sich die Regale mit Gläsern voller Eingemachtem füllten, zwischen den Deckenbalken zahllose Schnüre mit getrockneten Moosbeeren baumelten und die Streifen geräucherten Schellfischs darauf hoffen ließen, dass wir im Winter keinen Hunger leiden mussten, fühlte ich mich in meiner Selbsttäuschung durchaus bestätigt.
Doch die Wahrheit, die ich jetzt an dieser Stelle und vor Gott darlege, ist eine ganz andere: dass ich nämlich die Zeit genoss, die ich mit ihm verbrachte. Binnen kurzem hatte er den gesamten Raum in meinem Herzen erobert, den früher Zuriel eingenommen hatte. Einen solchen Freund hatte ich zuvor nie besessen. Als Kind hatte ich kein Bedürfnis danach, weil Zuriel immer an meiner Seite gewesen war, der beste Begleiter, den ich mir wünschen konnte. Als er starb, war ich unfähig, mit jemand anderem Freundschaft zu schließen. Das einzige Mädchen meines Alters, mit dem ich mich hätte anfreunden können, gehörte zu den Aldens, der Familie, mit der wir Mayfields in der Siedlung über Kreuz waren, und mit einem der wenigen englischen Burschen meines Alters eine kameradschaftliche Beziehung, welcher Art auch immer, einzugehen, wäre wiederum ein undenkbarer Verstoß gegen den Anstand gewesen. Doch mit diesem Jungen war alles ganz anders. Er war schon bald mehr zu einem Bruder geworden als Makepeace, dessen Sorge um mein züchtiges Verhalten ihn streng und unnahbar gemacht hatte. Ich hatte gelernt, von Makepeace keine anderen Äußerungen zu erwarten als Anweisungen oder Tadel. Scherze oder spielerisches Geplänkel, die unsere Herzen einander geöffnet hätten, waren zwischen uns undenkbar.
Was mich antrieb, diesem wilden Jungen zu folgen, war zu Beginn sein Wissen über die Insel – sein tiefes Verständnis für alles, was blühte, was Flossen oder Flügel hatte. Doch schon bald war in mir auch die Neugier auf eine ungezähmte Seele entfacht worden, und auch das wurde für mich zu einem Grund, seine Nähe zu suchen. Doch eigentlich waren es sein frohes Gemüt und sein Lachen, die mich mit der Zeit an ihn banden, und ich vergaß allmählich, dass es sich bei ihm um einen halbnackten, nach Sassafrasöl duftenden Heiden handelte, der sich mit Waschbärenfett einrieb. Kurzum: Er wurde mein allerliebster Freund.