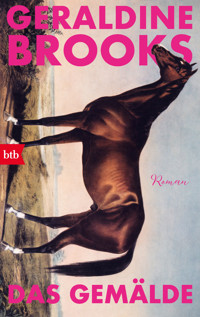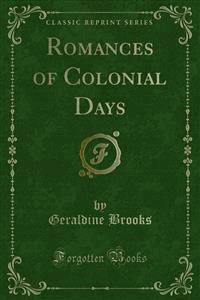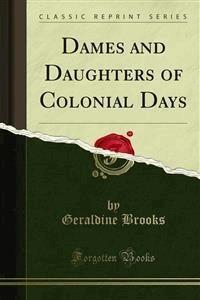9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuauflage des New-York-Times-Bestsellers, erscheint parallel zum neuen großen Roman der Pulitzerpreisträgerin
Eine Frau gegen den Schwarzen Tod. Als in einem kleinen Dorf im Norden Englands die Pest ausbricht, übernehmen Angst, Hysterie und Hexenwahn die Herrschaft. Der Schwarze Tod wütet unerbittlich. Die Dorfbewohner haben dem Pfarrer gelobt, den Ort nicht zu verlassen, ehe nicht die Seuche besiegt ist. Mehr als einmal sind sie kurz davor, einander gegenseitig zu meucheln. Die junge Witwe Anna Frith beweist in dieser schlimmen Zeit Mut, sie schenkt Leben und findet Liebe und privates Glück. Eines Tages hat das Grauen ein Ende. Aber Anna Frith steht die schwerste Prüfung noch bevor ...
Geraldine Brooks, mehrfach ausgezeichnete amerikanische Journalistin und Sachbuchautorin, wurde zu ihrem ersten Roman durch das Hinweisschild auf ein englisches „Pestdorf“ angeregt. Dort hatten sich Menschen bei Ausbruch der Pest im 17. Jahrhundert selbst in Quarantäne begeben, um das Ausbreiten der Seuche zu verhindern. An ihren Mut und ihre Verzweiflung erinnert bis heute im Peak District ein kleines Museum.
- »Das Porträt einer Frau an der Schwelle zur Moderne. Anna Frith lässt den Aberglauben hinter sich, geht mutig ihren Weg und findet ihre persönliche Freiheit.« (The Wall Street Journal)
- »Ergreifend, klug und unglaublich spannend.« (Washingon Post)
- »Eine Verbindung von Sprache und Geschichte, wie ich sie so noch nie gefunden habe. Bemerkenswert.« (Anita Shreve)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Year of Wonders. A Novel of the Plague« bei Viking, New York
Für Tony.Ohne dich wäre ich nie so weit gekommen.
Genug, o Herr, halt ein in Deinem Zorn, Der wilde Reiter durch die Straßen treibt. Zu rasch der Pfeil, aus gift’gem Quell geborn. Der Tapfre fällt, die Tugend sinkt entleibt.
So wenig Leben ward noch nie, noch Tod So viel. Von Gott verlassen, ohne Rat, Beschwört ein Häuflein Elend seine Not: Genad uns, Herr, verzeih die Missetat.
John Dryden, Annus Mirabilis,Das Jahr der Wunder, 1667
HERBSTZEIT
Anno 1666
Apfelernte
Früher habe ich diese Jahreszeit geliebt. Holzstapel neben der Türe. Frischer Harzgeruch, der die Erinnerung an den Wald birgt. Goldglänzende Heuhaufen im tief stehenden Nachmittagslicht. Im Keller rollen Äpfel polternd in die Kisten. Gerüche und Bilder und Geräusche. Alles werde gut dieses Jahr, versprachen sie. Und wenn der Schnee fiele, hätten die Kleinsten zu essen und lägen warm. Früher bin ich um diese Zeit gerne im Obstgarten unter den Apfelbäumen spaziert. Wie weich es unter den Füßen nachgab, wenn ich auf Fallobst trat. Der süßlich-schwere Duft nach verfaulenden Äpfeln und feuchtem Holz. Dieses Jahr gibt’s nur wenige Heubündel und spärliche Holzhaufen. Und beides bedeutet mir nicht viel.
Gestern haben sie die Äpfel gebracht, eine Wagenladung für den Pfarrkeller. Spät geerntet, was sonst. Auf ziemlich vielen entdeckte ich schwarze Flecken. Ich habe den Fuhrmann deswegen ins Gebet genommen, aber er meinte nur, wir sollten froh sein, überhaupt welche zu bekommen. Vermutlich nur allzu wahr. Es gibt doch nur so wenig Leute für die Ernte. So wenig Leute für alles und jedes. Und wer von uns noch übrig ist, geht herum, als schliefe er halb. Wir alle sind so müde.
Einen der knackigen und guten Äpfel nahm ich und schnitt ihn auf, hauchdünn, und trug ihn in jenen dämmrigen Raum, wo er sitzt, reglos und stumm. Seine Hand liegt auf der Bibel, und doch schlägt er sie nie auf. Jetzt nicht mehr. Ich fragte ihn, ob er möchte, dass ich ihm daraus vorlese. Er wandte den Kopf, um mich anzuschauen, und ich zuckte zusammen. Seit Tagen war es das erste Mal, dass er mich ansah. Ich hatte vergessen, was seine Augen auslösen konnten, wozu sie uns bringen konnten, wenn er unverwandt von der Kanzel heruntersah und uns mit seinen Blicken festhielt, einen nach dem anderen. Die Augen sind immer noch dieselben, nur sein Gesicht hat sich so sehr verändert. Verhärmt und ausgezehrt und jede Falte tief eingegraben. Als er hierher kam – ganze drei Jahre ist das her –, machte sich das ganze Dorf über sein jugendliches Aussehen lustig und darüber, dass so ein Jüngling zu ihnen predigen sollte.
»Anna, du kannst nicht lesen.«
»Hochwürden, ich kann’s. Mistress Mompellion hat’s mir beigebracht.«
Als ihr Name fiel, zuckte er zusammen und wandte sich ab, und sofort bedauerte ich es. Heutzutage macht er sich nicht die Mühe, seine Haare zusammenzubinden. Lang und dunkel fielen sie herab und verbargen sein Gesicht, sodass ich seine Miene nicht lesen konnte. Aber als er erneut sprach, klang seine Stimme leidlich gefasst. »Tatsächlich? Hat sie das?«, murmelte er. »Nun ja, dann werde ich dich vielleicht eines Tages anhören. Damit ich weiß, wie gut sie ihre Sache gemacht hat. Aber heute nicht, Anna, ich danke dir. Nicht heute. Das wäre dann alles.«
Eine Dienerin hat kein Recht zu bleiben, wenn man sie entlassen hat. Und doch tat ich’s, schüttelte das Kissen auf, legte ein Schultertuch zurecht. Er würde mich kein Feuer machen lassen. Nicht einmal dieses winzige Stück Behaglichkeit würde er von mir annehmen. Als ich schließlich nichts angeblich Wichtiges mehr zu tun hatte, verließ ich ihn.
In der Küche nahm ich ein paar angeschlagene Äpfel aus den Eimern und ging hinaus in die Ställe. Der Hof war ganze sieben Tage nicht gefegt worden. Es roch nach fauligem Stroh und Pferdepisse. Ich musste meinen Rock hochraffen, damit er nicht schmutzig wurde. Schon auf halbem Wege konnte ich den dumpfen Schlag hören, wenn sein Pferd bei jeder Drehung und Wendung mit dem Rumpf gegen den engen Pferch stieß und dabei tiefe Rillen in den Stallboden grub. Heutzutage ist niemand mehr kräftig oder erfahren genug, um mit ihm fertig zu werden.
Der Stallbursche, dessen Sache es war, den Hof sauber zu halten, döste auf dem Boden der Sattelkammer. Bei meinem Anblick sprang er auf und suchte umständlich nach dem Sichelgriff, der ihm beim Einschlafen aus der Hand gerutscht war. Als ich das Sichelblatt sah, das noch immer auf seiner Werkbank lag, wurde ich wütend, hatte ich ihn doch schon seit langem gebeten, es auszubessern. Inzwischen war das Lieschgras abgeblüht und keinen Schnitt mehr wert. Eigentlich wollte ich ihn deshalb und wegen des Unrats draußen schon ausschelten, aber beim Anblick seines verhärmten und erschöpften Gesichtes schluckte ich die Worte hinunter. Ich konnte nicht anders.
Als ich die Stalltür öffnete, flirrten plötzlich Staubkörnchen im Sonnenstrahl auf. Das Pferd hielt, einen Huf erhoben, im Scharren inne und blinzelte ins ungewohnte Gleißen. Dann bäumte es sich auf seine muskulösen Hinterbeine und schlug durch die Luft, als wollte es so deutlich wie möglich sagen: »Da du nicht er bist, verschwinde von hier.« Obwohl ich nicht zu sagen wusste, wann es das letzte Mal einen Striegel gespürt hatte, schimmerte sein Fell an der Stelle, wo das Licht auftraf, noch immer wie Bronze. Als Mister Mompellion auf diesem Pferd hier eingetroffen war, hatte es allgemein geheißen, ein so prachtvoller Hengst sei kein geeignetes Ross für einen Priester. Außerdem passte es den Leuten nicht, als sie hörten, dass Hochwürden ihn Anteros rief. Einer der alten Puritaner hatte ihnen nämlich erklärt, dies sei der Name eines heidnischen Götzen. Als ich meinen ganzen Mut zusammennahm und Mister Mompellion danach fragte, hatte er nur lachend gemeint, sogar die Puritaner sollten sich darauf besinnen, dass auch Heiden Kinder Gottes und ihre Geschichten ein Teil Seiner Schöpfung sind.
Ich blieb stehen, presste meinen Rücken gegen die Stallwand und redete sachte auf den mächtigen Hengst ein. »Ach, es tut mir so Leid, dass du den ganzen Tag hier drinnen eingepfercht bist. Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht.« Langsam griff ich in meine Schurztasche und streckte ihm einen Apfel hin. Er drehte seinen massigen Schädel ein wenig herum, sodass ich das Weiße in einem seiner feuchten Augen sehen konnte. Ich sprach leise weiter, so wie ich es immer bei den Kindern gemacht hatte, wenn sie Angst oder sich wehgetan hatten. »Du magst doch Äpfel. Weiß ich doch. Na los, dann mach schon und hol ihn dir.« Wieder scharrte er am Boden, aber diesmal klang es bereits weniger überzeugend. Langsam reckte er mir seinen breiten Hals entgegen und nahm mit geblähten Nüstern Witterung auf, vom Apfel und von mir. Handschuhweich und warm streifte seine Schnauze meine Hand, während er den Apfel mit einem Biss aufnahm. Als ich aus meiner Tasche den zweiten holen wollte, riss er den Kopf in die Höhe, dass der Apfelsaft nur so spritzte. Im Nu stieg er wieder hoch und drosch zornig in die Luft. Da wusste ich, dass mir der entscheidende Moment entglitten war. Ich ließ den zweiten Apfel auf den Stallboden fallen und trat schnell hinaus, wo ich an der geschlossenen Tür verschnaufte und mir einen Faden Pferdespeichel aus dem Gesicht wischte. Der Stallbursche musterte mich verstohlen und fuhr mit seiner Flickarbeit fort.
Nun ja, dachte ich, es ist einfacher, dem armen Tier einen kleinen Gefallen zu tun als seinem Herrn und Meister.
Als ich wieder im Haus war, konnte ich hören, dass sich der Herr Pfarrer von seinem Stuhl erhoben hatte und hin und her ging. Die Böden des Pfarrhauses sind alt und dünn. Das Knarzen der Dielen verriet mir jeden seiner Schritte. Hin und her ging das, hin und her. Wenn ich ihn doch nur dazu bringen könnte herunterzukommen und im Garten auf und ab zu gehen. Aber als ich das einmal andeutete, sah er mich an, als hätte ich die Besteigung des White Peak vorgeschlagen. Als ich seinen Teller holen ging, lagen die Apfelschnitze immer noch völlig unberührt da. Sie wurden schon braun. Morgen werde ich mit der Arbeit an der Saftpresse beginnen. Auch wenn ich ihn zu keinem Bissen Essen bewegen kann, so wird er manchmal doch etwas trinken, ohne es recht zu merken. Außerdem wäre es unsinnig, einen Keller voller Obst verderben zu lassen. Denn eines kann ich ganz sicher nie mehr ertragen: den Geruch eines faulenden Apfels.
Wenn ich mich am Ende des Tages vom Pfarrhaus auf den Heimweg mache, gehe ich lieber durch den Obstgarten als die Straße entlang, wo ich Gefahr laufe, Menschen zu begegnen. Nach allem, was wir gemeinsam überstanden haben, kann man nicht einfach mit einem höflichen »Guten Abend« aneinander vorübergehen. Doch zu mehr fehlt mir die Kraft. Diese Erinnerungen an glückliche Tage sind nur flüchtig, gleichen Spielgelbildern in einem Fluss, die eine Sekunde lang, in Einzelteile zerbrochen, aufschimmern und anschließend im Strom der Trauer, der nun unser Leben prägt, mitgerissen werden. Ich kann nicht behaupten, dass ich je das empfinde, was ich damals empfunden habe, damals, als ich glücklich war. Aber manchmal rührt doch etwas an jenen Ort, wo dieses Gefühl gelebt hat, eine Berührung wie von Mottenflügeln, die uns im Dunkeln im Vorüberflattern geschwinde streifen.
Wenn ich in einer Sommernacht im Obstgarten meine Augen schließe, kann ich die hohen Kinderstimmen hören: Flüstern und Lachen, Füßegetrappel und Blätterrascheln. Immer zu dieser Zeit im Jahr denke ich an Sam – den starken Sam Frith, und wie er mich um die Taille fasst und auf den Ast eines knorrigen alten Baumes hebt. »Heirate mich«, sagte er. Und warum sollte ich nicht? Die Kate meines Vaters war seit je ein freudloser Ort. Mein Vater liebte das Bier mehr als seine Kinder, obwohl er jahrein, jahraus immer welche bekam. Für meine Stiefmutter Aphra war ich in erster Linie ein Paar Hände und erst danach ein Lebewesen, eine, die sich um ihre Jüngsten kümmert. Und doch war sie es, die sich für mich einsetzte. Ihre Worte beeinflussten meinen Vater so, dass er seine Zustimmung gab. In seinen Augen war ich noch immer ein Kind, zu jung, um in die Ehe versprochen zu werden. »Mann, mach deine Augen auf und schau sie dir an«, sagte Aphra. »Du bist der einzige Mann im Dorf, der’s nicht tut. Besser, früh von Frith gefreit, als von irgendeinem Jüngling ins Bett gezerrt, dessen Schwanz härter ist als seine Moral.«
Sam Frith war Bergmann und hatte ein eigenes Bleiflöz zum Arbeiten. Er besaß ein hübsches kleines Häuschen. Seine erste Frau war gestorben, ohne ihm Kinder zu hinterlassen. Es dauerte nicht lange, und ich hatte Kinder von ihm. Zwei Söhne in drei Jahren. Drei gute Jahre, sollte ich wohl sagen, denn inzwischen gibt es viele, die zu jung sind, um zu wissen, dass wir damals nicht im Glauben an zukünftiges Glück aufgewachsen sind. Damals hatten die Puritaner hier im Dorf das Sagen. Inzwischen setzt man den wenigen, die noch unter uns sind, schwer zu. Mit ihren Predigten, denen wir in einer Kirche ohne jeden Zierrat lauschten, wuchsen wir auf. Ihre Ansichten bestimmten, was heidnisch war, dämpften den Sabbat und ließen die Kirchenglocken verstummen. Das Bier verschwand aus der Taverne und die Spitze von den Kleidern, die Bänder vom Maibaum und das Lachen aus den Dorfstraßen. Deshalb überfiel mich das Glück, das mir aus meinen Söhnen und aus dem Leben entgegenlachte, für das Sam sorgte, so unverhofft wie das erste Tauwetter im Frühling. Als sich alles erneut in trostloses Elend verwandelte, überraschte es mich nicht. Ruhig trat ich an die Türe, in jener Nacht mit ihren blakenden Fackeln und gellenden Rufen und den Männern mit den rabenschwarzen Gesichtern, die im Dunkeln kopflos wirkten. Auch diese Nacht kann der Obstgarten wiederbringen, wenn ich hier in Gedanken verweile. Unter der Türe stand ich, mit dem Kleinsten im Arm, und sah, wie die Fackeln auf und nieder tanzten und irrwitzige Lichtbänder durch die Bäume flochten. »Geht langsam« , flüsterte ich. »Geht langsam, denn erst, wenn ich die Worte höre, ist’s wahr.« Und sie gingen langsam und mühten sich den kleinen Hügel hinauf, als wär’s ein Berg. Aber so langsam sie auch gingen, schließlich waren sie doch am Ziel, stießen einander an und traten von einem Bein aufs andere. Den Größten, Sams Freund, schoben sie nach vorne. An seinem Stiefel klebte ein fauliges Stück Apfel, zu Brei getreten. Seltsam, dass man so etwas bemerkt, aber vermutlich hatte ich nach unten gesehen, um ihm nicht ins Gesicht schauen zu müssen.
Vier Tage gruben sie Sams Leichnam aus. Anstatt zu mir nach Hause brachten sie ihn direkt zum Küster. Sie versuchten, ihn vor mir zu verbergen, aber ich ließ mich nicht abhalten. Wenigstens diese letzte Ehre würde ich ihm erweisen. Sie wusste das. »Sag ihnen, sie sollen sie zu ihm lassen«, sagte Elinor Mompellion mit ihrer sanften Stimme zum Pfarrer. Kaum hatte sie gesprochen, war es auch schon vorbei. Sie bat ihn ja so selten um etwas. Und auf das Nicken von Michael Mompellion hin traten sie beiseite, die hünenhaften Männer, und ließen mich durch.
Offen gestanden war nicht mehr viel von ihm übrig. Und doch versorgte ich das Wenige, das noch da war. Zwei Jahre ist das her. Seitdem habe ich viele Leichen versorgt, Menschen, die ich liebte, und Menschen, die ich kaum kannte. Aber Sam war der Erste. Ich wusch ihn mit der Seife, die er so gerne hatte, weil sie, wie er sagte, nach den Kindern duftete. Armer schwerfälliger Sam. Ihm wurde nie ganz klar, dass es die Kinder waren, die nach Seife dufteten. Jeden Abend, ehe er heimkam, wusch ich sie damit. Ich kochte sie mit Heideblüten, eine viel weichere Seife als die, die ich für ihn machte. Seine Seife bestand fast zur Gänze aus Sand und Unschlitt. Musste ja so sein, damit er sich den Schweiß und die Rußschicht von der Haut scheuern konnte. Dann vergrub er immer sein armes müdes Gesicht in den Haaren der Kleinen und atmete ihren frischen Duft ein. Näher kam er den luftigen Hügeln nicht. Bei Tagesanbruch in die Grube hinunter und nach Sonnenuntergang wieder heraus. Ein Leben im Dunkeln. Und dort auch ein Sterben.
Und jetzt ist es Elinor Mompellions Mann, der den ganzen Tag bei geschlossenen Läden im Dunkeln sitzt. Und ich versuche, ihm zu dienen, obwohl mich manchmal das Gefühl beschleicht, ich würde lediglich noch einen aus jener langen Totenprozession versorgen. Und doch tu ich’s. Ich tu’s für sie. Für sie tu ich’s, rede ich mir ein. Warum sollte ich’s denn sonst tun?
An solchen Abenden öffnet sich hinter meiner Haustür eine lastende Stille, die wie eine Decke auf mich herabfällt. Von allen einsamen Augenblicken in meinem Tageslauf ist dieser stets der einsamste. Wenn das Sehnen nach einer menschlichen Stimme zu heftig wird, habe ich mich schon manchmal, ich gesteh’s, hinreißen lassen, meine Gedanken wie eine Irrsinnige laut vor mich hin zu murmeln. Doch dies gefällt mir gar nicht, denn ich befürchte, dass zur Zeit die Grenze zwischen mir und dem Irrsinn spinnwebenfein ist. Obendrein habe ich schon mit eigenen Augen gesehen, was es heißt, wenn eine Seele an jenen elenden Dämmerort hinüberwechselt. Und doch gestatte ich, die immer so stolz auf ihre Anmut war, mir heute bewusst ein tollpatschiges Benehmen. Ich lasse meine Füße schwer auftreffen, klappere mit dem Herdbesteck, und wenn ich Wasser heraufziehe, lasse ich die Eimerkette über den Stein schrappen, nur um anstatt der erstickenden Stille ein grelles Geräusch zu hören.
Wenn ich einen Unschlittstummel habe, lese ich, bis er flackert. Mistress Mompellion erlaubte mir immer, die Stummel aus dem Pfarrhaus mitzunehmen. Heutzutage gibt es nicht mehr viele davon, und doch wüsste ich nicht, wie ich ohne sie zu Rande käme. Denn die Stunde, in der ich mich in den Gedanken eines anderen verlieren kann, erleichtert mir die Last meiner eigenen Erinnerung. Doch wenn das Licht erloschen ist, werden die Nächte lang. Ich schlafe schlecht. Im Schlummer tasten meine Arme nach den kleinen warmen Körpern meiner Kinder, und wenn ich sie nicht finden kann, schrecke ich plötzlich hellwach auf.
Der Morgen tut mir meistens viel wohler als der Abend, er mit seiner Fülle an Vogelliedern und dem alltäglichen Versprechen, das jeder Sonnenaufgang mit sich bringt. Inzwischen halte ich mir eine Kuh, ein wahrer Segen, den ich mir in jenen Tagen nicht leisten konnte, als die Milch Jamie oder Tom hätte nützen können. Letzten Winter habe ich sie gefunden, wie sie abgemagert mitten auf der Straße lief. Aus ihren großen Augen traf mich ein solch hoffnungsloser Blick, dass es mir vorkam, als sähe ich in einen Spiegel. Die Kate meiner Nachbarn stand leer. So trieb ich sie hinein und machte daraus einen Schober für sie und fütterte sie während der kalten Monde mit Hafer dick und fett – herrenloses Futter, den Toten zu nichts mehr nütze. Dort bekam sie klaglos alleine ihr Kalb. Als ich es entdeckte, war es vermutlich schon zwei Stunden auf der Welt. Rücken und Flanken waren schon trocken, nur hinter den Ohren war es noch immer feucht. Ich verhalf ihm zu seinem ersten Schluck, indem ich ihm meine Finger ins Maul steckte und dazwischen ihre Zitze auf seine glitschige Zunge presste. Als Gegenleistung stahl ich am nächsten Abend ein bisschen von ihrer fetten, gelben Muttermilch, um daraus mit Ei und Zucker einen Bienenstich zu backen, den ich Mister Mompellion brachte. Er aß ihn. Da freute ich mich, als wäre er mein Kind, und dachte dabei, wie froh Elinor darüber wäre. Das kleine Stierkalb hat mittlerweile ein glänzendes Fell, und seine Mutter betrachtet mich mit freundlicher Duldsamkeit aus braunen Augen. Wie gerne lehne ich meinen Kopf an ihre warme Flanke und atme ihren Fellgeruch ein, während in meinem Eimer die Milch dampfend aufschäumt. Diese trage ich dann ins Pfarrhaus und mache daraus einen heißen Milchpunsch oder stampfe süße Butter oder schöpfe den Rahm ab und trage ihn zu einem Teller Heidelbeeren auf – was mir eben gerade als bester Gaumenschmaus für Mister Mompellion einfällt. Wenn der Eimer für unsere geringen Bedürfnisse voll genug ist, führe ich sie zum Grasen ins Freie. Seit letztem Winter ist sie so fett geworden, dass ich inzwischen jeden Tag befürchte, sie könnte mitten im Türrahmen stecken bleiben.
Mit dem Eimer in der Hand verlasse ich die Kate durch die Vordertüre. Morgens fühle ich mich eher zu einer Begegnung mit denen, die vielleicht schon draußen sind, im Stande. Wir alle hier, an diesem steilen Abhang des mächtigen White Peak, leben in der Schräge. Beim Bergaufgehen beugen wir uns immer vor, und um den steilen Abstieg zu bremsen, graben wir die Absätze in den Boden. Manchmal überlege ich mir, wie’s wohl wäre, an einem Ort zu leben, wo das Land nicht so sehr ansteigt und die Menschen mit aufrechtem Gang die Blicke auf einen geraden Horizont richten können. Sogar die Hauptstraße unserer Stadt hängt nach einer Seite, sodass die Leute auf der dem Berg zugewandten Seite höher stehen als die anderen bergab.
Unser Dorf besteht aus einer losen Reihe von Behausungen, die sich östlich und westlich der Kirche dahinschlängelt. Hie und da zerfranst sich die Hauptstraße in ein paar schmalere Pfade, die zur Mühle führen, nach Bradford Hall, zu den größeren Höfen und einsameren Katen. Schon immer haben wir hier mit dem gebaut, was zur Hand ist. Deshalb sind die Steine für unsere Wände aus dem örtlichen Granit geschlagen und die Dächer mit Heidematten gedeckt. Hinter den Katen links und rechts von der Straße liegen bebaute Felder und Gemeindewiesen, die abrupt an einer plötzlichen Erhebung oder einem Abgrund enden. Nördlich von uns ragt das Edge auf, dessen blankes Steingesicht das Ende des besiedelten Landes und den Beginn der Moore markiert, während sich zum Süden hin der Steilhang des Dale urplötzlich im Nichts verliert.
Ist schon merkwürdig, welchen Anblick unsere Hauptstraße heutzutage bietet. Früher habe ich im Sommer den Staub und im Winter den Schlamm verwünscht, wenn das Regenwasser in den Wagenspuren stehen blieb und sie in spiegelblanke Stolperfallen verwandelte. Jetzt hingegen gibt’s weder Eis noch Schlamm, noch Staub, denn nun wächst überall Gras auf der Straße. Nur in der Mitte, wo wenige Füße das Unkraut abgetreten haben, zieht sich ein schmaler Trampelpfad hin. Jahrhundertelang haben die Menschen dieses Dorfes die Natur aus ihrer näheren Umgebung verdrängt. Weniger als ein Jahr hat sie gebraucht, um erneut Anspruch auf ihr Revier zu erheben. Mitten auf der Straße liegt eine Walnuss, aus der bereits ein Schössling sprießt, der im Größerwerden unseren Weg zur Gänze blockieren möchte. Ich habe ihn vom ersten Keimblatt an beobachtet und mir dabei überlegt, wann ihn wohl einer ausreißen würde. Bisher hat’s noch niemand getan, und inzwischen hat er eine beachtliche Höhe. Fußabdrücke beweisen, dass wir alle um ihn herumgehen. Ist’s Gleichgültigkeit? Oder ergeht es anderen so wie mir? Haben wir so unendlich vieles enden sehen, dass sie es nicht übers Herz bringen, einen spillerigen Schössling auszureißen, der sich zögernd ans Leben klammert?
Ohne einer Menschenseele zu begegnen, habe ich den Weg zum Pfarrhausgatter zurückgelegt. Deshalb war ich nicht darauf vorbereitet, jener Person gegenüberzutreten, die ich am wenigsten auf der ganzen Welt zu sehen wünschte. Kaum war ich durchs Gatter und hatte mich umgedreht, um den Riegel wieder vorzuschieben, hörte ich hinter mir Seide rascheln. Ich fuhr herum und verschüttete dabei Milch aus meinem Eimer. Elizabeth Bradford warf mir einen bösen Blick zu, als ein Tröpfchen auf dem dunkelvioletten Saum ihres Gewandes landete. »Tollpatsch!«, zischte sie. So traf ich sie fast im gleichen Zustand wieder wie beim letzten Augenblick vor über einem Jahr: mürrisch und verwöhnt. Leider lassen sich lebenslange Gewohnheiten nur schwer abschütteln. Unwillentlich versank ich in einen Knicks. Obwohl mein Kopf fest entschlossen war, dieser Frau keine solche Ehre zu erweisen, gehorchte mein Körper aus alter Gewohnheit.
Sie fand nicht einmal einen Gruß der Mühe wert. Typisch. »Wo steckt Mompellion?«, wollte sie wissen. »Seit gut einer Viertelstunde klopfe ich nun schon an diese Türe. So früh kann er doch unmöglich außer Haus sein.«
Ich zwang meine Stimme zu salbungsvoller Höflichkeit. »Miss Bradford«, sagte ich, ohne auf ihre Frage weiter einzugehen, »welch große Überraschung und unvorhergesehene Ehre, Sie hier in unserem Dorf zu erblicken. Sie haben uns in solcher Eile verlassen und inzwischen so viel Zeit verstreichen lassen, dass wir bereits alle Hoffnung aufgegeben hatten, je wieder mit Ihrer Gegenwart beehrt zu werden.«
Elizabeth Bradford war so maßlos stolz und derart begriffsstutzig, dass sie nur die Wörter hörte, dem Tonfall aber keine Beachtung schenkte. »In der Tat.« Sie nickte. »Meine Eltern waren sich darüber im Klaren, dass unsere Abreise eine unfüllbare Lücke hinterlassen würde. Sie sind sich ihrer Verpflichtungen stets aufs Äußerste bewusst gewesen. Und wie du weißt, sind wir genau aus diesem Pflichtgefühl heraus von Bradford Hall fortgegangen. Damit unsere Familie gesund bleibt und wir auch weiterhin unsere Verantwortungen erfüllen können. Mompellion hat doch sicher den Brief meines Vaters der Gemeinde vorgelesen?«
»Hat er«, erwiderte ich, ohne hinzuzufügen, dass er ihn zum Anlass genommen hatte, eine seiner flammendsten Predigten zu halten, die wir je von ihm gehört hatten.
»Also, wo steckt er? Man hat mich bereits lange genug warten lassen. Außerdem ist meine Angelegenheit dringlich.«
»Miss Bradford, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Herr Pfarrer gegenwärtig niemanden empfängt. Die jüngsten Ereignisse sowie sein eigener schmerzhafter Verlust haben ihn so erschöpft, dass man ihm zur Zeit nicht einmal die Last der Gemeindearbeit im rechten Maße aufbürden kann.«
»Nun ja, das mag schon sein, soweit es den normalen Ansturm von Gemeindemitgliedern betrifft, aber er weiß ja nicht, dass meine Familie hierher zurückgekehrt ist. Sei so gut und teile ihm mit, dass ich ihn auf der Stelle zu sprechen wünsche.«
Jeder weitere Disput mit dieser Frau war zwecklos. Außerdem muss ich zugeben, dass ich vor Neugier fast platzte. Ich wollte unbedingt sehen, ob die Nachricht von der Bradfordschen Rückkehr in Mister Mompellion irgendwelche Gefühlsregungen hervorrufen würde. Vielleicht vermochte ihn der Zorn da zu packen, wo die Nächstenliebe versagt hatte. Vielleicht musste ihn ein derartiges Brandzeichen versengen.
Ich drehte mich um und ging voraus, um das große Pfarrhaustor zu öffnen. Darüber verzog sie das Gesicht; sie war es nicht gewohnt, mit Dienstboten eine Schwelle zu teilen. Sie hatte erwartet, ich würde zum Küchengarten herumgehen, dann wiederkommen und sie mit der üblichen Förmlichkeit hereinlassen. Das sah ich ihr genau an. Nun, die Zeiten hatten sich während der Bradfordschen Abwesenheit geändert, und je eher sie sich an die Unannehmlichkeiten der neuen Ära gewöhnte, umso besser.
Sie schob sich an mir vorbei und fand aus eigenen Stücken den Weg zum Salon, wo sie ihre Handschuhe auszog und damit ungeduldig in die flache Hand klatschte. Als ihr bewusst wurde, wie kahl der Raum war, aller seiner ehemaligen Bequemlichkeiten beraubt, war sie überrascht. Ich sah es ihr genau an. Ich ging weiter in die Küche. Egal, wie dringlich ihre Angelegenheit war, sie würde warten müssen, bis Mister Mompellion gefrühstückt hatte. War doch die dürftige Portion Haferkuchen und Sülze die einzige Mahlzeit, von der ich mit Sicherheit wusste, dass er sie auch tatsächlich einnahm. Als ich einige Minuten später mit dem vollen Tablett vorbeiging und flüchtig einen Blick durch die offene Türe warf, lief sie unruhig auf und ab und konnte kaum noch an sich halten. Ihre Augenbrauen waren zusammengezogen, ihre Stirn voller Runzeln. Es sah aus, als hätte jemand ihr Gesicht von unten gepackt und Richtung Boden gezerrt. Droben benötigte ich eine Minute, um meine Fassung wiederzugewinnen, ehe ich an die Tür klopfte. Wenn ich dem Herrn Pfarrer den Besuch meldete, wollte ich weder mit Worten noch mit meiner Miene mehr ausdrücken, als mir zustand.
»Komm«, sagte er. Bei meinem Eintreten stand er am Fenster. Erstmals waren die Läden offen. Er wandte mir den Rücken zu, als er sagte: »Elinor wäre traurig, wenn sie sähe, was aus ihrem Garten geworden ist.«
Zuerst wusste ich nicht, wie ich darauf antworten sollte. Die Wahrheit war zu offensichtlich. Wer sie aussprach, steigerte damit wahrscheinlich nur noch seine düstere Stimmung. Andererseits hieße es lügen, wenn man seine Aussage verneinte.
»Ich nehme an, sie hätte Verständnis dafür, warum es so ist«, sagte ich, wobei ich mich bückte, um die Teller vom Tablett zu nehmen. »Aber auch wenn wir genug Hände für die normalen Arbeiten hätten – zum Unkrautjäten und für den Rückschnitt –, so wär’s doch nicht ihr Garten. Ihr Blick würde uns fehlen. Denn das hat ihn zu ihrem Garten gemacht: die Art und Weise, wie sie sich im Winter beim Betrachten einer Hand voll winziger Samen vorstellen konnte, welche Blütenpracht Monate später im Sonnenlicht daraus entstehen würde. Es war, als malte sie mit Blumen.«
Als ich mich aufrichtete, hatte er sich umgewandt und starrte mich an. »Du hast sie wirklich gekannt!« Es klang, als wäre ihm das eben erst eingefallen.
Um meine Verwirrung zu verbergen, platzte ich mit dem heraus, was ich eigentlich so vorsichtig übermitteln hatte wollen. »Miss Bradford ist im Salon. Die Familie ist wieder im Herrenhaus. Sie sagt, sie müsse dringend mit Ihnen sprechen.«
Was dann geschah, verblüffte mich so sehr, dass ich beinahe das Tablett fallen ließ. Er lachte. Ein volles, amüsiertes Lachen. Ich hatte vergessen, wie so etwas klang, so lange hatte ich es schon nicht mehr gehört.
»Ich weiß, ich habe sie gesehen. Hat wie eine Belagerungsmaschine gegen meine Tür gedonnert. Ich dachte schon, sie wolle sie einreißen.«
»Welche Antwort soll ich ihr geben, Hochwürden?«
»Sag ihr, sie soll zur Hölle fahren.«
Beim Anblick meines Gesichtes lachte er wieder. Meine Augen müssen tellergroß gewesen sein. Mühsam rang er um Fassung, während er sich eine Lachträne aus dem Auge wischte. »Nein, man kann wohl kaum von dir erwarten, dass du solch eine Botschaft überbringst. Fasse sie in dir genehme Worte, egal, welche, aber übermittle Miss Bradford, dass ich sie nicht empfangen werde, und schaff sie aus diesem Haus.«
Mir kam es vor, als ginge ich in doppelter Gestalt die Treppe hinab. Die eine war das verschüchterte Mädchen, das in ständiger Angst für die Bradfords gearbeitet und ihre harten Blicke und bitteren Worte gefürchtet hatte. Die andere war Anna Frith, eine Frau, die mehr Schrecken Aug’ in Auge gegenübergestanden war als viele Soldaten. Elizabeth Bradford war ein Feigling, die Tochter von Feiglingen. Als ich ihr im Salon entgegentrat, wusste ich, dass ich von ihr nichts mehr zu befürchten hatte.
»Tut mir Leid, Miss Bradford, aber der Herr Pfarrer sieht sich gegenwärtig außer Stande, Sie zu empfangen.« Ich hielt meine Stimme möglichst ausdruckslos, aber als die Unterkiefer in ihrem wütenden Gesicht zu mahlen begannen, ertappte ich mich beim Gedanken an meine wiederkäuende Kuh. Mister Mompellions befremdlicher Heiterkeitsanfall wirkte ansteckend. Nur mit großer Mühe gelang es mir, Haltung zu bewahren und fortzufahren. »Wie bereits erwähnt, kommt er derzeit keinerlei seelsorgerischen Pflichten nach und begibt sich weder in Gesellschaft, noch empfängt er irgendwelche Personen.«
»Wie kannst du es wagen, mich süffisant anzugrinsen, du freche Schlampe!«, schrie sie. »Mich wird er nicht abweisen, das wagt er nicht. Aus dem Weg!« Sie trat auf die Türe zu, aber ich war schneller und stellte mich ihr wie ein Hirtenhund, der auf einen ungebärdigen Hammel trifft, in den Weg. Einen langen Augenblick starrten wir einander an. »Na gut«, sagte sie und nahm ihre Handschuhe vom Kaminsims, als ob sie gehen wollte. Daraufhin trat ich beiseite, da ich sie eigentlich zur Vordertüre bringen wollte, aber stattdessen drückte sie sich an mir vorbei und war schon halb die Treppe hinauf, als der Pfarrer höchstpersönlich oben auftauchte.
»Miss Bradford«, sagte er, »hätten Sie die Güte, dort zu bleiben, wo Sie sind.« Trotz seiner leisen Stimme ließ sein gebieterischer Tonfall sie wie angewurzelt stehen bleiben. Die gebeugte Haltung der letzten Monate war wie weggeblasen, hoch aufgerichtet und kerzengerade stand er da. Endlich war er wieder am Leben. Und nun konnte ich trotz seines Gewichtsverlustes erkennen, dass die Auszehrung in seinem Gesicht keine zerstörerischen Spuren hinterlassen, sondern ihm sogar noch Charakter verliehen hatte. Es hatte eine Zeit gegeben, wo man bei seinem Anblick vielleicht behauptet hätte, er habe ein nichts sagendes Gesicht. Nur seine tief liegenden grauen Augen hatten in ihrer Lebendigkeit immer schon beeindruckt. Jetzt lenkten seine hohlwangigen Züge den ganzen Blick so sehr auf diese Augen, dass man sich ihnen nicht mehr entziehen konnte.
»Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie davon absehen würden, Mitglieder meines Haushaltes zu beleidigen, die doch lediglich meine Anweisungen ausführen«, sagte er. »Bitte haben Sie die Freundlichkeit, sich von Mistress Frith zur Türe begleiten zu lassen.«
»Das können Sie doch nicht machen!«, erwiderte Miss Bradford, diesmal allerdings im Tonfall eines ganz kleinen Kindes, dessen Wunsch nach einem Spielzeug vereitelt wurde. Da der Pfarrer eine halbe Treppe über ihr stand, musste sie wie ein Bittsteller zu ihm aufschauen. »Meine Mutter bedarf Ihrer…«
»Meine liebe Miss Bradford«, unterbrach er sie kühl, »im vergangenen Jahr hatten hier viele Menschen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung Sie und Ihre Familie im Stande gewesen wären. Und doch waren Sie nicht… hier. Bitten Sie Ihre Mutter freundlichst, sie möge meine Abwesenheit gütigst im gleichen Maße tolerieren, wie dies Ihre Familie so lange bezüglich der eigenen für sich in Anspruch genommen hat.«
Inzwischen war sie rot angelaufen. Ihr Gesicht glich einem Flickenteppich. Plötzlich fing sie aus heiterem Himmel zu weinen an. »Mein Vater ist nicht mehr… mein Vater hat nicht… Es geht um meine Mutter. Meine Mutter ist schwer krank. Sie befürchtet… sie glaubt, sie wird daran sterben. Der Oxforder Chirurg schwor, dass es ein Geschwulst war, aber jetzt steht außer Frage… Bitte, Reverend Mompellion, ihr Geist ist sehr verwirrt. Sie will keine Ruhe geben und redet nur noch davon, Sie zu sehen. Aus diesem Grund sind wir wieder hierher gekommen, damit Sie ihr vielleicht Trost spenden und dabei helfen können, dem Tod ins Antlitz zu schauen.«
Eine lange Weile blieb er stumm. Ich war überzeugt, er würde mich mit den nächsten Worten bitten, ihm Mantel und Hut herauszusuchen, damit er sich ins Herrenhaus begeben könne. Als er wieder sprach, war sein Gesicht so traurig, wie ich’s schon oft gesehen hatte. Nur seine Stimme klang fremd und rau.
»Sollte sich Ihre Mutter von mir Absolution wie von einem Papisten erhoffen, dann hat sie ohne Erfolg eine lange und unbequeme Reise getan. Mit ihrer Bitte um Vergebung für ihr Verhalten sollte sie sich unmittelbar an Gott wenden. Leider fürchte ich, dass es ihr ergehen könnte wie schon vielen von uns hier, die in Ihm einen schlechten Beichtvater fanden.« Und damit drehte er sich um, stieg die Stufen zu seinem Zimmer hinauf und zog die Türe hinter sich zu.
Auf der Suche nach Halt packte Elizabeth Bradford hastig das Treppengeländer und klammerte sich daran, bis ihre Knöchel unter der Haut hervortraten. Sie zitterte, ihre Schultern bebten unter einem Schluchzen, das sie mit aller Macht unterdrücken wollte. Instinktiv trat ich zu ihr. Trotz meiner jahrelangen Abneigung gegen sie und ihrer Verachtung für mich sackte sie wie ein Kind in meine Arme. Eigentlich hatte ich sie zur Türe bringen wollen, aber bei ihrem derzeitigen Zustand konnte ich es nicht übers Herz bringen, sie ohne weiteres Federlesen hinauszubefördern, obwohl genau dies der eindeutige Wunsch des Herrn Pfarrers gewesen war. Stattdessen führte ich sie in die Küche und setzte sie behutsam auf die Anrichte. Dort löste sie sich so vollends in Tränen auf, dass das kleine Stück Spitze, das sie als Taschentuch benützte, restlos durchweicht war. Ich streckte ihr ein Geschirrtuch hin. Zu meinem Erstaunen nahm sie es und schnäuzte sich derart unfein und unbefangen wie ein Gassenkind. Ich bot ihr einen Becher Wasser an, den sie durstig austrank. »Ich sagte, die Familie sei wieder da, aber in Wahrheit handelt es sich nur um meine Mutter, um mich und unsere persönlichen Bediensteten. Sie grämt sich so sehr, dass ich nicht weiß, wie ich ihr helfen kann. Seit mein Vater über ihren wahren Gesundheitszustand Bescheid weiß, will er mit ihr nichts mehr zu tun haben. Meine Mutter hat keinen Tumor, aber auch das, was sie hat, wird sie in ihrem Alter möglicherweise umbringen. Und mein Vater sagt, es sei ihm egal. Er ist ja schon immer grausam zu ihr gewesen, aber nun hat er den Gipfel an Erbärmlichkeit erreicht. Ständig sagt er die entsetzlichsten Dinge … Seine eigene Frau hat er Hure genannt …« Und hier hielt sie endlich inne. Sie hatte mehr gesagt als beabsichtigt, weit mehr, als sie hätte sagen sollen. Sie schoss von der Anrichte hoch, als hätte sich diese urplötzlich in eine heiße Herdplatte verwandelt, straffte die Schultern und streckte mir ohne ein Dankeschön das benützte Geschirrtuch und den leeren Becher hin. »Ich finde schon alleine hinaus«, sagte sie, während sie an mir vorbeirauschte, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Ich folgte ihr nicht. Trotzdem wusste ich genau, dass sie fort war. Die große Eichentüre fiel laut ins Schloss.
Erst jetzt gestattete ich mir ein kurzes Erstaunen über das, was Mister Mompellion zu ihr gesagt hatte. Offenbar hatte sich sein Sinn noch mehr verdüstert, als ich vermutet hatte. Ich war besorgt um ihn und wusste doch nicht, womit ich ihm Trost bringen konnte. Trotzdem stieg ich leise die Treppe hinauf und lauschte draußen vor seiner Türe. Drinnen herrschte Stille. Ich klopfte sachte, und als von ihm keine Antwort kam, öffnete ich die Türe. Er saß da und hatte den Kopf in die Hände gestützt. Wie immer lag die Bibel neben ihm, ungeöffnet. Plötzlich stand mir wieder ganz deutlich vor Augen, wie er im letzten Winter am Ende eines der dunkelsten Tage genau so dagesessen hatte. Mit einem Unterschied: Neben ihm war Elinor gesessen und hatte mit sanfter Stimme aus den Psalmen vorgelesen. Mir war, als hörte ich es noch immer, ein leises, ach so tröstliches Murmeln, nur unterbrochen durch das sachte Rascheln beim Umblättern. Ohne ihn um Erlaubnis zu bitten, hob ich die Bibel auf und schlug eine mir wohl bekannte Stelle auf:
»Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat! Der dir all deine Sünden vergibt, und heilet alle deine Gebrechen; Der dein Leben vom Verderben erlöset …«
Er erhob sich aus seinem Lehnstuhl und nahm mir das Buch aus der Hand. Seine Stimme klang tief und doch zerbrechlich. »Sehr gut gelesen, Anna. Ich sehe, meine Elinor war eine hervorragende Lehrerin. Aber warum hast du nicht diese Stelle gewählt?« Er blätterte ein paar Seiten um und begann zu rezetieren:
»Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her …«
Er hob die Augen und starrte mich durchdringend an, ehe er langsam und ganz bewusst die Hand öffnete. Das Buch glitt ihm aus den Fingern. Instinktiv stürzte ich vor, um es zu fangen, aber er packte meinen Arm. Mit einem dumpfen Knall fiel die Bibel zu Boden.
Da standen wir nun, von Angesicht zu Angesicht. Immer stärker umklammerte seine Hand meinen Unterarm, bis ich dachte, er würde ihn brechen. »Herr Pfarrer«, sagte ich, wobei ich mich mit aller Macht um eine ruhige Stimme bemühte. Daraufhin ließ er meinen Arm fallen, als sei er ein heißes Brandeisen, und raufte sich mit der Hand die Haare. Sein derber Griff hatte eine rote Druckstelle hinterlassen, in der es heftig pochte. Ich konnte spüren, wie mir Tränen in die Augen schossen, und wandte mich ab, damit er sie nicht sehen konnte. Diesmal ging ich unaufgefordert.
FRÜHLING
Anno 1665
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!