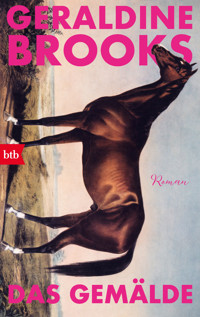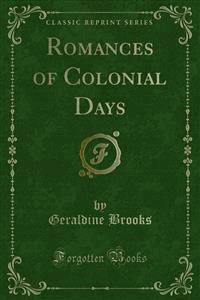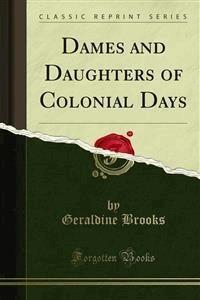2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuauflage des New-York-Times-Bestsellers, erscheint parallel zum neuen großen Roman der Pulitzerpreisträgerin
Hanna, eine junge, angesehene Buchrestauratorin, wird 1996 von Sydney in das vom Bürgerkrieg zerrissene Sarajevo gerufen. Sie soll dort die kostbare Sarajevo-Haggadah, eine jüdische Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, untersuchen. In der Bibliothek angekommen, trifft sie auf den zurückhaltenden moslemischen Museumsleiter Ozren, der das Buch vor der Zerstörung gerettet hat. Er irritiert und fasziniert sie gleichermaßen. Und je mehr sich Hanna auf einer Spurensuche, die sie durch ganz Europa führt, mit der Schrift und ihrer geheimnisvollen Geschichte beschäftigt, desto mehr wird sie auch mit ihrer eigenen Vergangenheit und Herkunft konfrontiert. Die Entdeckung ihrer eigenen Wurzeln lässt sie schließlich einen mutigen Schritt wagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Hochzeitsgabe
Hanna
I
II
III
IV
V
Ein Insektenflügel
Hanna
Federn und eine Rose
Hanna
Weinflecken
Hanna
Salzwasser
Hanna
Ein weißes Haar
Hanna
Lola
Hanna
Nachwort
Zur Autorin
Eine zweifache Rettung in Sarajevo während des Zweiten Weltkriegs
Newsletter-Anmeldung
Orientierungsmarken
Titelei
Copyright-Seite
Widmung
Hauptteil
Nachwort
Geraldine Brooks
Die Hochzeitsgabe
Roman
Aus dem Englischen von Almuth Carstens
Hanna, eine junge, angesehene Buchrestauratorin, wird 1996 von Sydney in das vom Bürgerkrieg zerrissene Sarajevo gerufen. Sie soll dort die kostbare Sarajevo-Haggadah, eine jüdische Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, unter die Lupe nehmen. Hanna wittert eine große Chance für ihre Karriere und ahnt nicht, dass dieser Auftrag ihr Leben verändern wird: In der Bibliothek angekommen, trifft sie auf den zurückhaltenden moslemischen Museumsleiter Ozren, der das Buch vor der Zerstörung gerettet hat. Er irritiert und fasziniert sie gleichermaßen. Und je mehr sich Hanna auf einer Spurensuche, die sie durch ganz Europa führt, mit der Schrift und ihrer geheimnisvollen Geschichte beschäftigt, desto mehr wird sie auch mit ihrer eigenen Vergangenheit und Herkunft konfrontiert. Die Entdeckung ihrer eigenen Wurzeln lässt sie schließlich einen mutigen Schritt wagen . . . Alles über die Autorin Geraldine Brooks und die wahre Geschichte der Sarajevo-Haggadah finden Sie im Anhang.
Geraldine Brooks bei btb: · Auf freiem Feld. Roman (73313) · Das Pesttuch. Roman (73223) · Das Pesttuch – besondere Leinenausgabe (73886) · Insel zweier Welten. Roman (74391)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2008
unter dem Titel »People of the Book« bei Viking, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Geraldine Brooks Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by arrangement with Viking, a member of Penguin Group (USA) Inc.
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Bridgeman Images/Fitzwilliam Museum; © Shutterstock/aga7ta
SL·Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-29368-0V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für die Bibliothekare
Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.
Heinrich Heine
Hanna
Sarajevo, Frühling 1996
I
Ich kann es ebenso gut gleich zugeben: Es war keiner meiner üblichen Jobs.
Ich arbeite gern allein, in meinem eigenen sauberen, stillen, gut beleuchteten Labor, wo das Klima kontrolliert und alles, was ich brauche, in Reichweite ist. Zwar habe ich mir den Ruf erworben, auch außerhalb des Labors effektiv arbeiten zu können – wenn es sein muss –, weil ein Museum zum Beispiel die Transportversicherung für ein Stück nicht bezahlen will oder ein Privatsammler nicht möchte, dass irgendjemand sonst weiß, was genau sich in seinem Besitz befindet. Auch bin ich früher schon wegen eines interessanten Jobs um die halbe Welt geflogen, aber noch nie zu einem Ort wie diesem: dem Sitzungssaal einer Bank inmitten einer Stadt, deren Bewohner erst vor fünf Minuten aufgehört haben, aufeinander zu schießen.
Zunächst einmal bin ich in meinem heimischen Labor nicht von Wachen umstellt. Klar, im Museum gibt es ein paar Sicherheitsbeamte, die in aller Ruhe ihre Runden drehen, aber keinem von ihnen würde es im Traum einfallen, an meinen Arbeitsplatz vorzudringen. Ganz im Gegensatz zu hier, wo es gleich sechs waren: zwei Wachleute der Bank, zwei bosnische Polizisten, und die anderen beiden, Angehörige der UN-Friedenstruppe, die wiederum ein Auge auf die bosnischen Polizisten haben sollten. Sie alle unterhielten sich laut auf Bosnisch oder Dänisch über ihre knisternden Funkgeräte. Und als reichte das noch nicht aus, war auch der offizielle UN-Beobachter Hamish Sajjan zugegen. Der erste schottische Sikh, dem ich begegnete, sehr elegant in Harris-Tweed und mit indigoblauem Turban. Der einzige in der UNO. Ich hatte ihn bitten müssen, die Bosnier darauf hinzuweisen, dass Rauchen nicht anging in einem Raum, in dem in Kürze ein Manuskript aus dem 15. Jahrhundert eintreffen würde. Seit sie ihre Zigaretten weggesteckt hatten, waren sie noch nervöser.
Auch ich wurde allmählich nervös. Wir warteten schon fast zwei Stunden. Ich hatte die Zeit so gut wie möglich ausgefüllt. Die Wachen hatten mir geholfen, den großen Konferenztisch näher ans Fenster zu rücken, um das Licht auszunützen. Ich hatte das Stereomikroskop aufgebaut und meine Werkzeuge auf dem Tisch ausgebreitet: Kameras zur Dokumentation, Sonden und Skalpelle. Die Gelatine wurde in einem Becher auf dem Heizkissen weich, und auch Weizenkleister, Leinwandfäden und Blattgold lagen bereit, daneben einige Pergamintüten für den Fall, dass ich das Glück hatte, in der Bindung irgendwelche Rückstände zu finden – es ist erstaunlich, was man über ein Buch in Erfahrung bringen kann, wenn man zum Beispiel die chemische Zusammensetzung einer Brotkrume untersucht. Ich hatte mir Kalbslederfetzen in mehreren Varianten zurechtgelegt, Rollen handgeschöpften Papiers in verschiedenen Farbtönen und Texturen sowie Styroporformen als Stützen, in die das Buch gebettet werden würde. Wenn ich es denn je in die Hände bekam.
»Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir noch warten müssen?«, fragte ich Sajjan. Er zuckte die Achseln. »Ich glaube, der Vertreter des Nationalmuseums hat sich verspätet. Da das Buch Eigentum des Museums ist, darf die Bank es nur in seiner Gegenwart aus dem Tresor holen.«
Unruhig trat ich ans Fenster. Wir befanden uns im obersten Stockwerk der Bank, eines Bauwerks, das einer österreichischungarischen Hochzeitstorte glich, und dessen stuckverzierte Fassade wie die jedes anderen Gebäudes der Stadt mit den Pockennarben von Granaten übersät war. Als ich meine Hand auf die Scheibe legte, spürte ich die Kälte. Angeblich war es Frühling; in dem kleinen Garten neben der Eingangstür zur Bank blühten die Krokusse. Allerdings hatte es kürzlich geschneit, und aus den Kelchen der Blüten quollen Schneeflocken wie Milchschaum aus winzigen Cappuccinotassen. Zumindest war das Licht im Raum durch den Schnee gleichmäßig und hell. Perfekt zum Arbeiten, falls es überhaupt dazu kam.
Nur um mich zu beschäftigen, entrollte ich einige meiner Papiere – gewalztes französisches Leinen. Ich strich mit einem Metalllineal über jedes einzelne Blatt, um es zu glätten. Das Geräusch, mit dem die Linealkante über den großen Bogen schabte, erinnerte mich an die Brandung, die ich von meiner Wohnung zu Hause in Sydney hören kann. Ich bemerkte, dass meine Hände zitterten. Das ist nicht gut in meinem Beruf.
Meine Hände sind nicht eben das Schönste an mir. Mit ihrer rissigen, zerfurchten Haut sehen sie nicht so aus, als ob sie an meine Gelenke gehörten, die, wie ich glücklicherweise behaupten kann, schlank und geschmeidig sind wie der Rest meines Körpers. Putzfrauenhände nannte meine Mutter sie bei unserem letzten Streit. Als wir uns danach noch einmal im Cosmopolitan zum Kaffee trafen – eine kurze, nüchterne Begegnung –, trug ich als spöttische Anspielung darauf Handschuhe von der Heilsarmee. Das Cosmopolitan ist wohl der einzige Ort in Sydney, wo jemandem das Ironische an so einer Geste womöglich entgeht. Meiner Mutter entging es jedenfalls. Sie sagte, sie würde mir einen passenden Hut besorgen.
In dem hellen Licht hier sahen meine Hände noch schlimmer aus als sonst, gerötet und rau vom Abschrubben des Fetts von Rindereingeweiden mit Bimsstein. Wenn man in Sydney lebt, zählt es nicht gerade zum Einfachsten von der Welt, einen Meter Kalbsdarm zu ergattern. Seit sie den Schlachthof aus Homebush ausquartiert und angefangen haben, das Gelände für die Olympischen Spiele 2000 aufzumotzen, muss man mit diesem Anliegen praktisch in die Walachei fahren. Und wenn man endlich angelangt ist, wimmelt es dort derartig von Tierschützern, dass man kaum durchs Tor kommt. Ich werfe es niemandem vor, wenn er mich für ein bisschen seltsam hält. Schließlich ist es nicht leicht zu begreifen, wofür jemand einen Meter Kalbsdarm benötigt. Wenn man jedoch mit sechshundert Jahre alten Materialien arbeiten will, muss man wissen, wie sie vor sechshundert Jahren hergestellt wurden. Dieser Meinung ist jedenfalls Werner Heinrich, mein Lehrer. Er sagte, man könne noch so viel über das Zermahlen von Farbpigmenten und das Anmischen von Gips lesen, der einzige Weg zum richtigen Verständnis sei immer noch, es selbst zu tun. Wenn ich wissen wolle, was Wörter wie Packen und Quetsche wirklich bedeuteten, müsse ich selbst Blattgold herstellen, es schlagen und falten und wieder schlagen, und zwar auf einem weichen Untergrund, an dem es nicht kleben bleibt, zum Beispiel sauber geschrubbter Kalbsdarm. Irgendwann hat man dann einen kleinen Stapel Blattgold, in dem jedes Blatt weniger als ein Tausendstel Millimeter dick ist. Und man hat scheußlich aussehende Hände.
Ich ballte die Hände zur Faust, um die Alte-Tanten-Runzelhaut zu glätten. Außerdem wollte ich versuchen, dem Zittern Einhalt zu gebieten. Ich war bereits nervös, seit ich tags zuvor am Flughafen Wien umgestiegen war. Ich reise viel; das muss man, wenn man in Australien lebt und an den interessantesten Projekten in meiner Branche, nämlich der Konservierung mittelalterlicher Manuskripte, teilhaben will. Im Allgemeinen suche ich aber keine Orte auf, die Kriegsreportern ihre Schlagzeilen liefern. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die so etwas tun und großartige Bücher darüber schreiben, und ich vermute, sie haben so eine Art »Mir-kann-nichts-passieren«-Optimismus, der ihnen das ermöglicht. Ich dagegen bin eine totale Pessimistin. Falls sich in dem Land, das ich besuche, auch nur ein Heckenschütze aufhält, rechne ich durchaus damit, dass ich in sein Fadenkreuz gerate.
Schon ehe das Flugzeug landete, sah ich, dass Krieg herrschte. Als wir die grauen Wolkenschwaden durchbrachen, die offensichtlich zur permanenten Verzierung des europäischen Himmels beitragen, wirkten die kleinen, rostbraun gedeckten Häuser an der Adriaküste zunächst so vertraut, als schaute ich über die Dächer von Sydney auf die tiefblaue Bucht von Bondi Beach. Hier aber waren die Hälfte der Häuser zerstört. Sie bestanden nur noch aus schartigen Stümpfen von Mauerwerk, das wie faulige Zähne in zerklüfteten Reihen aufragte.
Es gab Turbulenzen, als wir die Berge überflogen. Ich konnte mich nicht überwinden, aus dem Fenster zu sehen, als wir in den bosnischen Luftraum kamen, und zog deshalb das Rollo herunter. Der junge Mann neben mir – wohl Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, wie ich aus seinem kambodschanischen Schal und dem von Malaria ausgezehrten Gesicht schloss – wollte offenbar hinausschauen, doch ich ignorierte seine Körpersprache und versuchte, ihn mit einer Frage abzulenken.
»Und was führt Sie hierher?«
»Minenräumung.«
Ich war in Versuchung, etwas echt Grenzwertiges zu sagen wie: »Läuft gut, das Geschäft, was?«, schaffte es aber untypischerweise, mich zurückzuhalten. Und dann landeten wir, und er stand zusammen mit allen anderen Passagieren auf, drängte sich in den Gang und kramte in den Gepäckfächern. Dann schulterte er einen riesigen Rucksack und brach dem Mann hinter ihm fast die Nase. Der tödliche 90-GradSchwenk des Globetrotters – im Bus nach Bondi sieht man ihn ständig.
Endlich ging die Kabinentür auf, und alle schoben sich vorwärts, als wären sie zusammengewachsen. Ich war die einzige, die noch saß. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Stein verschluckt, der mich auf den Sitz drückte.
»Dr. Heath?« Die Flugbegleiterin stand vor mir in dem leeren Gang.
Ich hätte beinahe gesagt: »Nein, das ist meine Mutter«, als mir klar wurde, dass sie mich meinte. In Australien schmücken sich nur Angeber mit ihrem Doktortitel. Ich war mir sicher, lediglich als Ms. eingecheckt zu haben.
»Ihre Eskorte von den Vereinten Nationen erwartet Sie auf der Rollbahn.« Das war die Erklärung. Mir war bei den Vorbereitungen zu diesem Auftrag bereits aufgefallen, dass die UNO Wert auf solch protzige Anreden legt.
»Eskorte?«, wiederholte ich einfältig. »Rollbahn?« Man hatte mir gesagt, ich würde abgeholt, doch hatte ich eher an einen gelangweilten Taxifahrer gedacht, der ein Schild mit meinem falsch geschriebenen Namen hochhielt. Die Flugbegleiterin schenkte mir ein breites, perfektes deutsches Lächeln. Sie beugte sich über mich und ließ das Rollo hochschwirren. Ich sah hinaus. Drei große gepanzerte Wagen mit getönten Scheiben, Fahrzeuge von der Art, in denen der amerikanische Präsident herumkutschiert wird, standen hinter der Tragfläche. Dieser Anblick, der eigentlich beruhigend hätte wirken müssen, machte den Stein in meinen Eingeweiden nur noch eine Tonne schwerer. Dahinter, in langem Gras, das mit Minenwarnschildern in mehreren Sprachen gespickt war, lag der rostige Rumpf einer riesigen Frachtmaschine, die bei irgendeinem misslichen Zwischenfall von der Landebahn abgekommen sein musste. Ich schaute Fräulein Lächelgesicht an.
»Ich dachte, der Waffenstillstand wird eingehalten«, sagte ich.
»Wird er auch«, entgegnete sie munter. »Meistens. Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem Handgepäck?«
Ich schüttelte den Kopf und beugte mich vor, um den fest unter meinem Vordersitz verkeilten, schweren Koffer hervorzuzerren. Im Allgemeinen gestatten Fluggesellschaften keine Sammlungen spitzer Metallgegenstände an Bord, doch die Deutschen haben großen Respekt vor dem Handwerk, und die Dame am Check-in-Schalter verstand, dass ich mein Werkzeug ungern aufgebe, weil es dann womöglich ohne mich auf Europa-Rundreise geht, während ich untätig dasitze.
Ich liebe meine Arbeit. Das ist auch der Grund dafür, dass ich, der größte Feigling auf Erden, eingewilligt habe, diesen Auftrag anzunehmen. Um ehrlich zu sein, kam es mir gar nicht mal in den Sinn abzulehnen. Man schlägt nicht die Chance aus, an einem der seltensten und rätselhaftesten Bücher der Welt zu arbeiten.
Der Anruf hatte mich um 2 Uhr morgens erreicht, wie so viele Anrufe, da ich in Sydney lebe. Manchmal macht es mich rasend, dass die intelligentesten Leute – Museumsdirektoren, die international bekannte Einrichtungen leiten, oder Aufsichtsräte, die einem auf die Kommastelle genau sagen können, wie hoch der Hang-Seng-Index an einem bestimmten Tag war – die simple Tatsache übersehen, dass es in Sydney generell neun Stunden später ist als in London und vierzehn Stunden später als in New York. Amitai Yomtov ist ein brillanter Mann. Wahrscheinlich der beste auf seinem Gebiet. Aber kennt er den Zeitunterschied zwischen Jerusalem und Sydney?
»Schalom, Channa«, sagte er mit seinem ausgeprägten hebräischen Akzent, der meinen Namen mit einem gutturalen
»Ch« versah. »Ich habe dich doch nicht geweckt?«
»Nein, Amitai«, erwiderte ich. »Um zwei Uhr morgens bin ich immer auf; ist die beste Tageszeit.«
»Ach so, tut mir leid, aber ich dachte, es interessiert dich vielleicht, dass die Haggadah von Sarajevo aufgetaucht ist.«
»Nein!«, rief ich, plötzlich hell wach. »Das ist ja eine großartige Nachricht.« Das stimmte wirklich, doch diese großartige Nachricht hätte ich ebenso gut zu einer zivilisierten Stunde als E-Mail lesen können. Mir war nicht klar, warum Amitai mich unbedingt hatte anrufen müssen.
Amitai war wie die meisten Sabres ein recht zurückhaltender Typ, aber diese Neuigkeit hatte ihn überschwänglich gemacht. »Ich habe immer gewusst, dass dieses Buch ein Überlebenskünstler ist. Ich wusste, dass es die Bomben überstehen würde.«
Die Haggadah von Sarajevo, entstanden im mittelalterlichen Spanien, war eine berühmte Rarität, eine üppig bebilderte hebräische Handschrift, geschaffen zu einer Zeit, in der der jüdische Glaube Illustrationen jeder Art streng verbot. Man hatte vermutet, das Gebot im 2. Buch Mose, »Du sollst dir kein Gottesbild machen«, habe die figurative Kunst bei den Juden des Mittelalters unterdrückt. Als das Manuskript jedoch 1894 in Sarajevo auftauchte, widerlegten die darin enthaltenen Miniaturen diese Annahme, was sogar dazu führte, dass Teile der Kunstgeschichte neu geschrieben werden mussten.
1992, zu Beginn der Belagerung von Sarajevo, als auch Museen und Bibliotheken unter Beschuss gerieten, war der Kodex verschwunden. Die bosnisch-muslimische Regierung habe ihn verkauft, um Waffen zu finanzieren, lautete ein Gerücht. Nein, Agenten des Mossad hätten ihn durch einen Tunnel unter dem Flughafen aus der Stadt herausgeschmuggelt. Ich schenkte beiden Versionen keinen Glauben. Meiner Meinung nach war das wunderschöne Buch wohl Teil des Ascheregens aus brennenden Seiten geworden – bestehend aus osmanischen Grundbesitzurkunden, antiken Koranen und slawischen Schriftrollen –, der nach dem Abwurf der Phosphorbomben auf Sarajevo herabgeregnet war.
»Aber Amitai, wo ist es die letzten vier Jahre gewesen? Wie ist es aufgetaucht?«
»Du weißt doch, dass Pessach ist, oder?«
Das wusste ich in der Tat; mich plagten noch die Überreste eines Rotweinkaters von dem ausgelassenen, höchst unorthodoxen Pessach-Picknick, das einer meiner Freunde am Strand veranstaltet hatte. Die dazugehörige rituelle Mahlzeit heißt seder, was auf Hebräisch »Ordnung« bedeutet, aber diese Nacht war eine der ungeordnetsten meiner jüngeren Vergangenheit gewesen.
»Also, gestern Abend feierte die jüdische Gemeinde von Sarajevo ihren Seder, und mittendrin wurde – sehr dramatisch – die Haggadah präsentiert. Der Leiter der Gemeinde sagte in seiner Ansprache, das Überleben des Buches sei ein Symbol für das Überleben von Sarajevos multiethnischen Idealen. Und weißt du, wer es gerettet hat? Ozren Karaman heißt er, und er ist Leiter der Museumsbibliothek. Trotz des heftigen Artilleriebeschusses hat er sich reingetraut.« Amitais Stimme zitterte vor Rührung. »Kannst du dir das vorstellen, Channa? Einen Muslim, der für ein jüdisches Buch seinen Kopf riskiert?«
Es sah Amitai nicht ähnlich, sich von Geschichten über tollkühne Taten beeindrucken zu lassen. Ein indiskreter Kollege hatte einmal angedeutet, dass Amitai seinen Wehrdienst in einem Kommandotrupp geleistet hatte, der so supergeheim ist, dass Israelis ihn nur als »die Einheit« bezeichnen. Obwohl das lange vorbei war, als wir uns kennen lernten, fielen mir damals schon sein außergewöhnlicher Körperbau und sein Auftreten auf. Er besaß die kompakte Muskulatur eines Gewichthebers und eine Art Hyper-Wachsamkeit. Wenn er mit mir sprach, schaute er mich direkt an, aber dazwischen schienen seine Blicke die Umgebung abzusuchen und alles und jeden zu speichern. Er hatte richtig verärgert gewirkt, als ich ihn auf die »Einheit« angesprochen hatte. »Von mir weißt du nichts«, fauchte er. Ich fand es trotzdem erstaunlich. Schließlich spricht man nicht oft mit Angehörigen von Sonderkommandos über Bücher.
»Und was hat der Typ dann mit dem Buch gemacht?«, fragte ich.
»Er hat es in ein Schließfach im Tresor der Zentralbank gesteckt. Du kannst dir ja vorstellen, wie das Pergament dabei gelitten hat … in Sarajevo konnte die letzten beiden Winter nicht geheizt werden … und dann so eine Metallkassette … ausgerechnet Metall … es liegt immer noch da drin … ich darf gar nicht darüber nachdenken. Jedenfalls will die UNO, dass jemand seinen Zustand überprüft. Sie zahlen für etwaige restaurative Maßnahmen – sie wollen das Buch so bald wie möglich ausstellen, um die Stimmung in der Stadt zu verbessern, weißt du. Und als ich in dem Programm der Konferenz, die im nächsten Monat in der Tate stattfindet, deinen Namen sah, dachte ich, wenn du sowieso auf diese Hälfte der Erdkugel kommst, könntest du vielleicht auch diesen Job erledigen.«
»Ich?«, quietschte ich. Falsche Bescheidenheit liegt mir nicht; ich leiste sehr gute Arbeit. Aber für solch einen Auftrag, einen Karriereschub, der einem vielleicht einmal im Leben widerfährt, gab es mindestens ein Dutzend Personen mit mehr Berufserfahrung und besseren Verbindungen in Europa.
»Warum nicht du?«, fragte ich.
Amitai wusste mehr über die Haggadah von Sarajevo als sonst jemand; er hatte Monografien darüber verfasst. Mir war klar, dass er nur zu gern die Gelegenheit gehabt hätte, mit dem Original zu arbeiten. Er seufzte tief. »Die Serben haben die letzten drei Jahre ständig behauptet, die Bosnier seien fanatische Muslime, und irgendwann haben die Bosnier angefangen, ihnen zu glauben. Sieht so aus, als wären die Saudis dort jetzt die großen Mäzene, deshalb war man dagegen, den Job einem Israeli zu geben.«
»O Amitai, das tut mir leid …«
»Ist schon in Ordnung, Channa. Ich bin in guter Gesellschaft. Einen Deutschen wollten sie auch nicht. Natürlich habe ich als ersten – sei mir nicht böse – Werner vorgeschlagen …« Herr Dr. Dr. Werner Maria Heinrich war nicht nur mein Lehrer, sondern nach Amitai der führende Spezialist auf dem Gebiet hebräischer Handschriften, deshalb konnte ich kaum gekränkt sein. Amitai erklärte mir, dass die Bosnier nach wie vor einen Groll gegen Deutschland hegten, das den Krieg durch die Anerkennung von Slowenien und Kroatien ausgelöst habe.
»Und die UNO will keinen Amerikaner, weil der US-Kongress die UNESCO immer schlecht macht. Also dachte ich, du wärst genau die Richtige, denn wer hat schon was gegen Australier? Außerdem habe ich ihnen gesagt, dass du handwerklich gar nicht schlecht bist.«
»Danke für das tolle Kompliment«, sagte ich. Und dann, weniger scherzhaft: »Amitai, das vergesse ich dir nie. Vielen Dank.«
»Du kannst es mir vergelten, indem du eine erstklassige Dokumentation des Buches vorlegst, damit wir wenigstens ein schönes Faksimile drucken können. Schick mir doch so bald wie möglich die Aufnahmen, die du machst, und einen Entwurf deines Berichts, ja?«
Seine Stimme klang so wehmütig, dass ich mich meiner eigenen Freude wegen schuldig fühlte. Aber ich musste ihm noch eine Frage stellen.
»Amitai, gibt es Zweifel an der Echtheit? Du kennst ja die Gerüchte, dass während des Krieges …«
»Nein, da haben wir keine Sorge. Der Bibliothekar Karaman und sein Chef, der Direktor des Museums, haben die Echtheit zweifelsfrei bestätigt. Deine Aufgabe ist so gesehen rein technisch.«
Technisch. Das werden wir noch sehen, dachte ich. Vieles von dem, was ich tue, ist Technik: Wissenschaft und Handwerk, die jeder einigermaßen intelligente und mit guter Feinmotorik ausgestattete Mensch erlernen kann. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu, eine Art Gespür für die Vergangenheit. Indem ich Forschung mit Vorstellungskraft verbinde, gelingt es mir manchmal, mich in die Leute hineinversetzen, die das Buch geschrieben haben. Ich finde heraus, wer sie waren, wie sie arbeiteten. So füge ich dem Sandkasten menschlichen Wissens meine paar Körnchen hinzu. Das liebe ich am meisten an dem, was ich tue. Die Haggadah von Sarajevo warf so viele Fragen auf. Wenn ich nur eine davon beantworten könnte …
Ich konnte nicht wieder einschlafen, deshalb zog ich meinen Jogginganzug über und ging durch die nächtlichen Straßen, die immer noch schwach nach erbrochenem Bier und Friteusenfett stanken, hinunter zum Strand, wo die Luft klar und salzig über einem Ozean weht, der sich über den halben Planeten erstreckt. Weil es Herbst war und mitten in der Woche, war kaum jemand draußen, nur ein paar Betrunkene, die an der Mauer des Surfclubs lehnten, und ein Liebespaar, das ineinander verschlungen auf einem Badelaken lag. Keiner bemerkte mich. Ich ging an dem Gischtrand entlang, der sich leuchtend von der lackschwarzen Dunkelheit des Sandes abhob. Ehe ich es mich versah, rannte und hüpfte ich, wich wie ein Kind den riesigen Wellen aus.
Das war vor einer Woche gewesen. In den Tagen darauf war meine Hochstimmung allmählich unter Visaanträgen, Bestellungen für Flugtickets, Bergen von rotem UNO-Klebeband und jeder Menge Nervenkrieg begraben worden. Als ich unter der Last meines Koffers die Treppe vom Flugzeug auf die Landebahn hinabtaumelte, musste ich mir erst wieder ins Gedächtnis rufen, dass dies genau die Art von Auftrag war, für die ich lebte.
Mir blieb kaum eine Sekunde, um die Berge auf mich wirken zu lassen, die rings um uns aufragten wie der Rand einer riesigen Schüssel, da sprang schon ein blau behelmter Soldat – hoch gewachsen und skandinavisch aussehend – aus dem mittleren der bereit stehenden Fahrzeuge, ergriff meinen Koffer und warf ihn hinten in den Wagen.
»Vorsicht!«, sagte ich. »Da sind zerbrechliche Instrumente drin!« Die einzige Reaktion des Soldaten bestand darin, mich am Arm zu packen und auf die Rückbank zu schleudern, die Tür zuzuknallen und auf den Beifahrersitz zu springen. Die automatische Türverriegelung rastete mit deutlich vernehmbarem Klicken ein, und der Chauffeur gab Gas.
»Das ist mein erstes Mal«, sagte ich mit gespielter Leichtfertigkeit. »Buchkonservatoren fahren nicht oft in gepanzerten Wagen.« Keine Reaktion, weder von Seiten des Soldaten noch des dünnen Zivilisten, der sich über das Lenkrad des gewaltigen Fahrzeugs beugte, den Kopf eingezogen wie eine Schildkröte. Hinter den getönten Scheiben sausten verschwommen die mit Granateinschüssen übersäten Gebäude der verwüsteten Stadt vorbei. Die Wagen manövrierten rasant um tiefe, von Mörsern erzeugte Schlaglöcher und holperten über den von Panzerketten zerfetzten Asphalt. Es war nicht viel Verkehr. Die meisten Leute waren zu Fuß unterwegs, ausgezehrte, erschöpft wirkende Gestalten, die Mäntel fest um sich geschlungen gegen die Kälte eines Frühlings, der noch nicht angebrochen war. Wir kamen an einem Wohnblock vorbei, der aussah wie das Puppenhaus, das ich als Mädchen gehabt hatte; die gesamte Fassade fehlte, sodass man in die Räume blicken konnte. Sie war von einer Explosion weggerissen worden, aber wie in meinem Puppenhaus waren die frei einsehbaren Zimmer möbliert. Als wir vorüberrasten, erkannte ich, dass dort noch immer Menschen lebten, deren einziger Schutz ein paar Plastikplanen waren, die sich im Wind blähten. Trotzdem hatten sie ihre Wäsche gewaschen. Sie flatterte an Leinen, gespannt zwischen dem verbogenen Stahl, der aus den Betontrümmern ragte.
Ich dachte, sie würden mich gleich zu dem Buch bringen. Stattdessen verging der Tag mit endlosen, ermüdenden Treffen, zuerst mit jedem einzelnen UN-Mitarbeiter, der sich jemals mit Kultur beschäftigt hatte, dann mit dem Direktor des bosnischen Museums und dann mit einer Gruppe von Regierungsbeamten. Ich bezweifle, dass ich aufgrund meiner Vorfreude auf die Arbeit ohnehin hätte schlafen können, doch die zehn Tassen starken türkischen Kaffees, die mir im Laufe des Tages serviert wurden, waren jedenfalls nicht hilfreich. Vielleicht zitterten meine Hände deswegen immer noch.
Aus den Polizeifunkgeräten ertönte lautes Knistern. Plötzlich waren alle auf den Beinen, die Polizisten, die Wachen, Sajjan. Der Bankangestellte entriegelte die Tür, und viele weitere Wachleute kamen in einer Art Zugvogelformation hereingeschwärmt. In der Mitte stand ein magerer junger Mann in verblichenen Bluejeans, wahrscheinlich der Bummelant aus dem Museum, der uns alle hatte warten lassen. Doch ich hatte keine Zeit, mich über ihn zu ärgern, denn er hielt einen Metallkasten in den Händen. Als er ihn auf den Tisch stellte, sah ich, dass er an mehreren Stellen mit Wachsstempeln und Klebeband versiegelt war. Ich gab ihm mein Skalpell. Er erbrach die Siegel, öffnete den Deckel, holte das Buch heraus und schälte es aus etlichen Lagen Seidenpapier. Und dann reichte er es mir.
II
So oft ich auch schon mit seltenen, schönen Dingen zu tun hatte – das Gefühl der ersten Berührung ist immer noch eine besonders eindringliche Erfahrung, eine Kombination aus Stromschlag und dem Streicheln des Hinterkopfs eines Neugeborenen.
Seit einem Jahrhundert hatte kein Konservator dieses Manuskript angefasst. Die Styroporformen standen bereit. Ich zögerte eine Sekunde – ein hebräisches Buch, also gehörte der Rücken nach rechts – und legte es darauf.
Solange man es nicht aufschlug, forderte das Manuskript ein ungeschultes Auge zu keinem zweiten Blick heraus. Zunächst war es klein, passend für den Gebrauch am PessachFestmahlstisch. Der unauffällige Einband stammte aus dem
19. Jahrhundert und war fleckig und abgestoßen. Ein so prächtig illustrierter Kodex wie dieser hatte ursprünglich bestimmt eine kunstvoll gearbeitete Bindung gehabt. Man bereitet keinen Hummer Thermidor zu und serviert ihn dann auf einem Pappteller. Der Buchbinder hatte womöglich Blattgold und Silberprägung verwendet, vielleicht Intarsien aus Elfenbein oder Perlmutt. Diese Handschrift war in ihrem langen Leben aber wahrscheinlich oft neu gebunden worden, das letzte Mal, von dem wir mit Sicherheit wussten, in den 1890ern in Wien. Leider hatte der österreichische Buchbinder sie in diesem Fall fürchterlich misshandelt, das Pergament stark beschnitten und den alten Einband ganz entfernt – etwas, was heutzutage niemand, vor allem kein Profi, der für ein großes Museum arbeitet, mehr tun würde. Unmöglich zu sagen, welche Informationen dadurch verloren gegangen waren. Er hatte das Manuskript in simple Pappdeckel gebunden, bedruckt mit einem unpassenden türkischen Blumenmuster, das mittlerweile ausgeblichen und verfärbt war. Nur die Ecken und der Rücken bestanden aus Kalbsleder, und das war dunkelbraun und abgeschabt, sodass der Rand der grauen Pappe darunter sichtbar wurde.
Ich strich mit dem Mittelfinger leicht über die rissigen Ecken. Die würde ich in den nächsten Tagen verstärken. Als mein Finger der Pappkante folgte, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches. Der Buchbinder hatte zwei Rillen und einige kleine Löcher in den Rand gestanzt, in die sich ein Paar Schließen hätten fügen lassen. Es waren aber keine Schließen vorhanden. Ich machte mir im Geiste eine Notiz, der Sache nachzugehen.
Nachdem ich die Formen so verschoben hatte, dass sie den Buchrücken stützten, klappte ich den Einband auf und beugte mich weit vor, um die eingerissenen Vorsatzblätter zu untersuchen. Ich würde sie mit Weizenkleister und Stücken passenden Leinenpapiers reparieren. Ich entdeckte sofort, dass die Leinenfäden, die der Wiener Buchbinder verwendet hatte, ausgefranst waren und kaum noch hielten. Das bedeutete, dass ich die Bögen würde auseinander nehmen und neu heften müssen. Ich atmete tief ein und blätterte die Seite zu der eigentlichen Handschrift um. Auf sie kam es an; sie würde zeigen, was vier harte Jahre ihr, die fünf Jahrhunderte überlebt hatte, angetan hatten.
Im Licht des Schnees flammten Farben auf. Blau: intensiv wie das eines Hochsommerhimmels, gewonnen durch das Zermahlen des kostbaren Lapislazuli, der von den Bergen Afghanistans mit einer Kamelkarawane nach Europa getragen worden war. Weiß: pur, sahnig, opak. Weniger strahlend und komplexer als das Blau. Damals wurde es sicher noch nach der Methode hergestellt, die die alten Ägypter erfunden hatten. Man bedeckt Bleistangen mit dem Bodensatz abgestandenen Weins und schließt sie in einen Schuppen voller Tierkot. Ich hatte das im Gewächshaus meiner Mutter in Bellevue Hill schon selbst ausprobiert. Sie hatte eine große Lieferung Dünger erhalten, und ich konnte nicht widerstehen. Die Säure in dem zu Essig vergorenen Wein wandelt das Blei in Bleiacetat um, das sich seinerseits mit dem von dem Dung freigesetzten Kohlendioxid zu weißem Bleikarbonat verbindet, PbCO3. Meine Mutter kriegte natürlich einen Anfall und konnte sich ihren preisgekrönten Orchideen wochenlang nicht mehr nähern.
Ich blätterte um. Wieder blendender Glanz. Die Illuminationen waren wunderschön, doch ich erlaubte mir nicht, sie als Kunstwerke zu sehen. Noch nicht. Zunächst musste ich ihre Chemie verstehen. Da war Gelb, hergestellt aus Safran. Diese prächtige Herbstblume, crocus sativus linnaeus, bei der jede Blüte nur drei winzige Stempelfäden enthält, galt damals und für sehr lange Zeit als kostbares Luxusgut, und obwohl wir heute wissen, dass die satte Farbe von einem Karotin stammt, dem Crocin, dessen Moleküle aus 44 Kohlenstoff-, 64 Wasserstoff- und 24 Sauerstoffatomen bestehen, können wir nach wie vor keinen gleichwertigen synthetischen Ersatz herstellen. Da waren Malachitgrün und Rot, jenes intensive so genannte »Wurmrot« – tola’at schani auf Hebräisch –, gewonnen aus auf Bäumen lebenden Schildläusen, die zerquetscht und in Lauge ausgekocht wurden. Später, als Alchimisten lernten, ein ähnliches Rot aus Schwefel und Quecksilber zu erzeugen, nannten sie die Farbe immer noch »kleiner Wurm« – vermiculum. Manche Dinge ändern sich nicht: auf Englisch heißt sie noch heute »vermilion«.
Veränderung. Sie ist der große Feind. Büchern ergeht es am besten, wenn Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die ganze Umgebung beständig bleiben. Drastischere Veränderungen als diese kann ein Manuskript kaum erleben: umgelagert unter extremen Bedingungen und ohne Vorbereitung oder Vorsichtsmaßnahmen, enormen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Ich hatte Angst gehabt, die Seiten könnten geschrumpft, die Pigmente abgeplatzt sein. Aber die Farben waren erhalten, so rein und lebhaft wie an dem Tag, an dem sie aufgetragen worden waren. Im Unterschied zu dem Blattgold auf dem Buchrücken, das abgeflockt war, wirkte das Gold der Abbildungen frisch und leuchtend. Der Mann, der sie vor fünfhundert Jahren gemalt hatte, hatte sein Handwerk definitiv besser beherrscht als der neuzeitliche Wiener Buchbinder. Auch Blattsilber entdeckte ich, allerdings grau und oxydiert, wie zu erwarten gewesen war.
»Werden Sie das ausbessern?« Es war der dünne junge Mann aus dem Museum, der auf eine deutlich verfärbte Stelle zeigte. Er stand zu nahe daran. Da Pergament Fleisch ist, können menschliche Bakterien es beschädigen. Ich verlagerte meine Schulter so, dass er seine Hand zurückziehen und einen Schritt nach hinten treten musste.
»Nein«, sagte ich. »Auf keinen Fall.« Ich schaute nicht auf.
»Aber Sie sind doch Restauratorin; ich dachte …«
»Konservatorin«, berichtigte ich ihn. Das Letzte, was ich mir in diesem Moment wünschte, war eine lange Diskussion über die Philosophie der Buchkonservierung. »Sehen Sie«, sagte ich, »Sie sind hier anwesend; mir wurde erklärt, dass das notwendig ist, aber es wäre mir lieb, wenn Sie mich bei der Arbeit nicht unterbrechen.«
»Ich verstehe«, begegnete er meiner Schroffheit mit sanfter Stimme. »Aber Sie müssen mich auch verstehen: Ich bin der Kustos, verantwortlich für dieses Buch.«
Kustos. Es dauerte eine Minute, ehe ich begriff. Dann drehte ich mich um und starrte ihn an. »Sie können doch nicht Ozren Karaman sein, der das Buch gerettet hat?«
Sajjan, der UNO-Vertreter, sprang auf. »Entschuldigung, ich hätte Sie einander vorstellen müssen. Aber Sie waren so erpicht darauf, mit der Arbeit anzufangen, dass ich – Dr. Hanna Heath, darf ich Ihnen Dr. Ozren Karaman vorstellen, Chefbibliothekar des Nationalmuseums und Professor für Bibliothekswissenschaft an der Nationaluniversität von Bosnien.«
»Ich – tut mir leid, das war unhöflich von mir«, sagte ich.
»Ich hatte gedacht, als Kurator einer so bedeutenden Sammlung wären Sie viel älter.« Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ein Mensch in seiner Position ganz so leger gekleidet war. Er trug eine abgewetzte Lederjacke über einem zerknitterten weißen T-Shirt. Seine Jeans waren ausgefranst. Sein Haar – wilde Locken, weder gekämmt noch zurechtgestutzt – fiel ihm über eine Brille, die über der Nase mit Klebeband repariert war.
Er zog eine Augenbraue hoch. »In Ihrem fortgeschrittenen Alter haben Sie natürlich allen Grund, das anzunehmen.« Seine Miene blieb dabei völlig ernst. Er war wohl genau wie ich erst Anfang dreißig. »Ich würde mich aber sehr freuen, Dr. Heath, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, mir zu erklären, was Sie vorhaben.« Er warf Sajjan einen Blick zu, als er das sagte, und der sprach Bände. Die UNO war der Meinung, sie täte Bosnien einen Gefallen damit, diese Arbeit zu finanzieren, damit die Haggadah angemessen präsentiert werden konnte.
Wenn es jedoch um nationale Schätze geht, will keiner, dass Außenstehende das Sagen haben. Ozren Karaman fühlte sich eindeutig übergangen. In diese Sache wollte ich mich keinesfalls hineinziehen lassen. Ich war hier, um mich um ein Buch zu kümmern, nicht um das verletzte Ego eines Bibliothekars. Trotzdem hatte er ein Recht darauf zu erfahren, warum die UNO jemanden wie mich ausgesucht hatte.
»Den Umfang meiner Arbeit kann ich erst abschätzen, wenn ich das Manuskript gründlich durchgesehen habe, aber die Sache ist folgende: Ich werde weder chemikalische Ausbesserungen noch eine umfassende Restauration vornehmen. Ich habe zu viele Artikel geschrieben, die diesen Ansatz kritisieren. Ein Buch in den Zustand zurückzuversetzen, in dem es bei seiner Entstehung war, bedeutet mangelnden Respekt vor seiner Geschichte. Ich finde, man muss es so akzeptieren, wie es einem von früheren Generationen überliefert wurde, weil Beschädigungen und Gebrauchsspuren diese Geschichte gewissermaßen widerspiegeln. Ich sehe meine Aufgabe darin, es so zu stabilisieren, dass man es gefahrlos anfassen und studieren kann, und nur zu reparieren, wenn es unbedingt notwendig ist. Das hier zum Beispiel«, sagte ich und zeigte auf eine Seite, wo ein rostbrauner Fleck sich wie eine Blüte über die glutrote hebräische Kalligrafie breitete. »Von diesen Fasern kann ich eine Probe fürs Mikroskop entnehmen, und wir können sie analysieren und vielleicht erfahren, was den Fleck verursacht hat, und dann vielleicht besser darauf schließen, wo sich das Buch zu der Zeit befand. Und wenn uns das jetzt nicht gelingt, dann womöglich einem künftigen Kollegen in fünfzig oder hundert Jahren, wenn die Labortechniken weiter fortgeschritten sind. Wenn ich diesen Fleck – diese so genannte ›Beschädigung‹ – dagegen chemisch beseitige, ist diese Chance auf ewig vertan.« Ich holte tief Luft.
Ozren Karaman schaute mich belustigt an. Ich war plötzlich verlegen. »Entschuldigung, das alles wissen Sie natürlich. Aber für mich ist es eine Art Obsession, und wenn ich erst mal loslege …« Ich machte es nur noch schlimmer, also hielt ich inne.
Dann sagte ich: »Die Sache ist bloß, dass ich das Manuskript nur für eine Woche zur Verfügung habe, daher brauche ich wirklich jede Minute. Ich würde gern anfangen … Bis heute Abend um sechs kann ich es haben, oder?«
»Nein, nicht ganz. Ich muss es Ihnen ungefähr zehn Minuten vorher wegnehmen, damit ich es noch vor dem Wachwechsel in der Bank wieder sicher verwahren kann.«
»In Ordnung«, sagte ich, zog meinen Stuhl nach vorn und wandte mich an das andere Ende des langen Tisches, wo die Sicherheitsbeamten saßen. »Können wir uns die nicht vom Hals schaffen?«
Karaman schüttelte seinen unfrisierten Kopf. »Ich fürchte, sie werden alle hierbleiben.«
Ich konnte nicht verhindern, dass mir ein Seufzer entfuhr. Meine Arbeit hat mit Gegenständen zu tun, nicht mit Menschen. Ich mag Stoffliches, Gewebe, das Wesen der unterschiedlichen Materialien, aus denen ein Buch besteht. Ich kenne die Beschaffenheit und die Bestandteile seiner Seiten, das Leuchten und die tödlichen Gifte uralter Pigmente. Weizenkleister – mit Weizenkleister kann ich jeden zu Tode langweilen. Ich habe sechs Monate in Japan verbracht und dort gelernt, wie man ihn anmischt, um die richtige Spannung zu erzielen.
Pergament liebe ich besonders. Es ist so haltbar, dass es Jahrhunderte überstehen kann, so empfindlich, dass ein Moment der Achtlosigkeit reicht, um es zu zerstören. Einer der Gründe dafür, mich mit diesem Auftrag zu betrauen, war sicherlich der, dass ich so viele Artikel über Pergament veröffentlicht habe. Ich erkannte allein an der Größe und Verteilung der Poren, die auf den Seiten sichtbar wurden, dass sie aus der Haut einer inzwischen ausgestorbenen, dicht behaarten spanischen Schafsrasse hergestellt waren. Handschriften, die aus den Königreichen Aragonien und Kastilien stammen, kann man bis auf etwa hundert Jahre genau datieren, wenn man weiß, wann diese spezielle Rasse bei den dortigen Pergamentmachern in Mode war.
Pergament ist eigentlich Leder, das jedoch anders aussieht und sich anders anfühlt, weil sich die Fasern der Haut durch das Strecken neu anordnen. Wird es nass, verwandeln sie sich jedoch in ihr ursprüngliches, dreidimensionales Geflecht zurück. Ich hatte mir Sorgen gemacht wegen eventueller Kondensation in der Metallkassette oder Einwirkungen der Elemente beim Transport, aber für beides gab es so gut wie keine Anzeichen. Einige Seiten zeigten allerdings Spuren von älteren Wasserschäden; unter dem Mikroskop sah ich eine Kruste aus würfelförmigen Kristallen, die ich erkannte: NaCl, auch bekannt als gutes altes Tafelsalz. Wahrscheinlich handelte es sich hier um das am Sedertisch benutzte Salzwasser, das die Tränen der Sklaven in Ägypten repräsentieren soll.
Natürlich ist ein Buch mehr als die Summe seiner materiellen Bestandteile, nämlich eine Schöpfung des menschlichen Geistes und der menschlichen Hand. Die Goldschläger, die Steinschleifer, die Schreiber, die Buchbinder, sie sind mir die Liebsten. Manchmal sprechen sie in der Stille zu mir. Sie lassen mich wissen, was sie antrieb, und das hilft mir bei meiner Arbeit. Ich hatte Angst, dass der Kustos mit seinen wohlmeinend forschenden Blicken oder die Polizisten mit dem leisen Gebrabbel aus ihren Funkgeräten meine freundlichen Geister fernhalten würden. Denn ich brauchte ihre Unterstützung. Es gab so viele Fragen.
Auf den ersten Blick sehen die meisten dieser Bücher, reich ausgestattet mit kostbaren Farben, aus, als wären sie für Paläste oder Tempel gemacht worden. Eine Haggadah aber dient nur dem häuslichen Gebrauch. Das Wort entstand der hebräischen Wortwurzel hgd, nämlich »erzählen«, und ist dem biblischen Gebot entnommen, das Eltern anweist, ihren Kindern die Geschichte des Auszugs aus Ägypten zu vermitteln. Die
»Erzählung« existiert in sehr unterschiedlichen Versionen, und im Laufe der Jahrhunderte hat jede jüdische Gemeinde auch eigene Varianten dieses im häuslichen Kreise begangenen Festes entwickelt.
Niemand wusste jedoch, warum die Haggadah von Sarajevo so üppig mit Miniaturen bebildert worden war, und das zu einer Zeit, in der figurative Kunst den meisten Juden als Verletzung der heiligen Gebote galt. Es war unwahrscheinlich, dass ein Jude damals die ausgefeilten Maltechniken hätte lernen können, wie sie in der Haggadah zu bewundern sind. Der Stil ist dem christlicher Illustratoren nicht unähnlich. Und doch zeigen die Miniaturen überwiegend biblische Szenen, wie sie vom Midrasch, der jüdischen Bibelexegese, ausgelegt werden. Ich blätterte um und erblickte diejenige Abbildung, die bei den Gelehrten mehr Spekulationen hervorgerufen hatte als alle anderen. Es war eine häusliche Szene. Eine jüdische Familie – Spanier, ihrer Kleidung nach zu urteilen – sitzt am Sedertisch. Wir sehen die rituellen Speisen, die Matze, die an das ungesäuerte Brot erinnert, das die Hebräer in der Nacht vor ihrer Flucht aus Ägypten in aller Eile backten, den Lammknochen, der die Opferung eines Pessachlamms im Jerusalemer Tempel symbolisiert. Der Vater, in fast liegender Haltung, um zu verdeutlichen, dass er ein freier Mann und kein Sklave ist, trinkt Wein aus einem goldenen Kelch, während sein kleiner Sohn neben ihm einen Becher hebt. Die Mutter sitzt gelassen im Festtagskleid und mit juwelengeschmücktem Kopfputz da. Doch es befindet sich noch eine weitere Frau am Tisch, mit ebenholzschwarzer Haut und im gelben Gewand, die ein Stück Matze in der Hand hält. Die Identität dieser an dem jüdischen Ritus teilnehmenden Afrikanerin in Safran, zu schön gekleidet, um eine Dienerin zu sein, gibt den Wissenschaftlern seit hundert Jahren Rätsel auf.
Langsam und sorgfältig untersuchte ich den Zustand jeder einzelnen Seite und machte mir Notizen dazu. Jedes Mal, wenn ich umblätterte, prüfte und justierte ich die Position der Haltevorrichtungen. Nie ein Buch strapazieren – das oberste Gebot des Konservators. Die Menschen dagegen, die im Besitz dieses Manuskripts gewesen waren, hatten unerträgliche Strapazen durchlitten: Pogrom, Inquisition, Exil, Genozid, Krieg.
Als ich am Ende des hebräischen Textes angelangt war, stieß ich auf eine Zeile in einer anderen Sprache, einer anderen Handschrift: Revisto per mi. Gio. Domenico Vistorini, 1609. Die italienischen Wörter, geschrieben in venezianischer Mundart, hießen übersetzt: »Begutachtet von mir.« Wären diese drei Wörter nicht gewesen, unterzeichnet von einem offiziellen Zensor der päpstlichen Inquisition, wäre das Buch damals vielleicht in Venedig zerstört worden und hätte nie seinen Weg über die Adria in den Balkan gefunden.
»Warum hast du es gerettet, Giovanni?«
Stirnrunzelnd schaute ich auf. Dr. Karaman, der Bibliothekar, stand vor mir. Er zuckte kaum merklich entschuldigend die Achseln. Vermutlich dachte er, ich ärgerte mich über die Störung, aber in Wahrheit war ich erstaunt darüber, dass er genau die Frage formulierte, die ich mir im Geiste gestellt hatte. Niemand kannte die Antwort, ebenso wenig wie man wusste, wie oder warum – oder auch nur wann – das Buch nach Sarajevo gelangt war. Ein Schriftstück von 1894 besagte, dass ein Mann namens Kohen es der Bibliothek verkauft hatte, doch es war niemandem eingefallen, ihn nach seinen Gründen zu befragen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem zwei Drittel der Juden in Sarajevo abgeschlachtet und die jüdischen Viertel der Stadt geplündert worden waren, gab es hier keine Kohens mehr, an die man sich hätte wenden können. Auch damals hatte ein muslimischer Bibliothekar das Buch gerettet, aber die Einzelheiten seiner Tat waren spärlich und widersprüchlich überliefert.
Als ich die Notizen zu meiner ersten Untersuchung vervollständigt hatte, baute ich eine 8x10-Kamera auf und begann wieder von vorn, indem ich jede einzelne Seite fotografierte, um den Zustand des Buches genau zu dokumentieren, ehe ich mich an die Konservierung machte. Wenn ich diese abgeschlossen hatte, würde ich die Seiten noch einmal fotografieren und den Film nach Jerusalem an Amitai schicken. Er würde dann die Anfertigung hochwertiger Abzüge für die Museen der Welt und den Druck eines Faksimile-Bandes veranlassen, an dem sich auch jeder Normalbürger erfreuen konnte. Normalerweise überlässt man das Fotografieren einem Spezialisten, aber die UNO wollte nicht noch einmal nach einem Experten suchen,der die Zustimmung aller städtischen Behörden fand, deshalb hatte ich eingewilligt, es zu übernehmen.
Ich ließ meine Schultern kreisen und griff nach meinem Skalpell. So saß ich da, das Kinn auf die eine Hand gestützt, die andere über dem Einband verharrend, ein Moment des Selbstzweifels, wie immer, bevor ich anfange. Der blanke Stahl glitzerte in dem hellen Licht und erinnerte mich an meine Mutter. Wenn sie zögerte, würde ihr Patient auf dem Tisch verbluten, doch meiner Mutter – die erste Frau in der Geschichte Australiens, die eine neurochirurgische Abteilung leitet – sind Selbstzweifel fremd. Sie hat nie an ihrem Recht gezweifelt, mit jeder Konvention ihrer Zeit zu brechen, ein Kind auf die Welt zu bringen, ohne zu heiraten oder auch nur den Namen des Vaters preiszugeben. Bis zum heutigen Tage habe ich keine Ahnung, wer er war. Jemand, den sie geliebt oder den sie nur benutzt hat? Letzteres ist wahrscheinlicher. Sie hatte geglaubt, sie könne mich zu ihrem Ebenbild erziehen. Was für ein Witz. Sie ist blond und dauergebräunt vom Tennisspielen, ich bin dunkelhaarig und blass wie ein Gespenst. Sie schwärmt für Champagner. Ich ziehe Bier vor, direkt aus der Dose.
Ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass sie meine Entscheidung, Bücher statt Menschen zu reparieren, nie respektieren würde. Für sie hätten meine Einser-Collegeabschlüsse in Chemie und alten Sprachen des Nahen Ostens ebenso gut gebrauchte Papiertaschentücher sein können. Auch ein Diplom in Chemie und ein Doktor in Konservierung und Restauration von Kunstwerken halfen nicht. »Kinderkram« nennt sie meine Papiere, die Pigmente und den Kleister. »Jetzt hättest du dein praktisches Jahr hinter dir«, sagte sie, als ich aus Japan zurückkam. »In deinem Alter war ich schon Oberärztin«, war alles, was ich zu hören kriegte, als ich aus Harvard heimkehrte.
Manchmal fühle ich mich wie eine Figur in einer der persischen Miniaturen, die ich konserviere, eine winzige Person, ständig beobachtet von reglosen Gesichtern, die von hohen Galerien herabschauen oder hinter durchbrochenen Stellwänden hervorspähen. In meinem Fall jedoch tragen die Gesichter stets dieselben Züge, die meiner Mutter mit ihren geschürzten Lippen und dem missbilligenden Blick.
Hier war ich also, dreißig Jahre alt, und immer noch hatte sie die Macht, sich zwischen mich und meine Arbeit zu drängen. Dieses Gefühl, dass sie mich ungeduldig und tadelnd beobachtete, weckte mich schließlich aus meiner Starre. Ich schob das Skalpell unter den Heftfaden, und die kostbaren Folioblätter des Kodex lösten sich voneinander. Ich hob das erste an. Ein Stäubchen flatterte aus der Bindung. Vorsichtig übertrug ich es mit einem Zobelpinsel auf einen Objektträger und legte es unter das Mikroskop. Heureka! Es war das winzige Fragment eines Insektenflügels, durchscheinend, geädert. Unsere Welt ist voll von Gliederfüßern, und vielleicht stammte der Flügel von einem ganz gewöhnlichen Insekt und würde uns gar nichts verraten. Vielleicht war es aber auch eine ganz seltene Art, die nur in einem begrenzten geografischen Gebiet existierte. Oder der Flügel gehörte einer inzwischen ausgestorbenen Spezies an. All das würde uns mehr Erkenntnisse über die Geschichte des Buches liefern. Ich steckte das Flügelstück in eine Pergamintüte und etikettierte sie mit einem Hinweis auf seinen Fundort.
Vor ein paar Jahren hatte ein von mir ebenfalls in einem Einband gefundener winziger Schnipsel eines Federkiels großen Aufruhr verursacht. Es handelte sich um eine sehr schöne kleine Sammlung kurzer Bittgebete an verschiedene Heilige, angeblich Teil eines verschollenen Stundenbuchs. Es gehörte einem einflussreichen Franzosen, der mit dem Getty-Museum über die Zahlung einer beträchtlichen Summe verhandelte. Er besaß weit zurückreichende Herkunftsnachweise, die es dem so genannten Bedford-Meister zuschrieben, der um 1425 in Paris gemalt hatte. Irgendetwas daran gefiel mir jedoch nicht. Normalerweise verrät einem ein Federkielschnipsel nicht viel. Man braucht keine exotische Feder, um einen Federkiel anzufertigen. Jede gute, kräftige Flügelfeder eines robusten Vogels reicht dafür aus. Ich muss immer lachen, wenn ich Schauspieler in historischen Filmen mit pompösen Straußenfedern vor sich hinkritzeln sehe. Erstens marschierten im mittelalterlichen Europa nicht allzu viele Strauße herum. Und zweitens entfernten die Hersteller von Schreibfedern die Befiederung, damit sie nicht bei der Arbeit störte. Jedenfalls bestand ich darauf, den Schnipsel von einem Ornithologen untersuchen zu lassen, und was kam dabei heraus? Die Feder stammte von einer Moschusente. Diese Enten sind heutzutage überall verbreitet, aber im 15. Jahrhundert beschränkte sich ihr Vorkommen auf Brasilien und Mexiko. In Europa wurden sie erst im frühen 17. Jahrhundert eingeführt. Es stellte sich heraus, dass der französische »Sammler« jahrelang selbst alte Handschriften gefälscht hatte.
Sanft hob ich das zweite Folioblatt der Haggadah an, zog den zerfransten Faden heraus, der es hielt, und bemerkte, dass sich ein feines weißes Haar, ungefähr einen Zentimeter lang, in ihm verfangen hatte. In der Vergrößerung sah ich, dass das Haar auf der Seite, wo die spanische Familie beim Seder abgebildet war, nahe der Bindung eine ganz leichte Kerbe hinterlassen hatte. Vorsichtig löste ich es mit einer Chirurgenpinzette heraus und steckte es in eine eigene Tüte.
Ich hätte keine Angst haben müssen, dass die anderen im Raum Anwesenden mich ablenken würden. Sie fielen mir gar nicht mehr auf. Leute kamen und gingen, und ich hob nicht einmal den Kopf. Erst als das Licht allmählich schwand, wurde mir klar, dass ich den ganzen Tag über ohne Pause gearbeitet hatte. Plötzlich fühlte ich mich steif vor Anspannung und hatte einen Mordshunger. Ich stand auf, und sofort war Karaman mit der unsäglichen Metallkassette an meiner Seite. Ich legte das Buch und die herausgetrennten Folioblätter behutsam hinein.
»Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen«, sagte ich.
»Metall ist ein viel zu starker Leiter für Hitze und Kälte.« Ich legte eine Glasscheibe auf das Manuskript und beschwerte sie mit kleinen Sandsäckchen aus Samt, um die Seiten zu glätten. Karaman fummelte mit Wachs, Stempeln und Schnüren herum, während ich meine Werkzeuge säuberte und ordnete.
»Wie gefällt Ihnen unser Schatz?«, fragte er, mit dem Kopf auf das Buch deutend.
»Bemerkenswert für sein Alter«, sagte ich. »Er hat keine offensichtlichen Beschädigungen aus jüngerer Zeit, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen wären. Ich werde ein paar Proben unter dem Mikroskop untersuchen und sehen, was sie uns verraten. Ansonsten geht es nur um Stabilisierung und die Reparatur des Einbands. Wie Sie wissen, stammt er aus dem späten 19. Jahrhundert und ist deshalb physisch und mechanisch entsprechend abgenutzt.«
Karaman lehnte sich auf die Kassette und presste den Bibliotheksstempel in das Wachs. Dann trat er beiseite, damit ein Bankangestellter dasselbe mit dem Stempel der Bank tun konnte. Das komplizierte Geflecht aus Schnüren und Wachssiegeln stellte sicher, dass jeder nicht autorisierte Zugriff auf den Inhalt der Kassette sofort auffallen würde.
»Ich habe gehört, Sie sind Australierin«, sagte Karaman. Ich unterdrückte ein Seufzen. Ich war immer noch erfüllt von meinem Arbeitstag und für Smalltalk nicht in Stimmung.
»Scheint mir eine seltsame Tätigkeit für jemanden aus einem so jungen Land, sich um die uralten Schätze anderer Völker zu kümmern.« Ich sagte nichts. Dann fügte er hinzu: »Sie hatten wohl Lust auf etwas Kultur, nachdem Sie dort aufgewachsen sind?«
Da ich vorhin unhöflich gewesen war, gab ich mir jetzt Mühe. Ein bisschen jedenfalls. Die Sache mit dem jungen Land und der kulturellen Wüste hängt mir zum Halse raus. Zufällig hat Australien die älteste kontinuierliche künstlerische Tradition auf der Welt – die Aborigines schufen auf den Wänden ihrer Behausungen raffinierte Kunstwerke, und das dreißigtausend Jahre, ehe die Menschen von Lascaux auch nur auf den Stielen ihrer ersten Malerpinsel herumkauten. Doch ich beschloss, ihm die vollständige Lektion zu ersparen. »Na ja«, sagte ich, »Sie sollten bedenken, dass die Einwanderer uns zum ethnisch vielfältigsten Land der Erde gemacht haben. Die Wurzeln von Australiern reichen sehr tief und sehr weit. Wir haben einen hohen Anteil am kulturellen Erbe der Menschheit. Einen höheren sogar, als Sie ihn haben.« Ich fügte nicht hinzu, dass die Jugoslawen in meiner Jugend den Ruf hatten, als einzige Immigrantengruppe ihre Streitigkeiten aus der Alten Welt mitgebracht zu haben. Alle anderen ergaben sich bald einer Art sonnentrunkener Apathie, Serben und Kroaten dagegen bekriegten sich noch ewig, indem sie sich gegenseitig Bomben in ihre Fußballvereinslokale warfen und sogar in entlegensten Käffern wie Coober Pedy aufeinander losgingen.
Er nahm die Spitze mit Anstand entgegen und lächelte mich über die Kassette hinweg an. Er hatte ein sehr schönes Lächeln, muss ich zugeben. Irgendwie zog er die Mundwinkel gleichzeitig nach unten und nach oben, wie eine Figur aus einem Charles-Schultz-Comic.
Die Wachen standen bereit, Karaman und das Buch zu begleiten. Ich folgte ihnen die langen, stuckverzierten Flure entlang, bis sie die Marmortreppe zu den Tresorräumen hinunterstiegen. Ich wartete darauf, dass mir jemand die Eingangstür aufschloss, als Karaman sich umdrehte und mich ansprach.
»Darf ich Sie vielleicht zum Abendessen einladen? Ich kenne ein Lokal in der Altstadt, das im letzten Monat wieder geöffnet hat. Um ganz ehrlich zu sein, für das Essen kann ich nicht garantieren, aber zumindest wird es bosnisch sein.«
Ich wollte schon ablehnen, mein üblicher Reflex in solchen Situationen. Doch dann dachte ich: Warum nicht? Besser als irgendein fades Steak mysteriöser Herkunft in meinem öden kleinen Hotelzimmer. Ich sagte mir, das gehöre schließlich zur Recherche. Ozren Karamans Rettungsaktion hatte ihn zum Teil der Geschichte dieser Haggadah gemacht, und ich wollte mehr darüber erfahren.
Während ich am Kopfende der Treppe auf ihn wartete, hörte ich das pneumatische Zischen der Tresortür und dann das Klirren der Metallriegel, die sie verschlossen. Es klang endgültig und beruhigend. Wenigstens das Buch war für heute Nacht in Sicherheit.
III
Wir traten hinaus auf die dunklen Straßen der Stadt, und ich erschauerte. Der meiste Schnee war tagsüber geschmolzen, doch jetzt sank die Temperatur wieder, und dicke Wolken verbargen den Mond. Keine der Straßenlaternen war an. Als mir klar wurde, dass Karaman zu Fuß in die Altstadt gehen wollte, kehrte das Gefühl, einen Stein im Bauch zu haben, zurück.
»Sind Sie sicher, dass das, äh, okay ist? Warum lassen wir uns nicht von meiner UNO-Eskorte chauffieren?«
Er zog eine Grimasse, als röche er etwas Unappetitliches.
»Die riesigen Panzer, die die fahren, passen nicht in die engen Gassen der Bascarsija«, meinte er. »Und es hat jetzt seit über einer Woche keine Angriffe aus dem Hinterhalt mehr gegeben.«
Na großartig. Ich überließ ihm die Auseinandersetzung mit den UNO-Wikingern in der Hoffnung, er würde sie nicht überreden können, mich ohne Eskorte gehen zu lassen. Leider war er ein sehr überzeugender Mensch – hartnäckig jedenfalls –, und so machten wir uns schließlich zu Fuß auf. Er eilte mit langen Schritten voran, und ich musste mich bemühen mitzuhalten. Im Gehen hielt er einen anti-touristischen Vortrag – eine Art Reiseführer durch die Hölle –, in dem er mir die Ruinen der Stadt beschrieb. »Das da ist der Präsidentensitz, Neorenaissance und das Lieblingsziel der Serben.« Ein paar Straßen weiter: »Das war mal das Olympische Museum. Und das da das Postamt. Das ist die Kathedrale. Neugotisch. Letztes Jahr zu Weihnachten fand dort eine Mitternachtsmesse statt, aber die wurde mittags abgehalten, weil nachts natürlich niemand auf die Straße ging, der kein Selbstmörder war. Links davon sind die Synagoge und die Moschee. Rechts die serbisch-orthodoxe Kirche. All diese Orte, die keiner von uns zum Beten aufsucht, nur hundert Meter voneinander entfernt.«
Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich empfinden würde, wenn Sydney plötzlich so verunstaltet, die Stätten meiner Kindheit beschädigt oder zerstört wären, wenn ich eines Tages aufwachen und sehen würde, dass die Einwohner von North Sydney auf der Harbour Bridge Barrikaden errichtet hätten und anfingen, die Oper zu beschießen.
»Vermutlich ist es immer noch so was wie ein Luxus, in der Stadt rumzuspazieren«, sagte ich, »wenn man vier Jahre lang vor Heckenschützen Angst haben musste.« Er lief vor mir her und blieb jetzt plötzlich stehen.
»Ja«, sagte er. »Allerdings.« Seine Stimme triefte vor Sarkasmus.
Die breiten Boulevards des östereichisch-ungarischen Sarajevo gingen allmählich in die schmalen Kopfsteinpflasterstraßen der ursprünglichen osmanischen Stadt über, wo man mit ausgebreiteten Armen beinahe die Gebäude links und rechts berühren konnte. Die Häuser waren klein, wie für Halblinge gebaut und so eng aneinandergedrängt, dass sie mich an beschwipste Freunde erinnerten, die sich auf dem Heimweg aus der Kneipe gegenseitig stützen. Große Teile dieses Viertels hatten sich außerhalb der Reichweite der serbischen Geschütze befunden, daher waren die Schäden hier viel weniger offenkundig als in den neueren Bezirken. Von einem Minarett rief der Muezzin die Gläubigen zum Abendgebet. Es war ein Ruf, den ich mit heißen Orten assoziierte – Kairo, Damaskus – und nicht mit einer Stadt, wo Frost unter den Füßen knirscht und sich zwischen der Kuppel der Moschee und ihrer steinernen Palisade Reste von ungeschmolzenem Schnee sammeln. Ich musste mir wieder ins Gedächtnis rufen, dass der Islam einst bis an die Tore Wiens vorgedrungen war, dass zur Zeit der Entstehung der Haggadah das riesige Reich der Muslime das helle Licht im Dunkel des Mittelalters gewesen war, der einzige Ort, wo noch Wissenschaft und Dichtkunst blühten und gediehen, wo Juden, von Christen gefoltert und ermordet, ein gewisses Maß an Frieden fanden.
Der Muezzin dieser kleinen Moschee war ein Greis, doch seine wunderschöne Stimme hallte kraftvoll durch die kalte Abendluft. Nur wenige andere alte Männer antworteten; sie schlurften durch den gepflasterten Innenhof und wuschen sich pflichtbewusst Hände und Gesicht in dem eisigen Wasser des Springbrunnens. Ich blieb einen Moment stehen, um ihnen zuzuschauen. Karaman stand vor mir, wandte sich jetzt aber um und folgte meinem Blick. »Da sind sie«, sagte er.
»Die wilden muslimischen Terroristen, die die Serben so fürchten.«
Das Restaurant, das er gewählt hatte, war warm und laut und erfüllt vom köstlichen Duft gegrillten Fleisches. Ein Foto neben der Tür zeigte den Besitzer, der in Militärkluft eine gewaltige Bazooka schwang. Ich bestellte Cevapcici, Karaman einen Weißkohlsalat und eine Joghurtspeise.
»Ganz schön spartanisch«, sagte ich.
Er lächelte. »Ich bin seit meiner Kindheit Vegetarier. Während der Belagerung war das nützlich, denn es gab kein Fleisch. Natürlich war das Gemüse, das man kriegte, meistens auch nur Gras. Grassuppe, das wurde meine Spezialität.« Er bestellte zwei Bier. »Bier war immer zu haben, sogar während der Belagerung. Die Brauerei war die einzige Einrichtung in der ganzen Stadt, die nicht dicht machte.«
»Aussies würde das gefallen«, sagte ich.
»Ich musste daran denken, was Sie vorhin sagten über die Menschen aus diesem Land, die nach Australien ausgewandert sind. Kurz vor dem Krieg gab es tatsächlich etliche Australier, die unsere Museumsbibliothek besuchten.«
»Ach ja?«, fragte ich geistesabwesend und nuckelte an meinem Bier, das leider etwas seifig schmeckte.
»Gut gekleidet, sprachen furchtbares Bosnisch. Dieselben Leute kamen auch aus den Vereinigten Staaten. Durchschnittlich fünf pro Tag, die sich für ihre Familiengeschichte interessierten. In der Bibliothek haben wir ihnen einen Spitznamen gegeben, nach diesem Schwarzen in der amerikanischen Fernsehserie – Kinta Kunte.«
»Kunta Kinte«, korrigierte ich.
»Genau; wir haben sie Kunta Kintes genannt, weil sie nach ihren Wurzeln suchten. Sie wollten immer die amtlichen Unterlagen von 1941 bis 45 einsehen. Aber nach Partisanen in ihrem Stammbaum suchten sie nie. Keiner wollte ein Nachkomme von Linken sein, nur von nationalistischen Fanatikern – Tschetniks, Ustaschi, den Mördern des Zweiten Weltkriegs. Man stelle sich vor, dass jemand mit solchen Menschen verwandt sein möchte. Ich wünschte, ich hätte damals schon gewusst, dass sie die Vorhut der Katastrophe waren. Aber wir wollten nicht glauben, dass sich so ein Wahnsinn jemals hier abspielen würde.«
»Irgendwie habe ich mich immer gewundert, dass man in Sarajevo so überrascht war über den Krieg«, sagte ich. Mir war er wie eine normale Reaktion erschienen. Wer würde sich nicht wehren, wenn der Nachbar plötzlich anfängt, auf einen zu schießen, beiläufig und ohne Skrupel, als wäre man eine Art unerwünscht eingeführte Spezies, so wie die Farmer bei uns zu Hause Kaninchen abknallen?
»Stimmt«, erwiderte er. »Vor Jahren haben wir erlebt, wie der Libanon auseinanderbrach, und gesagt, das ist der Nahe Osten, die sind eben primitiv. Dann haben wir Dubrovnik in Flammen gesehen und gesagt, wir in Sarajevo sind anders. Das dachten alle. Wie konnte es hier, wo jeder Zweite aus einer Mischehe stammt, einen Krieg zwischen den Ethnien geben? Ein Religionskrieg in einer Stadt, in der kein Mensch je in die Kirche geht? Für mich ist die Moschee ein Museum, etwas Altmodisches, was für Omas und Opas. Pittoresk, verstehen Sie? Einmal im Jahr vielleicht sind wir zum zikr gegangen, wenn die Derwische tanzen, und das war wie Theater, wie – wie nennt man das? Eine Pantomime. Mein bester Freund Danilo, der ist Jude und nicht mal beschnitten. Nach dem Krieg gab es hier keinen mohel; wir mussten alle zum selben Frisör gehen, und das störte niemanden. Unsere Eltern waren sowieso Linke, die das alles für rückständig hielten …« Er trank die letzten Schlucke von seinem Bier und bestellte zwei weitere.
»Ich wollte Sie danach fragen, wie Sie die Haggadah gerettet haben.«
Er zog eine Grimasse und schaute auf seine Hände, die auf dem gesprenkelten Resopal der Tischplatte lagen. Seine Finger waren lang und grazil. Komisch, dass ich das nicht bemerkt hatte, als ich aus Sorge darüber, er könnte unbefugterweise mein wertvolles Pergament begrabschen, so grob zu ihm gewesen war.
»Sie müssen das verstehen. Wie ich schon sagte: Wir glaubten nicht an den Krieg. Unsere politische Führung hatte erklärt: ›Zu einem Krieg gehören zwei, und wir werden nicht kämpfen.‹ Nicht hier, nicht in unserem kostbaren Sarajevo, unserer idealistischen Olympia-Stadt. Wir sind zu intelligent, zu zynisch dafür. Natürlich muss man nicht dumm und primitiv sein, um einen dummen, primitiven Tod zu sterben. Das wissen wir mittlerweile. Aber damals, in jenen ersten Tagen, haben wir alle Dinge getan, die ein bisschen verrückt waren. Jugendliche, Teenager demonstrierten mit bunten Plakaten und Musik gegen den Krieg, als gingen sie auf eine Party. Selbst als die Heckenschützen ein Dutzend von ihnen abgeknallt hatten, begriffen wir noch nicht, was los war. Wir erwarteten, dass die internationale Gemeinschaft ihnen Einhalt gebieten würde. Auch ich glaubte das. Ich dachte, wir würden höchstens ein paar schlimme Tage durchstehen müssen, während die Welt – wie sagen Sie dazu? – sich einkriegt.«
Er sprach so leise, dass ich ihn bei dem Stimmengewirr um uns herum kaum hörte. »Ich war Kustos, das Museum wurde beschossen. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Die Exponate waren ungeschützt. Im Museum lagerten Hunderte Bücher, und es war nur zwanzig Meter von den Waffen der Tschetniks entfernt. Ich dachte, eine einzige Phosphorbombe könnte das Ganze in Schutt und Asche legen, oder diese … diese … das bosnische Wort für sie ist papci, ich kann es nicht übersetzen.« Er ballte seine Hand zur Faust und schob sie über den Tisch.
»Wie nennt man den Fußteil bei einem Tier? Bei einer Kuh oder einem Pferd?«
»Einen Huf?«, fragte ich.