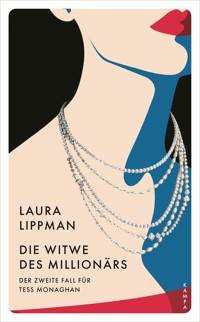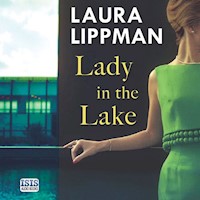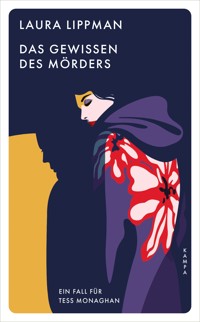
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tess Monaghan
- Sprache: Deutsch
Ex-Journalistin Tess Monaghan hat endlich ihre eigene Privatdetektei. Allerdings hatte sie sich das alles etwas glamouröser vorgestellt: Das Büro liegt in Butchers Hill, einem der übelsten Viertel von Baltimore, die Möbel sind ausrangierte Erbstücke, und auf dem Firmenschild steht immer noch der Name des Vormieters, den Tess am Umsatz beteiligen muss. Noch dazu ist ihr erster Klient ein Mörder: Luther Beale, besser bekannt als »Schlachter von Butchers Hill«. Vier Jahre zuvor hat Beale einen elfjährigen Jungen erschossen, der sein Auto demoliert hat. Jetzt will der Ex-Häftling sein Gewissen beruhigen und die vier schwarzen Jugendlichen, die damals Augenzeugen waren, finanziell entschädigen. Tess soll sie finden. Kaum hat sie die Suche aufgenommen, kommen die Jugendlichen einer nach dem anderen ums Leben. Ihre Ermittlungen konfrontieren Tess nicht nur mit der von Gewalt, Drogen und Kriminalität geprägten Lebenswelt vieler Kinder in Baltimore, sondern auch mit dem Versagen der amerikanischen Jugendfürsorge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura Lippman
Das Gewissen des Mörders
Der dritte Fall für Tess Monaghan
Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulrich Hoffmann
Kampa
Für Susan Seegar, die mir beibrachte, wie man liest,
die mich ermutigte zu schreiben und die mich überredete,
meiner Barbiepuppe den Kopf zu rasieren.
Ich bin froh, kein Einzelkind gewesen zu sein.
When years without number
like days of another summer
had turned into air there
once more was a street that had never
forgotten the eyes of its child
W.S. Merwin,»Another Place«
Prolog
Vor fünf Jahren …
Er träumte seinen Lieblingstraum, den von Annie, als er glaubte, Steinchen an seine Fensterscheibe fliegen zu hören. Klick, klick, klick. Nein – er war doch derjenige, der die Kiesel an Annies Fenster geworfen hatte, vor so vielen Jahren, damals in der Castle Street. Und wenn er sah, dass sie ihren Vorhang beiseitezog, sang er: »Buffalo girl, won’t you come out tonight, come out tonight, come out tonight.« Und das tat sie.
Sie war ein dünnes, langbeiniges Mädchen gewesen, war mit nackten Füßen die Feuerleiter heruntergestiegen, die hochhackigen Schuhe steckten in den Taschen ihres Kleids wie leuchtend rote Vögel, die ihre langen Hälse hervorreckten. »Tolle Taschen«, hatte sie gesagt, als er diese bewunderte. Er bewunderte alles an ihr – die weiße Spitze, die sie an Saum und Ausschnitt ihres Kleids genäht hatte, um ihm mehr Flair, wie sie sagte, zu verleihen, ihr herzförmiges Gesicht, die Mulde am Ansatz ihres Halses, in die er ihr ein herzförmiges Medaillon hängte.
Egal wie oft sie die Feuerleiter herunterstieg, um sich mit ihm zu treffen, sie zögerte jedes Mal auf der letzten Stufe, etwa ein halbes Stockwerk über dem Erdboden, als fürchtete sie zu fallen. Aber er wusste, dass sie sich ein wenig vor ihm fürchtete, davor, ihn zu lieben, davor, was es für ein junges, gut gelauntes Mädchen bedeutete, einen so ernsthaften und düster dreinschauenden Mann zu lieben. So hing sie an der letzten Sprosse, und die Zehen ihrer nackten Füße krümmten sich vor Angst, als sie über dem Bürgersteig hin und her schwang, und er lachte, er konnte nicht anders, er lachte über dieses dünne, langbeinige Mädchen, das über der Castle Street schwebte. Seine Annie. »Der Prinz soll doch sein Mädchen in ein Schloss entführen, aber du lebst schon in einem«, sagte er ihr immer. »Wo soll ich nur mit dir hin, meine Prinzessin?« Er versprach ihr, sie nach Europa mitzunehmen, nach Jamaika, nach New York. Am Ende hatte er sie nur fünf Blocks weit zur Fairmount Avenue entführt, und jeden August eine Woche nach Virginia Beach.
Klick, klick, klick.
Aber das war vierzig Jahre her, und Annie war tot, schon fast zehn Jahre, er lag allein im Ehebett. Die Geräusche an seinem Fenster mussten von einem Ast stammen oder von Eisregen. Aber es gab verdammt wenig Bäume in der Fairmount Avenue, und es war Anfang Juni, der dritte Juni. Selbst im Halbschlaf wusste er, welches Datum es war, er wusste, welche Zahlen gezogen worden waren, denn er schrieb sie immer in den Kalender. 467 beim Pick Three, 4526 beim Pick Four, die hatten ihm glatt 350 Dollar eingebracht. Sein Glückstag. Aber das war gestern gewesen. Er hatte seinen Schein schon beim Koreaner eingelöst. Am Morgen müsste er in sein Traumbuch sehen, er müsste nachschlagen, welche Zahl für eine verlorene Liebe stand, für ein Herz, für die Farbe Rot.
Klick, klick, klick. Dann ein lauteres Geräusch, das er sofort erkannte, das mittlerweile allzu bekannte Geräusch zerbrechender Scheiben. Fensterscheiben direkt unter ihm – nein, diesmal eine Windschutzscheibe. Das Geräusch ließ verfliegen, was von seinem Schlaf noch übrig war, von seinem Traum, von seiner Annie.
Diese verdammten Kinder, die aus der Fayette. Aber es reichte jetzt, schwor er sich, dann sagte er es laut: »Es reicht.«
Er bewahrte seine Pistole in der untersten Kommodenschublade auf, sie lag in einem Nest aus einzelnen Socken, die er aufhob, weil die Gegenstücke vielleicht eines Tages wieder auftauchten. Und man konnte damit gut sauber machen, man zog sich einen Strumpf über die Hand und konnte Staub wischen. Die Patronen befanden sich zusammen mit seinen nie getragenen Manschettenknöpfen in der kleinen Schublade am Rande des altmodischen Ankleidetischs. Er lud die Pistole in aller Ruhe. Die Kinder hatten es ja auch nicht eilig. Wenn diese Kinder erst mal anfingen, ließen sie sich verdammt viel Zeit, sie wussten, dass niemand die Polizei rief, und es wäre auch egal, wenn doch. In dieser Gegend hatten alle Angst vor den Kindern, und den Bullen war das so egal, dass man heulen könnte. »Es sind ja bloß Sachen«, sagten sie jedes Mal, wenn er anrief. Aber es waren nicht ihre Sachen. Nur sein Wagen, sein Radio, seine Fenster, seine Haustür. Sein, sein, sein.
Langsam ging er im Dunkeln die Treppe herunter. Er keuchte ein wenig. Teufel, er wurde dick, er müsste Magermilch auf seine Frühstücksflocken gießen. Aber ein Mann musste tun, was ein Mann tun muss. Das hatte John Wayne gesagt, da war er sich ziemlich sicher. Er hatte den Film mit Annie im alten Hippodrom-Kino gesehen, oder vielleicht auch im Mayfair. Einem von beiden. Es war nicht einfach, sich seine Erinnerungen zu bewahren, so, wie in dieser Stadt Häuser abgerissen wurden. Und was die Stadt nicht abriss, fiel von allein in sich zusammen. Annie und er waren danach tanzen gegangen, da war er sich sicher, drüben auf der Pennsylvania Avenue.
Als er hinaus auf den Treppenabsatz trat, waren die Kinder viel zu konzentriert auf ihren nächtlichen Zerstörungszug, um auf ihn zu achten. Sie kratzten mit Stöcken seitlich an dem geparkten Wagen entlang, sie traten methodisch die Scheinwerfer ein und hämmerten Steine auf die Kotflügel. Irgendwann, das wusste er, würden sie alle Scheiben einschlagen und dann die Radios stehlen, sofern die Radios es wert waren, gestohlen zu werden. Diejenigen, die kein vernünftiges Radio im Wagen hatten, wurden mit zerfetzten Sitzen belohnt, Müll auf dem Wagenboden, Hundescheiße auf den Sitzen.
Die Marmorstufen fühlten sich kalt und glatt unter seinen nackten Füßen an. Er verfehlte die unterste, stürzte mit einem peinlich dumpfen Geräusch auf den Bürgersteig, wie ein überreifer Apfel, der zu Boden klatschte. Entgeistert schauten die Kinder auf. Als sie sahen, dass er es war, lachten sie.
»Geh wieder rein, Alter«, sagte der Dünne, der immer für alle sprach. »Du brauchst deinen Schlaf, sonst schaffst du morgen nicht alle deine Nickerchen.«
Der kleine Dicke lachte über diesen tollen Witz, die anderen stimmten ein. Es waren insgesamt fünf, alles Pflegekinder, die bei einem jungen christlichen Ehepaar lebten. Ausgesprochen nette Leute, sie meinten es gut, aber sie konnten mit diesen Kindern nichts anfangen. Sie konnten ihnen nicht mal vernünftige Klamotten anziehen. Sie nahmen einfach immer mehr Kinder auf und sahen hilflos zu, wie sie durchdrehten. Der Dünne, der Dicke, die Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, und der Neue, ein Gerippe, dem irgendjemand mal sagen müsste, er sollte sich die Nase putzen. Ja, dafür immerhin waren diese neuen Sicherheitslaternen gut, man konnte sich die Kriminellen bei der Arbeit ordentlich anschauen.
»Es reicht jetzt«, sagte er. »Ihr hört jetzt sofort auf.«
Darüber lachten sie noch lauter, sie lachten über diesen bemitleidenswerten alten Mann, der am Boden saß und ihnen vorschreiben wollte, was sie zu tun hatten. Dann fingen sie an, ihn zu bewerfen, mit Steinen, Stöcken und Getränkedosen. Er versuchte nicht, sein Gesicht oder seinen Kopf zu schützen, er saß einfach da und ließ ihren Müllregen auf sich niedergehen. Als alle Steine und Stöcke geworfen waren, als sie ihn mit allen Schimpfworten bedacht hatten, die ihnen einfielen – dann, erst dann zeigte er ihnen die Pistole.
»Scheiße, Alter, das kannst du doch nicht machen«, sagte der Dünne, aber er schien nicht mehr ganz so selbstsicher zu sein wie vorher.
»Glaubst du?« Er schoss nach oben in den Himmel.
»Er bringt uns um. Er bringt uns alle um«, schrie das Mädchen und lief weg. Das Mädchen war schnell, schneller als die anderen, obwohl ihr Zwillingsbruder fast genauso schnell war. Die beiden hatten schon das Ende des Blocks erreicht und bogen nach Norden ab, bevor er wusste, was los war. Der Dicke lief hinter ihnen her, während der große Dünne an dem Kleinsten zerrte, dem Rotznasigen, der erstarrt schien, nicht so sehr aus Angst, sondern aus reiner, großmäuliger Dummheit.
»Komm schon, Donnie«, bettelte der Dünne und zerrte an seinem Arm. »Der Alte hat eine Pistole. Diesmal will er uns nicht verarschen.«
Die Rotznase zögerte noch einen Moment, dann lief sie in Richtung der Straßenecke, der Junge machte ungeschickte, krummbeinige Schritte, aber er konnte mehr oder weniger mit dem dünnen Langbeinigen mithalten. Er hätte die Kinder einholen können, wenn er gewollt hätte. Stattdessen schoss er noch einmal und dann noch einmal, die Pistole in seiner Hand war lebendig geworden, sie hatte sich von ihm losgelöst. Ein Wagen bog in die Fairmount ein, als sie davonliefen, jemand öffnete ein Fenster und brüllte, dass endlich Ruhe sein sollte, und dann war da noch ein Knall zu hören, ein Junge schrie, ein weiterer Knall, die Pistole schoss einfach immer weiter. All diese Geräusche gerieten durcheinander, er konnte nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge sie aufgetreten waren. Der Kleinste taumelte und stürzte, und jetzt schrie der Dünne mit hoher, piepsiger Stimme, wie ein Mädchen.
Und dann war die Straße leer, abgesehen von einem kleinen Haufen zerknüllter Klamotten an der Straßenecke.
Er schaute auf die Waffe, die er immer noch auf Schulterhöhe in seiner merkwürdig ruhigen rechten Hand hielt, die aber jetzt schwieg. Er wartete darauf, dass etwas passierte, dann wurde ihm klar, dass es schon passiert war.
Er ging hinein und legte die Pistole unter einige Decken am Boden von Annies Schrank, hinter eine Tür, die er selten öffnete. Er griff nach Handfeger und Schaufel, er zog Schuhe an, um seine Füße zu schützen. Als die Polizei und der Krankenwagen kamen, war er fast fertig damit, die Glasscherben vor seinem Haus aufzukehren. War ja klar, diesmal kamen sie so schnell, wo er noch so viel zu tun hatte.
»Augenblick noch«, sagte er, und die Polizeibeamten warteten sprachlos, während er mit seinem Handfeger die letzten paar Glassplitter und Müllreste auf seinem kleinen Stück der Fairmount zusammenkehrte.
»Okay«, sagte er und lehnte Handfeger und Schaufel gegen die Treppe; er wusste, er würde sie nie wiedersehen. »Ich bin bereit.«
1
Tess Monaghans Schreibtischunterlagen-Kalender war die größte, weißeste Fläche, die sie je betrachtet hatte. Dreißig Kästchen Junitage, leer wie die sibirische Tundra, erstreckten sich über ihren Schreibtisch, bis es ihr vorkam, als gäbe es keinen Platz für irgendetwas anderes. Sie dachte, sie würde erblinden, während sie daraufstarrte, konnte ihren Blick aber auch nicht davon lösen. Dreißig perfekte Quadrate, die alle auf irgendwelche Dinge warteten, die zu tun waren, und auf Orte, an die man musste, und nur im heutigen, dem vierten, gab es Eintragungen:
9:30Beale
10:30 Browne
(SuperFresh: Hundefutter)
Außerdem gab es eine hingekritzelte Zeichnung in der linken unteren Ecke, die sie für eine ziemlich gute Version eines Mannes in einem Rollstuhl hielt, der von einem kurzen Steg ins Wasser rollte. Geschmacklos natürlich, solange man den Mann nicht als ihren bisherigen Arbeitgeber Tyner Gray erkannte, dann bekam das Bild einen eigenwilligen Charme.
Sie hatte Tyner gesagt, Juni wäre kein guter Monat, um ein eigenes Büro zu eröffnen, aber er hatte wie immer ewig genervt und ihr genug Arbeit von seiner Kanzlei versprochen, um die ersten Monate zu überbrücken. In den finsteren Momenten – und dieser war einer davon – glaubte sie, dass er bloß einen Schreibtisch für die Sommervertretung hatte freimachen wollen.
Na gut, sie hatte ja auch erst letzte Woche aufgemacht. Und man hätte damit rechnen können, dass es in der Woche nach dem Memorial-Day-Wochenende nicht so besonders lief. Andererseits würden Juli und August noch ruhiger werden, denn halb Baltimore fuhr dann nach Ocean City und an die Strände Delawares.
»Aber wir nicht, Esskay. Wir sind Arbeitermädchen«, sagte sie zu ihrer Windhündin, die auf dem klumpigen malvenfarbenen Sofa eine hervorragende Imitation einer Matisse-Statue hinlegte. »Die rosa Nackte«. Nein, »die schwarze, haarige Nackte mit dem rosa Bauch«. Esskay war eine Rennhündin gewesen, aber jetzt war sie nur noch eine Weltklasse-Pennerin, pro Tag brachte sie es auf dem Sofa hier und im Bett zu Hause auf etwa achtzehn Stunden Schlaf. Esskay konnte es sich leisten zu schlafen, sie hatte ja auch keine laufenden Kosten.
Laufende Kosten – das war nun wirklich eine tolle Bezeichnung. Die Kosten liefen Tess nämlich einfach davon. Bislang hatte ihr Buchhaltungsprogramm nichts als Ausgaben bei Tess Monaghan, Inc. angezeigt, korrekterweise: Keyes Investigations, Inc. Die Firma war nach einem pensionierten Polizisten benannt, dessen Unterlagen nötig waren, damit Tess in Maryland als lizenzierte Privatdetektivin arbeiten konnte. Sie hatte Edward Keyes niemals getroffen, er hatte bloß die Firma gegründet und bekam dafür einen kleinen Prozentsatz ihrer Gewinne. Sie hoffte, dass er auch Geduld mitgebracht hatte.
Immerhin würde ihr erster potenzieller Klient, ein Mr. Beale, in zehn Minuten hier sein. Sie vermutete, dass er absolut pünktlich käme, immerhin hatte er versucht, noch gestern einen Termin zu bekommen. Er hatte sie kurz nach acht Uhr abends angerufen, als müsste sein Bedürfnis nach einem Privatdetektiv sofort befriedigt werden. Tess, die lange geblieben war, um vergebens zu versuchen, ihr neues Büro büroartiger aussehen zu lassen, konnte es sich nicht leisten, einen Mandanten abzulehnen, aber sie fand es klüger, diesen hier über Nacht in seinem eigenen Saft schmoren zu lassen. Oder auch einfach mal auszuschlafen. Beale hatte am Telefon ein bisschen betrunken geklungen, mit der sorgfältigen Aussprache eines Besoffenen. Tess hatte ihm einen Termin um neun Uhr dreißig eingeräumt, nachdem sie sich lang und breit darüber ausgelassen hatte, welche Probleme das in ihrem übervollen Arbeitstag verursachen würde. Und tatsächlich hatte sie ihr morgendliches Work-out um fast dreißig Minuten abkürzen müssen, sie war in ihrem Alden-Skiff nur bis zum Fort McHenry gerudert.
Gestern Abend hatte das Büro im sommerlichen Dämmerlicht sauber und professionell ausgesehen, nur eine Winzigkeit von einem erstklassigen Laden entfernt. Heute fiel die grelle Sonne direkt durch die Schaufensterscheibe, und das Büro sah nach dem aus, was es war – das Erdgeschoss eines zu oft renovierten Reihenhauses in einem der übleren Blocks in Butchers Hill. Das Haus war fast hundert Jahre alt und schien langsam in sich zusammenzusacken, der Linoleumboden wellte sich und sah aus wie ein Swimmingpool, die Türen und Türrahmen hatten kaum mehr Kontakt miteinander. Beige Farbe, selbst drei Schichten, half da auch nicht viel weiter.
Mit mehr Geld in der Tasche hätte Tess dem alten Ladengeschäft auch mehr Gerechtigkeit angedeihen lassen können, sie hätte sich richtige Möbel statt ausrangierter Familienerbstücke leisten können. Aber mit mehr Geld in der Tasche hätte sie auch gleich ein besseres Büro in einer besseren Gegend gemietet, ein ordentliches Büro mit Holzfußboden, Ziegelwänden und vielleicht sogar mit Hafenblick. In einer netteren Umgebung hätten ihre Schrottmöbel vielleicht sogar trendig gewirkt. Hier waren sie einfach bloß Schrott.
Und dass Tante Kitty ihr zur Eröffnung gerahmte Familienfotos geschenkt hatte, war zwar wirklich herzensgut gemeint, machte die Sache aber nur noch schlimmer. Was für eine Geschäftsfrau hatte denn bitte ein verblichenes Foto von sich selbst an der Wand hängen, wie sie sich mit schokoladenverschmiertem Gesicht mit aller Kraft an den Hals eines mit Münzen zu fütternden fliegenden Hasens klammerte, während ihre Großmutter versuchte, sie davon loszureißen. Kurz entschlossen nahm Tess das Bild von der Wand, aber dann fiel ihr wieder ein, dass das vergrößerte Foto den kleinen Wandsafe verdeckte, in dem ganz einsam ihre Pistole lag. Sobald sie Bargeld im Überfluss hätte, würde sie es dort hineinpacken.
Jemand klopfte so kräftig an die Tür, dass es klang, als würde die Faust gleich durch die Glasscheibe brechen. Der brave Beale, zehn Minuten zu früh, wenn man der neonbeleuchteten »Zeit für einen Haarschnitt«-Friseur-Uhr glaubte, die an der Wand hing; eine weitere Gabe ihrer Tante. »Ist offen«, rief Tess über die Schulter und schaute sich schnell um, um festzustellen, ob es etwas anderes gab, was sie über den Safe hängen konnte. Der Türknauf drehte sich ungeduldig, was sie daran erinnerte, dass sie abgeschlossen hatte. Eine traurige, aber notwendige Vorsichtsmaßnahme in Butchers Hill.
»Augenblick«, rief sie und hängte das Bild zurück an die Wand. Sie würde später etwas Passenderes suchen. Poker spielende Hunde waren zum Beispiel immer gut.
»Miss Monaghan?«
Der Mann, der ihr Büro betrat, hatte dünne Beine, aber einen fast tonnenförmigen Oberkörper. Er ging um Tess herum, als trüge er ein unsichtbares Kraftfeld mit sich, das ihn zwang, eine möglichst große Distanz zu anderen einzunehmen, dann setzte er sich langsam auf den Stuhl ihrem Schreibtisch gegenüber. Seine Gelenke knackten hörbar; er war wie der Blechmann aus Oz nach einem langen, intensiven Regen. Nein, er erinnerte sie eigentlich an eine andere Figur aus dem Zauberreich Oz, den weit unbekannteren König der Gnome aus einem späteren Buch der Serie. Er hatte dieselbe rundliche Mitte auf dürren Beinen. Und was noch? Der König der Gnome hatte tödliche Angst vor Eiern.
»Das ist also Keyes, Inc.«, sagte ihr Besucher. »Sind Sie Keyes?«
»Ich bin seine Partnerin, Tess Monaghan. Mr. Keyes ist, äh, in Frührente.«
»Ich bin auch in Rente«, sagte der Mann und schaute in seinen Schoß. Tess hatte sich gerade noch solche Sorgen gemacht, aber er schien seine Umgebung gar nicht zu registrieren – nicht die Möbel, nicht die Fotos, nicht einmal Esskay, die ihre Augen geöffnet hatte und niedlich tat, nur für den Fall, dass der Besucher ihr einen der Kekse herüberwerfen wollte, die Tess in einer Dose auf dem Schreibtisch aufbewahrte.
»Ich nehme an, Sie wissen, wer ich bin?« Seine Stimme klang bescheiden, aber seine Brust, deren Umfang schon groß war, schien vor Wichtigkeit noch weiter anzuschwellen.
Nein, wusste sie nicht. Sollte sie? Er war ein älterer Schwarzer, was in seinem Fall bedeutete, dass seine Haut dieselbe Farbe hatte wie ein zu lange gelagerter Schokoriegel – dunkelbraun mit kreidigem Unterton. Er trug einen braunen Anzug, der zwei Farbnuancen heller war als sein Gesicht, und obwohl der Anzug sauber und ordentlich war, passte er nicht gut. Zu eng an den Schultern, ein bisschen weit an den Beinen und dazu ein rosa Hemd und ein knallroter Schlips. Der Mann hielt einen ehemals weißen Panamahut in Händen, der jetzt gelb war wie ein Tortillachip. Auf jeden Fall hatte ihm heute Morgen keine Frau beim Anziehen zugeschaut, befand Tess.
»Nein, leider nicht«, gab sie zu.
»Luther Beale«, sagte er, als wäre sein voller Name ausreichend. Aber das war er nicht. Sie konnte in seiner Stimme dieselbe angeberisch überbetonende Präzision hören, die sie hatte glauben lassen, dass er am Telefon betrunken gewesen war.
»Luther Beale?«
»Luther Beale«, wiederholte er ganz ernst.
»Ich weiß leider nicht …«
»Vielleicht kennen Sie mich auch als den Schlachter von Butchers Hill«, sagte er steif, und Tess registrierte peinlich berührt das kleine Geräusch, das sie von sich gab, irgendwo zwischen einem Quieken und einem Keuchen. Der Spitzname war ihr bekannt. Den hatte ihr ehemaliger Arbeitgeber, der mittlerweile eingestellte Baltimore Star, ihm verpasst. Der Star war gut darin gewesen, Spitznamen zu verteilen, wohingegen die überlebende Zeitung, der stinklangweilige Leuchtturm, nur gut darin war, sich selbst welche zuzuziehen.
Luther »Der Schlachter« Beale. Der Schlachter von Butchers Hill. Ein paar Wochen lang war er berühmt gewesen, er hatte die Hauptrolle in einem nationalen Moralstück gespielt. Luther Beale war ein übler Rächer oder ein armer alter Mann gewesen, je nachdem, wie man die Sache sah. Luther Beale. Sein Name war im Talk-Radio öfter genannt worden als der Hillary Clintons. Hatte nicht sogar »60 Minutes« etwas über ihn gebracht? Nein, das war Roman Welzant gewesen, der Schneeball-Killer, der vor zwanzig Jahren vor Gericht gestanden hatte, weil er Teenager erschossen hatte, die weitere zehn Jahre zuvor mit Schneebällen auf sein Haus außerhalb der Stadtgrenze geworfen hatten. Beale hatte einen wesentlich jüngeren Jungen erschossen, weil der eines seiner Fenster eingeschlagen hatte. Oder seine Windschutzscheibe? Egal. Entscheidend war, dass die Jury auf dem Land Welzant freiließ, während die Jury in der Stadt Beale verknackte.
»Ja, Mr. Beale. Ich erinnere mich an den … Zwischenfall.«
»Wissen Sie noch, wie es endete?«
»Sie wurden verurteilt – Totschlag, denke ich, oder etwas Ähnliches, jedenfalls kein Mord, wenn Sie heute hier sitzen – und mussten ins Gefängnis.«
Beale beugte sich in seinem Stuhl vor und wedelte mit dem Finger vor Tess’ Gesicht herum. Ein alter Mann, der es gewohnt war, unaufmerksamen jungen Leuten Lektionen zu erteilen. »Nein, nein, nein. Ich habe Bewährung für den Totschlag bekommen. Ich musste wegen Waffenbesitz in den Bau. Ich hatte einen Jungen umgebracht, eine schreckliche, schreckliche Sache, aber sie hätten mich laufen lassen, weil ich es nicht geplant hatte. Sie haben mich eingesperrt, weil ich innerhalb der Stadtgrenzen eine Waffe abgefeuert habe. Mindeststrafe. Ist das nicht was?«
Da stimmte Tess ihm zu. Das war wirklich was, etwas sehr Eigenartiges. Aber sie erkannte die Frage als rhetorisch und lehnte sich zurück. Sie hatte Leute wie Beale schon häufiger getroffen. Sie waren wie diese kleinen Züge im Zoo oder im Einkaufszentrum, sie fuhren einfach den ganzen Tag auf derselben Spur im Kreis.
»Was kann ich für Sie tun, Mr. Beale?«
»Wissen Sie, ich war zweiundsechzig, als ich ins Gefängnis kam. Jetzt bin ich sechsundsechzig. Ich bin seit drei Monaten draußen. Diese Gegend ist übler als damals, bevor ich ins Gefängnis musste. Ich schätze, selbst in der Hölle kann es immer noch heißer werden. Deswegen ist mir aufgefallen, dass eine nette junge Frau wie Sie hier ein Geschäft eröffnet hat. Ich hoffe, Sie haben mehr aufzufahren, Miss, als diesen dünnen Hund. Sie sollten eine Waffe tragen. Denn Sie können darauf wetten, dass die kleinen Jungs hier in der Gegend welche haben. Aber ich darf keine Waffe mehr besitzen. Ich bin vorbestraft. Ist das nicht was?«
Dieses Mal schien er eine Antwort zu erwarten. Tess versuchte, sich eine unverbindliche, niemanden verärgernde Antwort zu überlegen. »So ist das Gesetz.«
»Das Gesetz! Das Gesetz ist albern. In der Bibel steht, du sollst nicht töten, nicht, du sollst keine Feuerwaffen innerhalb der Stadtgrenzen benutzen. Wissen Sie, dass ich mir nie zuvor im Leben etwas habe zuschulden kommen lassen, bevor sie mich verhafteten? Sie haben gesucht, glauben Sie mir, Sie haben gesucht. Sie wollten mich unbedingt drankriegen. Das habe ich nie verstanden, warum es diese Polizisten und Staatsanwälte so auf mich abgesehen hatten. Als würde in dieser Stadt alles wieder in Ordnung kommen, wenn sie mich wegsperrten. Aber ich war nicht vorbestraft. Ich hatte nicht mal einen unbezahlten Strafzettel. Wissen Sie, was sie über mich herausfanden, nachdem sie lange genug gesucht hatten?«
Tess schüttelte den Kopf, wenn auch nur um anzudeuten, dass sie zuhörte.
»Manchmal habe ich am Wochenende auf dem Bau gearbeitet, aber ich hatte keinen Gewerbeschein. O ja, da hatten sie den Staatsfeind Nr. 1, da waren sie sicher. Da zieht ein Mann los und streicht Zimmer und reinigt Siele, und er hat keinen Gewerbeschein. Den müssen wir einsperren und den Schlüssel gleich wegwerfen.«
»Ich hab gehört, dass Sie auch noch nach Bob Vila suchen«, bot Tess an.
Beale wedelte durch die Luft, als wäre Tess’ Scherz ein störendes Insekt. »Und jetzt bin ich vorbestraft. Das ist alles. Das ist alles, was jemand über mich wissen muss. Früher haben die Leute mich auf der Straße gesehen und vielleicht gesagt: ›Oh, da ist Luther Beale, seine Frau Annie ist an Krebs gestorben.‹ Oder: ›Luther Beale, der arbeitet drüben bei Procter & Gamble in Locust Point, er könnte sich ein hübscheres Haus in einer netteren Gegend leisten, aber er mag die Fairmount Avenue, er hat sein ganzes Leben hier gelebt.‹ Wissen Sie, was sie jetzt über mich sagen?«
Sie wartete einen Moment. »Nein, weiß ich wohl nicht.«
Tess meinte, Tränen in Beales Augenwinkeln zu sehen. »Sie sagen: ›Da ist Luther Beale. Der bringt dich um, wenn er dich nur sieht. Er hat mal einen kleinen Jungen erschossen, nur weil der mit Steinen auf ein paar Autos geworfen hat.‹«
Haben Sie ja auch. Aber man verdiente kein Geld damit, einen potenziellen Mandanten mit der Wahrheit zu konfrontieren. Tess konnte sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie sie mit diesem Gespräch Geld verdienen sollte. Hatte Beale sie für einen Psychiater gehalten? Oder ging er einfach, wie so viele Männer, davon aus, dass die Funktion einer Frau schlicht und ergreifend darin bestand, Männern zuzuhören? Vielleicht konnte sie ein bisschen nebenbei verdienen, indem sie Männern zuhörte, die von ihren Sorgen erzählten. Vergiss Telefonsex. Wie wär’s mit 1-900-LANGWEILMICH oder einer Website, www.erzaehlmirdeinesorgen.com.
»Mr. Beale, kann ich irgendetwas für Sie tun?«
»Wiedergutmachung.«
Das Wort, das Luther Beale mit seiner tiefen, knurrigen Stimme sehr sorgfältig ausgesprochen hatte, schien in der Luft zu hängen und vor sich hin zu glitzern. Tess stellte es sich in schwarzen Plastikbuchstaben auf der Markise vor einer der grausigen Kirchen an der Ostküste vor, einem dieser kleinen Ziegelgebäude, die sich mitten zwischen endlosen Maisfeldern befanden. Predigt heute: Wiedergutmachung. Und nicht vergessen: Am Wochenende ist das alljährliche Skrupel-Frühstück der schuldigen Damen.
»Wiedergutmachung«, wiederholte er. »Ein schönes Wort, finden Sie nicht?«
Das fand sie nicht. »Rache ist keine schöne Angelegenheit. Vielleicht haben Sie einen legitimen Grund, gegen das System zu sein, aber wenn Sie darauf aus sind, Mr. Beale, sollten Sie sich lieber jemand anders suchen, der Ihnen dabei helfen kann.«
»Sie sind doch eine gut ausgebildete Frau, Miss Monaghan? Waren Sie auf dem College?«
»Ja, Washington College, drüben in Chestertown.«
»Ich hätte doch gehofft, so eine gute Schule hätte Ihnen die Bedeutung eines so weit verbreiteten Wortes beigebracht. Ich habe im Gefängnis viel gelesen – die Bibel, Geschichte. Aber ich habe auch ein Wörterbuch gelesen, eines der besten Bücher, die wir haben. Im Wörterbuch gibt es keine Lügen, nur Wörter, schöne Wörter, die darauf warten, dass man etwas aus ihnen macht. Das Wichtige an der Wiedergutmachung ist der Schluss: Gutmachung. Retribution. Geht zurück auf das Lateinische: Retribution – zurückzahlen. Das kann ›belohnen‹ bedeuten – oder ›bestrafen‹.«
Beale genoss seine kleine Vokabelstunde. Tess nicht. Ihr fielen mehrere mögliche Entgegnungen verschiedenen Zorn- und Witzgrades ein. Aber ihre Tante und ihr ehemaliger Arbeitgeber hatten ihr mehrfach klargemacht, dass das Betreiben eines eigenen Geschäfts vor allem bedeutete, jeden Tag mehrere Haufen Scheiße zu fressen.
»Okay, und an wem wollen Sie nun was wiedergutmachen?«
Beale drehte seinen Hut in den Händen, er knetete die Krempe mit Fingern, die so dick und lang waren wie die Esskay-Würstchen, der die Windhündin ihren Namen verdankte. Hotdog-Finger und Schinken-Hände, dachte Tess, dann fragte sie sich, wieso sie Schweinefleischprodukte im Kopf hatte. Offensichtlich würde ihr morgendlicher Bagel nicht bis zum Mittagessen vorhalten.
»Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich bei Procter & Gamble in Locust Point gearbeitet habe. Es war gut, dort zu arbeiten – ordentliches Geld, anständige Sozialleistungen. Die Fabrik hat zugemacht, während ich … weg war.«
Im Gefängnis, du warst im Gefängnis. Weil du einen kleinen Jungen getötet hast.
»Für die Menschen war das schlimm, aber die Aktien sind gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das war meine Altersvorsorge, und ich kam fünf Jahre lang nicht ran, also sind sie noch weiter gestiegen. Für meine Verhältnisse bin ich ein reicher Mann, ohne zu arbeiten bin ich reicher geworden, als ich es durch Arbeit je geworden wäre. Ich könnte dieses Geld nicht mehr ausgeben, selbst wenn ich wollte. Und ich habe keine Frau, keine Kinder, überhaupt keine Familie, niemanden, dem ich es hinterlassen kann.«
Tess nickte, obwohl sie immer noch keine Ahnung hatte, worauf er hinauswollte.
»Es gab mal eine Fernsehsendung, vor Ihrer Zeit, Der Millionär. Da tauchte ein Typ namens Michael Anthony auf und sagte den Leuten, dass sie Geld bekämen. Meine Frau und ich mochten diese Sendung immer. Ich hab gedacht – vielleicht kann ich meinen eigenen Michael Anthony haben, jemanden, der diese Kinder suchen und ihnen helfen kann. Nicht mit Millionen – so viel habe ich nicht –, aber mit ein paar Tausend hier oder da.«
»Die Kinder?« Sie wusste nicht, wovon er redete.
»Die Kinder, die in jener Nacht dort waren. Die gesehen haben, was … passierte.«
Tess versuchte, sich an die Berichte über den Schlachter von Butchers Hill zu erinnern. Viel war zu lesen gewesen über sein Opfer – Donnie Moore –, das fiel ihr jetzt wieder ein. Die Journalisten hatten hart daran gearbeitet, etwas Interessantes über einen Elfjährigen herauszufinden, der weder besonders nett noch klug gewesen war, es aber dennoch nicht verdient hatte, wegen Vandalismus in den Rücken geschossen zu werden. Das Beste, was ihnen einfiel, war, dass Donnie noch unfertig war. Die anderen Kinder, die Zeugen, waren schon aus rechtlichen Gründen anonym geblieben. Als Pflegekinder waren ihre Namen vertraulich, und die lokalen Medien beließen es während des Verfahrens dabei. Der Gerichtszeichner hatte die Kinder nicht einmal im Zeugenstand skizziert, wenn sie sich recht erinnerte.
»Warum wollen Sie das tun? Diese Kinder haben Sie geärgert und gequält.«
»Und eines von ihnen wurde getötet. Das ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Ich bin vielleicht mit den Gerichten im Reinen, aber ich bin nicht mit mir und ich bin nicht mit Gott im Reinen. Ich kann nichts mehr tun für den Jungen, der gestorben ist, außer, für uns beide zu beten, aber ich kann vielleicht den anderen helfen. Stipendien, wenn sie auf ein College gehen wollen. Ein Auto, um einen Job annehmen zu können. Hilfe zu Hause. Ich weiß auch nicht. Braucht nicht jeder irgendwie Geld?«
Damit hatte er sie. Junge, damit hatte er sie.
»Wer sind diese Kinder? Wo sind sie?«
»Also, da war der Dicke. Und die Zwillinge, an deren Namen erinnere ich mich, Truman, das war der Junge, und das Mädchen hieß, glaube ich, Destiny. Dann noch ein Junge, ein dünner, der hat am meisten geredet.«
»Sie haben keine vollständigen Namen?« Tess versuchte, nicht laut zu seufzen.
»Nein. Es waren Pflegekinder, sie haben bei den Nelsons gelebt, einem netten jungen Paar, das viele Kinder aufgenommen hat. Die haben es gut gemeint, aber sie konnten mit diesen Kindern nicht umgehen, sie hatten nicht mal saubere Sachen für sie. Die Nelsons sind nach der Schießerei weggezogen, die Kinder kamen alle in neue Familien. Aber jetzt sind sie über achtzehn, jetzt sind sie auf sich allein gestellt, oder?«
»Wenn sie damals wenigstens dreizehn waren, dann schon. Aber wenn sie noch Jugendliche und in Pflegefamilien sind, wird es schwer sein, sie aufzutreiben, selbst mit Namen. Donnie war erst elf, man kann nicht wissen, ob die anderen viel älter waren. Wir können nicht einmal davon ausgehen, dass sie Führerscheine haben. Stadtkinder …« Sie hatte sagen wollen: »Arme schwarze Kinder«, aber sich gerade noch zusammengerissen. »Stadtkinder haben oft keinen, wissen Sie.«
»Oh.« Beale dachte einen Moment nach. »Ich glaube, der Dicke hieß Earl. Oder Errol.«
»Errol?«
»Vielleicht auch Elmer. Ein Name, der mit E anfing und irgendwo ein L drin hatte, da bin ich ziemlich sicher. Hilft das?«
Tess unterdrückte einen weiteren Seufzer. »Hören Sie, Mr. Beale, ich muss Ihnen sagen, dass die Chancen, diese Kinder zu finden, ziemlich gering sind, und es wird zwar nicht wahnsinnig teuer, aber es kostet auf jeden Fall Geld, vielleicht mehr, als Sie denken. Sie müssen nicht nur meinen Stundensatz bezahlen, sondern auch alle Ausgaben, die ich habe. Kilometergeld. Auslagen für Computerrecherchen.«
»Ich kann zahlen«, antwortete er.
»Bevor ich offiziell an Ihrem Fall zu arbeiten beginnen kann, müssen Sie zu einem Anwalt namens Tyner Gray gehen und um die Vermittlung an einen Privatdetektiv bitten.« Sie zog ihre Schreibtischschublade auf und nahm eine von Tyners Karten heraus. »Er wird einen Vertrag für meine Arbeit aufsetzen. Das garantiert, dass unsere Beziehung vertraulich bleibt, was Ihnen vielleicht nicht wichtig erscheinen mag, aber mir ist es sehr wichtig.«
»Das heißt, dass Sie nicht mit irgendjemand über mich reden müssen, richtig?«
»Ja.« Vielleicht. Nicht einmal Tyner konnte garantieren, dass die Bullen sie da nicht eines Tages rausprügeln würden. Der Trick bestand darin, sich einfach aus Sachen rauszuhalten, die Bullen interessierten, und das hatte sie ohnehin vor. »Tyner wird Ihnen seinen normalen Stundensatz für Ihren Besuch berechnen. Das mag Ihnen vielleicht viel Geld für wenig Arbeit erscheinen, aber es geht nicht anders, wenn Sie möchten, dass ich Ihren Fall übernehme.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Geld ist nicht das Problem.«
»Meiner Erfahrung nach ist Geld immer irgendwann das Problem. Sie müssen verstehen, dass Sie hier für Ihr Geld nicht unbedingt ein Ergebnis bekommen. Ich suche, Sie bezahlen. Leute zu finden ist heutzutage einfacher als jemals zuvor. Aber nicht, wenn man die Namen nicht weiß. Sie wären überrascht, wie viele Kinder namens Destiny es allein in Baltimore gibt.«
»Destiny ist nicht so wichtig. Sie ist ein Mädchen.«
Kleine Haufen Scheiße, kleine Haufen Scheiße, murmelte Tess stumm vor sich hin. »Und wieso sind Mädchen nicht so wichtig?«
Nicht einmal Beale war so gefühllos, dass er ihre Irritation nicht bemerkte. »Ich wollte nicht – es ist bloß, dass ich ein Mann bin, und ich sorge mich um die jungen schwarzen Männer, die ich sehe. Die Mädchen finden manchmal allein einen Ausweg. Für die Jungs ist es schwieriger. Es ist nicht einfach, ein schwarzer Mann zu sein, aber es ist noch schwieriger, ein schwarzer Mann zu werden, verstehen Sie, was ich meine?«
Tess verstand ihn, aber nur ungefähr so, wie sie Fakten über Bosnien aufnahm, Singapur und den Gazastreifen. Teile Baltimores waren für sie praktisch Ausland, Orte, die sie nicht einmal mit einem Pass bereisen konnte. So war das einfach, so war es immer gewesen, so würde es immer sein.
»Okay, ich versuche, die Jungs und das Mädchen zu finden, wenn ich erst einmal heraushabe, wer sie sind. Sagen wir mal, es geschieht ein Wunder, und ich treibe alle auf. Was dann? Möchten Sie, dass ich ein Treffen vereinbare?«
»Ich hätte nichts dagegen, sie zu treffen, aber ich vermute mal, dass sie mich nicht unbedingt wiedersehen wollen. Nein, finden Sie sie bloß und kriegen Sie raus, was sie brauchen, was es kostet. Dann schreibe ich Ihnen einen Scheck und Sie schreiben denen einen Scheck. Ich muss dabei anonym bleiben. Ich möchte nicht, dass sie das Geld aus falsch verstandenem Stolz ablehnen.«
Tess kritzelte diese Anweisungen auf ihren Tischkalender, obwohl sie bezweifelte, dass die Kinder Beales Geld ablehnen würden. Dieser falsche Stolz existierte im Märchen, nicht in der Wirklichkeit.
»Wenn Sie einem von ihnen mehr als zehntausend Dollar schenken, können Sie dem Finanzamt gegenüber nicht mehr anonym bleiben. Es gibt nämlich eine Schenkungssteuer. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, eine Stiftung oder so was zu gründen. Tyner kann das für Sie tun. Das ist steuerlich vielleicht günstiger.«
»Mich interessiert nicht, Steuern zu sparen. Mich interessiert …«
»Wiedergutmachung. Ich weiß. Geht zurück aufs Lateinische. Zurückzahlen. Belohnung oder Strafe.«
Beale stand auf und schaute auf sie herab. Es sah aus, als müsste er sich entscheiden, ob sie ihn verhöhnte oder einfach nur zeigte, wie gut sie aufgepasst hatte.
»Sie sind ein kluges Mädchen, Miss Monaghan, nicht wahr?«
Sie entschied sich, ihm das »Mädchen« durchgehen zu lassen. Diesmal. »Ich glaube schon, dass ich einigermaßen intelligent bin. Ja.«
»Aber Sie sind noch nicht weise. Haben Sie die Bibel gelesen? ›Der Weisheit Anfang ist: Erwirb dir Weisheit, kaufe Einsicht für all deine Habe!‹ Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 7.«
Das breite, sonnige Grinsen auf Tess’ Gesicht konnte man nur erklären, weil sie jetzt keine Scheiße mehr fraß.
»Bevor Sie gehen, sollten Sie wissen, dass das Erreichen der Weisheit in diesem Fall einen ordentlichen Vorschuss voraussetzt.«
2
Beale ging, er hielt Tyners Karte in seiner verkrampften Hand, und Tess blieben noch dreißig Minuten bis zu ihrem nächsten Termin. Sie entschied sich, mit Esskay einen kurzen Spaziergang zu machen und sich dabei eine Kleinigkeit zu essen zu holen, denn so konnte sie bis zum Mittagessen durchhalten und zugleich ihre neue Nachbarschaft besser kennenlernen. Sie nahm die Leine vom Haken an der Tür, und Esskay wachte sofort auf, rollte sich in einer flüssigen Bewegung vom Sofa und tapste mit den Krallen auf dem Linoleum, glücklicher als Gene Kelly an einem Regentag.
Aber es war ein wunderschöner Tag. Der Frühling in Baltimore war kalt und nass gewesen, dann aber hatten sich ein paar merkwürdig schöne Tage breitgemacht. Sonnig, trocken, nicht zu heiß, und die kleinen Parks standen voller Azaleen und Lilien, die niemals zu verwelken oder ihre Blüten zu verlieren schienen. Außerdem spielten die Orioles. Natürlich ließ diese paradiesische Perfektion die Eingeborenen nervös werden. Man glaubte in dieser Stadt, dass etwas Gutes immer seinen Preis hatte, wie diese Mieten-mit-Kaufabsicht-Angebote, bei denen man tausend Dollar für einen Dreihundert-Dollar-Fernseher bezahlte. Früher oder später würde die Rechnung fällig werden.
Esskay blieb abrupt stehen, und Tess stieß sich das Knie am spitzen Steißbein der Hündin. Das würde bestimmt einen blauen Fleck geben. »Was, zum …« Sie hätte es wissen müssen. Die Hündin hatte die ganze letzte Woche jedes Mal hier angehalten, denn hier gab es eine Katze, die sich auf der Fensterbank eines Hauses sonnte. Esskay hatte bereits vergessen, was sie gesehen hatte, aber sie hatte das zugehörige Gefühl nicht vergessen. Fröhlich, fröhlich, glücklich, glücklich, schienen ihre zitternden Muskeln zu singen. Tess genehmigte der Hündin eine Pause, dann zog sie an der Leine.
»Gehen bedeutet, sich von Zeit zu Zeit vorwärts zu bewegen, Esskay. Also geh weiter.«
Sie überquerten die Straße und betraten den Patterson Park durch einen der verzierten Steinbögen. »Der Stadt smaragdenes Juwel« hatte ein ausgebrannter Leuchtturm-Schreiber den Park einmal getauft. Aber das Juwel war aus der Fassung gebrochen und klapperte jetzt in irgendeiner Kommodenschublade herum, zu teuer, um es zu versichern oder zu tragen. Baltimore war voll mit solchen unnützen Schätzen. Die Standardlösung der Stadt bestand darin, sie zu versteigern oder verfallen zu lassen, aber dann gab es immer eine Rette-das-irgendwas-Gruppe, die im letzten Augenblick intervenierte, wie Soldaten in einem altmodischen Melodram. Das waren wirklich nutzlose Siege. Was, um Himmels willen, half es beispielsweise, die wunderschöne alte Pagode zu retten, die in der nordwestlichen Ecke des Patterson Parks stand, wenn es den städtischen Bediensteten nicht einmal gelang, regelmäßig den Rasen zu mähen. Und erst vor einer Woche hatte ein Jogger eine Frauenleiche im hohen Gras am Fuße der Pagode gefunden, den Hals aufgeschlitzt, das Gesicht praktisch eingeschlagen. Der Leuchtturm hatte der Geschichte einen Absatz auf Seite drei eingeräumt. Frau ermordet. Tess wusste, wie diese Zeitungssprache zu übersetzen war, wie die Details der Geschichte zu decodieren waren, was Fundort und die Kürze der Meldung bedeuteten. Drogen und Prostitution führen zu einem weiteren verdienten Opfer. Das Stück hatte für Aufregung im Stadtteil gesorgt, aber nur, weil die Zeitung die Leiche in Butchers Hill angesiedelt hatte statt in Patterson Park. Diese herumliegenden Leichen waren schlecht für die Grundstückspreise.
Butchers Hill. Der Name hatte zu einem wunderbar makabren Spitznamen für Luther Beale geführt, aber der Hintergrund hätte nicht passender sein können. Um die vorletzte Jahrhundertwende herum hatten die reichen Schlachter der Stadt westlich des Patterson Parks gewohnt, sie bauten sich aus den Gewinnen ihrer Steaks schöne Häuser. Und zwar auf einem Hügel, von dem aus man den Hafen sehen konnte: Butchers Hill. Ende der Geschichte, es gab nur ein ironisches Postskriptum. Beales Haus befand sich genau genommen nicht einmal in diesem Stadtteil. Aber »der Schlachter der Fairmount Avenue« klang einfach nicht so gut.
Wo auch immer man die Grenzen zog, die Schlachter waren ohnehin schon lange weggezogen. Jetzt wohnten in dieser Gegend alte arme Leute. Und das nahe gelegene Johns Hopkins Hospital sorgte für steten Nachschub an jungen Städtern, die sich auf die gemauerten Kamine und Bleiglasfenster stürzten. Tess spürte geradezu, wie sie beobachtet wurde, wie die Leute versuchten, sie einzuordnen. Weiß plus jung plus komischer Hundename bedeutete hier normalerweise Yuppie. Aber wie erklärte man dann den zwölf Jahre alten Toyota, dessen Auspuff mit Klebeband befestigt war?
Sie schaute auf ihre Schweizer Armeeuhr, ein Abschiedsgeschenk von Tyner. »Abschiedsgeschenk«, hatte sie gesagt. »Kriegt man das nicht bei einer Spielshow, wenn man verloren hat?« »Wasserdicht bis hundert Meter«, hatte er entgegnet, als hätte sie vor, sich auch nur knöcheltief in den Patapsco zu begeben, ganz abgesehen vom Meer. Es war fast Viertel nach zehn. Sie zog an Esskays Leine. Der Hund war tatsächlich stehen geblieben, um an den Rosen zu riechen, Relikte eines längst vergessenen Gartens, der in dieser Ecke des Patterson Parks vor sich hin wucherte.
»Wir müssen weiter, wenn wir noch einen Kaffee holen und pünktlich zum nächsten Termin kommen wollen. Wenn du dich gut benimmst, gibt es für dich vielleicht einen Berger-Keks. Hast du mich verstanden? Wenn du was Süßes haben willst, dann geh jetzt los.«
Esskay war völlig verzogen, weil sie Tess den Großteil des Frühlings für sich allein gehabt hatte, also kümmerte sie sich nicht weiter um sie. Die Sonne ließ jeden Tag neue, aufregende Gerüche aus der Erde treten, und der Wind vom Hafen her wiegte das Gras verlockend, als würden darin Feldmäuse und Kaninchen herumlaufen. Und obwohl die Hündin keine Ahnung hatte, was ein Berger-Keks war, wusste sie, was etwas Süßes bedeutete, und sie wusste, dass sie immer etwas nach dem Gassigehen bekam, egal, wie sie sich benommen hatte. Fröhlich, fröhlich, glücklich, glücklich.
Der Zehn-Uhr-dreißig-Termin wartete schon vor dem Büro, eine leuchtend gelbe Flamme vor den verblichenen Ziegeln. Tess konnte, als sie mit einem Kaffee und einer offenen Packung Berger-Kekse in der Hand, einen halb aufgegessenen Keks zwischen den Zähnen, um die Ecke kam, gleich sehen, dass die Frau ungeduldig und verärgert war.
»Ich warte nicht gern«, sagte Mary Browne, als Tess aufschloss.
Tess errötete, würgte ihren schokoladenüberzogenen Keks herunter, schloss auf und bat die Frau ins Büro. »Normalerweise bin ich sehr pünktlich, aber ich war mit meiner Hündin unterwegs, und …«
»In Ordnung. Jetzt sind ja alle da, können wir anfangen?« Sie setzte sich gegenüber von Tess’ Schreibtisch, schlug die Beine übereinander und zog dann ihren Rock herunter, als könnte Tess sonst in Versuchung geraten, ihr drunterzuschielen.
Tess verabreichte der Windhündin das versprochene Stückchen Keks und schaute bei dieser Gelegenheit sehnsüchtig auf die anderen, die noch in der Schachtel lagen. Einen hatte sie auf dem Weg zurück zum Büro heruntergeschlungen, aber der hatte bloß Appetit auf mehr gemacht. Vielleicht sollte sie die Kekse auf einen Teller legen und der gnadenlosen Mary Browne zur Versöhnung anbieten? Dann könnte sie auch selbst noch ein paar essen.
»Möchten Sie einen Keks und vielleicht ein Glas Wasser?« Esskay nutzte den Augenblick, um ins Bad am hinteren Ende des Büros zu schlendern und lautstark aus der Kloschüssel zu schlabbern. Keyes Investigations, der Laden hat Klasse. »Ich hab im Kühlschrank auch Orangensaft. Und ein Sixpack Coke …«
»Ich möchte lieber über das Geschäftliche sprechen«, sagte die Besucherin und zog einen kleinen braunen Umschlag aus ihrer Handtasche.
Im Gegensatz zu Luther Beale, dem alles egal gewesen war, bedachte Mary Browne ihre Umgebung mit einem schnellen, nicht sonderlich beeindruckten Blick. Die neue beige Farbe schien sich vor ihren Augen von der Wand zu lösen und die Jahrzehnte der beschämenden Geschichte des Hauses zu enthüllen: das letzte Leben als billiges Studio-Apartment, für das eine kleine Kochnische in eine Ecke gequetscht worden war; die kurze Zeit als Bar; die Jahre als chemische Reinigung, wegen der die Wände immer noch einen merkwürdigen Geruch ausdünsteten.
Während ihre potenzielle Klientin sich umsah, betrachtete Tess die potenzielle Klientin. Mary Browne könnte Beweisstück A für eine Lehrstunde darüber sein, dass die Afrikaner das antike Ägypten für sich beanspruchen wollten. Ihre Gesichtszüge waren so zart wie Nofretetes, ihre Haut war von einem samtenen Dunkelbraun, das das gelbe Kostüm und der passende Strohhut noch dunkler wirken ließen. Ihre Haare schienen sehr kurz geschnitten zu sein, aber nicht so kurz, dass sie sich nicht noch lockten. Mit ihrem langen Hals, der wie ein Stängel aus dem dunklen V ihres Kostüms aufragte, und dem dunklen glatten Gesicht, das von der breiten Krempe des Huts mit einem gelben Hutband eingerahmt wurde, erinnerte sie vor allem an die Rudbeckien, die später im Sommer aufblühen würden.
»Miss Monaghan?« Mary Brownes Tonfall konnte kalt und glatt sein wie dünnes Eis.
»Bitte, nennen Sie mich Tess. Immerhin bin ich wahrscheinlich jünger als Sie.«
»Ich bin erst zweiunddreißig.«
»Ich bin neunundzwanzig.« Tess ging auf, dass es vielleicht keiner von Dale Carnegies Tipps war, einer potenziellen Klientin zu sagen, dass sie älter aussah, als sie war. »Aber es liegt nicht daran, dass Sie über dreißig wirken, Sie erscheinen bloß so viel … eleganter. Mir überlegen, möchte ich, glaube ich, sagen.«
»Ich bin nicht hergekommen, um über mein Alter oder meine Kleidung zu sprechen.« Mary Brownes Aussprache war von fast komischer Präzision, abrupt und hart. »Ich möchte, dass Sie meine Schwester suchen, die unsere Familie als Teenager aus den Augen verloren hat.«
»Aus den Augen verloren? Ist sie weggelaufen? Oder wurde sie von einem Elternteil gekidnappt, das nicht das Sorgerecht ausübte?«
Die Frage schien Mary Browne zu überraschen. »Sie ist aus freien Stücken gegangen, als sie achtzehn war. Es war absolut legal, wenn man ihr Alter in Betracht zieht, aber … ich meine …«
»Ich habe festgestellt«, sagte Tess, »dass es hilft, wenn die Leute mir von Anfang an die Wahrheit erzählen. Ich will nicht über Sie richten, und was Sie mir sagen, ist vertraulich.«
»Nun gut. Meine Schwester wurde schwanger, als sie achtzehn war, und meine Mutter hat sie rausgeworfen, als sie sagte, sie würde das Baby zur Adoption freigeben. So etwas tun wir nicht. Ist das genug ›Wahrheit‹ für Sie?«
»›Tun wir nicht‹?« Sie wiederholte papageienhaft Mary Brownes Worte, aber aus ihrem Munde klangen sie ein wenig hässlicher.
»Schwarze Familien kümmern sich umeinander, selbst wenn sie dafür Sozialhilfe benötigen. In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gab kein Mädchen sein Baby weg. Es der Mutter oder Großmutter zu geben – das war in Ordnung. Meine Mutter wollte ihr Enkelkind großziehen, aber Susan hatte etwas anderes im Sinn. Also warf meine Mutter sie hinaus – und ich schaute zu. Ich wusste, dass Susan das Richtige tat, hatte aber zu viel Angst vor meiner Mutter, um mich gegen sie zu stellen. Sie war eine großartige Frau, meine Mutter, unsere Mutter. Man legte sich nicht mit ihr an, wenn man nicht verlieren wollte. Susan war dazu bereit. Ich nicht.«
»Und wie lange haben Sie keinen Kontakt mehr zu Susan gehabt? Seit wie vielen Jahren?«
Tess nahm einen Notizblock aus ihrer Schreibtischschublade und machte sich Notizen. Mary Brownes geschäftliches Benehmen sorgte dafür, dass auch sie geschäftiger wirken wollte.
»Dreizehn. Dreizehn Jahre diesen Monat.«
»Sie hatten überhaupt keinen Kontakt zu ihr? Was ist mit Ihrer Mutter?«
»Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ich schätze, auch deswegen will ich sie finden. Sie ist die einzige Verwandte, die ich noch habe.«
»Also gut, erledigen wir erst mal die Formalitäten.« Tess schaltete ihren Macintosh an, der auf einem Computertisch neben ihrem Schreibtisch stand. »Ich habe Ihnen schon meine Stundensätze und das mit den Auslagen erklärt, als Sie anriefen. Sie waren schon bei Tyner, also muss ich jetzt nur noch eine Datei für Sie anlegen. Ich habe hier ein Formular, in dem Ihr Name, Ihre Adresse und Telefonnummer stehen, aber ich muss noch ein paar Dinge wissen, um anfangen zu können. Darf ich fragen, was Sie beruflich tun?«
»Ich bin selbstständig. Ich arbeite als Lobbyistin für Wohltätigkeitsorganisationen.«
Selbstständig. Das ließ Alarmglocken schrillen. Tess sollte Mary Brownes Kreditwürdigkeit überprüfen, um sicherzugehen, dass sie Geld genug hatte, sie zu bezahlen.
»Wie haben Sie von meinem Büro gehört, Miss Browne?« Tante Kitty, ganz Geschäftsfrau, hatte ihr empfohlen, danach zu fragen, um ihr Marketing verbessern zu können.
»Ich wollte eine unabhängige Geschäftsfrau wie mich selbst beauftragen, und ich habe mich erinnert, etwas über Sie im Daily Record gelesen zu haben. Da stand, dass Sie in Mr. Keyes’ Firma eingetreten sind. Und ich erinnerte mich an Ihren Namen. Diesen Winter war etwas über Sie in der Zeitung, nicht wahr? Ich weiß nicht mehr genau, was – jemand hat versucht, Sie zu töten, oder vielleicht haben auch Sie beinahe jemanden getötet, als Sie im Leakin Park angegriffen wurden?«
»So in der Art«, sagte Tess unzufrieden, und ihre Rippen, die inzwischen vollständig abgeheilt waren, schienen trotzdem in Erinnerung daran, was ein Fußtritt anrichten konnte, zu schmerzen. »Der vollständige Name Ihrer Schwester?«
»Susan Evelyn King.«
»King?«
»Verschiedene Väter«, sagte Mary Browne kurz angebunden, und ihr Blick forderte Tess heraus, einen Kommentar zu wagen.
»Kennen Sie ihre Sozialversicherungsnummer?«
»Warum … nein, leider nicht. Ist die nötig?«
»Nein, sie macht die Sache bloß einfacher. Wann wurde sie geboren?«
»Sie ist am 17. Januar zweiunddreißig geworden.«
Tess schaute Mary Browne an. »Ich dachte, Sie hätten gesagt, Sie wären zweiunddreißig. Wie kann Ihre Schwester gleich alt sein?«
Wenn man ihre dunkle Hautfarbe in Betracht zog, war es unmöglich zu sagen, ob Mary Browne tatsächlich errötete, aber irgendwie schien sie peinlich berührt zu sein.
»Ich meinte, ich werde im Dezember zweiunddreißig«, sagte Mary Browne steif. »Wir wurden im selben Jahr geboren, fast genau elf Monate nacheinander.«
Eitelkeit, dein Name ist Frau. Aber was ging es Tess an, wenn Mary Browne sich jünger machen wollte? Wahrscheinlich war sie schon vierunddreißig oder fünfunddreißig und log, was ihr Alter anging. Aber wenn Tess erst einmal über dreißig war, würde es ihr ja vielleicht genauso gehen.
»Ich hab zwei Cousins väterlicherseits, bei denen es genauso war«, sagte sie und tippte Susan Kings Geburtsdatum ein. »Sie werden die irischen Zwillinge genannt. Als meine Tante Vivian im selben Kalenderjahr den zweiten Jungen zur Welt brachte, erledigten die Ärzte im Mercy die zweite Beschneidung umsonst.«
Mary Browne erlaubte sich ein kleines Lächeln mit zusammengepressten Lippen, dann reichte sie Tess den braunen Umschlag, den sie am Anfang des Gesprächs aus ihrer ledernen Aktentasche genommen hatte. Darin steckten ein Foto und ein Scheck über die Vorschusssumme.
»Ist sie das?«, fragte Tess. Das Mädchen auf dem Foto hatte breite Schultern und wirkte dicklich. In großen Brillengläsern spiegelte sich der Blitz der Kamera, sodass ihr Gesicht wenig mehr war als ein dunkler Fleck mit zwei explodierenden Sternen darin. Sie trug eine Schürze und hielt irgendetwas am Griff, einen Besen oder einen Mob. Das konnte auch Jimmy Hoffa sein – oder Madalyn Murray O’Hair, ebenfalls ein verschwundener Baltimorer. Das Foto war völlig nutzlos, aber der Scheck – nun ja, es war schlechter Stil, einen Scheck zu gierig anzustarren.
»Das ist sie mit siebzehn.«
»Ist Ihnen nicht sehr ähnlich, oder? Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie seien bloß Halbschwestern.«
»Sie war im Grunde ein hübsches Mädchen, nur nicht besonders fotogen.«
»Ja, klar«, sagte Tess zweifelnd.
»Das ist alles, was ich habe.« Mary Browne schaffte es, zugleich entschuldigend und defensiv zu klingen. »Aber ich denke, es ist ungefähr so hilfreich, als wollte jemand Sie mit dem Foto da an der Wand ausfindig machen.«
Großartig. Mary Brownes gnadenloser Blick hatte das Foto mit dem fliegenden Hasen entdeckt. Tess musste sich unbedingt etwas anderes suchen, um es vor den Safe zu hängen.
»Das ist vor dem alten Weinstein-Drugstore in der Edmondson Avenue aufgenommen worden. Erinnern Sie sich, das war im selben Einkaufszentrum wie der alte Hess-Schuhladen, mit dem Friseursalon und den Spielzeugeichhörnchen im Schaufenster?«
»Wir haben unsere Schuhe nicht bei Hess gekauft, aber ja, ich weiß, wovon Sie reden.«
Ich weiß, wovon Sie reden – wenn man die Augen zumachte, könnte sie auch aus der neuesten BBC-Produktion von Jane Austen stammen. »Meine Mutter hat mich mitgenommen, um die Affen anzuschauen.«
»Nur Sie?« Tess hatte das Gefühl, Mary Browne hätte ihr nicht alles gesagt. Das taten die Leute oft. Vielleicht war mehr dran an der Geschichte, wieso Susan King abgehauen war – das hässliche, ungeliebte Entlein, das im Schatten dieses Schwans aufwuchs.
»Susan natürlich auch.«
»Das Foto jedenfalls stammt von dem Tag, an dem ich eine böse Lektion lernte. Meinem Großvater gehörte Weinstein’s, also dachte ich, ich könnte endlose Runden auf dem fliegenden Hasen drehen. Aber wenn mein Quarter alle war, war er alle, genau wie bei jedem anderen. Poppa hatte ein weiches Herz, er ließ mich ewig weiterfahren, aber Gramma hielt die Regeln ein. ›Du bezahlst wie die anderen Kinder!‹ Ich durfte nicht umsonst fahren, und ich bekam auch keine Getränke umsonst, obwohl Poppa mir manchmal ein bisschen Schokolade rüberschob.«
»Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber Sie sehen ein wenig aus wie dieses kleine Mädchen, das vor Jahren im Fernsehen zu sehen war und auf dem Sofa mit einem Plastiküberzug herumhüpfte.«
»Sie meinen« – Tess wechselte in den Baltimore-Akzent, den anzunehmen ihre Mutter sie gehindert hatte: »›Hey, ihr Kinder, hüfft nicht auf den Möbeln rum! Ihr macht die kabbut!‹«
»Ja, genau das. Ich weiß noch, dass ich mir wünschte, meine Mutter würde diese Plastiküberzüge kaufen, weil ich glaubte, dann könnte ich ewich