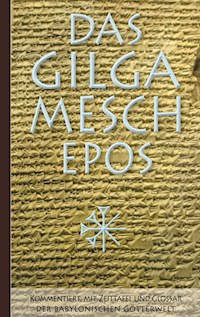
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Gilgamesch-Epos | Mit erklärendem Vorwort, umfangreichem Glossar der babylonischen Götterwelt und Zeittafel | Gilgamesch ist der älteste antike Held, dessen Existenz sich tatsächlich zurückverfolgen lässt. Gleichzeitig ist das auf Keilschrift-Tafeln festgehaltene Gilgamesch-Epos eines der ältesten bekannten schriftlichen Dokumente der Menschheit. Gilgamesch herrschte in der antiken Stadt Uruk in Mesopotamien, vermutlich zwischen 2652 und 2602 vor unserer Zeitrechnung. Damals - also rund 1500 Jahre vor dem Trojanischen Krieg mit seinen Helden Achilles und Odysseus - war Uruk vielleicht die kulturell am höchsten entwickelte Stadt der Welt. Das Epos berichtet davon, dass Gilgamesch, der seine Untertanen hart und undankbar behandelt, nach dem Willen der Götter vom wilden Enkidu zum Kampf herausgefordert wird. - Doch der Kampf endet unentschieden, beide schließen Freundschaft. Nun bestehen sie gemeinsame Abenteuer, die jedoch die Götter weiter erzürnen ... Gilgamesch beginnt eine Reise nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Sie führt ihn zuletzt zum Weisen Utnapischtim.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Zum Inhalt
Die Sumerer
Die Stadt Uruk
Anmerkung zum Text
Erste Tafel
Zweite Tafel
Dritte Tafel
Vierte Tafel
Fünfte Tafel
Sechste Tafel
Siebte Tafel
Achte Tafel
Neunte Tafel
Zehnte Tafel
Elfte Tafel
Zwölfte Tafel
Zeittafel
Genese des Werkes
Vorwort
GILGAMESCH ist der älteste antike Held, dessen Existenz sich tatsächlich zurückverfolgen lässt. Gleichzeitig ist das auf Keilschrift1-Tafeln festgehaltene Gilgamesch-Epos eines der ältesten bekannten schriftlichen Dokumente der Menschheit.
Laut überlieferter sumerischer Königslisten war Gilgamesch einer der ersten Könige (der fünfte König der ersten Dynastie) in der Stadt Uruk in Mesopotamien, auf dem Gebiet des heutigen Irak – etwa 180 Kilometer südlich von Babylon (heute Babil).
Gilgamesch herrschte hier von ungefähr 2652 bis 2602 v. Chr. – also rund 1500 Jahre vor dem Trojanischen Krieg und den griechischen Helden Achilles und Odysseus. Man schreibt ihm eine harte Regentschaft zu, andererseits soll er auch viel für sein Reich getan haben. Er vervollständigte die Unabhängigkeit Uruks, eröffnete neue Handelswege und ließ die Stadt mit einer 11,3 Kilometer langen, etwa 9 Meter hohen und ebenso tiefen Stadtmauer umgeben. Zu dieser Zeit war Uruk vielleicht die kulturell am höchsten entwickelte Stadt der ganzen Welt, mit Arbeitsteilung, Kunst, einem Priesterwesen und Bürokratie – und nicht zuletzt der ersten bekannten Schrift, der Keilschrift, die sich in dieser Region entwickelte.
Von den nachfolgenden Generationen wurde Gilgamesch schon bald als gottähnlich verehrt. Man sah ihn als Sohn der Göttin Ninsun und des vergöttlichten Königs Lugalbanda an. Die Götter hatten entschieden, dass Gilgamesch zu seiner menschlichen Natur zwei göttliche Attribute erhalten sollte: Die Manneskraft von Šamaš (Sonnengott) und den Heldensinn von Adad. Damit war Gilgamesch zu »zwei Drittel göttlich und einem Drittel menschlich« – somit auch sterblich.
In den tausend Jahren nach Gilgameschs Regentschaft entstanden zahlreiche Sagen, die um den gottähnlichen Helden kreisten und in verschiedenen Sprachen (Akkadisch, Hurritisch und Hethitisch) verfasst wurden. Die Erzählungen verbreiteten sich im gesamten Nahen Osten. Textfragmente in Keilschrift fand man zum Beispiel in der alten Hauptstadt Assyriens, Assur am Tigris, und auf dem Hügel Sutantepe (oder Chusirina) nahe Harran in Nordmesopotamien.
Im zwölften Jahrhundert v. Chr. machte sich der Schreiber und Orakelpriester Sîn-leqe-unnīnī2 daran, die Erzählungen um Gilgamesch neu zu sichten und zu einem einheitlichen Werk zusammenzufassen. Er verwendete dazu einen Teil – jedoch nicht alle – der bis dahin bekannten Gilgamesch-Sagen. Das Ergebnis, das Zwölftafel-Epos, ist das heute allgemein Gilgamesch-Epos genannte Werk. Die Endversion des Epos mit etwa 3.600 Verszeilen wurde vermutlich in Uruk auf elf Keilschrifttafeln niedergeschrieben. Den größten Teil des noch erhaltenen Textes fand man – um eine zwölfte Tafel ergänzt – in der sagenhaften, großen Tontafelbibliothek des Assyrerkönigs Aschurbanapli (biblisch: Assurbanipal) (669–627 v. Chr.) in dessen Hauptstadt Ninive.
1Keilschrift: Die altmesopotamische Keilschrift ist die älteste bekannte Schrift. Sie wurde von den Sumerern entwickelt und hat ihren Namen von den keilförmigen Eindrücken des Schreibgeräts, eines Griffels aus Rohr, mit dem in feuchte Tontafeln geritzt wurde. Diese wurden anschließend gebrannt oder getrocknet. Archäologen fanden bisher ca. 500.000 dieser Tafeln, als Bruchstücke oder unversehrt. Aus solchen Tafeln konnte das Gilgamesch-Epos rekonstruiert werden. – Die voll entwickelte Keilschrift verfügte über rund 600 Zeichen. Ungefähr die Hälfte dieser Zeichen konnte entweder als Logogramm oder als Silbe eingesetzt werden, die anderen waren nur Logogramme. Der Schritt zu einem Alphabet (bei dem jedes Zeichen einem Laut entspricht) wurde noch nicht vollzogen.
2Sîn-leqe-unnīnī (Sinleke-unini, 12. Jhd. v. Chr.): Stammvater einer späteren Priesterfamilie in Uruk. Mutmaßlicher Verfasser des 12-Tafel-Gilgamesch-Epos.
Zum Inhalt
GILGAMESCH, zu Beginn ein übermütiger und stolzer König, verlangt seinen Untertanen viel ab – zu viel. Immer wieder zieht er sie zu Bauprojekten seiner Paläste heran, lässt sie schuften, regiert despotisch und zeigt keine Dankbarkeit. Die Frauen von Uruk beschweren sich bei der Göttin Ištar, die Gilgamesch in seine Schranken weisen soll. So erschafft die Muttergöttin Aruru gemäß der Anordnung des Himmelsgottes Anu, Vater der Ištar, aus Lehm den Enkidu, der – mehr wildes Tier als Mensch –, ungeheuer stark und wild, in der Steppe nahe Uruk haust, und der Gilgamesch besiegen soll. Doch noch ist Enkidu nicht reif, den Kampf mit dem König aufzunehmen. Erst muss er durch den siebentägigen Umgang und Beischlaf mit einer Tempeldienerin, die aus Uruk zu ihm entsandt wird, zivilisiert werden.
Nach dem Liebesspiel vergisst Enkidu sein bäuerliches Dasein und seine Herde und zieht mit der neuen Gefährtin zurück nach Uruk. Unterwegs lernt er zivilisierte Nahrung und Getränke kennen und wird von einem Barbier vollends menschlich gemacht. In Uruk kommt es schließlich zum von den Göttern gewollten Kampf mit Gilgamesch. Doch dieser schlägt sich gegen den Wilden aus der Steppe besser als erwartet: Der Kampf endet unentschieden. Ermüdet sinken beide schließlich nieder und schließen Freundschaft.
Nun nehmen sie sich vor, gemeinsame Heldentaten zu vollbringen und ziehen los zum Zedernwald der Ištar, um dort Chumbaba, den Hüter des Waldes, zu töten und Zedern zu fällen. Doch Ištar, die Göttliche, hasst Gilgamesch nicht wegen dieses Frevels, sondern erst, als er ihre Liebesschwüre beleidigend zurückweist. Er wagt es sogar, zu ihr zu sagen: »An der Straße, da sei dein Sitz, ... dann wird dich nehmen, wer immer Lust dazu hat.«
Zutiefst gekränkt fordert Ištar ihren Vater Anu auf, den Himmels-Stier auszusenden, der Gilgamesch und seine Anhänger töten soll. Doch Enkidu und Gilgamesch können das Ungeheuer besiegen. Die Götter schicken zur Strafe eine Krankheit, an der Enkidu stirbt.
Verzweifelt über den Tod seines Freundes, beginnt Gilgamesch eine Reise nach dem Sinn des Lebens und dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Die Reise führt ihn durch viele Stationen des Jenseits, etwa den mit Edelsteinbäumen bewachsenen Garten, oder das ›Wasser des Todes‹, das er mit Hilfe des Fährmannes Urschanabi überquert. Am Ende kommt er zum Weisen Utnapischtim am Ende der Welt, von dem er das Geheimnis der Unsterblichkeit erfahren möchte.
Dieser erzählt Gilgamesch die Geschichte einer großen Flut (von der die Sintflut-Sage in der Bibel inspiriert ist); diese Erzählung findet sich auf der elften und bekanntesten Keilschrift-Tafel aus Assurbanipals Bibliothek.
Später verrät Utnapischtim dem Gilgamesch, dass sich im Meer ein Gewächs befindet, »dem Stechdorn ähnlich«, das ewige Jugend verleihe. Gilgamesch taucht ins Meer hinab und bringt das Gewächs an Land. Doch auf dem Rückweg nach Uruk –während Gilgamesch sich an einem Brunnen wäscht, schnappt eine Schlange das Gewächs und vertilgt es. Enttäuscht, doch klüger, kehrt Gilgamesch nach Uruk zurück, bereichert um die Erkenntnis, dass er sich nur durch große Werke als guter König einen unsterblichen Namen machen kann. So beginnt er mit dem Bau der Stadtmauern von Uruk.
Zuletzt steigt Enkidus Geist aus seinem Grabe auf und beschwört den Freund, sich dem irdischen Los (der Sterblichkeit) zu unterwerfen. © A. Fischer, 2014
Die Sumerer
(Sumerisch: Ki-engir/Akkadisch: Shumerum): Volk, das sich ca. 3500 v. Chr. am Euphrat nahe des Persischen Golfs ansiedelte und dort anderthalb Jahrtausende die Herrschaft ausübte. Die Geschichte der Sumerer wurde auf Tontafeln, die in Keilschrift geschrieben sind, festgehalten.
Vorgeschichte: Im 5. Jahrtausend v. Chr. siedelte das Volk der Ubaidier in jener Region Westasiens, die später als Sumer bekannt wurde. Aus diesen Siedlungen entstanden die bedeutenden sumerischen Städte Adab, Eridu, Isin, Kisch, Kullab, Lagasch, Larsam, Nippur, Uruk und Ur (heute die Ruinenstätte Tell Mukajir, 150 Kilometer westlich von Basra, Irak, südlich des Euphrats). Einige Jahrhunderte später kamen Semiten aus den syrischen und arabischen Wüsten in dieses Gebiet.
Nach 3250 v. Chr. zog ein anderes Volk aus dem Nordosten von Mesopotamien in diese Region und begann, sich mit der Urbevölkerung zu vermischen. Dieses Volk, das später den Namen Sumerer tragen sollte, sprach eine agglutinierende Sprache3, die mit kaum einer gegenwärtig existierenden Sprache zu vergleichen ist. – In den folgenden Jahrhunderten wurde das Land reich und mächtig. Kunst, Architektur und Handwerk kamen zur Blüte, und die Hauptsprache des Landes wurde Sumerisch. Die Sumerer entwickelten eine eigene Schrift, die Keilschrift. Für etwa 2000 Jahre war sie das Hauptmedium der schriftlichen Kommunikation in Westasien. Der erste nachgewiesene Herrscher von Sumer war Etana, König von Kisch (ca. 2800 v. Chr.). Die Stadt Uruk erreichte unter Gilgamesch (ca. 2652 bis 2602 v. Chr.), dessen Taten im Gilgamesch-Epos gepriesen werden, eine politisch herausragende Stellung.
Die Stadt Uruk
Sumerischer Stadtstaat, in der Bibel Erech benannt, heute die Ruinenstätte Warka im Irak. Uruk lag im Altertum am Euphrat, heute rund 20 Kilometer von seinem Nordufer entfernt in der Wüste, da sich der Flusslauf verändert hat. Die Stadt war seit etwa 4000 v. Chr. besiedelt. Zwischen 3500 und 3100 v. Chr. (der so genannten ›Uruk-Zeit‹) bestand dort eine Kultur, die eine charakteristische Keramik herstellte. In der zweiten Hälfte dieser Epoche begann man prächtige Tempelanlagen mit Ziegelsäulen und geometrischen Tonstiftmosaiken zu errichten und entwickelte ein System von Bildzeichen (Piktogramme), das als älteste nachgewiesene Schrift gilt. Daraus entstand die sumerische Keilschrift. Seit Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. war Uruk ein wichtiger Stadtstaat Sumers und als Kultzentrum der obersten Gottheit Anu auch ein religiöser Mittelpunkt des Reiches. Bedeutende Bauwerke der annähernd kreisförmigen Stadt mit elf Kilometer langer Stadtmauer waren u. a. der Anu-Schrein, der weiße Anu-Tempel, die große Anlage des Eanna-Tempelbezirks, die Archive und eine Zikkurat4.
Uruk ist nicht zu verwechseln mit der ebenfalls mächtigen, nur knapp 100 Kilometer südöstlich gelegenen sumerischen Stadt Ur.
3In agglutinierenden Sprachen (lat. agglutinare ›ankleben‹) wird die grammatische Funktion, beispielsweise Person, Zeit, Kasus, durch das Anfügen von Affixen (unselbstständige Wortbestandteile) kenntlich gemacht.
Anmerkung zum Text
Einige Keilschrifttafeln sind nur bruchstückhaft vorhanden, aus diesem Grund enthält der Text Auslassungen. In anderen Fällen ist die Übersetzung bestimmter Begriffe bis heute zweifelhaft. Unsicheres oder Ergänztes wurde im Lauftext des Epos kursiv gesetzt.
4Zikkurat (Ziggurat): Monumentale Tempelform im alten Mesopotamien. Zikkurats wurden seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. aus ungebrannten, luftgetrockneten Lehmziegeln errichtet und anschließend mit gebrannten, oft farbig glasierten Ziegeln verkleidet. Sie bestanden aus mehreren abgestuften quadratischen oder rechteckigen Plattformen, die zu einem kleinen Tempel oder Heiligtum führten. – Die berühmteste Zikkurat war der Tempelturm von Etemenanki (allgemein bekannt als Turm zu Babel) am Tempel des Gottes Marduk in Babylon, der von König Nabopolassar (625–605 v. Chr.) und seinem Sohn Nebukadnezar II. wieder aufgebaut wurde. Die größten Ruinen sind die der Elamite-Zikkurat in Choga Zambil Dur Untash (Iran, 3. Jahrhundert v. Chr.), die eine Grundfläche von 10.400 Quadratmetern (102 Metern im Quadrat) aufweisen.
Erste Tafel
[Gilgamesch,] der alle Tiefen auslotete, der die Fundamente des Landes gelegt hatte,
Der die Ferne kannte, Jegliches erfasst hatte, der gleichermaßen [...];
Der alles an Kenntnis der Dinge hatte, die Summe der Weisheit,
dazu hatte Anu5 ihn bestimmt.
Verwahrtes auch sah er, Verborgenes erblickte er;
brachte Kunde von der Zeit vor der Sintflut,
Einen weiten Weg legte er zurück, war dabei erschöpft einmal und dann wieder frisch.
Auf einen Denkstein hat er die ganze Mühsal gemeißelt.
Die Mauer um Uruk-Gart ließ er bauen,
Um das allerheiligste Eanna, den strahlenden Hort des Schatzes.
Sieh an seine Mauer, deren Friese wie Bronzeschalen scheinen!
Ihren Sockel beschau, dem niemands Werk gleicht!
Auch den Blendstein fass an – der seit Urzeiten da ist! –
Nahe dich Eanna, dem Wohnsitz Ischtars6
Das kein späterer König, kein Mensch ebenso machen kann!
Auch steig auf die Mauer von Uruk, geh fürbass,
Prüfe die Gründung, besieh das Ziegelwerk!
Ob ihr Ziegelwerk nicht aus Backsteinen ist,
Ihren Grund nicht legten die sieben Weisen!
Ein Sar die Stadt, ein Sar die Palmgärten,
ein Sar die Flußniederung,
dazu der (heilige) Bereich des Ischtartempels:
Drei Sar und den (heiligen) Bereich von Uruk umschließt sie.
Sieh dir an die Urkundenkapsel aus Kupfer,
Nimm ab davon das Schloß aus Bronze!
Öffne die Tür vor seinem verborgenen Schatz,
Komm und lies gründlich die Lapislazuli-Tafel,
Die erzählt, wie er, Gilgamesch, durch alle Beschwernisse zog!
Überragend ist er weit voran den Königen, der
Ruhmreiche von schöner Gestalt,
Der heldenhafte Abkömmling von Uruk, der stößige Stier.
Er geht voran, ist der Allererste;
Er geht hinterher, ist die Stütze seiner Brüder,
Ein starkes Kampfnetz, der Schirm seines Heerbanns;
Eine wilde Wasserflut, die Steinmauern zerstört,
Sproß des Lugalbanda7, Gilgamesch, der an Kräften Vollkommene,
Kind der erhabenen Kuh Rimat-Ninsun.
Der Wildstier Gilgamesch, der Vollkommene, Ehrfurchtgebietende,
Der da fand die Eingänge in das Gebirge,
Der dürstete nach den Zisternen am Rand des Steppenlandes.
Der die See überfuhr, das weite, zum Sonnenaufgang hin liegende Meer.
Der die Weltränder ins Auge fasste, überall das Leben suchend,
Der in seiner Stärke gelangte bis hin zum fernen Utnapischtim8
Der die Städte wiederherstellte, die die Sintflut vernichtet hatte.
Nicht ... für die umwölkten Menschen,
Der mit ihm verglichen werden könnte für das Königtum,
Der wie Gilgamesch sprechen könnte: »Ich bin der König!«
Gilgamesch, seit dem Tage, an dem er geboren wurde, ist sein Name herrlich.
Zwei Drittel an ihm sind Gott, ein Drittel nur Mensch.
Das Bild seines Leibes hat ihm die Mach ...
Sie bereitete seine Gestalt ...
... ist prächtig
... [Zeile fehlt]
... [Zeile fehlt]
In den Hürden von Uruk geht er einher,
Wilde Kraft setzt er ein gleich dem Wildstier, erhabenen Schrittes!





























