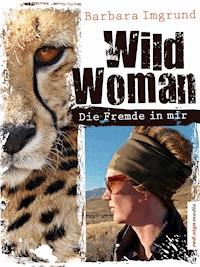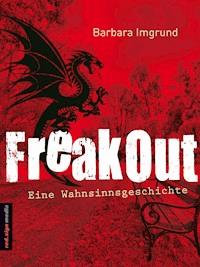Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: red.sign Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie hat per Notkaiserschnitt ihren Sohn tot zur Welt gebracht und kann keine weiteren Kinder bekommen. Fiebrig mäandert sie durch die Tage im Krankenhaus. Nachts, in ihren Albträumen, wird sie von einem dämonischen Schmetterling in den Abgrund getrieben. Schließlich bricht mit der Operationswunde auch die Verlassenheit wieder auf, die sie seit ihrer Kindheit begleitet: „Ich bin die, die übrig bleibt.“ Ihr Heil sucht Marie auf dem Friedhof gegenüber. Ein Glück, dass es dort viel lebendiger und launiger zugeht, als man meinen sollte – die Menschen, denen sie begegnet, sind ebenso gestrandet wie sie, sie haben nichts mehr zu verlieren. Doch schon bald spürt Ma-rie, dass etwas nicht stimmt. Es ist, als hätten Rose und Adrian, Siegfried und Gretel schon viele Jahre auf sie gewartet. Und allmählich dämmert ihr, dass ein gemeinsames Schicksal sie alle aneinander fesselt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glück ist Talent für das Schicksal.
Novalis
Nullpunkt
Manchmal verirre ich mich.
Manchmal verliere ich mich.
Ich bin diese andere,
aus der Zeit gefallen,
aus der Haut gefahren,
verrutscht, verrückt,
nur noch daneben
und in meinem Fremdkörper
immer weniger: ich.
Hingekritzelt stand das da, bleistiftgrau auf klopapierbeige. Sie musste es nachts geschrieben haben, schlaftrunken, zwischen dem letzten und dem nächsten Abgrund. Sie erinnerte sich nicht.
Marie schüttelte den Kopf. Schüttelte die Nacht und ihre Gespenster ab. Sie faltete ihr sonderbares Poem zusammen und schob es unters Kopfkissen. Vielleicht taugte es ja als Albtraumfänger.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1
Aufschrecken, ängstlich, in tiefer Nacht … Kein Geräusch, nichts ... Blei auf den Lidern ... Dunkel im Zimmer und Dunkel in ihr ... Zittern und Fürchten wie damals als Kind ... Allein, so allein ... und noch immer kaum wach ...
Marie kam allmählich zu sich. Lauschte mit angehaltenem Atem. Kein Monster im Raum. Nur dieser Traum, erneut dieser Traum. Ein Zitronenfalter mit Menschenaugen. Er wandte das Köpfchen und sah sie an. Unverwandt, zeitalterlang … dann flog er davon. Komm, komm, hieß das, ich zeige dir etwas, und sie folgte ihm. Es galt ihr Leben, warum, wusste sie nicht, und sie lief und lief, und sie erreichte ihn nie. Sie ahnte, sie musste zu ihm, und sie erreichte ihn nie. Verzweifeln und Schluchzen. Dann, plötzlich, ein Abgrund, jäh, schwarz und tief, und ein Gedanke, der von nirgendwo kam.
Ich bin die, die übrig bleibt.
Sie stürzte hinein in das schwarze Loch, und die Angst, die sie packte, hatte scharfe Klauen. Doch sie schlug nie auf, sie wurde nur wach. Und der Zitronenfalter war fort und sein Geheimnis mit ihm.
Du hast geträumt, Marie, nur geträumt ...
Die Stimme ihrer Mutter flüsterte so klein durch die Zeit, sie hörte es kaum. Ihr Trost hatte keine Kraft, es war zu lange her. Marie passte nun selbst auf sich auf. Nur nicht so gut.
Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Ihr fiel wieder ein, wo sie war. In Sicherheit. Beim Aufatmen kam sie sich schon albern vor. Träume zerstoben, wenn man Licht machte. Doch sie fand den Schalter nicht … Warum meinte der Zitronenfalter sie? Warum lockte er sie in den Abgrund? Sie sah das Gelb seiner Flügel, das sie an Frühling erinnerte und an freundliches Gaukeln im Sonnenschein, und sie verstand nicht, warum sie sich fürchtete. Diese Augen. Blaue Augen, so groß, dass man darin ertrinken konnte … Er wollte, dass sie in Abgründe blickte … Was sollte sie sehen?
Wieder schreckte Marie hoch. Ihr Haar war feucht, der Pyjama klebte auf der Haut. Kälte und Hitze schüttelten sie. Unter dem Pflaster klopfte es. Beim Verbandswechsel hatte sie die Wunde gesehen. Keine Spur von einer sauberen Naht, die heilen wollte.
Wenn sie den Rufknopf drückte, musste sie nicht mehr allein sein. Die Nachtschwester würde kommen und Licht machen. Sie würde ihr einen frischen Pyjama aus dem Schrank geben und den Kissenbezug wechseln. Ein bisschen hastig vielleicht, weil Marie nicht die Einzige auf der Station war, die gegen Dämonen kämpfte. Aber Marie würde gleich wärmer werden, und das Fürchten würde aufhören. Warum konnte sie sich dieses Geschenk nicht machen?
„Ist alles in Ordnung bei Ihnen?“
Die Nachtwache hatte lautlos die Tür geöffnet. Keine Schwester, ein Pfleger. Wie ein freundlicher Engel stand er dort, umflossen vom Licht, das hinter ihm aus dem Korridor hereindrang. Ein Engel aus Fleisch und Blut mit verdammt gutem Timing.
Sie setzte sich mühsam im Bett auf. „Ja ... Nein ... Ich weiß es nicht. Albträume.“ Sie klang wie eine Neunjährige. Dreißig Jahre zu jung.
Der Pfleger schaltete die Deckenbeleuchtung ein. „Haben Sie Ihre Schlaftablette genommen?“
Marie blinzelte in die plötzliche Helligkeit und schüttelte den Kopf. „Danach bin ich morgens so –“ Sie suchte nach dem richtigen Wort. „Betäubt. Unzurechnungsfähig … Es fühlt sich nicht richtig an.“
„Ich weiß.“ Der Pfleger nickte. „Möchten Sie darüber sprechen?“
Marie sah ihn groß an. „Worüber?“
„Über Ihre Albträume.“
Gut, dann erzähle ich es eben. Die Nacht ist noch lang. Dunkelheit wie schwarze Watte. Zentnerschwer. Vielleicht wacht die Welt sonst nie wieder auf, und ich bleibe allein mit meiner Ewigkeit … Aber das denke ich immer um diese Zeit. Das geht vorbei, ich muss nur fest daran glauben. Ich bin ja wach.
„Ich bin doch wach, oder?“, fragte sie.
„Ja.“ Der Pfleger zog den Besucherstuhl ans Bett und setzte sich so, dass Marie ihn sehen konnte, ohne sich den Hals zu verrenken. Nun konnte sie auch das Namensschild lesen, das oben an seiner Brusttasche befestigt war: Pfleger Emil. „Und ich bin hier.“
„Das hilft.“ Marie wagte ein Lächeln. „Ein bisschen.“
Dann begann sie zu erzählen, von dem menschenäugigen Zitronenfalter, der sie jede Nacht in den Abgrund lockte. Von der Angst und dem Kleinsein im Dunkeln und von der Leere bei Tageslicht. Davon, dass sie plötzlich nicht mehr wusste, wie das ging: weitermachen. Sie erzählte, als säße ein vertrauter Freund vor ihr und nicht ein Wildfremder. Aber sie wunderte sich nicht.
„Ich bin wie ein Gast im eigenen Leben. Als wäre ich nur auf der Durchreise, aber ich weiß nicht, wohin ... Ich weiß überhaupt nichts mehr. Am wenigsten weiß ich Bescheid über die Marie, die ich bis vor Kurzem war. Während ich schlafe, stürze ich in ein schwarzes Loch, und Morgen für Morgen muss ich mühsam herausklettern.“ Sie fügte leise hinzu: „Sie haben ja keine Ahnung, wie anstrengend das ist.“
Emil nickte. „Doch. Schon.“ Leise sprach er weiter. „Ich glaube, Sie müssen da durch. Traumbilder sind Übersetzungen, die unser Unterbewusstsein für etwas findet, das uns beschäftigt. Wenn wir träumen, verarbeiten wir schon. Und das ist gut.“
Sie verzog den Mund. „Verarbeiten. Ich weiß nicht, ob man so etwas jemals verarbeiten kann.“
„Wenn Sie den Träumen ihren Schrecken nehmen wollen, müssen Sie sich damit beschäftigen. Schauen Sie hin, nicht weg! Überlegen Sie, warum es ein Zitronenfalter ist, der Sie heimsucht, ein Zitronenfalter mit Menschenaugen ... Vielleicht können Sie die Träume umdeuten. Vielleicht bedeuten sie etwas anderes, als Sie im Moment glauben, und Sie müssen gar keine Angst vor ihnen haben.“ Emil schüttelte den Kopf. „Das, was Sie erlebt haben, versteckt man nicht im Besenschrank und macht weiter, als wäre nichts gewesen. Sonst sucht es sich andere Wege. Unsere Dämonen finden uns, ob wir wollen oder nicht.“
Marie sah ihn an, als wäre er wirklich ein Engel, der aus dem Licht gekommen war. Hinschauen. Finden. Umdeuten. Es klang so einfach. Wie ein Spiel, so leicht. Kinderleicht …
Emil war ein guter Pfleger, deshalb tröstete er sie nicht, als sie zu weinen begann. Er nickte nur und reichte ihr die Spenderbox vom Nachttisch. Im Hunderterpack kam das heulende Elend billiger. Sie nahm ein Taschentuch, schneuzte hinein und weinte weiter, weil sie noch lange nicht fertig war. Aber der Druck auf ihrer Brust wurde ein bisschen weniger, als würde ein Schmetterling losfliegen, sodass nur noch zehntausend andere übrig blieben.
Draußen auf dem Gang ertönte ein Signal – ein anderer Patient, den die Nacht umtrieb. Emil stand auf und rückte den Stuhl wieder an den Tisch. „Tut mir leid. Ich muss jetzt gehen. Aber ich bin die ganze Nacht nicht weiter als fünfzig Meter von Ihnen entfernt. Wenn Sie etwas brauchen oder der Zitronenfalter zurückkommt, klingeln Sie, ja?“
Marie nickte. Sprechen ging noch nicht wieder.
Als Emil schon an der Tür war, drehte er sich noch einmal um. „Sie hatten eine schwere Operation und haben viel Blut verloren – ganz zu schweigen von … allem anderen. Sie haben noch Fieber. Passen Sie gut auf sich auf.“
Sie nickte erneut.
Emil schien etwas einzufallen. Er sah sie eindringlich an. „Ich habe keinen Vermerk in Ihrem Krankenblatt gelesen, dass Sie Ihre Schlaftabletten nicht nehmen ... Sammeln Sie sie?“
Marie antwortete nicht.
„Sie haben nicht zufällig einen Plan B?“, fragte er weiter.
„Es ist immer gut, einen Plan B zu haben.“ Ihre Stimme klang zitterig, aber in ihrem Blick lag Trotz.
Ihr guter Engel schüttelte den Kopf. „Das ist kein Plan. Das ist zur Hintertür hinausgeschlichen.“
Sie fühlte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. „Denken Sie, was Sie wollen. Es ist mein Leben.“
„Dann nicht mehr.“
Marie wusste, dass er mit allem recht hatte, was er gesagt hatte, seitdem er ihr Zimmer betreten hatte. Sie hatte nur nicht genügend Taschentücher, um es zuzugeben. Stattdessen dachte sie daran, dass sie gleich wieder mit der Dunkelheit allein sein würde. „Ich muss etwas wissen“, sagte sie nach ein paar Atemzügen.
Emil rührte sich nicht von der Stelle, obwohl die Patientenklingel ein zweites und drittes Mal ertönte. „Ja?“
„Haben Sie auch Ihre Dämonen – oder bin ich die Einzige?“
Emil lächelte, als hätte sich das Warten nun doch gelohnt. „Natürlich habe ich meine Dämonen“, antwortete er. „Ich glaube, ich habe sie erfunden. Aber das glaubt jeder.“
Dann schaltete er die Deckenbeleuchtung aus, zog die Tür hinter sich zu, und fort war er.
Reflexhaft knipste Marie die Nachttischlampe an. Die Schatten wieselten vor dem Lichtkegel in die hintersten Ecken des Raums davon. Ansonsten: Leere. Kein Grund zur Besorgnis also, alle Dämonen und Zitronenfalter hatten Feierabend. Nach ein paar Sekunden knipste sie das Licht wieder aus. Zu leicht. Das war zu leicht.
Es klopft in meinem Bauch, als wäre Leben da drin. Sind das meine Dämonen? Anschauen soll ich sie. Umdeuten. Na gut, dann kommt, hier bin ich. Auf unruhige Nächte war ich schon eingestellt. Ich kann euch Schlaflieder singen, ich habe viel geübt in letzter Zeit. Nur sagt endlich, was zu sagen ist, ich bin so fürchterlich müde.
Heil will ich werden und falle doch immer mehr auseinander. Aus den Fugen ... Alles gerät aus den Fugen.
2
Frühling lag in der Luft, und wenn Marie in den Klinikgarten hinunterging, fand sie hier und da sogar schon ein paar Gänseblümchen. Vor einer Woche hatte der Himmel noch Schnee gespuckt, und nun murmelte der Bach, der durch den kleinen Park floss, schon wieder lustig vor sich hin.
Ein Zitronenfalter flatterte vorbei. Er gaukelte ihr vor, dass alles leicht und mühelos war und dass das Leben jetzt wieder begann. Lügner, dachte sie, heute Nacht kommst du zurück und lockst mich wieder hinunter in dieses schwarze Loch. Jenseits der hohen Mauer, die den Garten begrenzte, strömte die große Straße dahin. Doch man hörte nicht mehr als ein Brummen wie von einem Bienenschwarm, der trunken vor Sonne war.
Marie saß auf der Bank und genoss die Wärme auf ihrem Gesicht. Nun will der Lenz uns grüßen ... Sie kramte in ihrem Gedächtnis nach der Melodie; mehr als ein paar Töne wollten ihr nicht einfallen. Es war zu lange her. Sie erinnerte sich ja nicht einmal mehr an das Gesicht ihrer Mutter, die ihr das Lied vorgesungen hatte.
Das Wiedersehen mit ihrem Spiegelbild vorhin war das blanke Grauen gewesen – Schatten unter den Augen, fleckige Haut, kleiner Blick. Kein Wunder, sie hatte noch stundenlang wach gelegen nach dem Gespräch mit Emil. Ein paar Mal war sie versucht gewesen, den Rufknopf zu drücken, um nicht mehr allein zu sein. Dann war ihr ein Satz eingefallen, den er gesagt hatte: Sie müssen da durch. Und sie hatte es ausgehalten, bis die Spenderbox auf ihrem Nachttisch leer gewesen war.
„Da bist du ja!“
Marie wandte den Kopf. Sie hatte ihn gar nicht kommen gehört. „Matti …“
Er beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss auf den Scheitel. „Ich habe dich gesucht.“
„Und hier bin ich … Hörst du, wie der Frühling kommt?“
Er lachte. „Nein. Aber ich sehe es.“
Sie zog ihn neben sich auf die Bank. „Wenn wir beide ganz still sind, dann hörst du es auch.“
„Also gut“, nickte er. „Ich wollte dir zwar gerade erzählen –“
„Schsch.“ Sie drückte ihm den Zeigefinger auf den Mund. „Gleich. Aber lass uns vorher den Frühling hören.“
Matti legte den Arm um sie. Dann lauschten sie dem Glucksen des Bächleins, dem Gezwitscher der Vögel und dem Aufatmen der Welt. Wenn die Sonne wollte, hatte sie schon ordentlich Kraft. Im Moment wollte sie, und mit ihrer Hilfe war es für ein oder zwei Sekunden ganz leicht, so zu tun, als wäre alles gut. Fast hätte Marie es selbst geglaubt.
Verstohlen betrachtete sie ihren Mann von der Seite. Ob er sich auch durch diese Nächte quälte? Wie viele unzählige Male hatte sie schon in Mattis Gesicht geblickt, in diese rehbraunen Augen, auf die etwas zu groß geratene Nase und den weichen Mund, der so selten laut wurde. Kein anderes Gesicht war ihr so vertraut wie dieses; an das ihres Vaters hatte sie sich nie erinnert, und das ihrer Mutter hatte sie längst vergessen. Matti war als Einziger immer bei ihr geblieben. Wie es wohl sein musste, auch ihn zu verlieren … Sie schob schnell ein bisschen Sonne vor den Gedanken.
Er wurde unruhig. Offenbar war er fertig damit, den Frühling zu hören. Er nahm seinen Arm wieder an sich.
Marie lächelte. „Na schön. Also los. Was wolltest du mir erzählen?“
„Wir haben den Zuschlag bekommen“, sagte er. „Wir haben den Großkunden und das Projekt!“
Das Lächeln entglitt ihr nur einen Sekundenbruchteil lang. „Fein.“
„Das klingt nicht begeistert.“
„Nein, ehrlich. Gratulation.“ Sie rang sich noch ein halbherziges Lächeln ab. „Ich freue mich für dich. Ihr habt doch so schwer dafür gearbeitet.“
„Allerdings“, nickte er. „Es war ein harter Brocken. Aber wir haben es geschafft. Weißt du, was das heißt?“
„Nein. Was heißt es denn?“
„Das Projekt läuft mindestens zwei Jahre. Marie, das sind zwei Jahre, in denen wir uns keine Sorgen machen müssen. Zwei Jahre, in denen wir keine anderen Aufträge brauchen!“
„Ja, das ist schön“, sagte sie leise. „Für dich. Aber es sind auch zwei Jahre, in denen ich keinen Mann haben werde. Das ist nicht so schön für mich.“
Das Rehbraun in seinen Augen wurde schmal. „Fängst du schon wieder damit an?“
„Sonst tut es ja keiner.“
Er rückte ein wenig von ihr ab, und sie merkte, dass sie fror. Von einem Augenblick auf den anderen schien die Sonne keine Kraft mehr zu haben. Wie sie.
Der Mann neben ihr in dem braunen Cordanzug, den sie so sehr an ihm mochte, biss sich auf die Lippen.
Matti, sag was. Lass mich nicht schon wieder allein, sonst wird das nichts mehr. Hörst du mich nicht? Ich schreie doch schon.
„Ich dachte, du würdest dich freuen“, sagte er. „Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ich irre mich in letzter Zeit öfter, was dich betrifft.“
Dann sind wir schon zu zweit. Ich irre mich zurzeit auch öfter, was mich betrifft.
„Was soll ich tun?“, fragte er, als sie immer noch nicht antwortete. „Wie willst du mich haben? Willst du mich überhaupt noch haben?“
„Ich weiß es nicht.“ Es kam so heraus aus ihr, sie musste gar nicht groß darüber nachdenken.
Matti öffnete den Mund. Schloss ihn wieder. Und nickte. Was das Fürchterlichste daran war.
„Es tut mir leid“, flüsterte sie. „Ich habe es nicht so gemeint. Nein, ich … ich weiß nicht, ob ich es so gemeint habe. Ich weiß gar nichts mehr, ich –“
„Aber ich weiß es“, fiel er ihr ins Wort. „Du hast es so gemeint. Du meinst es schon lange so. Nicht erst, seit …“ Er fuhr sich durchs Haar. „Ich kann dir nichts mehr recht machen. Dabei nehme ich Rücksicht auf dich, wo ich kann. Ja, ich strenge mich wirklich an. Du glaubst gar nicht, wie sehr mir das zum Hals heraushängt ...“
Du brauchst dich doch gar nicht anzustrengen. Nimm mich in den Arm, jetzt gleich, und sag mir, dass ich Marie bin und keine Fremde für dich. Oder für mich. Ich werde dir glauben, und alles wird wieder gut.
Kann es nicht wieder so werden wie früher? Du hast immer darauf geachtet, dass ich nicht abhob, und ich zeigte dir die Wolken. So haben wir uns kennengelernt: Ich war mit der Kamera hinter einem Schmetterling her, und du hast mich vor dem Laternenpfahl gerettet.
Sie wollte es sagen, aber sie fand ihre Sprache nicht wieder. Wohin waren all die Worte? Früher waren sie immer von ganz allein gekommen, wenn sie mit Matti zusammen gewesen war, sie hatte kaum ein Ende finden können. Früher.
Er sagt immer, ich träume zu viel. Weil ich nach oben schaue. Marie, die in den Wolken wohnt. Die sich zu viele Gedanken macht. Die zu viele Fragen hat. Aber ich bin Restauratorin, ich darf mich nicht mit dem begnügen, was man auf den ersten Blick sieht. Das Kunstwerk, wie es einmal gemeint war, finde ich nur, wenn ich genau hinschaue und Schicht um Schicht abtrage, was nachträglich aufgebracht wurde und das Ganze verfälscht.
Man musste das Andere sichtbar machen, den Kern, den der Künstler erschaffen hatte, bevor er ihn mit einer Form ummantelte. Diesen Mantel des Augenscheinlichen musste man abstreifen, wie neulich bei dieser wurmstichigen heiligen Margaretha aus dem dreizehnten Jahrhundert. Sie hatte Marie fast zur Verzweiflung getrieben mit diesem Kätzchen auf dem Arm. Eine Schutzpatronin mit einem Haustier? Niemals, Margaretha konnte nicht Margaretha sein.
Stunden und Tage hatte Marie sie immer wieder studiert und mit feinsten Pinseln gesäubert. Sie träumte schon von ihr, weil sie der Statue ihr Geheimnis nicht abringen konnte. Bis ihr das Glück zu Hilfe kam und sie das Schattenspiel der Sonne im richtigen Winkel beobachtete. Nicht Margaretha war falsch, sondern das Kätzchen! Es war ein kleiner Drache – jenes Fabeltier, das für die Versuchung Margarethas durch den Teufel stand. Margaretha durfte Margaretha bleiben, und Marie konnte sie endlich wieder heil machen, den Farbauftrag erneuern und sie nachvergolden. All das war nur noch Fingerübung, auch wenn es Mühe machte. Das Umdenken, das Anderssehen war viel schwerer gewesen.
Matti war nicht besonders gut im Gedankenlesen. Er ahnte nichts von den Heiligen, Fabelwesen und Schmetterlingen in Maries Kopf. Er wartete nur auf eine Antwort. Die nicht kam.
„Hör zu“, begann er noch einmal. „Ich weiß, dass es dir schlecht geht, und nach allem, was war, ist das kein Wunder. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Aber ich könnte es versuchen. Du müsstest mich nur lassen. Du müsstest nur den Mund aufmachen und mit mir reden.“
Verzeih, aber das kann ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Dies und alles andere nicht. Dein „nur“ ist kein kleiner Schritt. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie Reden geht ...
Es liegt nicht an dir. Ich bin es. Ich bin mein Problem. Ich falle in einen Abgrund, die ganze Zeit schon. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Da unten ist es dunkel und kalt und so still.
Ironischerweise schickte der Frühling gerade jetzt eine Blaumeise vorbei; sie landete neben der Bank, auf der Matti und Marie schwiegen. Der kleine Vogel zeigte keine Furcht und hüpfte auf dem Boden hin und her, aber auch er fand die passenden Worte nicht. Dann zwei-, dreimal enttäuscht gezwitschert und wieder Abflug, irgendwohin, wo es mehr zu holen gab. Marie wäre gern mitgekommen.
Unterdessen hatte Matti genug gewartet. Er stand auf. „Vielleicht sollten wir uns ein andermal darüber unterhalten“, sagte er leise.
Die Sonne täuscht, und der Frühling macht sich lustig über mich. Am Tag tun sie so groß, aber in der Nacht haben sie keine Macht. Und die Nacht ist lang, ich bin immer allein mit ihr ... Wenn du jetzt gehst, werde ich mich im Dunkeln verirren und nie mehr herausfinden. Auch wenn ich es dir nicht sagen kann: Bleib bei mir, bleib bitte bei mir. Und dann rette mich.
Er konnte es nicht hören, und er konnte sie nicht beschützen. Aber das wusste sie ja schon. Zum Abschied wollte Matti seine Hand an ihre Wange legen, doch Marie wandte den Kopf ab; er brauchte nicht zu wissen, dass sie wieder Fieber hatte. Er nickte, als hätte er nichts anderes erwartet, und murmelte: „Bis heute Abend.“ Auf dem Weg zurück zum Parkplatz drehte er sich nicht noch einmal nach ihr um.
Wieder allein, dachte sie, während sie ihn als kleinen Punkt ins Auto steigen sah, und ich kann ihm nicht mal böse sein. Sie strich über das Holz der Bank, auf der sie saß. Es war alt und ausgeblichen und irgendwie gut. Und anders als sie hatte es eine Bestimmung: Es sollte eine Bank sein unter diesen Wolken am heutigen Tag. Für sie, für Marie, die in den Wolken wohnte. Vielleicht wusste das Holz ja sogar, dass es eigens zu diesem Zweck und zu keinem anderen gewachsen war. Ob Holz eine Seele besaß? Bei Bäumen konnte sie sich das vorstellen, denn sie lebten ja, und sie sprach manchmal mit ihnen, aber dieses Holz war doch schon tot ... Sie schüttelte den Kopf. Blödsinn. Wenn Matti das hörte! Aber Matti war inzwischen schon auf halbem Weg in die Stadt.
Es ist eine merkwürdige Sache mit den entscheidenden Augenblicken im Leben, die alles verändern, sodass nichts bleibt, wie es war. Sie geschehen ganz von allein und ohne, dass man sie herbeigerufen hätte. Sie kommen auf Samtpfoten daher und gehen mucksmäuschenstill vorüber, und man schenkt ihnen zunächst gar keine Beachtung, weil sie so unscheinbar sind. Aber dann, später, wenn das Leben diese eine entscheidende Wendung genommen hat, ohne die es ein ganz anderes Leben geworden wäre, blickt man auf jenen Augenblick zurück, und man erkennt plötzlich, welche Macht in ihm lag. Und welcher Zauber.
„Miau!“
Marie hörte auf, mit dem Holz zu flüstern, und blickte über die Armlehne nach unten. Da saß mit einem Mal eine Katze mit rotweißschwarz geflecktem Fell. Eine Glückskatze. Ihr mandelförmiger Blick ruhte auf Marie und fragte: „Weißt du es denn nicht?“
Marie verstand sie auf Anhieb, und da niemand da war, vor dem sie sich lächerlich machen konnte, schüttelte sie den Kopf. „Nein. Ich habe noch nie so wenig gewusst wie heute Morgen.“
Es musste die richtige Antwort gewesen sein, denn die Katze gähnte, streckte sich und spreizte die Krallen. Anschließend wickelte sie sich einmal um Maries rechte Wade, machte einen Buckel und sprang direkt neben ihr auf die Bank.
Behutsam legte Marie der Katze die Hand auf den Rücken. Mal ausprobieren, was so ging. „Hallo. Ich bin Marie. Und wer bist du?“
Sie hatte keine Erwiderung erwartet. Aber die Katze miaute erneut, und das hieß doch bestimmt etwas. Es klang jedenfalls freundlich. Man musste auf alles gefasst sein, sogar auf ein kleines Glück mit scharfen Krallen.
„Freut mich sehr“, sagte Marie. Ihre Hand, schon mutiger, wanderte weiter und begann, das Tier hinter dem rechten Ohr zu kraulen. „Wem gehörst du denn?“
Keine Antwort, nur Schnurren.
„Wohnst du hier in der Gegend?“
Katzen sind wankelmütige Geschöpfe; sie tun, was auch immer ihnen durch ihr eigensinniges Köpfchen schießt, und legen sich nicht gern fest. Wer ihr Herz gewinnen will, muss es sich verdienen, und Vertraulichkeiten, die eben noch hingenommen wurden, werden gleich darauf bestraft. Zu viel Nähe legen sie günstigenfalls als Anbiederung aus – und als Sakrileg, wenn die Hoheiten einen schlechten Tag haben. Die Glückskatze hielt es augenscheinlich für angebracht, daran zu erinnern. Sie legte die Ohren an, fuhr die Krallen aus und kratzte beherzt einmal quer über diese Menschenhand. Marie zuckte zusammen und rückte ab von der kleinen Glückshexe an ihrer Seite.
Aufbruch war angesagt. Die Katze sprang zu Boden und tänzelte Richtung Mauer davon, den kleinen rotweißschwarzen Kopf schon voller neuer Abenteuer und von schlechtem Gewissen keine Spur. Marie legte die Lippen an den Kratzer und leckte das Blut weg.
Na warte. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden das letzte Wort hat.
Sie kannten sich kaum, aber Marie hätte die Antwort ahnen können. Trotzdem hastete sie der kleinen Furie nach, auf die efeubewachsene Pforte in der Mauer am anderen Ende des Klinikgartens zu. Marie hatte sie noch nie geöffnet – warum auch, dahinter lagen nur der Alltag und die große Straße, die sie irgendwann wieder nach Hause bringen würde. Mit jedem Schritt schwoll der Verkehrslärm an, und unter dem Verband begann es wieder zu ziehen.
Die Katze blieb vor der Pforte stehen. Selbst einer kratzbürstigen Glückshexe war es nicht gegeben, aus dem Stand drei Meter hoch über die Mauer zu springen.
Schau, ich stehe hier und habe nicht das kleinste bisschen Mitleid.
„Miau.“
Wie bitte? Ich soll dir den Sesam öffnen? Du hast mich eben blutig gekratzt!
„Miau.“
Und was, wenn du auf die Straße läufst und unter die Räder kommst? Ich kann kein Blut sehen.
„Miau …“
Und fort war das Tier, denn Marie hatte längst getan, wie ihr befohlen worden war. Nun stand sie da, die Hand auf der rostigen Klinke, und starrte dem kleinen Irrwisch nach, der sich frohgemut in den Stoßverkehr stürzte.
Sie werden sie überfahren, ich weiß es genau. Ich muss ihr nach. Ich will nicht schuld sein – nicht schon wieder schuld sein …
Vergessen der Kratzer, vergessen das Fieber. Kein Gedanke daran, dass sie sich in ihrem Zustand, in Jogginganzug und Hausschuhen mitten im April besser nicht auf Wanderschaft begeben sollte. Marie hatte nur Augen für das Tier. Sie lief durch die Pforte auf den Bürgersteig und von dort direkt auf die Ausfallstraße. Wie gut, dass die Ampel gerade auf Rot geschaltet hatte und die Autos standen. Vielleicht hatte ja die Katze dafür gesorgt, damit Marie nichts geschah ...
Schon wieder so ein Quatsch. Das muss aufhören.
Einen Atemzug später schlängelten sich beide zwischen den wartenden Wagen hindurch. Einmal drehte sich die Glückshexe zu ihr um, und Marie meinte fast zu hören, wie es in dem kleinen Kopf dachte: Kommst du jetzt endlich?
Die Autos fuhren gerade wieder an, als Marie die andere Straßenseite erreichte. Hier lief der Gehsteig neben einer mannshohen Mauer dahin. Auch sie war efeubewachsen; wo sie endete oder was sie umschloss, war nicht zu erkennen. Die Katze hatte ebenfalls überlebt und ließ sich etwa zwanzig Meter weiter vor einer Lücke in der Mauer nieder. Wie ein Metronom schlug ihre rotweißschwarze Schwanzspitze hin und her. Marie zögerte und blieb stehen.
Da sitzt sie und sieht so unternehmungslustig aus. Aber meine Mission ist hier zu Ende: Katze lebt, alles gut. Ich verzeihe ihr und kehre zurück in mein gemütliches Krankenzimmer mit den Zitronenfalteralbträumen ...
Es sei denn, all das wäre Absicht gewesen, und sie hätte mich hierher gelockt.
Es musste das Fieber sein, das sie nicht auf dem Absatz kehrtmachen ließ. Hatte man sowas schon gehört: Katzen, die einen Plan haben? Wie aufs Stichwort wandte die Glückshexe den Kopf und fragte: Wie sieht’s aus – hast du Mut?
Was glaubst du denn? Natürlich habe ich Mut! Immer, wenn jemand Licht macht oder die Sonne scheint oder gerade kein Zitronenfalter in Sicht ist ...
Wir werden es so machen: Ich werfe einen Blick hinter diese Mauer, und wenn da nichts ist, was der Rede wert wäre, dann gehe ich keinen Schritt weiter. Hörst du? Dann endet hier unsere kleine Geschichte. Und das nächste Mal, wenn du dich im Klinikgarten blicken lässt, werde ich so tun, als würde ich dich überhaupt nicht kennen.
Im Handumdrehen hatte Marie das Tier erreicht. Von Flucht war keine Rede mehr; die Katze erwartete sie in aller Seelenruhe. Sie schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Warum, sah Marie, als sie durch die verrosteten Gitterstäbe der Pforte dort in der Mauer blickte: Dahinter lag ein Friedhof.
Bei Friedhöfen ging Marie das Herz auf. Schon als ganz kleines Mädchen hatte sie diese Orte geliebt wie jedes andere Kind Abenteuerspielplätze. Sie war noch nicht einmal in der Schule, als sie an der Hand ihrer Mutter zum ersten Mal einen Friedhof betrat. Ein alter Mann war gestorben – sie wusste nicht mehr, woher ihre Mutter ihn kannte, und sie selbst hatte ihn nie gesehen. Man sagte ihr, dass er nun tot sei und auf dem Friedhof beerdigt werden müsse, und zuerst war Marie ganz erschrocken gewesen, denn warum durfte er nun plötzlich nicht mehr zu Hause wohnen, sondern musste unter die Erde umziehen? Sie sah ihre Mutter weinen und ein paar andere Leute auch – bestimmt waren sie genauso erschrocken. Ihr fiel ein Stein vom Herzen, als man ihr erklärte, dass der alte Mann von alldem nichts mehr bemerkte und von jetzt an ewig schlafen würde.
So ganz hatte sie noch nicht verstanden, was das hieß: tot sein. Es interessierte sie aber, und so begleitete sie ihre Mutter von da an häufiger auf den Friedhof. Sie wollte nachsehen, ob der alte Mann nicht vielleicht doch in der Zwischenzeit aufgewacht war und wieder nach Hause wollte ... Während ihre Mutter am Grab Unkraut zupfte, spielte Marie zwischen den Kreuzen und Grabmalen mit sich selbst Verstecken und lernte die Sprache der Engel und unschuldigen Marmorkinder. Wenn sie an diesen Friedhof dachte, hatte sie kein Bild vor Augen, sondern ein Gefühl von zu Hause, was sie als Erwachsene einigermaßen merkwürdig fand. Sie musste wirklich oft dort gewesen sein.
Später, als sie allmählich hinter das Geheimnis der Friedhöfe kam und ihre Mutter sie im Stich gelassen hatte, stahl sie sich immer wieder aus dem Heim auf den Friedhof, um die Namen und Daten der fremden Toten auf den Steinen und Grabplatten zu buchstabieren und sich Lebensgeschichten dazu auszudenken. Und noch viel später, als sie längst groß war, machte sie es sich zur Gewohnheit, in jeder Stadt, in die sie kam, zuerst auf den Friedhof zu gehen.
Matti schüttelte üblicherweise den Kopf darüber und wartete irgendwo in einem Café auf sie, bis sie damit fertig war, den Toten ihre Aufwartung zu machen: „Ich werde mir vielleicht eine Kirche oder das Rathaus oder irgendetwas ansehen, mit dem mein kleines Architektenherz etwas anfangen kann. Ich mag Orte, an denen es lebendig zugeht. Auf einem Friedhof liege ich noch lange genug herum.“
Marie konnte es ihm nicht verübeln. Die meisten Menschen scheuten die Begegnung mit dem Tod. Sie selbst konnte sich der Wehmut längst vergangenen Kummers nicht entziehen, die so still über Friedhöfen weht. Es war eine sonderbare Faszination, die sie jedes Mal wieder packte – halb Ehrfurcht vor einem unausweichlichen Schicksal, das auch sie erwartete, und halb Mitgefühl mit demjenigen, der da bereits vorausgegangen war. Manchmal blieb sie sehr lange vor einem Grab stehen, weil ihr der Grabstein gefiel oder eine Eidechse, die sich darauf sonnte, oder weil sie wie früher als kleines Mädchen Geschichten zu diesem erloschenen, fremden Leben erfand.
Am liebsten mochte Marie die alten Friedhöfe – die, die längst aufgelassen waren. „Es ist so schön friedlich dort“, hatte sie Matti zu erklären versucht. „Kein Trauerzug, der stört, keine Klagen und kein frischer Schmerz. Man hat seine Ruhe. Als Besucher und als Toter.“ Und Ruhe war wichtig. Ruhe war der glatte Spiegel, der sich nach dem Sturm über die See legte, als wäre nichts gewesen und alles schon immer gut.
Besonders mochte sie die schlichten Grabstätten. Sie hätte sie jederzeit einer protzigen Gruft oder einem Marmorsarkophag vorgezogen: „Zu laut. Das brauchen doch nur die, die übrig geblieben sind. Die anderen, die unter der Erde, haben das und alles andere hinter sich ...“
Nicht, dass sie aus eigener Erfahrung sprach. Es gab weder einen Ort noch ein Grab, an dem Marie ihre Familie hätte aufsuchen können. Die Erinnerungen, die sie an ihre Mutter hatte, rissen plötzlich ab, als sie keine fünf Jahre alt war, und danach kamen nur noch Gesichter, die fremd waren und fremd blieben. Mama hatte viel gearbeitet und wenig geredet, aber sie war eben Mama und Zuhause gewesen. Manchmal glaubte Marie, dass sie entführt worden war. Alles war so schnell gegangen und so endgültig gewesen. Und so unbegreiflich.
„Warum hast du mich hierher gebracht?“, fragte sie nun also die Katze. Die antwortete nicht, sondern musterte sie nur schweigend. Ihr Blick ging durch den dünnen Stoff des Jogginganzugs, unter dem Marie längst fror, und direkt unter die Haut. Sie kam sich schutzlos vor, nach guten und schlechten Eigenschaften durchleuchtet, gewogen und womöglich für zu leicht befunden.
Nach einer kühlen Ewigkeit waren die kleinen Mandelaugen fertig mit Röntgen. Das Tier zwinkerte ihr zu, was schlicht unmöglich war, zwängte sich durch die Gitterstäbe der rostigen Pforte und lief schnurstracks auf den Friedhof.