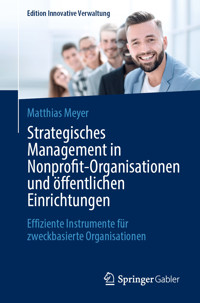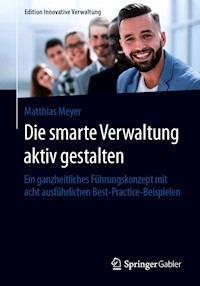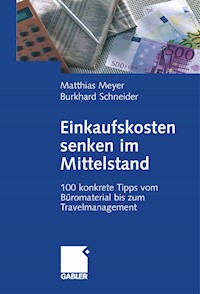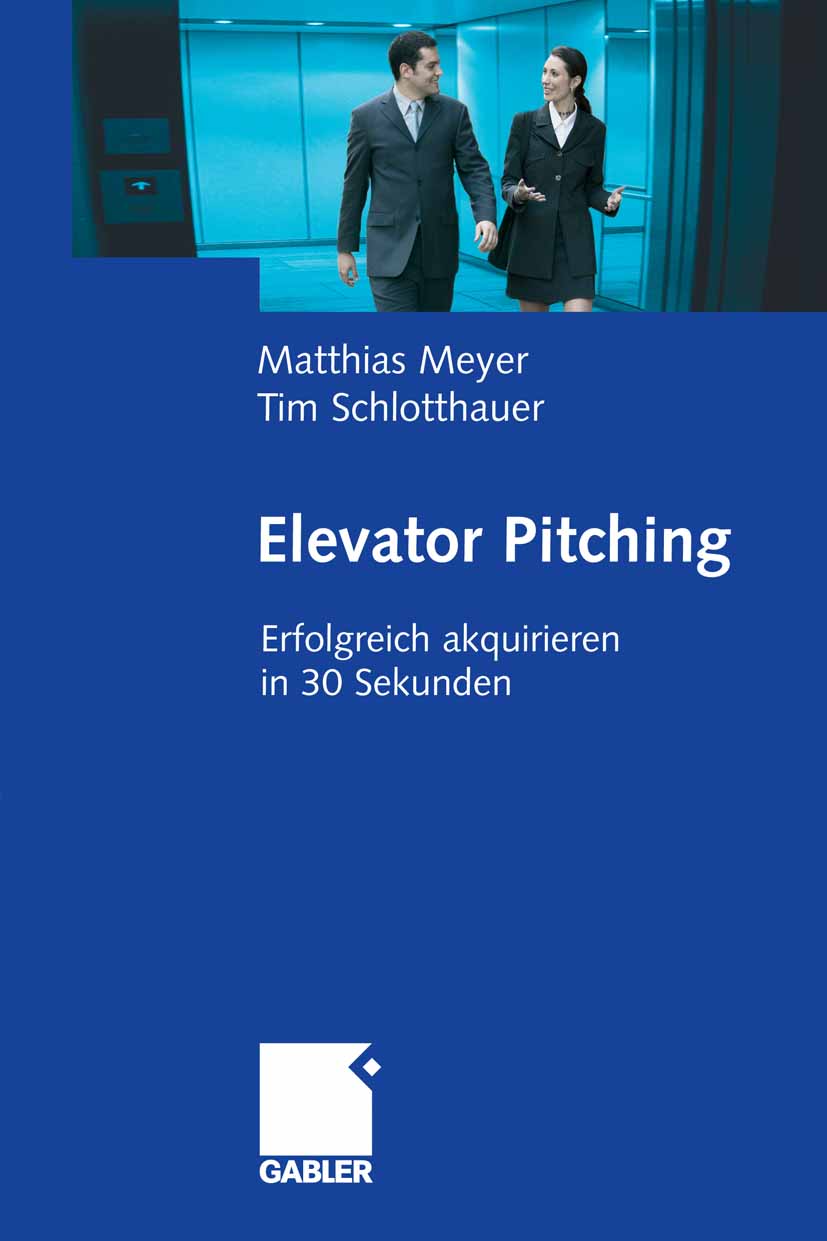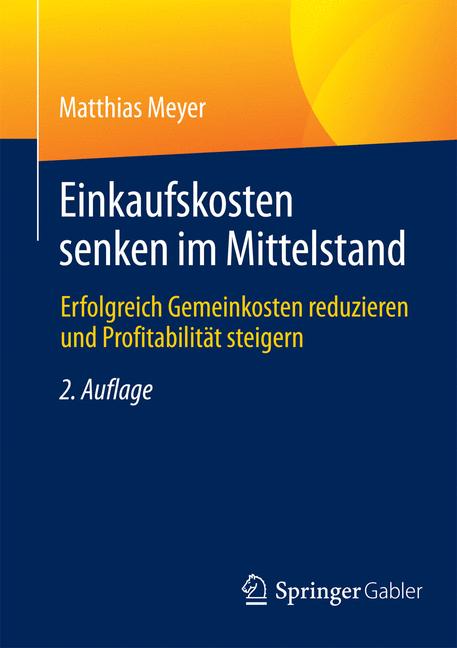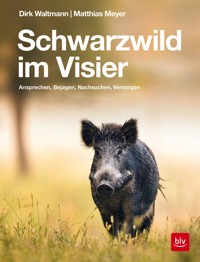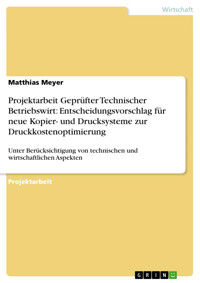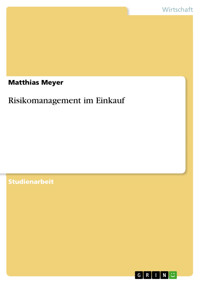33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: BLV Jagdpraxis
- Sprache: Deutsch
Das neue Standardwerk – und das erste seiner Art auf dem deutschsprachigen Markt! Während Rothirsch, Reh und Schwarzwild immer häufiger durch intensive Flächennutzung und drastische Waldumbaumaßnahmen in Bedrängnis geraten, erlebt die Hege von Niederwild eine echte Renaissance. Es sind vor allem junge Jägerinnen und Jäger, die die Lebensräume des Niederwilds schützen und verbessern möchten und sich der Raubwildbejagung widmen. Die älteren Waidfrauen und -männer hingegen sehnen sich nach alten Zeiten, in denen Hase, Fasan und Rebhuhn in unserer Kulturlandschaft keine Seltenheit waren. Die Bejagung und Hege von Niederwild ist komplex. Dieses Buch ist das erste auf dem deutschsprachigen Markt, das das Thema umfassend beleuchtet und in dem leidenschaftliche Experten ihr fundiertes Wissen und viele Praxistipps teilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2025 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2025 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
BLV ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.blv.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Jens van Rooij
Lektorat: Dirk Waltmann
Bildredaktion: Esther Herr
Covergestaltung: Natascha Klebl
eBook-Herstellung: Klara Wimmer
ISBN 978-3-9674-7149-6
1. Auflage 2025
Bildnachweis
Coverabbildung: AdobeStock (szczepank)
Illustrationen: Anton Walter; Shutterstock
Fotos: Alle Fotos im Innenteil stammen vom Autor
Syndication: Bildagentur Image Professionals GmbH, Tumblingerstr. 32, 80337 München www.imageprofessionals.com
GuU 4-7149 06_2025_01
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die BLV-Homepage finden Sie im Internet unter www.blv.de
Liebe Leserin und lieber Leser,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein BLV-Buch entschieden haben. Mit Ihrem Kauf setzen Sie auf die Qualität, Kompetenz und Aktualität unserer Bücher. Dafür sagen wir Danke! Ihre Meinung ist uns wichtig, daher senden Sie uns bitte Ihre Anregungen, Kritik oder Lob zu unseren Büchern.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weiteren Rat zum Thema? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
GRÄFE UND UNZER Verlag Grillparzerstraße 8 81675 Münchenwww.graefe-und-unzer.de
WICHTIGER HINWEIS
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch vorgestellten Informationen resultieren, eine Haftung übernehmen
QR-Code scannen und mehr erfahren!
Dieses Buch bietet Ihnen nicht nur Wissen in gedruckter Form, sondern auch eine Fülle digitaler Zusatzinhalte. Am Ende vieler Kapitel finden Sie einen QR-Code; scannen Sie den Code einfach mit Ihrem Smartphone – und schon erhalten Sie Hintergrundinformationen, weiterführende Texte und praktische Tipps zum Thema.
So geht‘s: Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone – oder eine QR-Code-App, die Sie in den App-Stores von Google oder Apple herunterladen können. Dann die Kamera auf den Code richten und der angezeigten Web-adresse folgen. Wenn Sie kein Smartphone verwenden möchten, können Sie alle digitalen Inhalte auch im Browser auf Ihrem Rechner abrufen. Verwenden Sie dafür einfach den Link am Ende dieses Kastens.
www.jagdleben.com/handbuch-niederwild
Vorwort
Vor dem Hintergrund des drastischen Rückgangs der primären Niederwildarten Hase, Fasan und Rebhuhn ist das vorliegende von Wildmeister Matthias Meyer verfasste BLV-Handbuch »Niederwild« über die Hege des Niederwildes und dessen Bejagung nicht nur angezeigt, sondern für die Erhaltung dieser Arten in bejagbarer Dichte geradezu zwingend notwendig. Die Besätze dieser Arten und damit deren Strecken sind nämlich in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber den »goldenen Jahren« von vor 1974 um zum Teil weit über 75 Prozent zurückgegangen. Von daher besteht die berechtigte Sorge, dass eine Bejagung dieser Arten in Zukunft nicht mehr möglich sein wird bzw. entfällt.
Wie dieser Situation vorgebeugt werden kann bzw. welche Hegemaßnahmen dazu ergriffen und auch nachhaltig umgesetzt werden müssen, ist Inhalt des Buches »Niederwild«, bei dem es sich endlich einmal um ein Fachbuch aus der Praxis für die Praxis handelt. Es wird darin nämlich nicht nur angesprochen und dargestellt, was zur Hege von Hasen, Fasanen und Rebhühnern gemacht werden muss, um deren Besätze wieder zu verbessern bzw. den Eintritt des vorstehend angesprochenen Szenarios einer Nicht-mehr-Bejagbarkeit dieser Arten zu vermeiden, sondern es wird darin zudem detailliert dargestellt, wie die betreffenden Hegemaßnahmen im Einzelnen umzusetzen sind bzw. was dabei zu beachten ist.
Diese Aussage gilt nicht nur für die Verbesserung des in über Jahrzehnte kontinuierlich schlechter gewordenen Lebensraums aufgrund der immer intensiver betriebenen Landwirtschaft, sondern auch für die zeitgleich immer mehr vernachlässigte Bejagung bzw. Kurzhaltung der Primärprädatoren dieser Arten. Die Fuchsstrecken haben sich in den vergangenen Jahren vielfach gegenüber den erwähnten »goldenen Jahren« mehr oder weniger verdoppelt. Daraus könnte gefolgert werden, dass der in den vergangenen Jahrzehnten eingetretene drastische Besatzrückgang der genannten Niederwildarten bzw. deren Strecken nicht mit der angesprochenen mangelnden Prädatorenbejagung in ursächlichem Zusammenhang stehen. Die Praxis sieht jedoch wie so oft anders aus.
Zu wünschen bleibt daher, dass das Buch »Niederwild« entsprechend großes Interesse – nicht nur in der Jägerschaft – findet und die darin dargestellten Hegemaßnahmen in den Revieren auch entsprechend umgesetzt werden. Das heißt, um nur ein Beispiel anzuführen, dass die für Fasanen aufgestellten Futtereimer nicht nur regelmäßig daraufhin zu kontrollieren sind, ob genügend Futter darin ist, sondern auch daraufhin, ob dieses auch noch nachrieselt. Vor dem Hintergrund der dargestellten praxisbezogenen Hegemaßnahmen sei Wildmeister Matthias Meyer aus der Sicht des Niederwildes bzw. der Niederwildhege für sein Fachbuch nicht nur Waidmannsheil gesagt, sondern auch ein kräftiges Waidmannsdank!
DR. HEINRICH SPITTLER,
langjähriger Leiter Referat Niederwild, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung Nordrhein-Westfalen
Vom Kulturfolger zum Kulturflüchter
Um das Niederwild ist es in vielen heimischen Revieren schlecht bestellt. Doch lässt sich dagegen arbeiten.
Das Bermuda-Dreieck des Niederwildes
Niederwild und Bodenbrüter leben im Spannungsfeld zwischen Wetter, Lebensraumverlust durch Flächennutzung und Fressfeinden.
Die Niederwildstrecken befinden sich im freien Fall. Seit den starken Strecken Anfang der 1960er-Jahre sind sie bis heute um rund 90 Prozent eingebrochen. Gebietsweise verzichten Revierinhaber auf eine Bejagung. Anfang der 1990er-Jahre übernahm ich als junger Berufsjäger die Verantwortung über ein 4500 Hektar großes Niederwildrevier. Waren dort Mitte der 1960er-Jahre Strecken von 500 Hasen an der Tagesordnung, brachen diese seit den 1980er-Jahren so sehr ein, dass zwar noch Tagesstrecken von 100 Hasen möglich waren, aber längst weit unter dem damaligen Niveau rangierten. Die ersten Treibjagden organisierte ich nach dem Konzept meines Vorgängers, ebenfalls mit einer Strecke um die 100 Hasen.
Angeregt durch einen interessanten Vortrag von Prof. Dr. Kurt Onderscheka (* 1926; † 2019, Gründer und ehem. Leiter des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Uni Wien) mit der Kernaussage, dass Gesellschaftsjagden auf Feldhasen unter einer Frühjahrsdichte von 25 Hasen pro 100 Hektar unterbleiben sollten, begann ich in besagtem Revier mit einer der ersten Hasenzählungen mittels Scheinwerfertaxation. Nach einem Ergebnis von rund 23 Hasen auf 100 Hektar wurde die Treibjagd für wenige Jahre ausgesetzt. Eine intensive Aufbauarbeit begann, die fast ausschließlich aus Prädationskontrolle bestand.
Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung waren damals nur in sehr begrenztem Umfang möglich und bezogen sich ausschließlich auf Eigentumsflächen. Bei annähernd sehr guten 80 Bodenpunkten gelang es uns trotz vielfacher Gespräche mit den Grundeigentümern nicht, geeignete Flächen zu bekommen. Einen Anbau von Zwischenfrüchten gab es derzeit ebenso nicht. Der Maisanbau war auch damals schon aufgrund der Bullenmast weit verbreitet.
Prädationskontrolle hilft
Allerdings wirkte sich die intensive Jagd auf Raubwild, besonders auf Fuchs und Marder, schnell aus. Der Hasenbesatz im Herbst kletterte, mit einigen witterungsbedingten Schwankungen, in wenigen Jahren auf über einen Hasen pro Hektar (118 Hasen/100 ha), so dass kurz vor der Jahrtausendwende nach einer Pause von 25 Jahren erstmals wieder Vorstehtreiben mit acht Flinten vertretbar waren. Über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren lagen die regelmäßigen Strecken zwischen 130 und 200 Hasen.
Ab den Jahren 2007/08 entwickelte sich die Region zu einer derer mit der höchsten Biogasanlagendichte. Mit jährlich fünf bis sechs Wiesenschnitten und einer sehr hohen Maisanbaufläche wurde sie alles andere als niederwildfreundlich. Dennoch gestaltet sich dort die Niederwildhege auch heute noch in vielen Revieren erfreulich gut, wenngleich sich die Hasendichten und damit die Jagdstrecken aufgrund der intensiven Landnutzung auf einem deutlich niedrigeren Niveau bewegen.
Niederwild und Bodenbrüter haben es in unserer Kulturlandschaft schwer. Das ist unumstritten. Schon in den 1990er-Jahren beschrieb der Biologe und Biogeograph Prof. Dr. Dr. h. c.mult. Paul Müller (* 1940; † 2010) die Misere des Niederwildes als ein Leben im »Bermuda-Dreieck« aus Wettereinfluss, technisierter Landwirtschaft und Prädation.
WETTEREINFLUSS
Für alle Niederwildarten und Bodenbrüter können die Wetterverhältnisse regional allentscheidend sein. Besonders eine nasskalte Witterung sowie Dauerregen und Starkregen-Ereignisse sind für Gelege und Jungwild eine tödliche Falle. Die Nestmulden aller Bodenbrüter laufen in kurzer Zeit voll Wasser und lassen die heranwachsenden Embryonen im Ei absterben, was zum Totalausfall des Geleges führt.
Junghasen und Rehkitze sind ebenfalls in den ersten Lebenswochen anfällig gegenüber Nässe und Kälte. Sie verfügen weder über ein dichtes wärmendes Haarkleid noch über ausreichend isolierende Fettreserven. Sie werden weder von der Mutter gegen den Regen abgeschirmt, noch verfügen sie über Rückzugsmöglichkeiten in einen Bau oder Ähnliches. In kurzer Zeit sind sie stark unterkühlt und verenden an Lungenentzündung oder Unterkühlung.
Am Wetter kann niemand etwas ändern und wir Jäger müssen mit den Konsequenzen leben, die der Niederwildbesatz witterungsbedingt zu tragen hat. Ungünstige Wetterereignisse wird es auch künftig geben. Sie treten glücklicherweise nie großflächig auf, sondern betreffen meist nur einzelne Regionen.
»Niederwildhege ist kein Kindergeburtstag!«
MATTHIAS MEYER
Den Totalausfall von Gelegen kompensiert das Federwild häufig durch ein Zweitgelege. Feldhasen kompensieren den Verlust von Nachwuchs durch mehrere Sätze im Jahr. Zudem sind die Niederwildarten, die von Natur aus als häufiges Beutetier rangieren, stark reproduktionsfreudig mit zum Teil vielen Jungtieren und/oder mehreren Würfen/Gelegen pro Jahr. Wetterbedingt schlechte Niederwildjahre hat es in der Vergangenheit regelmäßig gegeben, aber über die hohe Reproduktion gab es auch in den Folgejahren meist einen schnellen Ausgleich.
Die in den vergangenen Jahren immer häufiger auftretenden Hitze- und Dürrephasen kommen allen Niederwildarten sehr entgegen. So gibt es beispielsweise in einigen Revieren trotz unzureichender Raubwildkontrolle wieder vermehrt Rebhühner und Hasen; Rebhühner sogar in Revieren, wo nachweislich über Jahrzehnte keine mehr beobachtet werden konnten.
Die Flächennutzung und -struktur können wir zwar mit Hecken und Wildäckern etwas aufbessern, die großflächigen Monokulturen sind aber »totes Land« für die Bewohner der Feldflur. Auf die rasante Technisierung in der Landwirtschaft zu immer größeren und schnelleren Maschinen sowie der nachfolgenden Umgestaltung der Kulturlandschaft in leicht und effektiv zu bewirtschaftende große Flächeneinheiten ohne störende Landschaftsbestandteile kann die Jägerschaft ebenfalls keinen Einfluss nehmen.
Unterstützt die Agrarpolitik nicht mit in der Fläche umzusetzenden Maßnahmen, geht den Verlierern der Kulturlandschaft der Lebensraum langfristig und dauerhaft verloren. Qualität und Größe eines Lebensraums entscheiden über die Häufigkeit und Artenvielfalt seiner Bewohner und bleiben für die Tierwelt limitierend. Nur wenn es gelingt, zumindest in Teilbereichen die vielen Grenzlinien wieder herzustellen, die die einstige kleinbäuerliche Kulturlandschaft zu einem Dorado für die ehemaligen Kulturfolger Rebhuhn, Hase und Fasan werden ließen, haben wir eine Chance, das Niederwild zu erhalten.
Die meisten Jäger verfügen in der Regel nicht über eigene Flächen, die für Niederwild und Bodenbrüter großzügig positiv gestaltet werden können. Selbst jagende Landwirte unterliegen in den meisten Fällen wirtschaftlichen Zwängen, um mit ihren Familien überleben zu können. Hinzu kommt das stetige Anwachsen der Bevölkerung und der damit durch den Bedarf notwendige Flächenfraß, der immer noch täglich mehr als eine Eigenjagd von rund 100 Hektar ausmacht.
Auf der immer kleiner werdenden Fläche muss dennoch stetig mehr produziert werden, was ohne eine Belastung von Boden und Wasser nicht geht. Einrechnen in den Flächenverlust muss man allerdings mittlerweile auch die Flächen für erneuerbare Energie in Form von Biogas. Es werden hierfür nicht nur riesige Flächen benötigt, sondern die Belastungen von Boden, Trinkwasser und Artenvielfalt sind durch den dauerhaften Maisanbau enorm.
Ein zunehmendes Problem sind die Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft in Bezug auf die Ernährung der Wildtiere. Der mengenmäßige Verlust von Insekten als Hauptnahrungsmittel für die Jungen der Hühnervögel und zahlreicher Singvögel ist bereits seit Jahren bekannt. Aber auch die durch eine immer perfekter werdende Ackerhygiene fehlenden Wildkräuter stellen Fasan, Rebhuhn, Hase und Reh bereits ab Juni vor eine ernste Nahrungsknappheit.
Für sie wird es nicht nur schwieriger, den für die Notzeit im Winter notwendigen Feist anzulegen, sondern ihr gesamter Immunhaushalt wird lebenswichtiger Wirkstoffe, die in den Wildkräutern enthalten sind, beraubt. Geschwächte oder nicht optimal ernährte Tiere, die zusätzlich in der belebten Feldflur ständigem Stress ausgesetzt werden, sind entsprechend anfällig gegenüber Krankheiten und Parasiten, die nachweislich deutlich häufiger bei pathologischen Untersuchungen bestätigt werden.
Verlierer Wiesen- und Bodenbrüter
Auf die einzige Säule des »Bermuda-Dreiecks«, die Prädation, können, sollten und müssen wir Jäger zumindest noch dort Einfluss nehmen, wo es der Gesetzgeber zulässt. Nur über eine intensive Kontrolle der Nahrungsgeneralisten unter den Raubwildarten können wir dem Niederwild und den Bodenbrütern etwas Luft verschaffen. Fuchs, Dachs, Steinmarder und in jüngster Zeit die Neozoen Waschbär und Marderhund sowie Aaskrähe und Elster sind in ihren Besätzen nicht gefährdet, greifen aber regional massiv in die Reproduktion bei den Verlierern der Kulturlandschaft ein.
In einigen Revieren ist es längst schon an der Tagesordnung, dass die immer seltener werdenden Wiesenbrüter trotz geeigneter renaturierter Biotope seit Jahrzehnten keine Reproduktion mehr zustande bringen. Ebenso sieht es bei den Feldhühnern von der Wachtel bis zum Fasan aus. Wo diese erst einmal verschwunden sind, wird das meist auch dauerhaft so bleiben. Wiederansiedlungen dürften nur schwer zu realisieren sein, wie die vielen Rebhuhn-Projekte im Land zeigen.
An so manchem Jägerstammtisch wird auch heute noch über zu hohe Greifvogelbesätze geklagt. Solche jedoch für die Niederwildmisere verantwortlich zu machen, ist sicherlich der falsche Weg und scheint eine Ablenkung vom eigentlichen Problem zu sein. Konzentrieren wir uns auf das überall weit über Soll vorhandene Haarraubwild.
Erledigen die für Niederwildreviere verantwortlichen Jäger flächendeckend ihre Hausaufgaben beim Fuchs und sonstigem Raubwild, ist dem Niederwild schon viel Vorschub geleistet. Ohne Frage erbeuten Greifvögel auch Jungwild und Küken zur Ernährung ihrer eigenen Nachkommen. Bei einer entsprechenden Grundlage, die wir mit einer erfolgreichen Niederwildhege gelegt haben, fällt das nicht mehr ins Gewicht – und sei den Greifen vergönnt.
Schon der Altmeister der Niederwildhege,Wildmeister Hans Behnke (* 1912; † 1998), gestand einem 1000 Hektar großen Revier ein Geheck Füchse zu, was einem guten Niederwildbesatz nicht abträglich war. Allerdings sind wir in den meisten Revieren des Landes deutlich über der angestrebten Fuchsdichte! Rein statistisch betrachtet hat jeder von den rund 436.000 deutschen Jagdscheininhabern im Jagdjahr 2022/23 zwar drei Sauen und ein Reh erlegt, aber nicht einmal einen Fuchs (0,9). Das sind Zahlen, die jemanden, der von Artenschutz redet, nicht wirklich überzeugen kann. Hier ist neben Worthülsen noch bei jedem verdammt viel Luft nach oben!
Die intensive Raubwildjagd besonders mit Bauhund, Flinte und Falle wird bereits nach wenigen Jahren deutliche Erfolge zeigen. Selbst in Revieren mit einer intensiven Landwirtschaft wird es gelingen, die Niederwilddichten mit einem durchdachten Konzept wieder bis an die mögliche Lebensraumkapazität zu bringen, wie eigene Erfahrungen und die von anderen begeisterten Niederwildjägern aus meinem Bekanntenkreis mehrfach belegen.
Nur wer nach anfänglichen Misserfolgen konsequent dranbleibt und Geduld aufbringt, wird sich langfristig durchsetzen. Niederwildhege verlangt viel Zeit, Engagement, Eigeninitiative und Überzeugung. Sie ist eine umfassende Aufgabe von Jagd und Landwirtschaft gemeinsam und sie verdient von Seiten der Gesellschaft eine angemessene Wertschätzung. Schließlich profitiert nicht nur das Niederwild von den Anstrengungen, sondern alle Bewohner der Feldflur. Niederwildjäger bestreiten die Sicherung von Lebensräumen aktiv und mit finanziellen Eigenmitteln, was in anderen Verbänden nicht immer der Fall ist.
Bitte werte Leser, sehen Sie mir nach, dass das ebenfalls zum Niederwild zählende Rehwild nicht weiter in diesem Buch behandelt wird. Lebensraumgestaltung, Jungwildrettung und eine intensive Raubwildbejagung kommen ihm aber genauso zugute. Eine intensive Beschäftigung mit dem Reh würde aber den Rahmen und die Zielsetzung dieses Buches sicher sprengen. Möge dieses Buch dazu beitragen, die Motivation vor allem auch unter den jungen Jägern trotz allen Gegenströmungen zu heben, um dem Niederwild und den anderen Verlierern der Feldflur wieder Aufwind zu geben – solange es noch fünf Minuten vor zwölf Uhr ist.
»Aufgeben ist keine Option!«
MATTHIAS MEYER
Vom Jagdschein- zum Revierinhaber
Im Niederwildrevier haben Jäger eine besondere Verantwortung für Wildtiere und deren Lebensraum.
Am 1. April beginnt für die Jägerschaft allgemein ein neues Jagdjahr, für so manchen Jäger aber auch der Traum vom eigenen Revier. Für den bisherigen Revierinhaber bedeutet das, von einem vertrauten und lieb gewonnenen Fleckchen Erde Abschied zu nehmen. Jagdpächter zu sein bedeutet nicht allein die Möglichkeit zu haben, unabhängig jagen zu können. Vielmehr übernimmt man mit dem eigenen Revier in erster Linie die große Verantwortung, es so zu gestalten, dass die vorhandenen Lebensräume mindestens in ihrem Status erhalten, besser noch ausgebaut werden. Nur dann wird den vorkommenden Wildtieren nachhaltig deren Lebensgrundlage gesichert.
Für die eine Tierart, oft die Verlierer in einer modernisierten Wirtschaftswelt, kann es zu einem Wettlauf mit der Zeit werden. Für eine meist besser angepasste Art wird es zu einem für alle Beteiligten frustrierenden Feldzug, wenn es darum geht, ihren Bestand an die land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Verhältnisse in der Kulturlandschaft anzupassen.
Bevor es an eine konkrete Planung geht, was man in der nächsten Pachtperiode in seinem Revier verwirklichen will, sollte an erster Stelle eine Analyse stehen, eine Beschreibung und Erfassung des Ist-Zustands. Wenngleich diese Informationen schon vor der Verpachtung nützlich gewesen wären, ist das leider oft vorher nicht zu realisieren.
Die Grundlage jeglicher Planung im Revier ist eine Revierkarte.
ZUM START EINE REVIERINVENTUR
Hilfreich für den Jagdpächter kann eine Bewertung des Reviers anhand eines Inventurkatalogs sein. Unterschiedliche Revierbestandteile und Merkmale werden dabei erfasst. Sie berücksichtigen die Reviergröße genauso wie Strukturelemente, Wildbestände und Streckenanalysen, Wildschäden und Unfallzahlen bis hin zu noch vorhandenen Reviereinrichtungen und Möglichkeiten der Revieraufsicht. Am Ende ist dann leichter zu beurteilen, ob ein Revier objektiv taxiert oder überbewertet angeboten wird.
Zu Beginn einer Pachtperiode ist es optimal, wenn sich der Revierinhaber von fachkundiger Seite Beratung einholt. Neben den Landesjagdschulen der Bundesländer bieten manche Berufsjäger, Diplombiologen, Förster oder sehr erfahrene Jäger Revierberatungen an. Solche sind in aller Regel wie ein Gutachten aufgebaut. Sie erfassen den Ist-Zustand und geben Hinweise auf Maßnahmen zur Biotop- und Äsungsverbesserung und auf die Wahl der Reviereinrichtungen. Weitergehende Gutachten geben sogar Informationen über Möglichkeiten der Bejagung, deren Organisation und Durchführung. Förderlich für den Jagdherrn ist diesbezüglich auch ein Adressenverzeichnis von Ansprechpartnern, Behörden oder Verbänden, mit denen er die Umsetzung der Maßnahmen besprechen muss.
Grundlage für jede Art von Revierberatung oder Revierbewertung ist die Revierkarte. Topographische Karten im Maßstab 1 : 25.000 geben nur wenig Auskunft, sofern das Revier nicht mehrere 1000 Hektar groß ist und eine Übersichtskarte erstellt werden soll. Für »normale« Reviergrößen von bis zu 1000 Hektar sind die Flurkarte 1 : 5000 oder Luftbildaufnahmen im selben Maßstab ein sinnvolles Hilfsmittel. Benötigen wir später einmal für einzelne Maßnahmen im Revier genauere Unterlagen, lässt sich das Vorhaben sehr gut und vor allem maßstabsgerecht auf Messtischblättern 1 : 1000 anfertigen.
Das Erstellen einer Revierkarte macht im Anfangsstadium viel Arbeit. Diese gibt letztlich aber einen guten Überblick über die durchgeführten und noch geplanten Maßnahmen. Entweder werden alle Revierereignisse farbig in dieselbe Karte eingetragen oder man besorgt sich sinnvollerweise Folien, die über die Grundkarte gelegt werden und jeweils ein anderes Thema beinhalten. In die Grundkarte tragen wir farbig unterlegt alle Feld-, Wald- und Wasserflächen ein. Alle Hecken, Naturschutzflächen, Wege, Straßen und Gräben werden dauerhaft skizziert. Auch die Reviergrenzen inklusive der benachbarten Ansprechpartner dürfen dabei nicht fehlen. In der Grundkarte finden wir also alle unveränderbaren Basisinformationen. In unsere Themenfolien tragen wir alle veränderlichen und zu einem bestimmten Thema passenden Ereignisse ein.
Folgende Themen sind in einem Niederwildrevier denkbar:
→Wildunfälle
→Raubwild (Bau- und Fallenjagd)
→Rehwild (Wechsel, Sichtbeobachtungen, Abschüsse)
→Organisation von Gesellschaftsjagden
→Reviereinrichtungen
→Landwirtschaftliche Fruchtfolge
→Biotophegemaßnahmen
→Wildbestandserfassung
So werden die Abläufe im Revier sichtbar. Der Revierinhaber ist nach einiger Zeit aufgrund der Eintragungen in der Lage, in seiner Revierkarte wie in einem Buch zu lesen. So kristallisieren sich beispielsweise Unfallschwerpunkte an Straßen heraus. Einstände beim Rehwild lassen sich erkennen, Raubwildpässe und gute Standorte für Kunstbaue und Fanganlagen sind ersichtlich. Noch exakter und professioneller erfolgt die Erstellung einer digitalen Revierkarte.
Technische Hilfsmittel wie eine Wildkamera erleichtern das Wildtiermonitoring.
Frühjahrsbesatz erfassen
Im Niederwildrevier werden gleich Anfang April bei niedrigem Bewuchs der Hasen-, Raubwild- und Federwildbesatz sowie die Zusammensetzung der Feldrehsprünge erfasst. Von anderen Tierarten wie Greifvögel, Rabenvögel, Tauben usw. schätzen wir deren Vorkommen. Ihre Horste sind ebenfalls Anfang April wegen des noch fehlenden Laubs bei einem Reviergang gut zu erkennen und können kartiert werden.
Zu dieser Zeit stört der Jäger auch in den Einständen am wenigsten. So sollten gerade jetzt Remisen und Feldgehölze im Niederwildrevier revidiert und auch nach winterlichem Fallwild abgesucht werden. Mit diesen ersten Tätigkeiten haben wir zu Beginn des Jagdjahres unmittelbar nach der Revierübernahme bereits einen guten Informationsstand erreicht. Zusätzlich hat man an Ortskenntnis gewonnen und auch erkannt, welche Revierteile bereits jetzt wertvoll für das Wild sind und in welchen noch nachgebessert werden muss.
Nach einer gründlichen Inventur und Vorbereitungsphase kann der Revierinhaber meist schon feststellen, in welche Richtung seine Zielsetzungen für das Revier laufen können.
Es macht nämlich keinen Sinn, sich jagdliche Ziele und Erwartungen zu stecken, die aufgrund von limitierenden Reviervorgaben nicht oder nur unter schwierigsten und teuren Anstrengungen realisierbar wären. In einem Niederwildrevier erwartet der Revierinhaber neben einer angemessenen Strecke auch Strukturelemente, die dem Wild Lebensraum und Äsung bieten, aber auch jagdbetrieblichen Ansprüchen genügen. So benötigen wir beispielsweise getrennte Deckungs- und Äsungsflächen für gute Fasanentreiben oder eingewachsene Uferstreifen für Ententreibjagden.
Mit ihrem Wissen über reviertypische Besonderheiten wie Rehbockeinstände, Fangplätze oder Fuchsbaue können frühere Mitjäger weiterhelfen. Der eine oder andere von ihnen lässt sich vielleicht sogar als Jagdhelfer oder zur Jagdaufsicht einsetzen. Die Jagdgenossen sind ebenfalls gute Partner, da sie täglich offene Ohren und Augen für alle Dinge in Feld und Flur haben. Sie sind auch Ansprechpartner, wenn Äsungsflächen angelegt werden sollen. Ihnen gehören die Flächen, sie wissen, wie sie zu bewirtschaften sind und sie haben die notwendigen Gerätschaften. Ein auf Vertrauen aufgebautes Verhältnis erleichtert in der Dorfgemeinschaft so einiges.
»Neben der Erstellung einer Revierkarte muss die erste Arbeit im neuen Revier die Erfassung der Frühjahrsbesätze sein.«
MATTHIAS MEYER
Ein persönliches Vorstellen bei den Reviernachbarn sollte für den neuen Jagdpächter eine Selbstverständlichkeit sein. Bei der heute oftmals geringen Größe der Jagdflächen kommt kein Pächter ohne den Reviernachbarn aus. Je mehr Gleichgesinnte auf großer Fläche etwas für das Wild tun wollen, desto angenehmer und erlebnisreicher wird die Jagd für den Einzelnen. Hier geht es für das Wild um mehr als nur darum, einen Grenzbock älter werden zu lassen! Somit steht auch der aktiven Mitarbeit in der jagdlichen Gemeinschaft auf der Ebene von Hegering und Kreisgruppe nichts im Wege.
Gute Kontakte zu Polizei und Landratsamt, sprich Jagd-, Naturschutz- und Veterinärbehörde, vervollständigen den Kreis der notwendigen Partner zum Wohl von Jagd und Wild.
Eine Vielzahl an Fallen gehört zu den wichtigsten Einrichtungen im Niederwildrevier.
Kurzfristige Maßnahmen
Im ersten Jahr nach der Revierübernahme stehen vor allem kurzfristige Maßnahmen an. Dazu gehört das Erbauen von Reviereinrichtungen zur Raubwildjagd an Naturbauen und Luderplätzen. Im Niederwildrevier wird jede Hecke, jede Remise und jedes Feldgehölz mit Futterbahnen aus Stroh, Fasanenschütten oder Futterautomaten bestückt, damit der Federwildbesatz ortsgebunden bleibt. Zusätzlich sind alle Fütterungen mit Rattenfutterkisten und Fangeinrichtungen für Raubwild zu versehen, da dieses vermehrt durch das an diesen Stellen konzentrierte Niederwild angelockt wird. Auch alle Gewässer, Deckungsstreifen, Wildäcker und Wege aus der Ortschaft ins Revier sollten am Anfang und Ende mit Fangeinrichtungen gesichert werden. Nur eine Vielzahl an Fallen sichert einen gleichbleibenden und wirkungsvollen Schutz für Niederwild und Bodenbrüter. Als Faustregel bauen wir eine Große Kasten- oder Betonrohrfalle für den Fuchsfang auf 50 Hektar Revierfläche ein.
Im Herbst und Winter setzen wir auf geeignete Gewässer Bruthilfen für die Stockente und bauen Revierkunstbaue ein, damit der Fuchsbesatz in den folgenden Jahren leichter und effektiver zu kontrollieren ist. Nach der Ernte oder auch schon früher kann der Revierinhaber für kurzfristige Deckung und verteilt liegende Äsungsflächen sorgen. Neben geeigneten Flächen, die er anpachtet, kauft oder als Stilllegungsfläche nutzen darf, benötigt er entweder einen eigenen Maschinenpark oder die Unterstützung durch Landwirte oder einen Maschinenring. Geeignete Flächen für solche Vorhaben kann er von Jagdgenossen, aus kirchlicher oder öffentlicher Hand erhalten.
Langfristige Maßnahmen
Die Anlage von Biotopen (Teiche, Tümpel, Hecken, Remisen, Feldgehölzen usw.) gehört zu langfristigen Maßnahmen und ist auf mehrjährig gepachteten oder besser noch gekauften Flächen realisierbar. Auch die für eine Baumaßnahme der Gemeinde dem Naturschutz zur Verfügung zu stellende Ausgleichsfläche erfüllt nach Absprache mit anderen Naturschutzverbänden in aller Regel auch des Jägers Absichten. Oftmals hilft es der Tierwelt schon ein gewaltiges Stück in der Lebensraumnutzung weiter, wenn man sich der Pflege bereits bestehender Biotope annimmt.
Heckenpflege nach Benjes, ein Zurückschneiden und Verjüngen von Hecken bieten vielen Arten Brutplatz und Nahrung. Auch das scheinbar unkontrollierte Umschneiden von Erlen- und Weidenbeständen sorgt dank schnellem Zuwachsen für undurchdringliche Wildeinstände. Durch Ausbringen von Gehölzstecklingen, Topinambur- und Chinaschilfknollen sowie eingefrästen Obsttrestern schaffen wir in Kürze wertvolle Äsung und Deckung.
Ruhe ist das Wichtigste, was man seinem Wildbestand angedeihen lassen kann. Leidet der Wildbestand unter Stress, egal ob unter zu hohen Beständen oder unter Feinddruck, wozu auch die Störungen durch den Menschen zählen, ist er anfällig für Krankheiten und Mangelerscheinungen. Zugleich produzieren zu hohe Bestände Wildschäden und verursachen gehäuft Verkehrsunfälle.
Lebensraumgestaltung durch z. B. Anlegen einer Remise ist eine langfristige Hegemaßnahme.
Beachte!
Die optimale Bewirtschaftung eines – auch kleinen – Reviers benötigt neben einem gehörigen Maß an finanziellen Mitteln viel Zeit. Je größer und gepflegter Revier und Wildbestand sein sollen, desto professioneller muss die Revieraufsicht sein.
Wildtiere in einer Räuber-Beute-Beziehung
Durch Lebensraumverlust und Prädation sind zahlreiche wildlebende Arten unter Druck geraten. Was tun Jäger dagegen?
Lassen Sie uns keinesfalls ausschließlich die jagdlich interessanten Niederwildarten in den Fokus nehmen. Ebenso nimmt der Besatz an früher einmal häufig vertretenen Wiesenbrütern seit Jahrzehnten dramatisch ab. Zurückzuführen ist das im Besonderen auf die schlechten Bruterfolge. Aktuell stehen alle Wiesenbrüter (zumindest in Bayern) in unterschiedlichen Kategorien der Roten Liste. Allein sieben Arten sind sogar vom Aussterben bedroht: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Bekassine, Braunkehlchen, Wiesenpieper und Grauammer. Kiebitz und Wachtelkönig sind stark gefährdet und die Feldlerche ist gefährdet.
Hauptursachen sind Verlust und Verschlechterung der Lebensraumbedingungen. Doch auch und gerade unter diesen Umweltbedingungen schmälern Verluste durch zahlreiche Beutegreifer die ausstehenden Bruterfolge massiv. Sind erst einmal die letzten erwachsenen Wiesenbrüter aus einem Gebiet aufgrund jahrelanger Totalverluste bei der Reproduktion verschwunden, wird man auf eine Neubesiedlung jahrelang meist vergeblich warten.
Wie in der Niederwildsituation auch ist das über viele Jahrzehnte beobachtete Anwachsen der generalistisch lebenden Raubwildarten wie Fuchs, Steinmarder, Dachs und Rabenkrähe ein entscheidendes Problem bei der Reproduktion der Wiesenbrüterarten. Doch nicht nur die »konservativen« Raubwildarten fressen Bodenbrüter und deren Gelege. Seit etlichen Jahren spielen die Neozoen wie Waschbär, Mink und Marderhund eine zunehmend tragende Rolle, denn sie bewohnen mehr noch als die anderen Fressfeinde zusätzlich Feuchtgebiete. Dort werden sie durch ihre mittlerweile hohe Besatzzahl nicht nur für Niederwild und Bodenbrüter, sondern auch für viele Amphibien zur Gefahr.
Die Uferschnepfe bringt seit Jahrzehnten nur wenige Junge durch.
Jagd ist Arten- und Naturschutz
Einerseits fordert die Europapolitik ein rigoroses Vorgehen gegen die »neuen« Arten, andererseits legt Hessen, das Bundesland mit der höchsten Waschbärendichte, eine lange Schonzeit vom 1. März bis zum 31. Juli fest (Stand 2/25); ausgerechnet in den Sommermonaten, wo der Kleinbär am aktivsten ist.
Zusätzlich wird seitens der Behörden und Verbände die Zunahme und Ausbreitung des Fischotters nicht nur begrüßt, sondern aktiv unterstützt. Der Wassermarder ernährt sich aber nicht nur von Fischen und Krebstieren, auch Wasservögel und Bodenbrüter jeglicher Art stehen auf seinem Speiseplan. Interessanterweise bewegt er sich nicht nur im Wasser, sondern nutzt über Gräben oder auf dem Landweg eben auch die sensiblen Brutbereiche der Wiesen- und Watvögel.
Ein weiterer Räuber ist unterdessen von Osteuropa kommend auf dem Vormarsch – der Goldschakal. Da er von allein in neue Gebiete einwandert, wird er politisch nicht als Neozoon betrachtet und erhält, obwohl seine Auswirkungen und das Beutespektrum ebenfalls bevorzugt in diese Nische fallen, bislang »freies Geleit« und Vollschonung (Stand 2/2025 keine Jagdzeit). Ausschließlich in Niedersachsen unterliegt er seit dem Jahr 2022 dem Jagdrecht. Zum jetzigen Zeitpunkt beschränken sich die Meldungen über seine Anwesenheit auf Einzeltiere, selten auf Reproduktion. Doch wenn man seine Entwicklung in anderen europäischen Ländern betrachtet und mit den Anfängen von Waschbären und Marderhund vergleicht, braucht man kein Hellseher zu sein, um die Auswirkungen in wenigen Jahrzehnten zu erahnen.
Tag- und Nachtgreifvögel, aber auch – darauf darf hingewiesen sein – Störche machen für die Aufzucht ihrer Jungen ebenfalls reichlich Beute bei Küken von Bodenbrütern. Sie genießen alle eine ganzjährige Schonzeit oder unterliegen besonders geschützt dem Naturschutzrecht.
Da läuft wohl was verkehrt
Manchmal ist es schon erstaunlich, mit welcher Zielsetzung und Gewichtung im Naturschutz operiert wird. Auf der einen Seite werden Millionenbeträge in Renaturierungsmaßnahmen, Projektbetreuungen und Kampagnen investiert, auf der anderen Seite unterstützt man genau das Gegenteil, obwohl die Auswirkungen durch die Prädation wissenschaftlich belegt und den Verantwortlichen bekannt sind. Ebenso wenig nachvollziehbar sind die zeit- und kostenaufwändigen Versuche, in Wiesenbrütergebieten die Neststandorte einzeln oder flächig durch Zäune vor Prädatoren zu sichern, obwohl man längst weiß, dass kleinere Raubwildarten wie Wiesel, Mink, Iltis und Marder sich nicht durch Zäunungen abhalten lassen. Sie finden immer undichte Stellen oder überwinden das Hindernis kletternd.
Rabenkrähen sind intelligente Vögel. In manchen Bereichen haben sie u. a. gelernt, dass zu bestimmten Zeiten die Zäune etwas mit dem Schutz von Bodenbrütergelegen zu tun haben. Wen wundert es, dass sie gezielt in der Brutzeit, wo sie sowieso ihr Beutesuchschema auf Gelege spezialisiert haben, die Zäune anfliegen und nach dem geschützten Gelege fahnden? Die Praxis hat gezeigt, dass der Gelegeschutz mit hohem Aufwand durch Zäunung und damit der Bruterfolg zwar Erfolge zeigt, diese aber spätestens mit dem Schlupf der Nestflüchter zeitnah enden. Die Küken verlassen schnell den gesicherten Bereich und fallen dann außerhalb in wenigen Tagen der Prädation zum Opfer.
Nutznießer der von der Jägerschaft bzw. den Revierinhabern selbst finanzierten und durchgeführten Hegebemühungen waren in erster Linie die nicht jagdbaren Wiesenbrüter und bodenbrütende Singvögel. Das war gut so für den landesweiten Artenschutz. Erst mit massiven Veränderungen in der Landwirtschaft und dem seit den 1980er-Jahren schwindenden Interesse an der Raubwildjagd verschlechterte sich die Gesamtsituation aller in der Feldflur lebenden Arten.
Die gesellschaftliche Akzeptanz für die intensive Jagd auf Raubwild verschärfte sich mit den aufkommenden Anti-Pelz-Kampagnen. Mit der bundesweit erfolgreichen Impfaktion gegen die Tollwut und deren Erlöschen fehlte der Jägerschaft ein weiteres wichtiges Argument – und die Entwicklung nahm ihren Lauf bis zum heutigen Stand.
»In den Jahren der intensiven Niederwildhege galt seit jeher eine wichtige Säule der Raubwildjagd. Damit ließ und lässt sich der Besatz an jagd- und nutzbarem Niederwild über den Sommer vermehren.«
MATTHIAS MEYER
Ganz anders sieht seit einigen Jahren die Entwicklung im Wiesenbrüterschutz aus. Die gesellschaftliche Sicht ist hier eine enorm positive. Mit Spenden und Unterstützung durch zahlreiche Freiwillige nimmt die Entwicklung Fahrt auf. Die negativen Auswirkungen für die Wiesenbrüter sind bekannt. Aus öffentlichen Mitteln werden Flächenkauf, Renaturierungsmaßnahmen und Arbeitsplätze geschaffen. Es entstehen Bildungszentren und es wird professionell Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Mit der Argumentation für eine dringend notwendige Prädation sind nicht nur hohe finanzielle Aufwendungen für Fallen und Meldesysteme aus meist öffentlichen Mitteln da, sondern es ergeben sich auch rechtlich abgesicherte Strategien zur Prädatoren-Kontrolle, die mitunter sogar Schonzeiten und waffenrechtliche Regelungen regional aussetzen lassen. Was früher bei der Raubwildjagd verboten oder verpönt war, nimmt heute mit einer anderen, von der öffentlichen Meinung akzeptierten Zielsetzung selbstverständliche Züge an.
Was früher Raubwildjagd hieß (und einen negativen Beigeschmack hatte), lautet jetzt Prädationsmanagement! Mittel, Wege und Ziele sind ähnlich, nur hat das Kind einen anderen Namen. Heute laufen wir vielmehr Gefahr, dass sich eine über Jahrzehnte verkorkste Situation mangels Wissens und Willens personell nicht mehr rechtzeitig in der Fläche umsetzen lässt.
Verlust des jagdlichen Handwerks
Bei zahlreichen Jägern ist über die Generationen das Handwerk »Jagd« in vielen wichtigen Bereichen verschwunden. Der heutige Jäger bedient mit der Büchse die Ziele des Waldbaus, kämpft seinen Kampf gegen das Schwarzwild hinsichtlich Wildschäden und Afrikanische Schweinepest und frönt der geselligen Bewegungsjagd. Engagement in der Wildhege und Lebensraumgestaltung für gefährdete Arten sind vielen Jägern zu zeit- und kostenintensiv. Die Jagd ist bei zu vielen Waidleuten heute eine Art der Freizeitgestaltung, aber nicht mehr die Identifikation mit dem Revier, den Wildtieren und ihren Ansprüchen. Wir haben heutzutage so viele Jagdscheininhaber wie nie zuvor in der Geschichte. Diejenigen davon, die sich nach dem § 1 (1) BJG der Pflicht zur Hege verbunden fühlen, befinden sich nach meinen Beobachtungen mittlerweile in einer bescheidenden Minderheit.
Der Waschbär nimmt seit Jahren in Deutschland exponentiell zu.
Weihen sind selbst gefährdete Bodenbrüter, aber ernähren sich in der Horstzeit gezielt von Küken der Wiesenbrüter.
Das jagdliche Handwerk geht zunehmend verloren.
Es helfen nur Zahlen und Fakten
Mithilfe unterschiedlicher Methoden zur Besatzerfassung erfahren wir, welche Wildarten in heimischen Revieren wie häufig vorkommen.
Inventur im Niederwildrevier
Um Informationen über den örtlichen Wildbesatz zu erlangen, muss dessen Erhebung erfolgen.
Für den Betreuer einer reinen Feldjagd oder eines gemischten Reviers mit hohem Feldanteil wird immer der Niederwildbesatz im Fokus stehen. Daher ist es nur konsequent, nicht nur Zähldaten der nutzbaren Niederwildarten zu erheben, sondern auch der wichtigsten Fressfeinde. Wer darüber hinaus belastbare Zahlen zu Horsten der Greif- und Krähenvögel vorweisen kann, wird sicherlich auch in der Diskussion mit anderen Verbänden wahrgenommen. Für alle Niederwildarten und Bodenbrüter ist sicherlich der Fuchs die den Besatz limitierende Art. Somit ist die Dokumentation seines Vorkommens von besonderer Bedeutung im Niederwildrevier.
Bei Ansammlungen von Wasserwild stellt die Zählung in Rastern eine bewährte Methode zur Besatzerfassung dar.
Methoden der Besatzerfassung
Längst von nicht allen Wildarten lässt sich der Besatz verlässlich erfassen. Bei den im Niederwildrevier wichtigsten wie Feldhase, Rebhuhn und Fasan funktioniert es mit wissenschaftlich anerkannten Verfahren recht gut. Neben der Scheinwerferzählung, die beim Feldhasen, beim Wildkaninchen und manchmal auch beim Rebhuhn gute Ergebnisse liefert, bedient sich der Heger besonders beim Rebhuhn der Provokation der Hähne durch die Klangattrappe. Systematisch und zur richtigen Zeit im Revier eingesetzt, lassen sich die Brutterritorien der einzelnen Hähne sicher ausfindig machen.
Darüber hinaus unterstützt im Frühjahr der Einsatz eines zuverlässigen Vorstehhundes, belastbare Daten bei allen Feldhühnern zu erhalten. Zur Fasanen-Balz untermauert das Beobachten bei der täglichen Revierfahrt oder beim Ansitz die dank der Hundearbeit bereits geschätzten Zählungen. Zu den prachtvoll gefiederten Hähnen, die auf den im Bewuchs noch niedrigen Feldern balzen, gesellen sich alsbald die sonst sehr versteckt lebenden unscheinbar gefärbten Hennen. Vor allem an warmen und windstillen Tagen, wenn die Frühjahrssonne an Kraft gewinnt, verlässt der Fasan die dichte Deckung seines Tageseinstands.
Im Sommer, wenn nach der Getreide-Ernte täglich mehr Freiflächen entstehen, zeigen sich auch die Fasanenhennen mit ihrem Gesperre zunehmend am Rand von Maisfeldern oder auf Sandwegen. Sie suchen dort nach Magensteinen und den Samenkörnern der Wildkräuter oder hudern und sonnen sich im trockenen Sand der Wege.
Beim Raubwild hingegen erschwert weitgehend dessen nächtliche und heimliche Lebensweise das sichere Vorgehen der Besatzerfassung. Beim Fuchs kann dennoch im Frühjahr über die Kartierung der Baue eine tendenzielle Besatzschätzung erfolgen.
Die Scheinwerfertaxation
Ein probates Mittel, um Besätze von Feldhasen mit einer hohen Genauigkeit zu erfassen.
Die Besätze von Feldhasen können starken jährlichen Schwankungen unterliegen. Langjährige Erhebungen zum Frühjahrs- und Herbstbesatz sind unbedingt notwendig, um Trendentwicklungen zu erkennen und zu ergründen. Hohe Jagdstrecken zusätzlich zu spontan aufgetretenen großen Verlusten innerhalb eines Jahres können massiv zulasten des Grundbesatzes gehen. Danach kann es mitunter Jahre dauern, bis der Besatzverlust ausgeglichen wird. Eine solide Berechnung des Hasenbesatzes und vor allem des jährlichen Zuwachses bedeuten die Basis für jede Abschussplanung.
Die Scheinwerfertaxation basiert auf der Erkenntnis, dass der Hase überwiegend nachtaktiv lebt. In deckungsarmen Feldrevieren können von einem langsam fahrenden Fahrzeug aus mit Hilfe eines Handsuchscheinwerfers die auf den Äsungsflächen befindlichen Hasen zumeist einfach gezählt werden.
Bei der Scheinwerferzählung unterscheidet man zwei Anwendungs-Varianten:
Der Scheinwerferkegel leuchtet im rechten Winkel zur Fahrtrichtung die Zählfläche etwa 150 Meter weit aus.
LINIEN- ODER STREIFENTAXATION
Zu Beginn der Hasenzählung muss eine für das Revier bzw. den Revierteil repräsentative Fahrstrecke festgelegt werden. Diese darf sich aufgrund der später vergleichbaren Zählergebnisse im Laufe der Jahre auf keinen Fall ändern. Um repräsentativ zu sein, müssen alle im Revier vorkommenden unterschiedlichen Bodentypen und landwirtschaftlichen Kulturen wie Acker, Wiese, Ödland und Sonderkultur von der Fahrstrecke tangiert werden. Die Zählstrecke gilt als statisches Basiselement bei allen zukünftigen Zählungen. Somit darf diese selbstverständlich nicht ausschließlich durch die besten Hasenecken führen. Zugleich muss sie immer befahrbar sein.