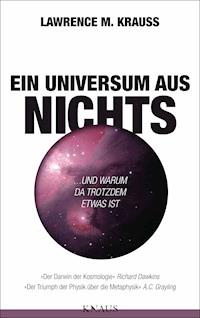21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Entschlüsselung des Universums ist das größte Abenteuer der Menschheit
Warum sind wir hier? Diese Frage steht hinter dem jahrtausendealten Versuch der Menschen, die Welt, in der wir leben, zu begreifen. Lawrence Krauss, einer der bekanntesten Astrophysiker der Gegenwart, erzählt die Geschichte dieses größten geistigen Abenteuers der Menschheit: Schritt für Schritt zu entschlüsseln, wie das Universum entstanden ist, woraus es besteht, wie es funktioniert und welche Rolle wir darin spielen, kurz, die Entdeckung der verborgenen Welt hinter der wahrnehmbaren Realität im Großen wie im Kleinen. Packend und anschaulich schildert er die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse bis hin zu dem faszinierenden Bild, das die Physik unserer Zeit von den rätselhaften Strukturen und Kräften des Universums zeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Warum sind wir hier? Diese Frage steht hinter dem jahrtausendealten Versuch der Menschen, die Welt, in der wir leben, zu begreifen. Lawrence Krauss, einer der bekanntesten Astrophysiker der Gegenwart, erzählt die Geschichte dieses größten geistigen Abenteuers der Menschheit: Schritt für Schritt zu entschlüsseln, wie das Universum entstanden ist, woraus es besteht, wie es funktioniert und welche Rolle wir darin spielen, kurz, die Entdeckung der verborgenen Welt hinter der wahrnehmbaren Realität im Großen wie im Kleinen. Packend und anschaulich schildert er die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse bis hin zu dem faszinierenden Bild, das die Physik unserer Zeit von den rätselhaften Strukturen und Kräften des Universums zeichnet.
Zum Autor
Lawrence M. Krauss, geboren 1954 in New York City, ist ein international bekannter theoretischer Physiker und beschäftigt sich insbesondere mit Fragen der Kosmologie. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler leitet das »Origins Project« an der Arizona State University, das sich interdisziplinär mit den Ursprüngen des Kosmos, des Menschen, des Bewusstseins und der Kultur befasst. Sein Vortrag »A Universe from Nothing« und das gleichnamige Buch »Ein Universum aus Nichts« machten ihn zum Star.
LAWRENCE M. KRAUSS
Das größte
ABENTEUER
der
MENSCHHEIT
Vom Versuch, das Universum zu entschlüsseln
Aus dem Englischen von Helmut Reuter
KNAUS
Das Original erschien 2017 unter dem Titel The Greatest Story Ever Told – So Far: Why Are We Here?bei Atria Books, Simon & Schuster, Inc., New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2017 Lawrence M. Krauss
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018
Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Manuela Knetsch
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN 978-3-641-21251-3 V002 www.knaus-verlag.de
Für Nancy
Hier sind Tränen dem Leid,
und das Herz rührt menschliches Schicksal.
Vergil
Inhalt
Prolog
TEIL I: GENESIS
Kapitel 1:Vom Lehnstuhl in die Höhle
Kapitel 2: Im Dunkeln sehen
Kapitel 3: Durch ein Glas – ganz nebenher
Kapitel 4: Hin und zurück
Kapitel 5: Eine Masche in der Zeit
Kapitel 6: Die Schatten der Wirklichkeit
Kapitel 7: Ein Universum – seltsamer als jede Fiktion
Kapitel 8: Eine Falte in der Zeit
Kapitel 9: Zerfall und Trümmer
Kapitel 10: Von hier in die Unendlichkeit – wir werfen ein Licht auf die Sonne
TEIL II; EXODUS
Kapitel 11: Zeiten der Verzweiflung – verzweifelte Maßnahmen
Kapitel 12: Marsch der Titanen
Kapitel 13: Schönste Formen endlos – die Symmetrie schlägt zurück
Kapitel 14: Kalte harte Wirklichkeit – abwegig oder schön?
Kapitel 15: Leben in einem Supraleiter
Kapitel 16:Die erträgliche Schwere des Seins – Symmetrie gebrochen, Physik wieder in Ordnung
TEIL III; OFFENBARUNGEN
Kapitel 17: Der falsche Ort zur rechten Zeit
Kapitel 18: Der Nebel lichtet sich
Kapitel 19: Endlich frei
Kapitel 20: Dem Vakuum einen Schlag versetzen
Kapitel 21: Gotische Kathedralen des 21. Jahrhunderts
Kapitel 22: Mehr Fragen als Antworten
Kapitel 23: Von einer Bierparty ans Ende der Zeit
Epilog:Kosmische Demut
Dank
Bibliografischer Hinweis
Register
PROLOG
Am schwierigsten ist es, das zu sehen, was tatsächlich da ist.
J. A. BAKER, DERWANDERFALKE
Am Anfang war das Licht.
Doch da war noch mehr, nämlich die Schwerkraft.
Danach brach die Hölle los.
So könnte man die Erzählung des größten geistigen Abenteuers der Menschheitsgeschichte angemessen einleiten. Die Geschichte handelt von der Suche der Wissenschaft, die unserer Erfahrungswelt zugrunde liegenden verborgenen Wirklichkeiten aufzudecken – eine Suche, für die die Spitzenleistungen menschlicher Schöpferkraft und intellektuellen Wagemuts in einem beispiellosen globalen Maßstab aufgeboten werden mussten. Ohne die Bereitschaft, alle Arten von Glaubensüberzeugungen und vorgefassten Meinungen – ob wissenschaftlicher oder anderer Natur – aufzugeben, wäre dieser Prozess nicht möglich gewesen. Die Geschichte ist voller Dramatik und Überraschungen. Sie umfasst den ganzen Bogen der Menschheitsgeschichte; und erstaunlicherweise ist die aktuelle Version noch nicht einmal die letzte, sondern nur ein weiterer Arbeitsentwurf.
Diese Geschichte verdient es, in weit größerem Umfang verbreitet zu werden. In den Staaten der westlichen Welt tragen Teile dieser Story bereits dazu bei, allmählich die Mythen und den Aberglauben zu ersetzen, in denen unwissendere Gesellschaften vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden Trost fanden. Dessen ungeachtet wird die jüdisch-christliche Bibel dank der Regisseure George Stevens und David Lean immer noch gelegentlich »die größte Geschichte aller Zeiten« genannt. Diese Bezeichnung ist deswegen so erstaunlich, weil die Bibel als literarisches Werk, selbst wenn man den häufigen Sex und die Gewalt und ein wenig Poesie in den Psalmen berücksichtigt, sich nicht mit den ebenso feurigen, aber weniger gewalttätigen griechischen und römischen Epen wie der Aeneis oder der Odyssee messen kann – auch wenn die englische Übersetzung der Bibel als Vorbild für viele nachfolgende Bücher gedient hat. Wie auch immer – als Leitfaden zum Verständnis der Welt ist die Bibel erschreckend widersprüchlich und überholt. Und man könnte mit Recht vorbringen, dass als Anleitung für menschliches Verhalten weite Teile davon ans Obszöne grenzen.
In der Wissenschaft ist schon das Wort »heilig« lästerlich. Keine Idee, ob religiös oder anderweitig, bekommt einen Freifahrtschein. Der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte ging deshalb nicht mit der Opferung eines Propheten vor 2000 Jahren zu Ende, und auch nicht mit dem Tod eines anderen Propheten 600 Jahre später. Die Geschichte unserer Ursprünge und unserer Zukunft ist eine Erzählung, die ständig weitergesponnen wird. Und diese Geschichte wird im Lauf der Zeit immer interessanter – nicht dank einer Offenbarung, sondern dank des beständigen Vorankommens wissenschaftlicher Entdeckungen.
Diese Geschichte der Wissenschaft schließt – anders, als oft wahrgenommen – auch Poesie und eine tiefe Spiritualität ein. Doch diese Spiritualität weist den zusätzlichen Vorzug auf, dass sie an die reale Welt gebunden ist und nicht weitgehend zu dem Zweck erschaffen wurde, unseren Hoffnungen und Träumen entgegenzukommen.
Die Lektionen unserer nicht von unseren Wünschen, sondern von der Kraft des Experiments geleiteten Erkundungsfahrt ins Unbekannte vermitteln Demut. 500 Jahre Wissenschaft haben die Menschheit von den Ketten der aufgezwungenen Unwissenheit befreit. Gemessen daran: Welche kosmische Anmaßung bildet den Kern der Behauptung, das Universum sei geschaffen worden, damit wir existieren können? Welche Kurzsichtigkeit bildet den Kern der Annahme, das Universum unserer Erfahrung sei für alle Zeiten und Räume kennzeichnend für das Universum?
Diese anthropozentrische, also den Menschen in den Mittelpunkt stellende Sicht ist als ein Ergebnis der Wissenschaftsgeschichte auf der Strecke geblieben. Wodurch wird sie ersetzt? Ist uns in diesem Prozess etwas verloren gegangen, oder haben wir, wie ich erörtern werde, dabei etwas noch Größeres gewonnen?
Bei einer öffentlichen Veranstaltung habe ich einmal gesagt, dass es Aufgabe der Wissenschaft sei, den Menschen Unbehagen zu bereiten. Kurzzeitig bedauerte ich die Bemerkung, weil ich befürchtete, sie würde die Leute abschrecken. Doch es ist eine Tugend und keine Behinderung, sich unbehaglich zu fühlen. Alles in unserer Evolutionsgeschichte hat unser Denken dahingehend geprägt, dass wir uns mit Vorstellungen wohlfühlen, die uns beim Überleben halfen. Dazu gehört etwa die natürliche teleologische Tendenz von Kindern, anzunehmen, Gegenstände seien dazu da, einem Zweck zu dienen. Und dazu gehört auch die weiter gefasste Tendenz, etwas zu anthropomorphisieren und leblosen Objekten Handlungsfähigkeit zuzuschreiben, weil es eindeutig besser ist, ein reaktionsloses Objekt für eine Gefahr zu halten, als eine tatsächliche Gefahr für ein reaktionsloses Objekt.
Die Evolution hat unser Denken nicht darauf vorbereitet, lange oder kurze Zeitskalen oder auch kurze oder weite Entfernungen abzuschätzen, die wir nicht direkt erfahren können. Deshalb ist es kein Wunder, dass bemerkenswerte Entdeckungen wissenschaftlicher Art – etwa die Evolution oder die Quantenmechanik – bestenfalls nicht intuitiv zu begreifen sind und schlimmstenfalls die meisten aus ihrer Komfortzone zerren.
Das ist auch der Grund, weshalb die größte Geschichte aller Zeiten – das größte Abenteuer der Menschheit – so mitteilenswert ist. Die besten Storys fordern uns heraus. Sie bringen uns dazu, dass wir uns anders wahrnehmen und das Bild, das wir von uns und unserer Stellung im Kosmos haben, neu ausrichten. Das gilt nicht nur für die bedeutendste Literatur, Musik und Kunst, sondern auch für die Wissenschaft.
In diesem Sinne ist es bedauerlich, dass der Ansatz, alte Glaubensüberzeugungen durch moderne wissenschaftliche Aufklärung zu ersetzen, oft als »Verlust des Glaubens« dargestellt wird. Wie viel größer als die Geschichte, die wir unseren Kindern erzählt haben, wird die Geschichte sein, die sie werden erzählen können? Der größte Beitrag der Wissenschaft zur Zivilisation ist ganz sicher, dass die großartigsten Bücher nicht die der Vergangenheit, sondern die der Zukunft sein werden.
Jedes Epos vermittelt eine Moral. In unserem Epos stoßen wir darauf, dass wir, wenn wir dem Kosmos gestatten, unser Denken durch empirische Entdeckungen anzuleiten, einen unglaublichen geistigen Reichtum erzeugen können, der das Beste nutzbar macht, was die Menschheit zu bieten hat. Er kann uns Hoffnung auf die Zukunft geben, indem er es uns ermöglicht, mit offenen Augen in die Zukunft zu gehen und mit den Werkzeugen, die notwendig sind, um aktiv daran teilzuhaben.
Mein voriges Buch Ein Universum aus Nichts zeigte auf, wie die revolutionären Entdeckungen der letzten 100 Jahre die Art und Weise verändert haben, in der wir unser sich entwickelndes Universum in den größten Maßstäben verstehen. Dieser Wandel hat die Wissenschaft dazu gebracht, die Frage »Warum gibt es etwas und nicht nichts?« – sie war einst religiöses Hoheitsgebiet – direkt aufzugreifen und sie in eine weniger solipsistische und in der Anwendung nützlichere Form zu überführen.
Wie Ein Universum aus Nichts ist auch diese Geschichte aus einem meiner Vorträge entstanden. In diesem Fall handelte es sich um eine Vorlesung am Smithsonian Museum in Washington, die damals für einige Aufregung sorgte und mich wieder einmal dazu antrieb, die Ideen, die ich für einen Vortrag ansatzweise entwickelt hatte, weiter auszuarbeiten. Im vorliegenden Buch werde ich jedoch das andere Ende unseres Wissensspektrums erkunden, und dazu dessen ebenso mächtige Implikationen für das Verständnis sehr alter Fragen. Die tief reichenden Veränderungen, die über die letzten 100 Jahre in unserem Verständnis der Natur in ihren kleinsten Maßstäben erfolgten, machen es möglich, auch die ebenso fundamentale Frage »Warum sind wir hier?« mit aufzugreifen.
Wir werden darauf stoßen, dass die Realität nicht das ist, was wir glauben. Unter der Oberfläche finden sich »seltsame«, unsichtbare innere Funktionen, die unserer Intuition zuwiderlaufen und unsere vorgefassten Ansichten von dem, was Sinn ergibt, ebenso in Frage stellen können wie ein Universum, das aus nichts hervorgeht.
Und in Anlehnung an die Schlussfolgerung aus meinem letzten Buch lässt sich aus der Geschichte, die ich hier erzählen möchte, ebenfalls der Schluss ziehen, dass es für die Welt, in der wir uns befinden, keinen offensichtlichen Plan oder Zweck gibt. Unsere Existenz war nicht vorgegeben, sondern scheint ein merkwürdiger Zufall zu sein. Wir taumeln auf einem schmalen Grat, wobei das Gleichgewicht letztlich von Phänomenen bestimmt wird, die tief unter der Oberfläche unserer Erfahrung liegen – von Phänomenen die in keiner Weise von unserer Existenz abhängen. In diesem Sinne lag Einstein falsch: »Gott« scheint tatsächlich um das Universum – oder die Universen – zu würfeln, und bisher haben wir Glück gehabt. Doch wie am Spieltisch könnte es sein, dass unser Glück nicht ewig andauert.
Die Menschheit unternahm einen großen Schritt in die Moderne, als unseren Vorfahren allmählich bewusst wurde, dass das Universum mehr umfasst als das, was ins Auge fällt. Diese Erkenntnis war möglicherweise kein Zufall. Wir sind anscheinend so angelegt, dass wir eine Geschichte brauchen, die über unsere eigene Existenz hinausgeht und ihr einen Sinn gibt. Dieses Bedürfnis war wahrscheinlich eng mit dem Aufkommen religiöser Vorstellungen in frühen menschlichen Gesellschaften verknüpft.
Die Geschichte vom Aufstieg der modernen Wissenschaft und ihrer Abspaltung vom Aberglauben erzählt dagegen davon, wie die verborgenen Wirklichkeiten der Natur durch Vernunft und Experimente aufgedeckt wurden. Bei diesem Prozess verstand man, dass scheinbar getrennte, seltsame und manchmal bedrohliche Phänomene letztlich direkt unter der sichtbaren Oberfläche miteinander zusammenhängen. Am Ende vertrieben diese Zusammenhänge die Kobolde und Feen, die zuvor zwischen unseren Vorfahren herumgewuselt waren.
Dass man Zusammenhänge entdeckt, welche ansonsten scheinbar getrennte Phänomene miteinander verknüpfen, ist mehr als jeder andere Indikator das Wahrzeichen wissenschaftlichen Fortschritts. Dafür gibt es viele klassische Beispiele, etwa Newtons Verknüpfung der Mondumlaufbahn mit einem fallenden Apfel, Galileis Erkenntnis, dass die großen Unterschiede im Verhalten fallender Gegenstände die Tatsache verbergen, dass sie in Wahrheit mit der gleichen Geschwindigkeit von der Erdoberfläche angezogen werden, und Darwins epochale Einsicht, dass die Vielfalt des irdischen Lebens durch den simplen Prozess der natürlichen Selektion aus einem einzelnen Vorfahren hervorgegangen sein könnte. Keiner dieser Zusammenhänge war anfangs offensichtlich. Wenn er dann aber ans Licht kommt, wird er klar und beinahe selbstverständlich – er sorgt für ein »Aha-Erlebnis« der Einsicht und der Vertrautheit. Man hört sich fast sagen: »Darauf hätte ich doch gleich kommen können!«
Die Überfülle an Erkenntnissen, die unser modernes Bild von der Natur auf der fundamentalen Skala – dem Standardmodell, wie man es genannt hat – prägt, hat Zusammenhänge ergeben, die unvermeidlich sehr weit vom Reich der Alltagserfahrungen entfernt sind. Tatsächlich ist die Entfernung so groß, dass es ohne ein gewisses Fundament unmöglich ist, sie mit einem einzigen Schritt zu veranschaulichen.
Es ist keine Überraschung, dass ein solcher einziger Schritt auch historisch nie stattgefunden hat. Eine Reihe bemerkenswerter, unerwarteter und scheinbar nicht miteinander verknüpfter Zusammenhänge tauchte auf und wuchs zu dem kohärenten Bild zusammen, über das wir heute verfügen. Die derzeitige mathematische Struktur, die sich dabei ergeben hat, ist so kunstvoll konstruiert, dass sie beinahe willkürlich erscheint. »Aha« ist gewöhnlich das Höchste, was Uneingeweihten über die Lippen kommt, wenn sie vom Higgs-Boson oder der Großen Vereinheitlichung der Naturkräfte hören.
Wenn wir uns unter die obersten Schichten der Realität begeben wollen, brauchen wir eine Story, welche die uns bekannte Welt mit den tiefsten Winkeln der unsichtbaren Welt um uns herum verknüpft. Jene verborgene Welt können wir nicht durch intuitives Erfassen verstehen, das allein auf direkter Wahrnehmung beruht. Diese Story möchte ich hier erzählen. Ich möchte Sie auf eine Reise ins Herz der Mysterien mitnehmen, die am Rand unseres Verständnisses von Raum und Zeit sowie der darin wirkenden Kräfte liegen. Damit will ich den Leser nicht unnötig provozieren oder kränken, sondern ihm einen Anstoß geben – wie wir Physiker unsererseits einen Anstoß bekamen und durch neue Entdeckungen in eine neue Wirklichkeit gezogen wurden, die sowohl unbequem als auch erhebend ist.
Unsere jüngsten Entdeckungen über die fundamentalen Größenordnungen der Natur haben unsere Wahrnehmung von der Unvermeidlichkeit unserer Existenz im Universum auf ernüchternde Weise verändert. Auch sie liefern Belege, dass die Zukunft zweifellos radikal anders aussehen wird, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben, und auch sie lassen unsere eigene kosmische Bedeutung weiter schrumpfen.
Wir würden diese unbequeme, unpassende Wirklichkeit, dieses unpersönliche und anscheinend zufallsbestimmte Universum vielleicht am liebsten leugnen, doch wenn wir es in einem anderem Zusammenhang betrachten, muss das alles nicht zwangsläufig deprimierend sein. Ein Universum ohne Zweck – was es nach allem, was ich weiß, tatsächlich ist – erscheint bei Weitem spannender als eines, das speziell für uns geschaffen wurde, weil es bedeutet, dass die Möglichkeiten der Existenz erheblich vielfältiger und weitreichender sind. Wie belebend ist es doch, dass wir uns in einer exotischen, zu erkundenden Menagerie befinden – mit Gesetzen und Phänomenen, die zuvor jenseits unserer kühnsten Träume zu liegen schienen – und wir versuchen können, die verknotete Wirrnis der Erfahrung aufzudröseln und nach irgendeiner darunterliegenden vernünftigen Ordnung zu forschen. Und wie faszinierend ist es, diese Ordnung zu entdecken und ein kohärentes Bild des Universums auf Skalen zu entwerfen, die weit jenseits dessen liegen, was wir jemals direkt erfahren können – ein Bild, gewebt aus unserer Fähigkeit vorherzusagen, was als Nächstes geschehen wird, und der daraus folgenden Fähigkeit, die Umwelt um uns herum zu kontrollieren. Was für ein Glück, dass wir unseren kurzen Augenblick an der Sonne erleben. Mit jedem Tag, an dem wir etwas Neues und Überraschendes entdecken, wird die Story noch besser.
Teil I
GENESIS
KAPITEL 1 VOMLEHNSTUHLINDIEHÖHLE
Die Unverständigen erben Torheit; aber Erkenntnis ist der Klugen Krone.
SPRÜCHE 14:18
An meinem Anfang war Licht.
Am Beginn der Zeit gab es mit Sicherheit Licht, doch ehe wir zum Beginn der Zeit kommen können, müssen wir unsere eigenen Anfänge erkunden, und das heißt, auch den Anfang der Wissenschaft. Was wiederum bedeutet, dass wir zum größten Motiv für Wissenschaft wie auch für Religion zurückkehren müssen: dem Verlangen nach etwas anderem. Nach etwas hinter dem Universum unserer Erfahrung.
Für viele Menschen übersetzt sich dieses Verlangen in etwas, was dem Universum Bedeutung und Sinn vermittelt, und erweitert sich zu einem Verlangen nach irgendeinem verborgenen Ort, der besser ist als die Welt, in der wir leben, und an dem Sünden vergeben werden, Schmerz abwesend ist und der Tod nicht existiert. Andere dagegen sehnen sich nach einem verborgenen Ort ganz anderer Art, zu dem die physische Welt jenseits unserer Sinne gehört – jene Welt, die uns zu verstehen hilft, auf welche Weise die Dinge sich so verhalten, wie wir es wahrnehmen, und nicht, weshalb sie das tun. Diese verborgene Welt liegt dem zugrunde, was wir erfahren, und das zu verstehen gibt uns die Macht, unser Leben, unsere Umwelt und unsere Zukunft zu verändern.
Der Gegensatz zwischen diesen beiden Welten spiegelt sich in zwei sehr unterschiedlichen literarischen Werken wider.
Das erste mit dem Titel Der König von Narnia von C. S. Lewis stammt aus dem 20. Jahrhundert und ist ein Fantasy-Roman für Kinder mit entschieden religiösen Untertönen. Er fängt eine Kindheitserfahrung ein, welche die meisten von uns gemacht haben – unter dem Bett, im Wandschrank oder auf dem Dachboden nachzusehen, ob ein verborgener Schatz zu finden ist oder irgendein mysteriöser Beleg dafür, dass es da draußen mehr gibt als das, was wir normalerweise erfahren. In dem während des Zweiten Weltkriegs spielenden Buch steigen einige britische Schulkinder, die evakuiert wurden und Schutz in einem Landhaus außerhalb Londons fanden, in einen großen Wandschrank und entdecken dort die merkwürdige Welt Narnia. Die Kinder retten Narnia mithilfe eines Löwen, der sich auf einem Altar erniedrigen und opfern lässt, um wie Christus das Böse in seiner Welt zu besiegen.
Obwohl die religiösen Anklänge in Lewis’ Geschichte klar sind, können wir sie doch auch anders deuten – nicht als Allegorie der Existenz Gottes oder des Teufels, sondern der bemerkenswerten und potenziell schrecklichen Möglichkeiten des Unbekannten. Möglichkeiten, die knapp unter der Oberfläche unserer Sinne liegen und nur darauf warten, dass wir so tapfer sind, sie aufzuspüren. Möglichkeiten, die, wenn erst entdeckt, vielleicht unser Verständnis von uns selbst bereichern könnten, oder einigen, die ein Bedürfnis danach verspüren, einen Sinn von Wert und Zweck vermitteln.
Diese Pforte zu einer verborgenen Welt im Wandschrank ist ein sicherer Ort mit dem vertrauten Geruch oft getragener Kleidung, aber zugleich geheimnisvoll. Sie schließt die Notwendigkeit ein, sich außerhalb der klassischen Begriffe von Raum und Zeit zu begeben. Denn wenn sich einem vor oder hinter dem Schrank stehenden Beobachter nichts enthüllt, sondern nur jemand, der sich im Inneren aufhält, etwas wahrnimmt, dann muss der innerhalb des Wandschranks erlebte Raum erheblich größer sein, als man von außen sieht.
Tatsächlich ist eine solche Vorstellung charakteristisch für ein Universum, in dem Raum und Zeit – wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie – dynamisch sein können. Dort könnte beispielsweise ein Schwarzes Loch von außerhalb des Ereignishorizonts – innerhalb dieses Radius’ gibt es kein Entkommen – so aussehen, als umfasse es ein kleines Volumen, während das Volumen für einen Beobachter im Inneren (der durch die Gravitationskräfte noch nicht in tausend Stücke zermalmt wurde) ganz anders aussehen kann. So ist es in der Tat möglich, wenn auch jenseits des Bereichs, für den wir verlässliche Berechnungen anstellen können, dass der Raum im Inneren eines Schwarzen Loches vielleicht eine Pforte in ein anderes, nicht mit unserem Universum verbundenes Universum bereitstellt.
Ich möchte aber vor allem auf den Punkt zurückkommen, dass die Möglichkeit von Universen jenseits unserer Wahrnehmung – zumindest in der literarischen und philosophischen Fantasie – unausweichlich an die Möglichkeit geknüpft ist, dass der Raum an sich nicht das ist, was er scheint.
Der Vorbote dieser Vorstellung – die »Urstory«, wenn man so will – wurde 23 Jahrhunderte vor der Zeit verfasst, in der Lewis seinen Fantasy-Roman schrieb. Ich denke da an Platos Republik und speziell an meinen darin enthaltenen Lieblingsabschnitt: das Höhlengleichnis. Trotz seiner frühen Entstehung beleuchtet es direkter und deutlicher sowohl die potenzielle Notwendigkeit als auch die möglichen Gefahren des Versuchs, etwas zu verstehen, dass sich außerhalb der Reichweite unserer unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen befindet.
In seiner Allegorie vergleicht Plato unsere Erfahrung der Wirklichkeit mit der einer Gruppe von Individuen, die ihr ganzes Leben als Gefangene in einer Höhle verbringen. Sie sind gezwungen, eine leere Wand anzusehen. Ihr einziger Blick auf die Welt ist diese Wand, die durch ein Feuer hinter ihrem Rücken beleuchtet wird und auf der sie nur sich bewegende Schatten sehen. Die Schatten stammen von Gegenständen hinter ihnen, die durch das Licht des Feuers an die Wand projiziert werden.
Ich veranschauliche das mit der folgenden Zeichnung. Sie stammt aus dem Text, in dem ich auf der Oberschule erstmals von dem Gleichnis las – einer Übersetzung von Platos Dialogen aus dem Jahr 1961.
Die Zeichnung ist amüsant, weil sie eindeutig ebenso viel über die Zeit aussagt, in der sie skizziert wurde, wie es die im Dialog geschilderte Beschaffenheit der Höhle vermittelt. Warum zum Beispiel sind hier alle Gefangenen Frauen, die noch dazu nur spärlich bekleidet sind? Zu Platos Zeit dürfte jede sexuelle Anspielung ganz einfach Knaben gezeigt haben.
Plato meint, die Gefangenen würden die Schatten als die Wirklichkeit ansehen und ihnen sogar Namen geben. Das ist nicht unvernünftig, und in einem gewissen Sinn ist es, wie wir bald sehen werden, eine sehr moderne Sicht dessen, was Wirklichkeit ist – nämlich das, was wir direkt messen können. Meine Lieblingsdefinition ist in der Tat diejenige, die der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick gab. Er sagte: »Wirklichkeit ist das, was nicht verschwindet, wenn du aufhörst, daran zu glauben.« Für die Gefangenen sind die Schatten das, was sie sehen. Wahrscheinlich hören sie auch nur die Echos von Geräuschen, die hinter ihnen erzeugt und von der Wand zurückgeworfen werden.
Plato vergleicht einen Philosophen mit einem Gefangenen, der von seinen Fesseln befreit wird und – beinahe gegen seinen Willen – gezwungen ist, nicht nur auf das Feuer zu schauen, sondern sich darüber hinaus an das Tageslicht dahinter zu begeben. Zunächst wird die arme Seele leiden, da der Schein des Feuers und später die Sonnenstrahlen außerhalb der Höhle in den Augen schmerzen. Gegenstände werden vollkommen fremd erscheinen, sie werden keine Ähnlichkeit mit ihren Schatten aufweisen. Plato meint, der gerade befreite Mensch dürfte die gewohnten Schatten weiterhin als zutreffendere Darstellung der Wirklichkeit empfinden als die Gegenstände, welche die Schatten werfen, selbst.
Wenn das Individuum schließlich widerstrebend ganz ins Sonnenlicht hinausgezerrt wird, werden sich all diese Gefühle von Verwirrung und Schmerz vervielfachen. Doch zuletzt wird es sich an die reale Welt gewöhnt haben; es wird die Sterne, den Mond und den Himmel sehen – seine Seele und sein Geist werden von den Illusionen befreit sein, die sein Leben vorher beherrscht hatten.
Wenn dieser Mensch in die Höhle zurückkehrte, würden laut Plato zwei Dinge geschehen. Erstens würde er, weil seine Augen nicht mehr an die Dunkelheit gewöhnt sind, die Schatten nicht mehr so gut unterscheiden und erkennen können, und seine zurückgelassenen Mitgefangenen würden ihn bestenfalls für sehbehindert, schlimmstenfalls für blind halten. Zweitens würde er die bedeutungslosen und kurzsichtigen Prioritäten seiner früheren Gemeinschaft nicht mehr als achtenswert ansehen, ebenso wenig wie die Ehren, die man denen zuteilwerden ließ, welche die Schatten anscheinend am besten erkennen und ihre Zukunft vorhersagen konnten. Poetisch und mit einem Homer-Zitat versehen, klingt es bei Plato wie folgt:
[…] wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen »das Feld als Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann« und lieber alles über sich ergehen lassen, als wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben?
So viel zu denen, die ihr Leben vollständig in einer Illusion zubringen, was Plato zufolge mehr oder weniger den größten Teil der Menschheit einschließt.
Dann konstatiert das Gleichnis, dass die Reise nach oben – ans Licht – den Aufstieg der Seele in die Welt des Geistes repräsentiert.
In Platos Denken konnte eindeutig nur ein Rückzug in die rein »geistige Welt« – eine nur wenigen, also den Philosophen, vorbehaltene Reise – die Illusion durch die Wirklichkeit ersetzen. Zum Glück ist diese Reise heutzutage um vieles einfacher, wenn man die Methoden der Wissenschaft verwendet – sie vereinen Vernunft und Reflektion mit empirischer Untersuchung. Dennoch stehen die Wissenschaftler heute weiterhin vor dieser Herausforderung: nachzuschauen, was hinter den Schatten liegt, um das zu erkennen, was nicht verschwindet, wenn man seine überlieferten Vorstellungen fallen lässt.
Auch wenn Plato nicht ausdrücklich davon spricht, impliziert seine Geschichte, dass die Mitgefangenen die arme Seele, die sich nach draußen gewagt hatte und zurückgekommen war, nun nicht nur als behindert ansähen, sondern den Betreffenden für verrückt halten würden, falls er von den Wundern der wahren Wirklichkeit erzählte, die er gesehen hat – von Sonne, Mond, Seen, Bäumen, anderen Menschen und deren Kulturen.
Diese Idee ist verblüffend modern. Da die Grenzen der Wissenschaft sich immer weiter von der aus unserer direkten Erfahrung abgeleiteten, vertrauten Welt und der Welt des gesunden Menschenverstands entfernt haben, wird es für uns zunehmend schwieriger, das unserer Erfahrung zugrunde liegende Bild der Wirklichkeit zu erfassen oder zu akzeptieren. Manche finden es angenehmer, auf Mythen und Aberglauben zurückzugreifen und sich davon leiten zu lassen.
Wir sollten uns jedoch aus guten Gründen darüber im Klaren sein, dass der »gesunde Menschenverstand«, der sich ursprünglich entwickelte, damit wir in den Savannen Afrikas besser mit Raubtieren fertigwerden konnten, uns in die Irre führen könnte, wenn wir versuchen, über die Natur in ganz anderen Größenordnungen nachzudenken. Im Lauf der Evolution haben wir nicht die Fähigkeit entwickelt, die Welt des sehr Kleinen, des sehr Großen oder des sehr Schnellen intuitiv zu begreifen. Wir sollten nicht erwarten, dass die Regeln, auf die wir uns in unserem Alltagsleben herkömmlicherweise verlassen, universell gültig sind. Auch wenn diese Kurzsichtigkeit aus evolutionärer Sicht nützlich gewesen sein mag, können wir als denkende Wesen über sie hinaus gelangen.
In diesem Zusammenhang kann ich der Versuchung nicht widerstehen, eine letzte Ermahnung aus Platos Höhlengleichnis zu zitieren:
Das sehe ich so, dass zuletzt unter allem Erkennbaren und nur mit Mühe die Idee des Guten erblickt wird, wenn man sie aber erblickt hat, sie auch gleich dafür anerkannt wird, dass sie für alle die Ursache alles Richtigen und Schönen ist, im Sichtbaren das Licht und die Sonne, von der dieses abhängt, erzeugend, im Erkennbaren aber sie allein als Herrscherin Wahrheit und Vernunft hervorbringend …
Anschließend meint Plato, danach sollten diejenigen streben, die sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben vernünftig handeln wollten; sie sollten nach dem »Guten« streben, indem sie sich auf Vernunft und Wahrheit konzentrieren. Und er führt weiter aus, das könnten wir nur, wenn wir die unserer direkten Erfahrungswelt zugrunde liegenden Wirklichkeiten erforschen, anstatt die Illusionen einer Wirklichkeit zu erkunden, von der wir uns vielleicht wünschen, dass es sie geben möge. Rationales Handeln oder das Gute sei nur mithilfe rationaler Überprüfung dessen möglich, was wirklich ist, und nicht durch Glauben allein.
Platos Vision des »reinen Denkens« ist heute durch die wissenschaftliche Methode ersetzt worden. Sie beruht auf Vernunft und Experiment und ermöglicht uns, die der Welt zugrunde liegenden Realitäten zu entdecken. Rationales Handeln im öffentlichen und privaten Bereich erfordert heute eine Begründung in der Vernunft wie auch in der empirischen Untersuchung, und oft verlangt es auch, dass wir uns von der solipsistischen Welt unserer unmittelbaren Erfahrung verabschieden. Dieses Prinzip ist tatsächlich die Quelle für den größten Teil meiner eigenen öffentlichen Aktivitäten – im Gegensatz zu staatlicher Politik, die statt auf Beweisen auf Ideologie basiert. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum ich so negativ auf das Konzept des »Heiligen« reagiere – es schließt eine gewisse Vorstellung oder Mahnung ein, die für öffentliche Fragen, Erkundungen und Debatten unzulässig und manchmal lächerlich ist.
Diese Sicht lässt sich kaum stärker zum Ausdruck bringen, als ich es in einem Artikel für den New Yorker tat: »Wann immer wissenschaftliche Behauptungen als nicht hinterfragbar präsentiert werden, untergräbt das die Wissenschaft. Und wenn es in unserer Gesellschaft möglich ist, die Forschung wegen religiöser Handlungen oder Behauptungen über Heiligkeit zu unterbinden, untergraben wir die Basis der modernen säkularen Demokratie. Wir sind es uns selbst und unseren Kindern schuldig, keinen Freibrief für Staaten – ob totalitär, theokratisch oder demokratisch – auszustellen, welche die Unterdrückung offenen Fragens unterstützen, ermutigen, durchsetzen oder sonst wie legitimieren, um Vorstellungen zu schützen, die als ›heilig‹ angesehen werden. 500 Jahre Wissenschaft haben die Menschheit von den Fesseln aufgezwungener Unwissenheit befreit.«
Abgesehen von philosophischen Überlegungen bringe ich Platos Höhle vor allem deswegen hier ein, weil sie uns ein konkretes Beispiel für die Natur der wissenschaftlichen Entdeckungen bietet, die den Kern der hier erzählten Geschichte ausmachen.
Man stelle sich einen Schatten vor, den unsere Gefangenen an der Wand sehen. Er wird von einem bösen Puppenspieler vorgeführt, der sich auf einem Felsvorsprung vor dem Feuer befindet:
Dieser Schatten weist sowohl Länge als auch Richtung auf, zwei Konzepte, die wir – nicht in der Höhle eingeschlossen – für verlässliche Größen halten.
Für die Gefangenen ändert sich dieser Schatten jedoch, während sie die Wand ansehen:
Später sieht er so aus:
Und noch etwas später so:
Und wieder etwas später so:
Was würden die Gefangenen aus alledem schließen? Vermutlich, dass Konzepte wie Länge oder Richtung keine absolute Bedeutung zukommt. In ihrer Welt können die Gegenstände sowohl ihre Länge als auch ihre Ausrichtung beliebig verändern. In der Wirklichkeit ihrer unmittelbaren Erfahrung scheinen weder Länge noch Richtung von Bedeutung zu sein.
Was wird der Naturphilosoph entdecken, der entkommen ist, um die reichhaltigere Welt jenseits der Schatten zu erkunden? Er wird feststellen, dass der Schatten vor allem ein Schatten ist: das zweidimensionale Bild eines realen dreidimensionalen Gegenstands, der sich hinter den Gefangenen befindet. Er wird erkennen, dass der Gegenstand eine festgelegte Länge aufweist, die sich nie verändert, und dass er zusammen mit einem Pfeil auftritt, der sich stets auf derselben Seite des Gegenstands befindet. Von einem leicht erhöhten Standort aus sieht er, dass die Bildabfolge von der Projektion einer rotierenden Wetterfahne auf die Wand herrührt:
Wenn er zu seinen ehemaligen Kollegen zurückkehrt, kann der Philosoph und Wissenschaftler erklären, dass es in Wirklichkeit eine absolute Größe namens Länge gibt, die sich nicht mit der Zeit verändert, und dass gewissen Gegenständen auch eine eindeutige Ausrichtung zukommt. Er wird seinen Freunden mitteilen, dass die reale Welt nicht zweidimensional, sondern dreidimensional ist, und dass ihre ganze Verwirrung wegen der scheinbar willkürlichen Veränderungen verschwände, sobald sie das verstanden hätten.
Würden sie ihm glauben? Er hätte wohl schwer zu kämpfen, weil sie keine intuitive Vorstellung von Rotation hätten (denn mit einer allein auf zweidimensionalen Erfahrungen beruhenden Intuition dürfte es schwierig sein, sich irgendwelche Rotationen in einer dritten Dimension »bildlich« vorzustellen). Verständnislose Blicke? Wahrscheinlich. Klapsmühle? Vielleicht. Doch er könnte seine Gemeinschaft möglicherweise überzeugen, wenn er die attraktiven Merkmale betonen würde, die mit seiner Behauptung verbunden sind: Oberflächlich scheinbar komplexes und willkürliches Verhalten kann aus einem viel einfacheren zugrunde liegenden Bild der Natur hervorgehen, sodass anscheinend nicht miteinander zusammenhängende Phänomene in Wahrheit verknüpft sind und Teil eines vereinten Ganzen sein können.
Besser noch – er könnte Vorhersagen machen, die seine Freunde überprüfen könnten. Erstens: Falls die von der Gruppe gemessene offensichtliche Änderung der Schattenlänge tatsächlich auf eine Rotation in einer dritten Dimension zurückzuführen sei, so würde die Längendimension des Gegenstands, wann immer sie kurz verschwände, gleich darauf wieder erscheinen, wobei der Pfeil in die entgegengesetzte Richtung wiese. Zweitens: Während die Länge schwankt, würde die maximale Länge des Schattens immer dann, wenn der Pfeil in eine Richtung weist, genau der Länge entsprechen, die man misst, wenn er in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
Platos Höhle wird damit zur Allegorie für etwas weit Umfassenderes, als er beabsichtigt haben mag. Platos befreiter Gefangener entdeckt die Kennzeichen der bemerkenswert wahren Geschichte unseres eigenen Kampfes, die Natur in ihren grundlegenden Größenordnungen von Raum, Zeit und Materie zu verstehen. Dabei mussten auch wir den Fesseln unserer vorherigen Erfahrungen entkommen, um tief reichende und schöne Vereinfachungen und Vorhersagen aufzudecken, die so wundervoll wie erschreckend sein können.
Doch so schmerzhaft das Licht außerhalb von Platos Höhle anfangs auch sein mag – mit der Zeit elektrisiert es uns. Und sobald man einmal Zeuge davon wurde, führt kein Weg mehr zurück.
KAPITEL 2 IMDUNKELNSEHEN
Es werde Licht! Und es ward Licht.
1. BUCHMOSE, 1:3
Am Anfang war das Licht.
Es ist kein Zufall, dass die Menschen des Altertums sich vorstellten, das Licht sei am ersten Schöpfungstag geschaffen worden. Ohne Licht wäre von dem ungeheuer großen Universum, das uns umgibt, wenig wahrzunehmen. Wenn wir nicken und im Englischen einem Freund gegenüber sagen »I see« (»Ich sehe«), teilen wir nicht nur eine einfache Beobachtung mit, sondern grundlegendes Verstehen.
Platos Gleichnis drehte sich passenderweise um Licht – das Licht eines Feuers, das Schatten auf die Höhlenwand wirft, und das Licht von außerhalb, das den befreiten Gefangenen zeitweilig blendet und ihm dann die reale Welt erhellt. Wie die Gefangenen in der Höhle sind auch wir Gefangene des Lichts – fast alles, was wir über die Welt erfahren, rührt von dem her, was wir sehen.
Doch während die wichtigsten Worte im religiösen Kanon des Westens »Es werde Licht« sein dürften, hat dieser Satz in unserer heutigen Welt eine völlig andere Bedeutung als einst. Menschen mögen Gefangene des Lichts sein, doch das gilt auch für das Universum. Was einst als Laune eines jüdisch-christlichen Gottes oder anderer Gottheiten vor diesem einen erschien, verstehen wir heute als notwendiges Erfordernis der Gesetze, die dem Himmel, aber vor allem der Erde die Existenz ermöglichen. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Die Erde oder die Materie folgen auf das Licht. Diese veränderte Wahrnehmung liegt fast jeder Weiterentwicklung des Gebäudes zugrunde, das wir moderne Wissenschaft nennen. Während ich dies schreibe, blicke ich von einem Schiff aus auf eine der Galapagos-Inseln, die durch Darwin berühmt geworden sind und die ihrerseits ihn berühmt gemacht haben, als er unsere Wahrnehmung des Lebens und seiner Vielfalt mit einer brillanten Einsicht veränderte – dass nämlich alle lebenden Arten sich durch die natürliche Auslese kleiner, vererbter Variationen entwickelt haben, die von den Überlebenden an nachfolgende Generationen weitergegeben wurden. Und so, wie unser verändertes Verständnis der Evolution alles verwandelte, was wir unter Biologie verstanden, hat unser verändertes Verständnis des Lichts alles verändert, was wir über unseren Platz im Universum zu verstehen glaubten. Als nützlicher Nebeneffekt ergab sich aus diesem Wandel praktisch die gesamte Technologie, auf der die moderne Welt aufbaut.
Wie sehr unsere Beobachtungen der Welt unser Denken gefangen halten und unserer Darstellung von der Struktur unseres Universums den Rahmen vorgeben, blieb nach Plato für mehr als 20 Jahrhunderte unerkannt. Und als seriöse Denker begonnen hatten, die verborgene Natur des Universums ernsthaft zu erforschen, dauerte es mehr als vier Jahrhunderte, bis sie die Frage »Was ist Licht?« umfassend gelöst hatten.
Der vielleicht seriöseste, wenn auch sicher nicht der erste moderne Denker, der diese Frage stellte, war auch einer der berühmtesten – und eigenartigsten – Wissenschaftler der Geschichte: Isaac Newton. Es ist durchaus angemessen, Newton als einen modernen Denker einzustufen – schließlich offenbarten seine Principia (Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie) im 17. Jahrhundert die klassischen Gesetze der Bewegung und legten das Fundament für seine Theorie der Gravitation. Beides zusammen bildete die Grundlage eines großen Teils der modernen Physik. Doch wie John Maynard Keynes festhielt, war
Newton nicht der Erste dieses Zeitalters der Aufklärung; er war der Letzte der Magier, der Letzte der Babylonier und Sumerer, der letzte große Geist, der mit den gleichen Augen in die sichtbare und geistige Welt blickte wie jene, die vor weniger als 10 000 Jahren anfingen, unser geistiges Erbe zu errichten.
Die Wahrheit dieser Aussage spiegelt die höchst revolutionäre Bedeutung von Newtons eigener Arbeit wider. Nach seinen Principia konnte kein rational denkender Mensch die Welt weiterhin so sehen, wie die Menschen der Antike sie betrachtet hatten. Doch sie spiegelt auch den Charakter Newtons. Schließlich verwendete Newton weit mehr Zeit und Tinte auf seine Schriften über die verborgenen Bedeutungen und Codes der Bibel – insbesondere konzentrierte er sich auf die Offenbarung des Johannes und die mit dem antiken Tempel des Salomon verbundenen Mysterien – als auf Arbeiten über die Physik.
In einer langen Reihe von Leuten (sowohl vor als auch nach ihm) war Newton einer, der den Eindruck hatte, er sei von Gott dazu auserwählt, zur Enthüllung der wahren Bedeutung der Heiligen Schrift beizutragen. In welchem Ausmaß seine Untersuchungen des Universums sich aus seiner Faszination für die Bibel ableiteten, ist nicht klar, doch man kann vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass er sich hauptsächlich für die Theologie interessierte und die Naturphilosophie – wie auch die Alchimie – erst weit dahinter kam.
Viele versuchen auf Newtons Faszination für Gott zu verweisen, um zu belegen, dass Wissenschaft und Religion vereinbar seien, und um geltend zu machen, dass die moderne Wissenschaft ihre Existenz notwendigerweise dem Christentum verdanke. Diese Ansicht verwechselt Geschichte mit Kausalität. Es ist nicht zu bestreiten, dass, von Newton an, viele frühen Giganten der modernen westlichen Naturphilosophie tief religiös waren, auch wenn Darwin später im Leben in beträchtlichem Maße, wenn nicht sogar ganz vom Glauben abkam. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass es für den längsten Teil dieses Zeitraumes nur zwei Quellen für Bildung und Reichtum gab: Kirche und Krone. In diesem Sinn war die Kirche die nationale Studienstiftung des 15., 16. und 17. Jahrhunderts. Alle höheren Bildungseinrichtungen waren an verschiedene Konfessionen geknüpft, und für gebildete Personen war es undenkbar, keiner Kirche anzugehören. Und wie Giordano Bruno und später Galileo Galilei erfuhren, war es im besten Fall unerfreulich, sich gegen ihre Lehre zu stellen. Es wäre bemerkenswert gewesen, wenn einer dieser führenden Pioniere der Wissenschaft nicht religiös gewesen wäre.
Die Religiosität der frühen Wissenschaftspioniere wird heute auch von Sophisten angeführt, die behaupten, wissenschaftliche und religiöse Lehre seien vereinbar – doch diese Leute verwechseln »Wissenschaft« mit »Wissenschaftler«. Obwohl es oft so scheint, als sei das Gegenteil der Fall, sind Wissenschaftler Menschen. Und wie alle Menschen sind sie dazu imstande, gleichzeitig viele einander potenziell widersprechende Vorstellungen im Kopf zu haben. Bei einem Individuum steht die Korrelation zwischen voneinander abweichenden Ansichten für nichts anderes als für eine menschliche Schwäche.
Wenn behauptet wird, manche Wissenschaftler seien religiös oder zumindest einmal religiös gewesen, so gleicht das der Aussage, einige Wissenschaftler seien Republikaner, glaubten, die Erde sei eine Scheibe, oder hingen dem Kreationismus an. Das schließt weder Kausalität noch Widerspruchsfreiheit ein. Mein Freund Richard Dawkins hat mir von einem Professor der Astrophysik erzählt, der tagsüber Aufsätze schreibt, die in astronomischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden und sich auf die Tatsache stützen, dass das Universum mehr als 13 Milliarden Jahre alt ist … dann aber nach Hause geht und privat die biblische Behauptung vertritt, das Universum sei 6000 Jahre alt.
In den Wissenschaften wird intellektuelle Konsistenz oder deren Fehlen allein durch die Kombination rationaler Argumente mit darauf folgenden Belegen und fortwährender Überprüfung bestimmt. Deshalb ist es absolut vernünftig zu behaupten, dass Religion zumindest in der westlichen Welt die Mutter der Wissenschaft sein dürfte. Doch wie alle Eltern wissen, wachsen Kinder selten zu Abbildern ihrer Eltern heran.
Der Tradition folgend, könnte Newton sich deshalb für das Licht interessiert haben, weil es eine Gabe Gottes war. An sein Werk erinnern wir uns jedoch nicht wegen seiner Motivation, sondern wegen seiner Entdeckungen.
Newton war davon überzeugt, dass Licht aus Teilchen besteht, die er als Korpuskeln bezeichnete, während Descartes und später Newtons Erzfeind Robert Hooke sowie – noch später – der holländische Wissenschaftler Christiaan Huygens behaupteten, Licht sei eine Welle. Eine der zentralen Beobachtungen, welche die Wellentheorie zu stützen schienen, war die Tatsache, dass weißes Licht (wie das Sonnenlicht) in alle Farben des Regenbogens zerlegt werden konnte, wenn man es durch ein Prisma leitete.
Wie so oft in seinem Leben war Newton davon überzeugt, dass er recht hatte und mehrere seiner berühmtesten Zeitgenossen (und Konkurrenten) falsch lagen. Um das zu demonstrieren, ersann er ein raffiniertes Experiment mit Prismen, das er – um der Pest zu entkommen, die in Cambridge wütete – erstmals zu Hause in Woolsthorpe durchführte. Wie er der Royal Society 1722 berichtete, hatte er beim 44. Durchlauf genau das beobachtet, was er zu sehen gehofft hatte.
Vertreter der Wellentheorie hatten vorgebracht, Lichtwellen bestünden aus weißem Licht; die Zerlegung in Farben, die man beim Durchgang durch ein Prisma beobachte, erfolge durch eine »Schädigung« der Strahlen, die das Glas durchquerten. In diesem Fall hätte eine weitergehende Zerlegung stattfinden müssen, wenn man es durch zusätzliches Glas leitete.
Newton dachte, das treffe nicht zu, und meinte, Licht bestehe aus farbigen Teilchen, die sich vereinigten und so weiß erschienen. (Mit einer Reverenz an seine Faszination für Okkultes teilte Newton die farbigen Teilchen des »Spektrums« – der Begriff wurde von ihm geprägt – in sieben verschiedene Arten ein: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Seit der Zeit der Griechen hatte man speziell der Zahl Sieben besondere mystische Eigenschaften zugeschrieben.) Um zu zeigen, dass das Bild von Welle und Schädigung nicht korrekt war, leitete Newton einen Strahl weißen Lichts durch zwei unterschiedlich ausgerichtete Prismen. Das erste Prisma zerlegte das Licht in sein Spektrum, das zweite setzte es wieder zu einem einzigen weißen Lichtstrahl zusammen. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn das Glas das Licht geschädigt hätte. Ein zweites Prisma hätte alles nur noch schlimmer gemacht und das Licht nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Die Wellentheorie des Lichts wird durch dieses Ergebnis in Wahrheit nicht widerlegt (eigentlich wird sie dadurch bestätigt, weil Licht sich verlangsamt, wenn es beim Eintritt in das Prisma gebeugt wird, so, wie es auch bei Wellen der Fall wäre). Doch weil die Vertreter der Wellentheorie (fälschlicherweise) vorgebracht hatten, die spektrale Zerlegung sei auf eine Schädigung zurückzuführen, gelang Newton mit seiner Demonstration, dass dies nicht der Fall war, ein bedeutender Schlag zugunsten seines Teilchenmodells.
Interessanterweise entdeckte Newton anschließend viele andere Facetten des Lichts, die wir heute bei unserem Verständnis seiner Wellennatur anwenden. Newton zeigte, dass jede Farbe des Lichts beim Durchgang durch ein Glasprisma einen eigenen Beugungswinkel besitzt. Er zeigte auch, dass alle Objekte scheinbar die Farbe des sie beleuchtenden Lichtstrahls annehmen. Und er zeigte, dass farbiges Licht seine Farbe nicht ändert, egal wie oft es ein Prisma durchläuft oder von ihm reflektiert wird.
All diese Resultate einschließlich seines ersten Ergebnisses können auf einfache Weise erklärt werden, wenn weißes Licht tatsächlich aus einer Kollektion unterschiedlicher Farben zusammengesetzt ist – insofern behielt er recht. Doch sie können nicht erklärt werden, wenn Licht aus unterschiedlich gefärbten Teilchen besteht. Weißes Licht setzt sich vielmehr aus Wellen vieler verschiedener Wellenlängen zusammen.
Newtons Gegner gaben nicht so leicht auf, nicht einmal angesichts seiner wachsenden Popularität oder des Todes seines Hauptgegners Hooke. Sie ließen nicht einmal locker, als Newton 1704 zum Präsidenten der Royal Society gewählt wurde, dem Jahr, in dem er auch seine Forschung über Licht in seinem Werk Opticks veröffentlichte. Tatsächlich zog sich die heftige Diskussion über die Natur des Lichts noch mehr als ein Jahrhundert lang hin.
Zu dem Problem, sich das Licht als Welle vorzustellen, gehörte auch die Frage: Woraus besteht diese Welle eigentlich? Und falls es eine Welle ist und da alle bekannten Wellen ein Medium benötigten: In welchem Medium bewegt es sich fort? Diese Fragen waren so verwirrend, dass die Anwender der Wellentheorie eine unsichtbare Substanz wiederauferstehen lassen mussten, die den ganzen Raum durchdringt – den Äther.
Die Auflösung des Rätsels kam, wie das bei solchen Lösungen oft der Fall ist, aus einer völlig unerwarteten Ecke der Physik – einer Welt voller Blitze und sich drehender Räder.
Als ich als junger Professor in Yale tätig war, hatte man für mich – in dem altertümlichen, aber riesigen Büro, das ich glücklicherweise beziehen konnte, als ein ebenso altertümlicher Kollege in den Ruhestand ging – die Kopie einer Fotografie von Michael Faraday aus dem Jahr 1861 hängen lassen. Ich habe das Bild seitdem stets geschätzt.
Ich glaube eigentlich nicht an Heldenverehrung, doch wenn ich es täte, gehörte Faraday hier zu den Besten. Vielleicht mehr als jeder andere Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts ist er für die Technologie verantwortlich, die unsere derzeitige Zivilisation antreibt. Faraday wurde jedoch kaum formale Bildung zuteil, und mit 14 Jahren begann er als Lehrling eines Buchbinders. In seiner späteren beruflichen Laufbahn, nachdem seine wissenschaftlichen Beiträge weltweit Anerkennung gefunden hatten, hielt er an seiner bescheidenen Herkunft fest. Er lehnte es ab, in den Adelsstand erhoben zu werden, und weigerte sich zweimal, den Vorsitz der Royal Society zu übernehmen. Noch später weigerte er sich, der britischen Regierung bei der Produktion chemischer Waffen für den Krimkrieg zu helfen und führte dafür ethische Gründe an. Außerdem hielt er 33 Jahre lang Weihnachtsvorlesungen an der Royal Institution ab, um junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern. Was könnte einem da missfallen?
So sehr man den Menschen bewundern mag – für unsere Geschichte kommt es auf den Wissenschaftler an. Und Faradays erste wissenschaftliche Lektion vermittle ich auch meinen Studenten: Buckelt immer vor euren Professoren. Mit 20 Jahren, nach sieben Jahren Lehrzeit als Buchbinder, hörte er die Vorlesungen des berühmten Chemikers Humphrey Davy, damals Vorstand der Royal Institution. Anschließend schenkte Faraday Davy ein wunderschön gebundenes Buch von 300 Seiten mit den Notizen, die er sich während der Vorlesungen gemacht hatte. Binnen eines Jahres wurde Faraday zu Davys Sekretär ernannt und erhielt kurz darauf eine Anstellung als chemischer Assistent an der Royal Institution. In der Folge musste Faraday seine erste Lektion noch einmal lernen, diesmal mit umgekehrtem Ausgang. Er ließ sich von der Aufregung über einige seiner frühen, ziemlich wichtigen Experimente leiten und vergaß in seinen veröffentlichten Resultaten versehentlich, die Zusammenarbeit mit Davy anzugeben. Diese Brüskierung brachte es wahrscheinlich mit sich, dass er von Davy mit anderen Aufgaben betraut wurde; seine die Welt verändernde Forschung verzögerte sich dadurch um mehrere Jahre.
Als Faraday eine andere Tätigkeit zugewiesen wurde, hatte er sich gerade mit dem »heißen« neuen Gebiet der wissenschaftlichen Forschung befasst, auf dem die kurz zuvor entdeckten Zusammenhänge zwischen Elektrizität und Magnetismus untersucht wurden – angetrieben von den Ergebnissen des dänischen Physikers Hans Christian Oersted. Diese beiden Kräfte scheinen einerseits ziemlich verschieden zu sein, sind sich aber in einigen Aspekten merkwürdig ähnlich. Elektrische Ladungen können einander anziehen oder abstoßen. Das könnten auch Magnete. Doch Magnete scheinen mit Nord- und Südpol immer zwei Pole zu besitzen, die nicht voneinander getrennt werden können, während elektrische Ladungen jeweils positiv oder negativ sein können.
Einige Zeit lang fragten sich Wissenschaftler und Naturphilosophen, ob es vielleicht einen verborgenen Zusammenhang zwischen den beiden Kräften geben könne, und der erste empirische Hinweis fiel Oersted durch einen Zufall auf. Als er 1820 eine Vorlesung hielt, sah er, dass eine Kompassnadel ausgelenkt wurde, wenn er den Strom einer Batterie einschaltete. Einige Monate später ging er dieser merkwürdigen Entdeckung gründlicher nach und fand heraus, dass ein Strom bewegter elektrischer Ladungen – heute bezeichnen wir das als elektrischen Strom – eine magnetische Anziehung hervorrief. Diese brachte Kompassnadeln dazu, rund um den Draht einen Kreis zu beschreiben.
Oersted hatte einen neuen Weg markiert, was sich unter Wissenschaftlern auf dem Kontinent und über den Ärmelkanal hinweg rasch herumsprach. Wenn man elektrische Ladungen bewegte, erzeugte man eine magnetische Kraft. Konnte es da noch andere Zusammenhänge geben? Konnten Magnete vielleicht ihrerseits elektrische Ladungen beeinflussen?
Wissenschaftler suchten nach einer solchen Möglichkeit, kamen aber zu keinem Ergebnis. Davy und ein anderer Kollege wollten auf Basis des von Oersted gefundenen Zusammenhangs einen elektrischen Motor konstruieren, doch der Versuch scheiterte. Faraday gelang es schließlich, einen stromführenden Draht dazu zu bringen, sich um einen Magneten zu bewegen, was eine primitive Art von Motor darstellte. Es war diese aufregende Entwicklung gewesen, die er dokumentiert hatte, ohne Davys Namen zu nennen.
Zum Teil war das alles nichts als ein Ablenkungsmanöver. Es wurde kein grundlegend neues Phänomen entdeckt. Möglicherweise war dies der Anlass für eine meiner (wahrscheinlich unwahren) Lieblingsgeschichten über Faraday. Wie es heißt, hatte der spätere britische Premierminister William Gladstone von Faradays Labor voller seltsamer Apparate gehört und 1850 angefragt, was denn der praktische Nutzen all dieser Studien zur Elektrizität sei. Laut dem 1903 erschienen Buch Democracy and Liberty soll Faraday erwidert haben: »Nun, Sir, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie bald in der Lage sein werden, sie zu besteuern.«
Ob wahr oder nicht – die witzige Erwiderung enthält sowohl Ironie als auch Wahrheit. Von Neugier getriebene Forschung mag maßlos selbstsüchtig erscheinen und wenig mit dem Gemeinwohl zu tun haben. Doch unsere gesamte heutige Lebensqualität – zumindest für diejenigen, die in den Staaten der Ersten Welt leben – ist im Wesentlichen aus den Früchten solcher Forschung hervorgegangen; dazu gehört auch die elektrische Energie, die fast jedes unserer im Alltag verwendeten Geräte antreibt.
Zwei Jahre nach Davys Tod im Jahr 1829 und sechs Jahre, nachdem Faraday Leiter des Labors der Royal Institution geworden war, machte er die Entdeckung, die seinen Ruf als möglicherweise größter Experimentalphysiker des 19. Jahrhunderts verfestigte – die magnetische Induktion. Seit 1824 hatte er versucht herauszufinden, ob Magnetismus den in einem nahen Draht fließenden Strom verändern oder auf andere Weise irgendeine Art elektrischer Kraft auf geladene Teilchen ausüben konnte: Er wollte vor allem erkennen, ob der Magnetismus Elektrizität induzieren konnte – genau wie Oersted gezeigt hatte, dass Elektrizität und speziell elektrische Ströme magnetische Effekte hervorrufen können.
Am 28. Oktober 1831 hielt er in seinem Labor-Notizbuch eine bemerkenswerte Beobachtung fest. Wenn er den Schalter umlegte, um in einem um einen Eisenring gewickelten Draht einen Strom fließen zu lassen, der das Eisen magnetisieren sollte, fiel ihm auf, dass in einem anderen, um den gleichen Eisenring gewickelten Draht kurzzeitig ein Strom floss. Damit war klar, dass es nicht die bloße Anwesenheit eines nahen Magneten sein konnte, die eine elektrische Kraft hervorrief und so dafür sorgte, dass in einem anderen Draht ein Strom floss – Grund war das Ein- oder Ausschalten des Magneten. Anschließend zeigte er, dass der gleiche Effekt auftrat, wenn er einen Magneten in der Nähe eines Drahtes bewegte. Wenn der Magnet näher kam oder sich entfernte, floss in dem Draht ein Strom. So, wie eine sich bewegende Ladung einen Magneten erzeugte, schuf ein sich bewegender Magnet – oder ein Magnet mit sich verändernder Stärke – irgendwie eine elektrische Kraft in dem nahen Draht und erzeugte einen Strom.
Wenn einem die tief reichende theoretische Implikation dieses einfachen und überraschenden Resultats nicht sofort aufgeht, ist das verzeihlich – diese Implikation ist subtil, und es bedurfte des größten theoretischen Denkers des 19. Jahrhunderts, um sie ans Licht zu bringen.
Wenn wir sie jedoch angemessen formulieren wollen, müssen wir eine Vorstellung ins Spiel bringen, die Faraday selbst eingeführt hatte. Wie schon gesagt, verfügte Faraday kaum über formale Bildung und hatte sich sehr viel selbst beigebracht. Deshalb kam er mit Mathematik nie besonders gut zurecht, und laut einer anderen, wahrscheinlich nicht der Wahrheit entsprechenden Story rühmte Faraday sich, in all seinen Publikationen nur eine einzige mathematische Gleichung verwendet zu haben. Tatsächlich wahr ist hingegen, dass er die bedeutende Entdeckung der magnetischen Induktion nie in mathematischen Begriffen dargestellt hat.
Weil er sich mit formaler Mathematik nicht wohl fühlte, war Faraday auf bildliche Vorstellungen angewiesen, wenn er die Physik hinter seinen Beobachtungen intuitiv erfassen wollte. Deshalb kam er auf eine Idee, die den Eckstein der gesamten modernen Physiktheorie bildet und tatsächlich ein Rätsel löste, das Newton bis ans Ende seiner Tage beschäftigt hatte.
Faraday stellte sich im Grunde folgende Frage: Woher »weiß« eine elektrische Ladung, wie sie auf die Gegenwart einer anderen, entfernten elektrischen Ladung reagieren soll? Die gleiche Frage hatte Newton sich in Hinblick auf die Gravitation gestellt; er überlegte, woher die Erde »wusste«, dass sie auf die Anziehung der Sonne so zu reagieren hatte, wie sie es tat. Wie wurde die Schwerkraft von einem Körper zum anderen übertragen? Darauf gab Newton die berühmte Antwort »Hypothesis non fingo« (»Ich bilde keine Hypothesen«), was besagte, er habe das Gesetz der Schwerkraft ausgearbeitet und gezeigt, dass seine Vorhersagen mit den Beobachtungen übereinstimmten, und das reiche völlig aus. Mit dieser Aussage haben sich in den Jahren danach viele von uns Physikern verteidigt, wenn sie gebeten wurden, mancherlei merkwürdige Resultate in der Physik zu erklären – insbesondere in der Quantenmechanik, wo die Mathematik funktioniert, das physikalische Bild jedoch stets verrückt zu sein scheint.
Faraday stellte sich vor, dass jede elektrische Ladung von einem elektrischen »Feld« umgeben sei, das er sich geistig vergegenwärtigen konnte. Er stellte sich vor, das Feld lasse sich als Bündel von radial aus der Ladung austretenden Linien veranschaulichen. Dabei seien die Feldlinien mit Pfeilen versehen, die bei einer positiven Ladung nach außen und bei einer negative Ladung nach innen zeigten:
Faraday stellte sich weiter vor, dass die Zahl der Feldlinien mit der Größe der Ladung zunahm:
Dieses mentale Bild ermöglichte es Faraday nun, intuitiv zu verstehen, was geschehen würde, wenn er eine weitere Testladung in die Nähe der ersten Ladung bringen würde, und in gewissem Sinn auch zu erfassen, warum das so war. (Zur Erinnerung: Wann immer ich das umgangssprachliche »warum« gebrauche, meine ich eigentlich »wie«.)
In Faradays bildlicher Vorstellung würde die Testladung das »Feld« der ersten Ladung spüren, wo immer die zweite Ladung sich befinden mochte; die Stärke der Kraft sollte dabei proportional zur Zahl der Feldlinien im Bereich und in der Richtung der Feldlinien sein. Demnach würde die fragliche Testladung beispielsweise in der gezeigten Richtung nach außen gelenkt:
Mit Faradays Bildern lässt sich noch mehr anfangen. Stellen wir uns zwei Ladungen vor, die sich nahe beieinander befinden. Da die Feldlinien in einer positiven Ladung beginnen, in einer negativen Ladung münden und sich nie überschneiden können, leuchtet es fast intuitiv ein, dass die Feldlinien zwischen zwei positiven Ladungen einander abzustoßen scheinen und auseinandergedrängt werden. Zwischen einer positiven und einer negativen Ladung hingegen sollten sie sich miteinander verbinden:
Eine Testladung, die man an einen beliebigen Punkt in der Nähe dieser beiden Ladungen bringt, erfährt auch in diesem Fall eine Kraft in Richtung der Feldlinien; die Größe der Kraft ist proportional zur Zahl der Feldlinien in diesem Bereich.
So konnte Faraday auch die Natur elektrischer Kräfte zwischen Teilchen darstellen, ohne dazu die algebraischen Gleichungen lösen zu müssen, die elektrische Kräfte beschreiben. Besonders erstaunlich an diesen Bildern ist, dass sie die Mathematik exakt und nicht nur annäherungsweise erfassen.
Eine ähnliche bildliche Anschauung konnte auf Magneten und Magnetfelder angewandt werden; sie reproduzierte das Gesetz magnetischer Kräfte zwischen Magneten, das Coulomb experimentell verifiziert hatte, oder stromführender Drähte, wie es von André-Marie Ampere abgeleitet worden war. (Damit sollte klar sein, dass die Gesetze der Elektrizität und des Magnetismus vor Faraday vor allem von den Franzosen entdeckt wurden.)
Mithilfe dieser mentalen Krücken können wir Faradays Entdeckung der magnetischen Induktion nun folgendermaßen neu ausdrücken: Eine Zunahme oder Abnahme der Zahl magnetischer Feldlinien, die durch eine Drahtschleife verlaufen, lässt in dem Draht einen Strom fließen.
Faraday begriff rasch, dass seine Entdeckung die Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie erlauben würde. Wenn man eine Drahtschleife an einer Schaufel befestigte, die wie bei einem Wasserrad durch einen Wasserstrahl in Bewegung versetzt wurde, und die ganze Vorrichtung mit einem Magneten umgeben war, so würde sich die Zahl der durch den Draht verlaufenden magnetischen Feldlinien mit der Drehung der Schaufel ständig verändern. Im Draht würde dann fortwährend ein Strom erzeugt. Und siehe da: Niagara-Fälle, Hydroelektrizität und die moderne Welt!
Das allein würde schon ausreichen, Faradays Ruf als größter Experimentalphysiker des 19. Jahrhunderts festzuschreiben. Doch tatsächlich war es nicht die Technik, die Faraday motivierte, und deshalb schätze ich ihn besonders. Es war sein tief empfundenes Staunen und seine Bereitschaft, seine Entdeckungen möglichst umfassend mitzuteilen, was ich am meisten an ihm bewundere. Meiner Überzeugung nach würde er der Aussage zustimmen, dass der entscheidende Nutzen der Wissenschaft in ihrer Fähigkeit liegt, unser grundlegendes Verständnis von unserer Stellung im Kosmos zu verändern. Und das ist ihm letztlich gelungen.
In diesem Sinn fällt mir unvermeidlich ein anderer großer Experimentalphysiker aus jüngerer Zeit ein, nämlich Robert R. Wilson. Er wurde mit 29 Jahren Leiter der Forschungsabteilung in Los Alamos, die während des Manhattan-Projekts die Atombombe entwickelte. Viele Jahre später war er dann der erste Direktor des Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Illinois. Nachdem das Fermilab errichtet worden war, zitierte man Wilson 1969 vor den Kongress; er sollte die Aufwendung erheblicher Finanzmittel für den exotischen neuen Beschleuniger begründen, mit dem die grundlegenden Wechselwirkungen von Elementarteilchen untersucht werden sollten. Auf die Frage, ob das Projekt zur nationalen Sicherheit beitrage (was aus Sicht der Mitglieder des Kongressausschusses die Ausgabe problemlos gerechtfertigt hätte), verneinte er das tapfer und erklärte vielmehr:
Es hat allein mit der Achtung zu tun, mit der wir einander ansehen, mit der Würde von Menschen, unserer Liebe zur Kultur … Es hat zu tun mit: Sind wir gute Maler, gute Bildhauer, große Dichter? Ich meine all die Dinge, die wir in unserem Land wirklich hochachten und ehren und auf die wir stolz sind. In diesem Sinne hat dieses neue Wissen alles mit Ehre und unserem Land zu tun, doch mit der Verteidigung unseres Landes hat es nicht direkt zu tun, wenn man davon absieht, dass es dazu beiträgt, es verteidigenswert zu machen.
Aus praktischer Perspektive haben Faradays Entdeckungen es uns ermöglicht, unsere Zivilisation zu erschaffen und mit Energie zu versorgen, unsere Städte zu beleuchten und unsere elektrischen Geräte zu betreiben. Man kann sich kaum eine Entdeckung vorstellen, die stärker in die Abläufe unserer modernen Gesellschaft eingebunden ist. Doch in einem tieferen Sinn ist sein Beitrag zu unserer Story aus einem anderen Grund so bemerkenswert: Das von ihm entdeckte fehlende Puzzlestück hat die Art verändert, in der wir heute über praktisch alles in der physischen Welt nachdenken (angefangen beim Licht selbst). Wenn Newton der letzte Magier war, so war Faraday der letzte moderne Wissenschaftler, der hinsichtlich des Lichtes im Dunkeln lebte. Nach seinen Arbeiten lag der Schlüssel, mit dem wir die wahre Natur unseres wichtigsten Fensters zur Welt entdecken konnten, offen da und wartete darauf, dass er von der richtigen Person gefunden wurde.
Binnen eines Jahrzehnts unternahm ein junger, vom Pech verfolgter theoretischer Physiker aus Schottland den nächsten Schritt.
KAPITEL 3 DURCHEINGLAS – GANZNEBENHER
Nichts ist zu schön, um wahr zu sein, solange es mit den Naturgesetzen übereinstimmt; und bei solchen Dingen ist das Experiment der beste Weg, diese Übereinstimmung zu prüfen.
MICHAELFARADAY, LABORNOTIZ 10,040 (18. MÄRZ 1849)
James Clerk Maxwell, der größte theoretische Physiker des 19. Jahrhunderts (Einstein sollte ihn später wegen seines Einflusses auf die Physik mit Newton vergleichen), wurde zufällig im gleichen Jahr geboren, in dem Michael Faraday die großartige Entdeckung der Induktion machte.
Wie Newton fand Maxwell zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere Farbe und Licht faszinierend. Newton hatte das Spektrum der sichtbaren Farben erforscht, in die weißes Licht beim Durchgang durch ein Prisma zerlegt wird; Maxwell dagegen ging schon als Student in gewissem Sinn der umgekehrten Frage nach: Welche minimale Kombination von Primärfarben würde für die menschliche Wahrnehmung alle im weißen Licht enthaltenen Farben reproduzieren? Mithilfe einer Sammlung farbiger Kreisel zeigte er, dass praktisch alle von uns wahrgenommenen Farben aus den passenden Mischungen von Rot, Grün und Blau entstehen können – diese Tatsache ist jedem vertraut, der RGB-Kabel in einen Farbfernseher gesteckt hat. Maxwell nutzte diese Idee, um das erste rudimentäre Farbfoto der Welt herzustellen. Später interessierte er sich für polarisiertes Licht, das aus Lichtwellen hervorgeht, deren elektrische und magnetische Felder nur in bestimmten Richtungen schwingen. Er legte Gelatineblöcke zwischen polarisierende Prismen und ließ Licht durch diese Konstruktionen fallen. Wenn die zwei Prismen nur Licht durchließen, das in unterschiedliche, senkrecht aufeinander stehende Richtungen polarisiert war, und wenn eines hinter dem anderen angebracht war, so drang kein Licht hindurch. Falls in der Gelatine jedoch Belastungen wirksam waren, dann konnte die Polarisationsachse des Lichts beim Durchgang durch das Material gedreht werden, sodass ein gewisser Lichtanteil durch das zweite Prisma gelangen konnte. Indem Maxwell nach solchen durch das zweite Prisma gelangenden Lichträndern suchte, konnte er Belastungen innerhalb des Materials sichtbar machen. Mittlerweile ist dies zu einem nützlichen Werkzeug zur Erforschung möglicher Materialbelastungen in komplexen Strukturen geworden.
Doch selbst diese scharfsinnigen Experimente geben die Stärke seines unersättlichen Geistes und seine mathematischen Fähigkeiten nicht angemessen wieder – beides zeigte sich schon in einem bemerkenswert frühen Alter. Tragischerweise starb Maxwell mit 48 Jahren, wodurch ihm wenig Zeit blieb, all das zu vollenden, was er geschafft hat.
Sein Forscher-Naturell spiegelt sich in einer Passage wider, mit der die Mutter einen Brief des Vaters an seine Schwägerin ergänzte, als Maxwell gerade drei Jahre alt war:
Er ist ein sehr glücklicher Mensch und hat sehr große Fortschritte gemacht, seit das Wetter besser geworden ist; er beschäftigt sich intensiv mit Türen, Schlössern, Schlüsseln etc., und »zeig mir, wie das geht« kommt ihm nie über die Lippen. Er erforscht auch den verborgenen Verlauf von strömenden Flüssigkeiten und Klingeldrähten, den Weg, auf dem Wasser vom Teich durch die Wand gelangt …
Nach dem frühen Tod seiner Mutter (sie starb an Magenkrebs, dem später auch Maxwell im gleichen Alter erliegen sollte) wurde seine schulische Ausbildung unterbrochen, doch mit 13 Jahren war er an der angesehenen Edinburgh Academy deutlich vorangekommen und bestand in Mathematik ebenso wie in Englisch und Poesie mit Auszeichnung. Anschließend veröffentlichte er seinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz über die Eigenschaften mathematischer Kurven, der in der Royal Society of Edinburgh vorgestellt wurde, als er gerade 14 Jahre alt war.