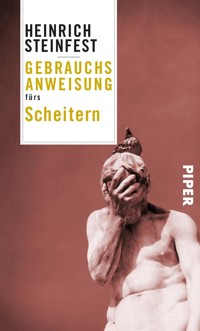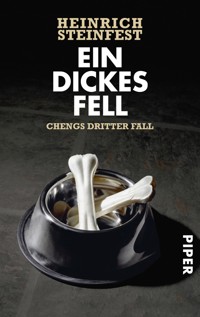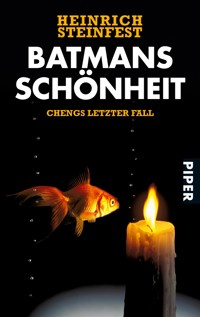10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Theo ist gerade aufs Gymnasium gekommen, als es eines Nachts, um 23:02, mit einem Ratsch plötzlich da ist. Vor seinem Fenster bläht sich im Mondlicht ein grünes Rollo. Tagsüber verschwindet es, aber von nun an entrollt es sich jede Nacht um exakt dieselbe Zeit. Das ist unheimlich genug, und nicht nur, weil es in Theos Zuhause noch nie Rollos oder auch nur Vorhänge gab. Viel unheimlicher ist aber, dass es, wenn man genau hinschaut, Augen zu haben scheint ... Nein, keine Augen, Ferngläser. Aus dem Rollo blicken kleine Männer durch Feldstecher streng zu Theo herüber. Theo ist sich sicher, dass dort, auf der anderen Seite des Rollos, eine eigene Welt existiert. Eine grünliche Welt. Nach schlaflosen Nächten fasst er sich ein Herz und beschließt, in jene andere Sphäre hinüberzusteigen ... Vierzig Jahre später hat Theo das alles als eine Kindheitsfantasterei abgetan. Bis es plötzlich wieder da ist - das grüne Rollo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97028-0
März 2015
© Piper Verlag GmbH, Berlin 2015, München 2015
Covergestaltung und -motiv: Rothfos & Gabler, Hamburg
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Das grüne Rolloder erste von zwei, womöglich drei Teilen
1
Dort, wo das Fenster war, war nie ein Rollo gewesen. Kein Rollo, kein Vorhang, kein Fensterladen, nichts dergleichen. Die Eltern wollten das nicht. Sie waren modern, und sie waren Vorhanghasser. Sie sagten gerne, sie hätten nichts zu verbergen und außerdem sei man ja nicht im Krieg. Dabei lächelten sie sich an.
Gott, dieses Lächeln!
Vierzig Jahre ist das her. Damals, als das neue Jahrhundert und damit auch das neue Jahrtausend soeben zehn geworden waren. Und ich ebenfalls. Ich würde immer genauso alt sein wie das Jahrhundert, in dem ich lebte. Mir gefiel die Vorstellung, daß ich, zumindest theoretisch, nicht nur immer im gleichen Alter wie dieses Jahrhundert bliebe, sondern es auch überleben könnte. Das Jahrhundert schon, das Jahrtausend freilich nicht, außer, sie würden in den nächsten neunzig Jahren etwas Ähnliches erfinden, was irgend so ein phantastischer Riesenschwamm im Polarmeer und natürlich einige Bäume bereits besaßen: extreme Langlebigkeit.
Eine andere Frage war, ob ich in der Zeit, die mir zur Verfügung stände, jemand kennenlernen würde, mit dem ich das gleiche innige Lächeln austauschen könnte, wie mein Vater und meine Mutter es praktisch tagtäglich taten.
Für uns Geschwister war das oft merkwürdig, diese absolute Vertrautheit zwischen den beiden, dieses Einverständnis in allen Dingen und daß sie niemals stritten, niemals böse aufeinander waren, sich aber auch niemals miteinander zu langweilen schienen. Ihre Harmonie war vollkommen. Wir Kinder blieben davon allerdings ausgeschlossen, was nicht hieß, daß wir nicht geliebt wurden. Vater wie Mutter waren zärtlich und aufmerksam, nahmen sich viel Zeit und waren geduldig, der Vater noch mehr als die Mutter, die hin und wieder Nerven zeigte, kleine Nerven, wie die braunen Streifen auf der Innenseite von Unterhosen. Streifen, die man nie wieder ganz wegbekam, und dennoch sagen konnte, man trage saubere Unterhosen. Vaters »Unterhosen« hingegen waren wohl das, was die Werbung früher mit weißer als weiß bezeichnet hatte. Seine Gelassenheit war mega.
Es bestand eine Art von unsichtbarer Hülle, in der die beiden Elternteile steckten und in die niemand anders eindringen konnte, bei aller Liebe zu den Kindern eben auch diese nicht. Von anderen Familien kannten wir ganz anderes, entweder Streit oder eisiges Schweigen oder eine superschnelle Routine, in der selbst der Streit zu kurz kam, mitunter eine inszenierte Fröhlichkeit an Grillnachmittagen, die ohne Alkohol kaum möglich gewesen wäre. Nicht, daß meine Eltern dem Alkohol entsagt hätten, aber sie genossen ihn immer gemeinsam, unter ihrer unzerbrechlichen Glocke, ausschließlich Wein, Weißwein, auch im Winter. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie oft mit diesen langstieligen Gläsern und wie sie anstoßen und es klingen lassen, aber es hört sich meistens sehr gedämpft an, wohl der Hülle wegen. Und dabei blicken sie sich an, als wäre es ihr erstes Rendezvous.
Und diese Eltern also lehnten es strikt ab, die Fenster zu »verbarrikadieren«, wie sie das nannten, auch am Abend und in der Nacht nicht.
Glücklicherweise wohnten wir im obersten Stockwerk eines Hauses, das höher war als die umliegenden. Keiner von uns brauchte zu fürchten, von den Nachbarn gesehen zu werden, wenn man nackt im Bad stand oder beim Essen war oder beim Spielen oder Schlafen. Oder wenn ich, der Kleinste und Jüngste in der Familie, auf einem Seil durch mein Zimmer schwang.
Da waren noch mein Bruder und meine Schwester, aber jeder von uns hatte sein eigenes Zimmer. Schien der Mond, war es manchmal so hell, daß ich mir vorkam wie auf einem Gletscher. Ich war noch nie auf einem gewesen, stellte ihn mir aber genau so vor, wenn in wolkenlosen Nächten die Fläche des ewigen Eises leuchtet. Mein Bett war dann quasi ein Gletschergrab. – Das war meine Vorstellung, sich beim Schlafen auf das Totsein vorzubereiten. Übungshalber tot sein, so, wie man sich im Möbelhaus angezogen auf ein Bett wirft und erklärt, man würde hier Probeliegen.
Wenn der Mond aber nicht schien, bekam ein anderes Licht seine Chance, das der sehr viel tiefer gelegenen Straßenbeleuchtung. Dann haftete den Gegenständen und den Wänden des Zimmers ein gelblicher Schimmer an. In einer Weise, die bei mir – der ich ja so viel ans Sterben dachte – zu der Idee führte, ein ganzer Packen alter Langenscheidt-Taschenbücher würde an diesem Ort sein Lebenslicht aushauchen. Daß sich hier nach und nach mehrere Jahrgänge von Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch vom Leben verabschiedeten, aber immer noch ein bißchen nachglühten.
Ich war soeben aufs Gymnasium gewechselt, und diese gewisse Fröhlichkeit, mit der ich in der Grundschule die englische Sprache eher geschmeckt als gelernt hatte, war nun abrupt einem konsequenten Programm gewichen. Englisch wirkte völlig verändert. Gerade noch eine freundliche Sprache, erschien sie jetzt bedrohlich. Eine verseuchte Landschaft. Die Englischlehrerin wiederum war das, was die Älteren eine Sexbombe nannten. Aber vom Sex besaß ich allein eine dumpfe Ahnung. Aus der Ferne wirkte der Sex auf mich wie eine komplizierte Sporttechnik. In der Art von Geräteturnen. Wenig Spaß, viel Verletzungsgefahr. Doch Sport war so unvermeidlich wie Englisch. Die Welt bei aller Vergnüglichkeit eine Qual. Sexbomben so streng wie die Punkterichter beim Eistanzen. Um so mehr beruhigte mich die Vorstellung, dieses über die Bettdecke und Spielsachen und die Tapete verstreute gelbe Licht stamme von verlöschenden Schulwörterbüchern.
Es war jedoch eine helle Mondnacht, als ich es das erste Mal sah: das grüne Rollo. Mit dem Kopf halb unter der Bettdecke, war es zunächst das Geräusch, das mich aufschrecken ließ. Eines, das ich von meiner Großmutter kannte, der es nämlich nicht egal war, ob man ihr quasi in den Bauchnabel sehen konnte, und die darum durchaus Vorhänge und Rollos und Rolläden in ihrer Wohnung hatte und sie auch benutzte. Ich vernahm also das großmütterliche Geräusch einer an einer Schnur heruntergezogenen und sich dadurch entrollenden Bahn von festem Stoff, bis dieser auf der gewünschten Höhe gestoppt wurde und sodann eine Feder einrastete. Als sage jemand kurz und rasch: »Gebongt!«
Ein Rollo?!
Ich zog vorsichtig die Decke zur Seite. Sofort war klar, daß sich etwas geändert hatte. Das Licht war anders. Nicht weiß, sondern grün. Vor dem gesamten Fenster spannte sich das Rechteck einer heruntergelassenen Stoffbahn, deren grüne Färbung eher dunkel als hell war, wobei allerdings dank des kräftigen Mondlichts viel von dem Grün – Flaschengrün, auch was den Glanz betraf – ins Zimmer getragen wurde. Es war, als säße ich in einem Gewächshaus.
»Mama?« fragte ich, weil ich für einen Moment mir nichts anderes vorstellen konnte, als daß meine Mutter im Zimmer stand und soeben an einer Verankerung, die mir nie aufgefallen war und von den Vormietern stammen mußte, ein Rollo aufgehängt hatte. Um mir nach all den vorhanglosen Jahren doch noch den Luxus eines bei Vollmond verdunkelten Zimmers zuzubilligen.
Ich schaute auf meinen Radiowecker. 23:02. Erneut rief ich nach meiner Mutter. Keine Antwort.
Natürlich kam keine Antwort. Warum sollte meine Mutter mitten in der Nacht etwas Derartiges tun? Das hätte nicht zu ihr gepaßt. Am ehesten mochte es ein dummer Scherz meines Bruders sein. Er war zwei Jahre älter und behauptete eine Überlegenheit, die körperlich auch gegeben war. Es war ein ständiges Stänkern, ein Rempeln und Ärgern, eine Lust an kleinen Gemeinheiten, für die er keinen echten Anlaß benötigte. Heute, viele Jahre später, würde ich sagen, mein Bruder hat sich überhaupt nicht verändert. Das tun sowieso die wenigsten Leute. Ein Sadist auf dem Spielplatz wird selten anders, nur weil er größer und schwerer wird und seine Bildung zunimmt. Selbige nutzt der geborene Sadist allein, um seinen Trieb zu perfektionieren. Ich weiß schon, daß viele das anders sehen, aber ich habe es nie erlebt, daß die Erziehung einen Menschen wirklich ändert. Die, die als Schildkröten auf die Welt kommen, bleiben auch Schildkröten. Säbelzahntiger bleiben Säbelzahntiger.
Ich hockte in meinem Bett und rief den Namen meines Bruders. Erneut keine Antwort. Wäre er hiergewesen, er hätte etwas gesagt oder getan. Sein Sadismus war gepaart mit Ungeduld.
Nein, das Rollo stammte nicht von meinem Bruder. Ich begriff, daß ich alleine im Zimmer war.
Natürlich bekam ich Angst. Aber nicht so eine, wie man sie beim Vokabeltest hat oder wenn man an einer Gruppe älterer Jungs vorbeimuß, die einen schon aus zehn Metern Entfernung komisch anschauen. Die Angst war nicht schwarz, sie war grün. Und sie brachte mich dazu, mich vorsichtig an das Kopfende des Bettes zu setzen und mir, auf den Fingernägeln kauend, den Stoff anzusehen, der da vor dem einzigen Fenster meines Zimmers hing.
Durch das Leinen hindurch konnte man die dahinterliegende Landschaft erkennen. In der Tat »Landschaft«, denn es handelte sich nicht um das vertraute Dächermeer der Stadt, in der ich lebte und in der unser Haus stand. Stattdessen zeichnete sich deutlich das Bild einer unterseeischen Gegend ab, mit Korallen und Wasserpflanzen und großen Muscheln, nicht aber mit Fischen, alles war starr. Die obere Hälfte des Ausblicks befand sich über der Wasseroberfläche, zeigte einen von Nachtwolken belebten Himmel und in einer Wolkenlücke das klare Rund des vollen Mondes. Dies alles wirkte überaus graphisch, und einen Moment lang glaubte ich auch, es handle sich um eine Zeichnung auf der Stoffbahn, die nun im Mondlicht deutlich hervorstach. Weshalb also die Mondscheibe als einziges Objekt kein Abbild gewesen wäre, sondern echt.
Nun, ein bemaltes oder bedrucktes Rollo war keineswegs phantastisch zu nennen. Allerdings stellte sich dann noch immer die Frage, woher das Ding so plötzlich gekommen war. Zudem vernahm ich jetzt auch die Geräusche eines Meeres: bewegtes Wasser und bewegte Luft. Die Töne drangen ganz eindeutig aus dem Rollo. Wobei nicht auszuschließen war, jemand habe hinter der Stoffbahn kleine Boxen aufgestellt. Ich mußte ans Theater denken, an ein Bühnenbild und an die Tricks, mit denen man im Theater derlei Phänomene wie Wind und Regen und Gewitter erzeugte.
Wäre mein Geburtstag gewesen, ich hätte es für eine verrückte Art von Überraschung gehalten.
Aber der Geburtstag war lange vorbei. Ich glitt aus dem Bett und bewegte mich mit kleinen Schritten – die Ferse des einen Fußes dicht vor die Zehen des anderen setzend, als müßte ich meine Verkehrtstüchtigkeit beweisen – hinüber zum Lichtschalter. Ich legte meinen Finger an und drückte nach unten.
Nichts!
Indem ich die Deckenlampe anknipste, war das Rollo verschwunden. Das Fenster kahl wie immer. Draußen die Stadt und der Mond, allerdings an einer anderen Stelle als auf dem Stoff, was nur bedeuten konnte, daß der Mond auf dem Rollo Teil des Aufdrucks, Teil der Meereslandschaft gewesen war.
Ein Rollo allerdings, das es gar nicht gab. Zumindest nicht bei Licht betrachtet. Genauer gesagt, beim Licht einer Glühbirne betrachtet.
Klar kam ich auf die Idee, die Beleuchtung wieder auszuschalten und nachzusehen, ob dann erneut das grüne Rollo auftauchen würde. Entschied mich aber dagegen, ließ sie an und legte mich ins Bett. So schlief ich ein.
Als am nächsten Morgen meine Mutter ins Zimmer trat und mich weckte, fragte sie, ob denn die ganze Nacht die Lampe gebrannt habe. Eine Lampe, die sie schließlich selbst ausgeschaltet habe.
»Ich war auf dem Klo, Mama«, sagte ich.
»Ist das ein Grund, das Licht anzulassen?«
»Nein.«
»Weißt du, Schatz, das ist Energieverschwendung. Das muß nicht sein. Du bist kein Baby mehr.«
Da war er wieder, dieser blaßbraune Streifen auf der Unterhose, den kein noch so kräftiges Waschmittel wegbekam.
2
Eines kann man wirklich sagen: Nach diesem Rollo hätte man die Zeit stellen können.
Als ich in der nächsten Nacht vom Geräusch der heruntergezogenen (oder sich selbst herunterziehenden) Stoffbahn erwachte und gleich darauf die grünliche Färbung des Raums feststellte, stellte ich eben auch fest, daß die Leuchtziffern meines Radioweckers erneut zwei Minuten nach elf zeigten. Ich vermied es jedoch vorerst, hinüber zum Fenster zu schauen, und verkroch mich stattdessen unter die Decke. Dort unten – tief in meinem Gletschergrab – überlegte ich, ob ich das Ding einfach ignorieren sollte. Vielleicht war es bloß etwas aus meiner Phantasie, eine Einbildung. Ich hatte gehört, daß kleinere Kinder manchmal Personen sahen, die gar nicht dawaren. Sie hatten unsichtbare Freunde oder meinten, ihre Stofftiere würden sprechen. Einige erzählten sogar, der verstorbenen Oma und sonst jemand Totem begegnet zu sein, oder behaupteten, ihr Meerschweinchen habe einen Kopfstand gemacht und dabei die Hinterbeine im Lotussitz verschränkt. Bei mir war das nie der Fall gewesen. Möglicherweise war dieses grüne Rollo also eine zu spät gekommene Einbildung, etwas, das sich eigentlich vor fünf, sechs Jahren hätte einstellen müssen, es aber erst jetzt tat.
Doch warum ein Rollo und wieso grün?
Noch immer unter meiner Decke versteckt, vernahm ich das Geräusch von Wellen, die gegen Felsen klatschten. Was bedeuten mußte, daß auf dem Rollo erneut das Bild vom Vortag zu sehen war. Und zum Bild gab es ein Toben. Wenigstens kein Monstertoben, ein Meerestoben. Das beruhigte mich etwas. So schob ich die Decke bis zum Kinn hinunter und spähte hinüber zu dem verhängten Fenster. Richtig, es war die gleiche Landschaft, allerdings meinte ich eine Dynamik zu erkennen. Zum Brausen der Wellen und des Windes und zu den vereinzelten Rufen von Meeresvögeln kam nun das tatsächliche Wogen des Wassers, auch das Gleiten der Wolken. Zudem roch ich die Meeresbrise und schmeckte das Salz in der Luft. Ich sagte mir: »Das Rollo lebt.«
War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn etwas lebendig wurde? Denn im großen und ganzen konnte man schon sagen, alles Lebendige tendiere dazu, sich dadurch am Leben zu halten, etwas anderem das Leben zu nehmen. Oder wenigstens dieses andere Leben kleiner und ärmer zu machen.
Ich war bereits alt genug, mir Gedanken darüber zu machen, wie die Wurst auf mein Brot gekommen war und was alles hatte geschehen müssen, damit sie dorthin kam. Viel Unschönes. Was mich veranlaßt hatte, mehr Käsebrote zu essen. Aber auch der Käse kommt nicht von der vielen Liebe auf die Welt. Indem ich am Leben war, indem ich atmete und mich ernährte und Ansprüche hatte, verursachte ich Schaden. Nicht gerne, oft unbewußt, aber was nützt das der Kuh, die in einem Melkautomaten steckt oder der ein Bolzen in den Kopf geschossen wird, daß ich nicht dabeiwar und keine Ahnung hatte?
Hatte das Rollo ebenfalls Ansprüche? War es hier, um mir etwas zu nehmen? Oder kam es von Gott, einem definitiv gütigen, und war darum in der Lage, etwas zu geben, ohne dafür nach meiner Seele zu verlangen, wie es das getan hätte, wäre es vom Teufel gekommen?
Weil ich diese Fragen nicht beantworten konnte, stieg ich aus dem Bett, huschte rasch zum Schalter hin und bereitete dem Spuk ein Ende. Auch diesmal verschwand das Rollo, sobald das Licht zu brennen begann.
Ich ließ es an und kehrte ins Bett zurück. Obwohl der nächste Tag ein Samstag war und damit schulfrei, stellte ich mir den Wecker. Ich wollte noch vor meiner Mutter aufstehen, um mir die Frage zu ersparen, warum ich schon wieder bei Licht geschlafen hätte. Und ob es Probleme in der Schule gebe, mit den Lehrern oder mit anderen Schülern. – Merkwürdiges Verhalten führte bei den Eltern so gut wie immer dazu, sich nach der Schule zu erkundigen.
Nacht 3. Ja, ich begann, die Nächte zu zählen. In dieser dritten Nacht beschloß ich, so lange das Licht anzulassen und aufzubleiben, bis es zwei Minuten nach elf war. Danach könnte ich noch eine Weile warten und erst dann ausschalten. Ich fand das eine gute Idee und hatte dank meines Gameboys wenig Probleme, die Augen offen zu halten. Mutter und Vater saßen vor dem Fernseher und tranken ihren Weißwein. In der Regel waren sie keine großen Kontrolleure. Schon gar nicht, wenn sie unter ihrer gläsernen Glocke hockten und nur noch Augen füreinander hatten. (Richtig, der Fernseher lief, aber sie schienen nie zu wissen, was für Sendungen und Filme sie sich da angeblich anschauten. Auf manche Nachfrage gaben sie dann Antworten wie: »Ach, so gut war der Film gar nicht.« Oder: »Den kann man nicht erklären.«)
So konnte ich also ungestört den Zeitpunkt abwarten, der mich in den letzten beiden Tagen so stark beunruhigt hatte. Verpaßte allerdings den Moment, da die Uhr von 23.01 auf 23.02 umsprang. Das schon, nicht aber, wie jetzt ohne mein Zutun das Licht ausging und ich im Dunkeln saß. Es folgte das Geräusch des Rollos, und gleich darauf erfüllten Schlieren von Grün mein Zimmer.
Ich sagte: »Scheiße!« Und ich denke, daß dieses Wort nie zuvor mit solcher Berechtigung meinen Mund verlassen hatte. Mehr aber sagte ich nicht, sondern hielt den Atem an. Ich hörte mein Herz. Es schlug mir gegen die Brust, als wäre es jemand, der aus einem verschlossenen Raum hinausmöchte und mit der Faust gegen die Türe trommelt. Während ja meine eigene Zimmertür durchaus zu öffnen war. Warum also nicht ...?
Doch ich blieb erstarrt. Mein Herz pochte, und meine Haut war eine Gans, aber meine Beine waren aus Stein. Auf dem Rollo war wieder das wilde Meer zu sehen, dazu ein Mond, der zwischen den dahinziehenden Nachtwolken mal nebelig auseinanderfloß, dann wieder klar und rund dastand und der eben nicht allein die peitschende See und all die Schneckengehäuse und Muscheln und das sich wiegende Seegras beleuchtete, sondern auch mein Zimmer. Während der richtige Mond, der draußen über der Stadt hing, hinter dichten Wolken praktisch unsichtbar gewesen war.
Aber konnte man überhaupt von einem »falschen Mond« sprechen? Das grünliche Licht, das er in mein Zimmer warf, schien alles andere als unecht. (Ich dachte bei diesem Grün übrigens nicht an den Matrixfilm, den ich noch gar nicht hatte sehen dürfen, sondern an Kryptonit, ein Mineral, das Superman schwächen und sogar töten konnte, doch für den Menschen in der Regel als unbedenklich galt; allerdings war das Grün in meinem Zimmer eine Spur blasser, Kryptonit mit ein wenig Deckweiß vermischt.)
Ich träumte nicht und phantasierte nicht. Außer ich war verrückt geworden. Aber das hätte ich merken müssen. Eine Verrücktheit begriff man doch, oder? Eher war ich ein normaler Junge mit mittelmäßigen Noten, vom Genie so weit entfernt wie vom Vollidioten. Nein, das war kein falscher Mond. Sowenig ein gemalter wie ein bloß geträumter.
Als ich meine Beine wieder spürte, stieg ich langsam vom Bett und bewegte mich auf den Lichtschalter zu. Blieb diesmal aber auf der Hälfte des Weges stehen und tat einen Schritt auf das Rollo zu. Ich meinte jetzt den Wind zu fühlen, der mir durchs Haar fuhr und auch dort kleine Wellen erzeugte. Meine Nase kitzelte, und ich glaubte, etwas Sand auf den Wangen zu spüren. Dazu kam ... nun, ich bemerkte eine Anziehungskraft, eine magnetische Wirkung, leicht nur, aber so, daß mir klar wurde, wie mit jedem Zentimeter, den ich näher käme, die Kraft zunehmen würde, vielleicht sogar so stark, mir jegliche Kontrolle zu rauben. Weshalb meine nächsten Schritte nicht nach vorn führten, sondern zur Tür hin, in Richtung des Lichtschalters. Mein Blick blieb aber auf das Rollo gerichtet, und indem ich nun von der Seite her auf das Leinen blickte, erkannte ich ...
Wie soll ich das erklären?
Das Meer und der Felsen hörten ganz plötzlich auf, eine Grenze, wie mit einem Lineal gezogen, und jenseits dieser Linie sah ich eine Ansammlung von Personen. Sie standen dicht gedrängt, waren ebenfalls in das grüne Licht getaucht und besaßen die faserige Struktur des Rollostoffs. So eng, wie sie standen, konnte ich ihre jeweilige Gestalt schwer ausmachen, doch schienen sie mir alle eher dünn. Am wenigsten konnte ich ihre Gesichter erkennen, was daran lag, daß ein jeder von ihnen sich ein Fernglas vor die Augen hielt. Und ich brauchte nicht lange zu überlegen, wer es war, den sie da beobachteten. Ich stürzte auf den Lichtschalter zu und hieb dagegen.
»Was machst du denn?« Es war Mutter. Sie hatte Geschirr in der Hand. Unsere Küche lag etwas ungünstig, beim Weg vom Wohnzimmer in die Küche mußte man an allen anderen Räumen vorbei. Es war also nicht so, daß Mutter spionierte, sondern sie war einfach hier langgegangen, hatte den Lichtstreifen gesehen und wollte nun wissen, wieso ich noch auf sei. Wochenende hin oder her.
»Da war was«, sagte ich.
»Was war da?«
»Ein Geräusch«, erklärte ich. Nicht, daß ich vorhatte, ihr vom Meer und vom Mond und von den Gestalten mit den Ferngläsern zu berichten. Noch nicht. Ich wollte mir vorher sicher sein.
Sicher in welcher Hinsicht? Nicht der einzige zu sein, der ein Rollo wahrnahm? Wäre dann nicht jetzt der beste Moment gewesen, das Licht auszuknipsen und zu überprüfen, ob die Mutter das gleiche sah?
Was aber, wenn nicht? War ich dann doch verrückt? Zurückgeblieben? Weil sich ja eher die Vierjährigen solche Dinge einbildeten? Hätte ich dann zum Arzt gemußt und vom Arzt zum Psychiater?
Meine Mutter stellte das Geschirr weg und nahm mich in den Arm. Offensichtlich war ihr der Schrecken in meinem Gesicht aufgefallen, und sie meinte, ich hätte schlecht geträumt.
Sie stellte sich auf die Zehen und küßte mich auf den Scheitel. Sie sagte oft, sie wolle es noch auskosten, mir von oben her einen Kuß geben zu können. Sie war recht klein, und ich selbst gerade stark am Wachsen. Bei der Schuhgröße hatte ich sie bereits eingeholt. Darum nutzte sie jede Gelegenheit, mir einen Kuß dorthin zu drücken, wo meine höchste Stelle war, also quasi mein Gipfel.
Sie schob mich zurück ins Bett, deckte mich zu, als schlösse sie eine Teigtasche, und erzählte mir von ihrer Schulzeit und daß sie damals alles viel zu schwer genommen habe. Sie sagte: »Später weiß man es dann. Blöd nur, daß man es nicht vorher weiß. Aber man sollte sich immer wieder vor Augen halten, wie wenig von der Schule übrig bleibt, wenn sie mal vorbei ist. Die Noten lösen sich in Luft auf. Schau dir den Papa an!«
Richtig, mein Vater war mit Ach und Krach durchs Gymnasium gekommen. Oma erzählte, wie man so sagt, Haarsträubendes. Trotzdem war er ein erfolgreicher Architekt geworden, auch wenn ich froh war, daß es die Mutter war, die unsere Wohnung eingerichtet hatte. Papa hatte viele Preise bekommen, aber mir war schleierhaft, wofür genau. Wenn ich durch seine Bauten ging, kam ich mir wie auf einem Schachbrett vor. Und zwar immer nur vom Standpunkt eines kleinwüchsigen Bauern aus betrachtet, der als erster in die Schlacht geschickt wird.
Natürlich begriff ich, warum meine Mutter das jetzt alles erwähnte. Offensichtlich dachte sie, daß gerade am Wochenende sich die Angst vor einer ganzen, sich ewig dahinziehenden Schularbeitswoche aufstaute und mir Alpträume bescherte.
War es das vielleicht wirklich? Sah ich das grüne Rollo, nur weil ich jetzt aufs Gymnasium ging?
»Schlaf schön.« Mama hatte wirklich eine gute Stimme. Selbst wenn sie genervt war, und erst recht, wenn sie müde war. Wenn sie müde war, klang sie so, wie ich mir vorstellte, daß Schutzengel reden, die zwar nie schlafen – denn ein unterbrochener Schutz wäre so gut wie keiner –, dafür aber phasenweise sehr viel ermatteter sind als die Menschen. Und trotzdem stets super klingen. Sexy, aber nicht sexy wie diese Englischlehrerin. (Später sollte ich ein höchst auffälliges Faible für Frauen haben, die müde klangen. Das ist kein Witz, ich suchte erschöpfte Frauen und fand sie etwa an der Kassa von Supermärkten. Nicht aus perversen Gründen, ich liebte diese Frauen. Ihre aus der Müdigkeit erwachsene Schönheit. Zwei solche Schönheiten heiratete ich sogar. Was auf Grund meiner eigenen gesellschaftlichen Stellung viele meiner Bekannten für Sozialromantik hielten. War es aber nicht. Die engelhafte Müdigkeit, die ich suchte, war im akademischen Bereich einfach nicht zu finden. Ja, viel Streß natürlich, viel Gejammer wegen der Terminflut und der Verpflichtungen. Bei Akademikerinnen erweist sich selbst der Besuch beim Friseur als aufreibender Akt. Oder die Überwachung eines Büfetts, das sie selbst gar nicht zubereitet haben. Doch ich sehnte mich eben nicht nach dem Erschöpftsein der Friseurkundinnen, sondern nach dem der Friseusen.)
Meine Mutter sagte also: »Schlaf schön!«, schaltete das Licht aus und ging.
Und zwar so rasch, daß sie bereits die Tür hinter sich geschlossen hatte, bevor sich der grüne Schein wieder bemerkbar machte. Es dauerte ein wenig, bis das Rollo in der Dunkelheit erneut seine Strahlkraft entwickelt hatte und das Meer zurückgekehrt war. Das Rauschen der See schwoll an, während sich die Schritte meiner Mutter entfernten.
Ich zog wieder die Decke über den Kopf und dachte nach. Wieso war ich mir so sicher, daß ich es war, den die Leute dort drüben mit ihren Feldstechern beobachteten? Auch fragte sich, ob sie in der Lage waren, mit ihren Geräten praktisch um die Ecke zu schauen, oder mich vielleicht nur sehen konnten, wenn ich selbst seitlich zum Rollo stand. – Wer weiß, vielleicht betrachteten sie ja nur Vorgänge, die sich innerhalb des Rollos abspielten, dort, wo das Meer war. Vielleicht waren es Vogelkundler. Seevogelspezialisten. Mir war einmal eine Fernsehsendung über solche Vogelforscher untergekommen. Ganz ähnlich hatte das ausgesehen. Birdwatching! Richtig, das war das englische Wort. Überhaupt Englisch! Ich griff nach meiner Taschenlampe und meinem Vokabelheft und begann unter der Decke zu üben. Die englische Sprache war jetzt wie ein Bollwerk gegen den Alptraum, der vor meinem Fenster hing. Mit einer Vokabel zwischen den Lippen, einem fadenförmigen kleinen Ding, schlief ich ein.
3
Am nächsten Morgen beim sonntäglichen Frühstück meinte mein Vater, ich hätte so kleine Augen wie ein gerade zur Welt gekommenes Hundebaby. Ich fand das ein schlechtes Bild. Eher wähnte ich mich alt, als würden schon sehr viel mehr Jahre in meinen Knochen stecken als bei einem Fünftklässler üblich. Jedenfalls hätte mir jetzt ein Schluck Kaffee wirklich geholfen. Bei meiner Oma durfte ich hin und wieder aus ihrer Tasse nippen und fühlte mich hernach belebt und erfrischt. Weil aber meine Eltern diesbezüglich durchaus konventionell dachten und niemals eine Ausnahme machten, blieb mir nur, wenigstens meine Nase über die Tasse meines Vaters zu halten und den Dampf zu inhalieren. Vater lachte. Mein Bruder hingegen meinte nur: »Meine Güte, du bist wirklich ein Clown!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!