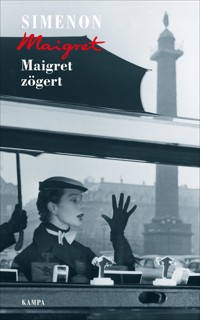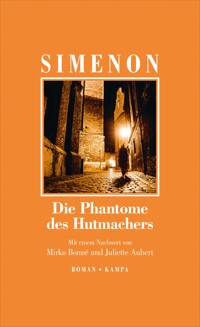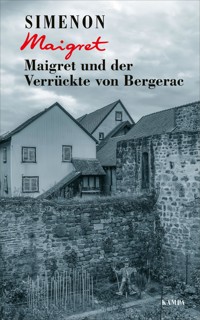9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
ZEIT FÜR MICH – ZEIT FÜR SIMENON »Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.« Gabriel García Márquez Die sechzehnjährige Edmée muss nach dem Tod des Vaters Brüssel verlassen und zu ihren Verwandten in die flämische Provinz ziehen. Schnell stellt sich heraus, dass das Mädchen aus der Stadt andere Vorstellungen vom Leben hat als die konservativen Familienangehörigen. Edmée ist dominant, verwöhnt und sich ihrer Wirkung auf Männer sehr bewusst. Gleich zwei ihrer Cousins erliegen ihren Reizen und glauben, sie gehöre ihnen allein. Das führt zu Unmut unter den Männern der Familie. Als Edmée sich für einen der Cousins entscheidet, kann sie nicht ahnen, welche brutalen Folgen diese Entscheidung nach sich zieht. Ein Beziehungsdrama in den nebelverhangenen Ebenen Flanderns. Ein Mädchen, das zur Frau heranreift und dabei Grenzen überschreitet – mit verhängnisvollen Folgen. Bandnummer: 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges Simenon
Das Haus am Kanal
Roman
Aus dem Französischen von Ursula Vogel
Mit einem Nachwort von Karl-Heinz Ott
Hoffmann und Campe
1
Im Strom der Reisenden, die sich in Schüben zum Aus-gang drängten, war sie die Einzige, die es nicht eilig hatte. Ihre Reisetasche in der Hand, den Kopf unter dem Trauerschleier hoch erhoben, wartete sie ruhig, bis es an ihr war, dem Schaffner ihre Fahrkarte hinzuhalten. Dann ging sie einige Schritte weiter.
Als sie um sechs Uhr früh in Brüssel den Zug bestiegen hatte, war es stockfinstere Nacht gewesen, und ein schwerer Eisregen hatte sich über die Stadt gelegt. Auch das Abteil dritter Klasse war nass, von den verschlammten Schuhen rann Wasser auf den Fußboden, die beschlagenen Zwischenwände waren klebrig, die Fenster innen und außen nass. Die Menschen dösten in ihren durchfeuchteten Kleidern.
Um acht Uhr, bei der Einfahrt in Hasselt, wurden die Zug- und auch die Bahnhofslampen gelöscht. Von den Regenschirmen in den Wartesälen liefen feine Rinnsale zu Boden, die nach eingeweichter Seide rochen. Um die Öfen drängten sich Leute, um sich zu trocknen. Sie waren fast ganz schwarz gekleidet, wie Edmée. War das ein Zufall? Oder bemerkte sie es nur, weil sie selbst tief in Schwarz ging? Und war die Tracht der Landbevölkerung nicht auch schwarz?
12. Dezember. Die großen schwarzen Lettern, neben einem Schalter angeschlagen, sprangen ihr in die Augen.
Draußen prasselte der Regen, Menschen rannten hin und her, an allen Türen drängten sich schutzsuchende Gestalten, und der Himmel war so düster, dass die Ladenbesitzer ihre Lampen brennen ließen.
Genau gegenüber dem Bahnhof, in der Mitte der Straße, stand eine dicke schwarz-grüne Lokalbahn. Sie war leer. Kein Zugführer, kein Schaffner weit und breit. Sie trug die Aufschrift Maeseyck. In diesem Städtchen musste Edmée umsteigen, um nach Neeroeteren zu gelangen.
Sie stieg kurzerhand in den ersten Waggon ein, der durch eine Glaswand zweigeteilt war. Auf der einen Seite saß man auf Holzbänken, und der Fußboden war voller Zigarettenstummel und Auswurf, die andere Seite war mit roten Samtkissen und Teppichboden ausgestattet.
Edmée war erst unschlüssig, trat dann durch die Tür in das Abteil erster Klasse und setzte sich in eine Ecke. Sie hielt sich kerzengerade, hob den Kreppschleier, der ihr Gesicht verhüllte. Sie war sehr schmal, sehr blass, ein wenig blutarm, wie es sechzehnjährige Mädchen oft sind. Ihre straff geflochtenen Zöpfe waren im Nacken zu einem festen Knoten geschlungen.
Eine halbe Stunde verging. Das Abteil zweiter Klasse bevölkerte sich, vor allem mit Bäuerinnen, die große Körbe trugen und sich lautstark unterhielten, wie es die Flamen gern tun. Mitunter warf die eine oder andere einen Blick auf Edmée, die allein hinter der Glaswand saß, flüsterte einer Nachbarin etwas zu, schüttelte mitleidig den Kopf, und andere Augen richteten sich auf das junge Mädchen.
Die Lokomotive pfiff. Die Bahn rollte durch die Straßen der verschlafenen Kleinstadt. Vielleicht war es ein Zufall, dass die Lampen aufleuchteten, jedenfalls wurden sie während der ganzen Fahrt nicht mehr gelöscht.
Der Regen, Edmées Schleier, die dicken schwarzen Tücher der Weiber, das Wasser auf dem Fußboden und den Bänken verschmolzen zu einem düsteren Grau. Die gepflügten Äcker waren dunkel, die Backsteinhäuser von schmutzigem Braun. Der Zug fuhr durch das limburgische Kohlegebiet, Bergwerksdörfer und Kohlehalden zogen vorbei.
Es war ein alter Zug, die Fahrgäste wurden durchgerüttelt und die Köpfe pendelten von einer Seite zur anderen. Edmée erging es nicht besser. Durch die Glaswand konnte sie nicht hören, was die Frauen sagten, aber sie sah ihren mitleidigen Gesichtsausdruck, die Münder, die sich zu einem Seufzer öffneten, und die leeren Augen, die sich, sobald das Gespräch ins Stocken kam, in die beschlagenen Fenster versenkten.
Der Schaffner trat in das Abteil erster Klasse, sprach Edmée auf Flämisch an. Sie sah ihn nicht an, hielt ihm das Geld hin und begnügte sich mit einem einzigen Wort:
»Maeseyck!«
Der Schaffner versuchte es mit zwei weiteren Sätzen, aber sie drehte den Kopf weg. Der Zug hielt in jedem Dorf, manchmal auch an einer Wegkreuzung, wo weit und breit kein Haus zu sehen war. Leute liefen herbei, Frauen, außer Atem, mit lachenden Gesichtern und gerafften Röcken ließen sich auf das Trittbrett heben. Der Schaffner stieß mit seiner Trompete den piepsenden Ton eines Kinderspielzeugs aus. Die Lokomotive pfiff.
Gegen elf Uhr öffneten die Bäuerinnen ihre Körbe und holten ihr Mittagsbrot heraus. Um zwei Uhr hielt der Zug in Maeseyck neben einer gleichartigen Bahn, die aber einen Waggon weniger hatte und mit der Aufschrift Neeroeteren versehen war.
Edmée erkundigte sich nicht nach der Abfahrtszeit, blickte nirgendwohin, richtete an niemanden das Wort. Wie in Hasselt setzte sie sich in ein Abteil, während die meisten Fahrgäste die Kneipen aufsuchten, wo sie sich an einem heißen Kaffee gütlich taten.
Der Zug fuhr erst um halb vier ab. Es dämmerte schon.
Die Fahrt ging durch Wälder und einen unendlich langen Kanal entlang, der so gerade war, dass er die Reisenden in seinen Bann zog. Die Nacht war bereits eingefallen, als sie einen Dorfplatz erreichten und der Schaffner rief:
»Neeroeteren!«
Edmée stieg aus, blieb reglos mitten auf der Straße stehen. Gegenüber befand sich ein Lebensmittelgeschäft mit einem flämisch beschrifteten Ladenschild. Menschen gingen zur Bahn, andere umarmten sich oder eilten davon. Keiner beachtete sie. Edmée ging zu dem überdachten Ladeneingang hinüber, der ihr vor dem Regen Schutz bot, und stellte ihre Reisetasche auf eine Stufe.
Die Lokalbahn fuhr wieder ab. Die Straße leerte sich. Im Schatten der einstöckigen Häuser stand ein schweres graues Pferd, das vor einen hochrädrigen Wagen gespannt war. Von irgendwo löste sich lautlos eine massige Gestalt, deren Riesenkopf mit einer durchweichten Mütze unmittelbar auf dem Rumpf zu sitzen schien und deren überlange Arme ungelenk am Körper herabbaumelten.
Das Wesen trug Holzschuhe und bäuerliche Kleidung. Zweimal ging es, ohne den Mund aufzutun, an Edmée vorbei, dann blieb es plötzlich zwei Schritte vor dem Ladeneingang stehen und brummelte:
»Sind Sie die, die in die Rieselungen kommt?«
»Ja.«
»Ich bin Jef.«
Er wagte sie beim Sprechen nicht anzublicken, und er konnte sich auch nicht recht dazu entschließen, ihr die Reisetasche abzunehmen.
»Haben Sie ein Auto?«
»Ich habe den Karren.«
Endlich gab er sich einen Ruck, ergriff die Tasche, rannte auf den hochrädrigen Wagen zu und beruhigte das ungeduldige Pferd.
»Sie können doch allein aufsteigen?«
Steif vor Kälte, wie schon den ganzen Tag, folgte ihm Edmée. Er stellte die Tasche in den Wagen, drehte sich zu ihr um, wusste nicht, wie er ihr die Hand reichen sollte.
»Sie könnten sich schmutzig machen.«
Mit einem Satz war sie oben, duckte sich, um unter das Verdeck zu gelangen. Gleich darauf saß er neben ihr, ergriff die Zügel und trieb das Pferd mit einem Zuruf an.
Noch zwei, drei Lichter waren zu sehen, dann führte der Weg durch schwarze Fichtenbestände. Es ging ein scharfer Wind. Das Verdeck blähte sich, ließ den Regen herein, der auch durch einige Löcher tropfte.
Edmée konnte den Burschen neben sich nicht sehen. In der Finsternis erkannte man nur das schwache Licht einer Laterne, die an der Wagendeichsel befestigt war und deren trüber Lichtkegel als matte Scheibe auf dem Schlamm tanzte.
»Ist Ihnen kalt?«
»Danke, nein.«
Sie fuhren nicht auf einer Straße, sondern auf einem Feldweg, der so tiefe Radspuren aufwies, dass Jef zweimal absteigen und in die Speichen greifen musste, um den Wagen wieder flottzumachen. Es war kalt. Der Frost ging Edmée durch Mark und Bein. Die Fahrt schien ihr unendlich lang, viel länger als der in der Lokalbahn verbrachte Tag.
»Ist es noch weit?«
»In einer Viertelstunde sind wir in unseren Ländereien.«
Nach dem Gehölz kamen sie durch eine Niederung, die durch Pappelreihen in Rechtecke aufgeteilt wurde. Dann stieg der Weg leicht an, und sie überquerten den Kanal, den Edmée schon gesehen hatte. Der in Erdwällen eingebettete Wasserlauf lag höher als die Wiesen. Ganz in der Ferne sah man einen Lastkahn.
»Haben Sie keinen Hunger? Sprechen Sie Flämisch?«
»Nein.«
»Schade.«
Er verfiel einige Minuten in Schweigen.
»Die Sache ist nämlich die, dass meine Mutter und meine jüngeren Schwestern kein Französisch können.«
Als der Wagen plötzlich einen Ruck machte, fiel Edmée gegen die Schulter ihres Cousins. Ein fürchterlicher Schreck durchfuhr sie, und sie richtete sich schnell wieder auf.
»Dort drüben ist es!«
Inmitten der von Pappeln gesäumten Rechtecke schimmerte in der Ebene ein winziges Licht. Es kam aus einem Fenster des ersten Stocks. Aus größerer Nähe zeichneten sich Schatten hinter den Vorhängen ab. Knarrend hielt der Wagen vor einer Tür.
»Ich bringe Sie hinein. Wir gehen durch den Hof.«
Das Pferd trottete allein auf die Ställe zu, und Jef schlug einen Weg ein, der an einer Hecke entlangführte. Zweige streiften Edmées Gesicht. Sie war wie blind. Als er eine Tür öffnete, machte sie gerade eben einen rötlichen Lichtschein aus. Im selben Augenblick warf sich ihr eine dürre, äußerst aufgeregte Frau an den Hals, drückte sie in ihre Arme, nässte ihr das Gesicht mit ihren Tränen und stieß dabei flämische Worte aus.
Edmée rührte sich nicht, blieb kerzengerade stehen, blickte über die Schulter der Frau hinweg in die Küche, die nur vom Kaminfeuer erhellt wurde. Da und dort erkannte sie winzige Gestalten, kleine Mädchen, die auf Schemeln saßen, starr vor sich hin blickten oder weinten.
Ein fremder Geruch schlug Edmée entgegen: ein starker Geruch nach Sauermilch, Speck und verbranntem Holz.
Endlich ließ die Frau sie los, umarmte Jef, stammelte voller Verzweiflung dieselben Worte. Die Tür stand offen. Der Wind blies Regenschwaden in die Küche. Ein Holzscheit fiel in sich zusammen.
»Papa!«, murmelte der Bursche mit dem dicken Kopf und blickte wie benommen vor sich hin
Dann, ohne seine Cousine anzusehen, stieß er aus:
»Papa ist gestorben! Genau in dem Augenblick, als Sie kamen.« Drei Tage lang ging alles drunter und drüber, man lebte im Schlamm, im ständigen Durchzug des Hauses, das ganz aus den Fugen geraten war. Nur Edmée beobachtete alles kühl und unbeteiligt.
Sie hatte ihren Onkel zu seinen Lebzeiten nie gesehen, und voller Neugier betrachtete sie ihn auf seinem Totenbett, beeindruckt von seinem langen rötlichen Schnurrbart. Im Totenzimmer begegnete sie zum ersten Mal ihrem ältesten Cousin Fred. Er hatte geweint. Das flackernde Kerzenlicht verzerrte seine Gesichtszüge mit den dicken Lippen und dem spröden, von Pomade klebrigen Haar.
Fred war einundzwanzig. Jef, der seine Cousine abgeholt hatte, war neunzehn. Ihre siebzehnjährige Schwester Mia gab unten den Kleinen zu essen, drei Mädchen, von denen das jüngste fünf war.
Die Mutter saß bald mit Mia, bald mit Jef irgendwo in einem Winkel. Sie weinte nicht. Sie klagte in einem eintönigen flämischen Singsang und redete auch verzweifelt auf Edmée ein, ohne zu merken, dass diese sie nicht verstand.
Von Anfang an entzog sich Edmée allen Annäherungen. Da ihre Cousinen sie mit ängstlicher Neugier betrachteten, richtete sie auch an sie kein Wort. Sie war hungrig und durstig, aber sie verlangte nichts zu essen und nahm erst um acht Uhr abends eine Schale Suppe zu sich.
Ein Unfall hatte den Tod des Onkels verursacht. Vor acht Tagen hatte ihn eine Kuh, die er schon lange schlachten wollte, mit ihren Hörnern am Oberschenkel verletzt. Die Wunde war nicht tief gewesen. Drei Tage lang hatte er gehinkt, dann war er bettlägerig geworden.
Als endlich der Arzt gerufen wurde, war es bereits zu spät. Der Wundbrand hatte sich über den ganzen Körper ausgebreitet. Edmée würde ihn nie kennenlernen. Aber da waren ja noch alle anderen, mit denen sie zusammenleben musste und die sie kühl und abschätzig beobachtete.
Ihre Mutter war bei ihrer Geburt gestorben. Nun hatte auch ihr Vater, ein Brüsseler Arzt, der sie sechzehn Jahre lang verhätschelt hatte, das Zeitliche gesegnet. Sie war arm, und ihr Vormund hatte sie zu Verwandten geschickt, zum »Onkel aus Neeroeteren«, wie man ihn in der Familie zu nennen pflegte, zu einem Onkel, den sie nie gesehen hatte und der im Kempenland viele hundert Hektar Land besaß.
Wie verstörte Ameisen nach der Vernichtung ihres Baus, verweint und rastlos, irrte die Familie des Onkels durch die Räume. Warum zündete man nur die Lampen nicht an? Das Bedrückendste war dieses Halbdunkel, das jede Form aufsaugte, sosehr sie auch die Augen aufriss, um die Gestalten im Dämmerlicht zu unterscheiden.
Nur das Büro wurde von einer Petroleumlampe mit einem rosaroten Lampenschirm erhellt. Der kalte Pfeifenrauch und der Geruch von violetter Tinte unterstrichen noch die penetrante Ausdünstung des Hauses. Cousin Fred, der Älteste, hatte sich hier häuslich eingerichtet und setzte Telegramme auf, an denen er eifrig feilte. Mitunter öffnete er die Tür einen Spaltbreit, um seine Mutter oder seinen Bruder etwas zu fragen.
Jef aber fuhr mitten in der Nacht mit seinem Wagen weg, und Edmée sah, wie er noch rauchende Kartoffeln, die er aus der Asche gefischt hatte, in seine Taschen stopfte. Mia brachte die Kleinen zu Bett, dann kam sie zu Edmée und sagte ein wenig gestelzt:
»Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen, Cousine?«
In dem nur von einer Kerze erhellten Raum mit Dachschrägen stand eine hohe Bettstatt mit einer gewaltigen Daunendecke. Auch während der Nacht kam das Haus nicht zur Ruhe. Edmée hörte den Pferdewagen zurückkommen. Als sie aufstand, hatten sich unten viele Leute eingefunden, die ihr fremd waren. Vor allem war da ein sehr großer, kräftiger und ruhiger Mann in den Fünfzigern, der urbaner wirkte als die anderen. Fred sprach mit ihm und blickte dabei Edmée an.
»Du bist also Berthas Tochter«, sagte der Mann, ohne ihr die Hand zu reichen oder sie zu umarmen.
Wohlwollend betrachtete er sie von Kopf bis Fuß.
»Nun, ich hoffe, dass du dich mit deinen Cousinen gut verstehen wirst. Gleich zwei Tote in der Familie, und das innerhalb einer Woche!«
Das war Onkel Louis aus Maeseyck, der Zigarrenfabrikant, dessen Porträt Edmée früher oft in Brüssel im Fotoalbum gesehen hatte. Von diesem Zweig der Familie hatte sie nur verschwommene Vorstellungen, die fast schon ins Reich der Legende gehörten. Ihre Mutter war die Schwester der Tante gewesen, die nur Flämisch verstand, Onkel Louis war ihr Bruder, aber sie hatte nie in der Provinz Limburg gelebt, und seit sie in Brüssel verheiratet war, kam sie nur selten auf ihre Verwandten zu sprechen.
»Du bist ja schon in Trauer«, sagte der Onkel, »aber alle deine Cousinen müssen noch eingekleidet werden.«
In seinem Auto, einem altmodischen Wagen, der zehn Personen Platz bot, brachte er sie nach Neeroeteren. Edmée fuhr ebenfalls mit. Sie traten in die Küche eines niedrigen Hauses, wo Hühner auf den Stuhllehnen hockten. Eine dürre, etwa fünfzigjährige Frau saß an einer Nähmaschine. Als sie die schlimme Nachricht vernahm, brach sie in lautes Klagen aus, wollte die Kinder umarmen, auch Edmée, die sich steif wegdrehte, schließlich aber nahm sie doch Maß, suchte Stoffmuster und vergilbte Modehefte heraus.
Auf der Straße warteten schon andere alte Frauen, die die Kinder küssten und Edmée neugierig betrachteten.
Onkel Louis übernachtete in den Rieselungen. Am nächsten Tag kamen weitere Gäste, und am Tag darauf fand endlich die Beerdigung statt.
Nun sah Edmée das Gut bei Tageslicht. Das Haus war groß. Es umfasste unter anderem auch einen geräumigen Salon, den man nur öffnete, um den Pfarrer und einen Herrn aus Maeseyck, der einen Pelzmantel trug, zu empfangen.
Befremdet war Edmée, als sie entdeckte, dass sich gleich neben dem Salon eine Trinkstube befand, die so ärmlich eingerichtet war wie jede andere Landkneipe. Später sollte sie begreifen, dass sie unentbehrlich war, denn die Fuhrleute, die in den Feldern zu tun hatten, konnten sonst nirgendwo ihren Durst löschen. Immerhin brauchte man über zwei Stunden, um die Domäne zu durchqueren.
Das Gut bestand aus tiefgelegenen, von symmetrischen Pappelreihen durchzogenen Wiesen. Hier und da ein schwarzes Fichtenwäldchen, und schließlich die schnurgerade, etwas erhöhte Linie des Kanals, auf dem Lastkähne dahinglitten.
Die Beerdigung war ein denkwürdiges Ereignis. Schon um acht Uhr morgens standen über fünfzig Pferdewagen jeder Bauart und ein Dutzend Autos um das Haus. Während der ganzen Nacht hatte Jef in der Backstube Brot gebacken. Erst in der letzten Minute wusch er sich und schlüpfte in seine Trauerkleider, während Fred die Gäste begrüßte. Mia arbeitete zusammen mit einer alten Dienstmagd in der Küche, wo lauter Töpfe auf dem Herd standen.
Die Kinder waren einem andauernd im Weg. Man schob sie bald dahin, bald dorthin. Alle sprachen Flämisch, alle seufzten und klagten, die Frauen falteten die Hände, neigten den Kopf zur Seite und jammerten in einem fort.
»Jesus Maria!«
Fred bat die Männer ins Büro und schenkte ihnen Bier ein. Edmée wurde dem einen oder anderen auf Flämisch vorgestellt, der dann mitleidig den Kopf schüttelte.
Um neun Uhr traf der Pfarrer ein. Es regnete immer noch, aber es goss nicht mehr in Strömen wie die Tage vorher. Der Leichenzug setzte sich langsam in Bewegung. Alles ging zu Fuß, hatte schwarze Regenschirme aufgespannt, auch der Pfarrer und die Diakone, deren blütenweiße Chorhemden wie Möwenflügel über die Wiesen flatterten.
Allmählich verklangen die liturgischen Gesänge und das Getrappel der Schritte im matschigen Boden, und die Frauen blieben allein mit den Kindern zurück. Ihre einzige Sorge galt jetzt dem Mittagessen. Ein Leichenschmaus für fünfzig Personen! Die Tische wurden ausgezogen. In Neeroeteren hatte man Stühle ausgeliehen. Zweimal brach Mia in Tränen aus, weil ihre Apfelkuchen nicht durchgebacken waren, aber wie durch ein Wunder färbte sich im letzten Augenblick die Kruste doch goldbraun.
Edmée war mit dem Tischdecken betraut worden. Ganz allein umschritt sie den fahlen weißen Tisch im großen Salon, der nun nicht mehr wiederzuerkennen war. Und ganz zum Schluss musste die jüngste der Cousinen angekleidet werden, die man so lange wie möglich hatte schlafen lassen.
Die Männer kamen erst um ein Uhr zurück, ihr Atem ließ darauf schließen, dass sie sich in der Dorfwirtschaft schon ein paar Gläschen genehmigt hatten. Fred spielte den Hausherrn, reichte die Tabaksdose und die Zigarrenkisten herum.
Die Frauen und Mädchen aßen in der Küche. Sie waren ständig auf dem Sprung, um nach dem Rechten zu sehen.
Es wurde alter Wein gereicht, und als Edmée gegen vier Uhr in den Salon trat, um die Lampen anzuzünden, stand dichter blauer Tabakqualm im Raum. Die meisten Gäste hatten sich bequem auf ihren Stühlen zurückgelehnt, ihre vom Leben in der frischen Luft und dem reichlichen Essen geröteten Gesichter zeichneten sich dunkel gegen die überweißen angeknöpften Kragen ab.
Es herrschte eine wohlige, herzliche, optimistische Stimmung. Inmitten der schmutzigen, als Aschenbecher verwendeten Teller standen nicht weniger als zehn Zigarrenkisten.
Als Edmée die drei Lampen anzündete, ließen die meisten Männer ihre schmale, feingliedrige Gestalt nicht aus den Augen.
Danach kehrte sie in die Küche zurück, wo die Tante unter Tränen einer eben eingetroffenen Alten ihr Leid klagte.
Um acht Uhr verabschiedete sich der letzte Gast, den Onkel Louis in seinem Wagen mitnahm. Dann war das Haus wieder leer. Zwischen Freds dicken Lippen steckte eine letzte Zigarre. Mit glänzenden Augen durchschritt er den Salon, in dem jetzt großes Durcheinander herrschte. Als sein Blick auf Edmée fiel, sagte er laut:
»Ein schönes Begräbnis! Alle Honoratioren waren da, sogar der Bürgermeister von Maeseyck!«
Sein Blick verweilte auf den zarten Formen seiner Cousine. Er warf sich in die Brust und atmete schwer, denn man hatte einen Krug Genever nach dem anderen geleert.
»Wir zwei werden uns sicher gut verstehen!«
Er lächelte und machte sich daran, die Zigarrenkisten wie gewohnt wieder wegzuschließen.
Die Gäste waren gegangen, der Tote aus dem Haus. In der Küche spülten die Mädchen und die Magd das Geschirr, während sich die anderen, die Füße am Feuer, die Begräbniszeremonie, die Predigt und die Grabrede des Vorsitzenden der Bauerngenossenschaft in allen Einzelheiten ins Gedächtnis zurückriefen. Die Tante hörte zu, schnäuzte sich, vergoss ein paar Tränen und stellte weitere Fragen.
Erst um Mitternacht war das Geschirr gespült. Alle gingen schlafen, außer Jef, der zwei Kälber zum Rothemer Rindermarkt bringen musste und deshalb den grauen Gaul anspannte. Nachdem er mit seinen Kälbern im Wagen, die auf dem holprigen Weg ständig das Gleichgewicht verloren, losgefahren war, verschlang ihn die Nacht.
2
Es wurde beschlossen, dass Edmée und Mia zum Notar mitkommen sollten. Sobald die jüngeren Geschwister, die mit ihren Kapuzen und Holzschuhen wie Heinzelmännchen aussahen, auf dem Schulweg waren, zog Mia sich in ihrem Zimmer um.
Sie war ein grobknochiges, kräftiges Mädchen, dessen Gesicht und Gestalt irgendwie gegen die Gesetze der Symmetrie verstießen, wie es bei der ganzen Familie der Fall war, ohne dass man so recht hätte sagen können, wo der Fehler eigentlich lag. Saß vielleicht eine Schulter ein wenig tiefer als die andere, war nicht auch die Nase irgendwie schief? Die Abweichungen waren kaum sichtbar, aber sie genügten, um Mia ein bäurisches, unfertiges Aussehen zu verleihen.
Sie stand immer als Erste auf, weil sie die Kleinen anziehen musste, während die Magd in der Küche den Herd und den Ofen heizte. Mia schnitt auch die dicken Speckscheiben, über die sie, wenn sie in der Pfanne brutzelten, mit dem Schöpflöffel den Buchweizenbrei goss.
Die jungen Männer standen erst auf, wenn der warme Duft der frischgebackenen Fladen durch das Haus zog, und wenn sie herunterkamen, trabten die drei Jüngsten im grauen Licht des anbrechenden Tages bereits zur Schule.
Dies war ein ganz besonderer Morgen. Jeder war in seinem Zimmer mit dem Anziehen beschäftigt, und die Tante rief im Flur nach jemandem, der ihr das schwarzseidene Mieder zuhaken könnte. Mia, die sich so gründlich gewaschen hatte, dass ihr Gesicht rosig glänzte, und die ausnahmsweise ihr Haar streng zurückgekämmt trug, trat in Edmées Zimmer.
»Sagen Sie, Cousine, ist meine Frisur so in Ordnung?«
Sie hatte dickes, glanzloses braunes Haar.
»Sehr hübsch«, entgegnete Edmée ihr gleichgültig.
»Stimmt das auch? Sagen Sie das nicht nur, um mich nicht zu kränken?«
Zum Flur öffnete sich eine Tür. Heraus trat Fred, auch er mit gerötetem Gesicht und pomadeglänzendem Haar. Er trug ein weißes Oberhemd mit frischgestärkter Hemdbrust. Er war wütend. Er warf Mia einen fleckigen Kragen zu und schrie sie auf Flämisch an. Sie schimpfte ebenso lautstark zurück, und bald kam es zu einem regelrechten Streit. Fred ließ nicht locker. Plötzlich gab er seiner Schwester eine so kräftige Ohrfeige, dass ihr die Luft wegblieb. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie in Tränen ausbrach.
Dann riss sie sich das Kleid herunter, hob den Kragen auf und ging im Unterrock nach unten, während ihr Bruder in sein Zimmer zurückkehrte.
Als Edmée in die Küche trat, war Mia, immer noch in ihrem rosa Unterrock, damit beschäftigt, einen frischen Kragen zu bügeln.
Sie bestiegen den vierrädrigen Wagen, dessen zwei Sitzbänke hintereinander befestigt waren. Jef spannte an. Wie die anderen hatte auch er sich in Schale geworfen, und sein großer Kopf, der aus einem Zelluloidkragen herausragte und auf dem eine schwarze, wenig kleidsame Wollmütze saß, wirkte noch mächtiger und gröber als sonst. Aber diesmal ergriff Fred die Zügel. Seine Mutter, die sich mit ihren Handschuhen und dem Schleier unbehaglich fühlte, saß während der ganzen Fahrt steif und wortlos neben ihm.
Der Regen hatte endlich aufgehört. Der Wind drehte auf Nordost, und die Landschaft erglänzte in einem harten, kalten, strahlend weißen Licht.
»In einer Woche werden wir Schnee haben«, erklärte Fred und wandte sich zu seiner Cousine um.
Man spürte den nahenden Winter. In den Handschuhen wurden die Fingerspitzen taub vor Kälte, und alle schnäuzten sich ohne Unterlass. Sie kamen durch Neeroeteren, ein kleines flämisches Dorf am Kanal, ein winziger Marktflecken mit Kopfsteinpflaster und niedrigen, düsteren Häusern.
Das Land war in alle Richtungen gleich flach, und außer einigen Fichtenwäldchen sah man nur eine Baumsorte: die Pappeln, die die Landschaft in Rechtecke unterteilten.
Vor dem Haus des Notars in Maeseyck nahm die Tante Fred am Arm. Auch Onkel Louis war eingetroffen. Er saß bereits im Empfangszimmer, rauchte eine Zigarre und schlürfte ein Gläschen Schiedamer. Der Notar, beleibt und liebenswürdig wie ein Domherr, begegnete dem Fabrikanten mit einer bemerkenswerten Hochachtung.
Edmée fiel auf, dass der Onkel elegante Schuhe aus Ziegenleder und einen gutgeschnittenen Anzug trug. Er sprach mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes, dem man immer aufmerksam zuhört.
Auch das folgende Gespräch wurde auf Flämisch geführt, nur hier und da streute jemand ein französisches Wort ein, um einer Bemerkung besonderen Nachdruck zu verleihen.
Das Empfangszimmer mutete in seiner peinlichen Sauberkeit geradezu klösterlich an. Die Möbel waren auf Hochglanz poliert, in der Mahagoniplatte des Tisches konnte man sein Spiegelbild sehen. An der Wand hingen zwei große Fotografien von Priestern, den beiden Söhnen des Notars.
Dieser las mit gemessener Langsamkeit die Dokumente vor, sah hin und wieder zum Onkel auf, um sich seines Einverständnisses zu vergewissern. Fred hörte aufmerksam zu, ließ sich den einen oder anderen Satz wiederholen, während Jef unbeteiligt seine Mütze glatt strich.
Die Mutter saß geistesabwesend da, wie schon im Wagen und zu Hause. Sie hatte die Fähigkeit, sich ihrer Umwelt völlig zu entziehen, und wenn es sein musste, konnte sie stundenlang kerzengerade in derselben Haltung verharren, ein trauriges, höfliches Lächeln auf den Lippen. Niemand hätte ihre Züge beschreiben können, in dem ausdruckslosen Gesicht sah man nur farblose, fügsame Augen und jenes eigentümliche Lächeln, das jedem recht gab.
Edmée, die nichts von dem, was um sie vorging, verstand, betrachtete vor allem Fred und Jef, verglich die beiden miteinander, prägte sich jede Einzelheit ein, wie die Narbe an Jefs Unterlippe und das Heftpflaster an Freds Hals, das sicher ein Furunkel verdeckte. War nicht dieses Furunkel die Ursache für das Kragendrama und Mias Abwesenheit?