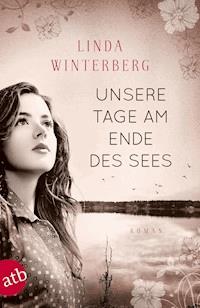9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nimmt man einer Mutter ihr Kind …
Norwegen, 1941: In dem kriegsgebeutelten Land verlieben sich Lisbet und ihre Freundin Oda in die falschen Männer – in deutsche Soldaten. Ihre verbotene Liebe fordert einen hohen Preis, und die beiden jungen Frauen verlieren alles, was ihnen lieb ist. Ausgerechnet bei den deutschen Besatzern scheinen sie Hilfe zu finden, doch dann wird Lisbet von ihrer kleinen Tochter getrennt. Erst lange Zeit später findet sich ihre Spur – in Deutschland!
Eine dramatische Geschichte um zwei junge Frauen in Norwegen im Zweiten Weltkrieg, deren Schicksal bis in die Gegenwart reicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus und begann schon im Kindesalter erste Geschichten zu schreiben. Bei einer Reise nach Norwegen stieß sie auf die historischen Fälle, die diesem Roman zugrunde liegen und die sie nicht mehr losließen.
Informationen zum Buch
Nimmt man einer Mutter ihr Kind …
Norwegen, 1941: In dem kriegsgebeutelten Land verlieben sich Lisbet und ihre Freundin Oda in die falschen Männer – in deutsche Soldaten. Ihre verbotene Liebe fordert einen hohen Preis, und die beiden jungen Frauen verlieren alles, was ihnen lieb ist. Ausgerechnet bei den deutschen Besatzern scheinen sie Hilfe zu finden, doch dann wird Lisbet von ihrer kleinen Tochter getrennt. Erst lange Zeit später findet sich ihre Spur – in Deutschland.
Eine dramatische Geschichte um zwei junge Frauen in Norwegen im Zweiten Weltkrieg, deren Schicksal bis in die Gegenwart reicht.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Das Haus der verlorenen Kinder
Roman
Inhaltsübersicht
Über Linda Winterberg
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Epilog
Nachwort der Autorin
Danksagung
Impressum
Prolog
Hurdal Verk, Norwegen, Dezember 1942
Lisbet stand auf dem Dachboden am Fenster und beobachtete die Schneeflocken bei ihrem Spiel mit dem Wind. Nur sein vertrautes Heulen war hier oben zu hören, sonst nichts. An manchen Tagen klang es beinahe klagend – als ob der Wind wüsste, worum zu weinen war. Dann wieder, wenn das Nordlicht über den Himmel tanzte, war er still, und die Welt wirkte erstarrt unter der eisigen Hand des Frostes. Weit hinter dem Park, hinter den Gärten und Wiesen lagen die Berge, die im heutigen Schneetreiben kaum auszumachen waren und die ihr wie eine undurchdringliche Mauer aus Fels und Gestein vorkamen. So anders war es da bei ihr zu Hause in Loshavn, wo nichts den Blick in die Ferne und über den Schärengarten einschränkte. Dort war das Meer mit seiner unendlichen Weite Teil des Lebens, das sie so schmerzlich vermisste. So oft träumte sie sich zurück auf die Veranda ihres Elternhauses. Mal stellte sie sich das Meer in ihrer Heimat wild und aufgepeitscht vor, so dass Draug, der alte Troll, die Fischer mit seinen Stürmen in den sicheren Hafen zurückzwang. Ein anderes Mal zauberte die Sonne funkelnde Perlen auf die Wasseroberfläche. Ganz still hatte sie an solchen Tagen vor Joakims Haus gesessen und die glitzernde Wasserwelt bewundert. Doch sosehr sie es sich auch wünschte: Heute gelang es ihr nicht, das warme Glücksgefühl dieser Stunden heraufzubeschwören. Die Erinnerung daran entglitt ihr genauso wie dieser eine Moment der Unendlichkeit, den sie mit Erich, ihrem Liebsten, gespürt hatte. Sie unterdrückte den aufwallenden Schmerz, zog einen Brief aus ihrer Rocktasche und faltete ihn auseinander. Zärtlich strich sie mit den Fingern über die Worte, mit schwarzer Tinte geschrieben, die von so viel Liebe und Sehnsucht zeugten.
Meine Liebste,
das Feuer wärmt nur wenig, und meine Hände zittern, was das Schreiben erschwert. Doch die Sehnsucht nach Dir lässt mich diesen Brief verfassen, wenigstens in Gedanken will ich bei Dir sein und dieser bis zum Horizont reichenden Eiswüste entfliehen. Die Kälte raubt uns unsere letzte Kraft. Aber was rede ich. Solche Dinge sollst Du nicht lesen müssen. Keinen Kummer sollst Du mit Dir tragen. Ich wünschte, ich könnte jetzt neben Dir am Strand sitzen, den salzigen Geruch des Meeres in der Nase, im warmen Licht der niemals sinkenden Sonne. Wie sehr ich Deine weiche Haut und den Klang Deiner Stimme vermisse. So gern würde ich jetzt mein Haupt an Deine Schulter legen, die Augen schließen und mich dem süßen Nichtstun hingeben, bis uns erneut die Leidenschaft einholt. Du wirst jetzt schon unser Kind in den Armen halten. Ich schließe Euch beide in meine Gebete ein, bete für uns alle, für eine Zukunft und ein Ende unserer Trennung, wie es auch immer aussehen wird. Bald werden wir wieder vereint sein, das wünsche und glaube ich.
Meine Liebste, mein Sonnenschein und Augenstern
Auf ewig Dein Dir treu ergebener
Erich
So oft hatte sie diese Zeilen bereits gelesen und zärtlich berührt. Sogar ihre Nase hatte sie an das Papier gehalten, um ein wenig von seinem Geruch zu erhaschen – was töricht war. Gewiss war der Brief auf seiner weiten Reise durch unendlich viele Hände gegangen. Trotzdem glaubte sie, einen Hauch seines Rasierwassers wahrzunehmen, was das warme Kribbeln in ihrem Bauch zurückbrachte. Für einen Moment vertrieb es den Kummer und die Zweifel, die sie immer wieder rastlos durch die langen Gänge trieben. Nur hier oben, hier war sie allein – mit dem Wind, der Stille, ihren Gedanken und Ängsten. Sie blickte auf das in Leder gebundene Buch neben sich auf dem Tisch. So viele Dinge hatte sie schon hineingeschrieben, so viele Momente und Erlebnisse festgehalten. Sie griff nach dem Buch, schlug es auf und überflog ihre Einträge. An manchen Tagen hatte sie die Texte eilig hingeworfen, an anderen akkurat und sauber geschrieben. Eine Seite fiel besonders ins Auge – das Datum war dreimal unterstrichen, als ob es dadurch mehr Wert bekommen würde. Aber dieser Tag war ja auch anders als all die anderen, denn an diesem Tag war ihre Tochter zur Welt gekommen. Das Kind des Mannes, den sie über alles liebte. Sie hätte damals glücklich sein sollen, doch sie hatte laut zu schluchzen begonnen. Die Zweifel und die Ungewissheit der letzten Wochen hatten sie überwältigt. Wie sollte sie für dieses kleine Wesen sorgen – ihm eine gute Mutter sein –, so allein, wie sie auf der Welt war? Schwester Helene hatte ihr das Kind aus den Armen genommen und die Verantwortung aus dem Raum getragen – wenigstens für ein paar Stunden. Nur Oda war bei ihr geblieben. Ihre geliebte Freundin, die mit ihrer Fröhlichkeit stets allen Kummer fortjagen konnte. Oda und Lisbet, eine Einheit, seit sie denken konnte. Als hätte sie das Schicksal füreinander geschaffen. Sie würden sich so lange aneinander festhalten, bis der Sturm an ihnen vorbeigezogen wäre – das hatten sie jedenfalls gedacht. Doch irgendwann hatten sie einander verloren. Irgendwann zwischen dem unterstrichenen Geburtstag ihres Kindes und dem letzten Eintrag in diesem Buch war die Ohnmacht gekommen, und niemand hatte sie aufhalten können.
Sie blätterte zu diesem Tag. Ein einfaches Datum, nicht unterstrichen. Dieser Text war gestochen scharf geschrieben. An der letzten Zeile blieb sie hängen. Langsam formten ihre Lippen die Worte, die den Schmerz und die Schuldgefühle jenes Augenblicks zurückbrachten und ihr die Tränen in die Augen trieben.
»Und plötzlich war sie still.«
Eins
Wiesbaden, Deutschland, Oktober 2005
Marie schritt am Spielfeldrand des Schachbrettes entlang und fixierte nachdenklich die lebensgroßen Figuren. Sie ahnte, dass sie verloren hatte. Sie holte tief Luft, dann schaute sie zu ihrer Gegnerin, die auf der Parkbank gegenüber saß. »Hat es überhaupt noch Sinn weiterzumachen?«
Betty schüttelte den Kopf. »Du kannst nur noch mit dem Turm ziehen, was dir aber nichts bringen wird, denn mit meinem nächsten Zug bist du schachmatt.«
»Und wenn ich den Bauern dorthin setze?« Marie trat auf das Spielfeld und rückte die Figur voran.
Bettys Blick war Antwort genug.
»Ich gebe auf.« Marie nahm die Hände in die Höhe. »Du hast schon wieder gewonnen.«
Betty erhob sich von der Parkbank, trat aufs Spielfeld, schob ihre Dame zwei Felder nach rechts und rief triumphierend: »Schachmatt!« Ein Grinsen um die Lippen, drehte sie sich zu Marie um. »Muss schließlich alles seine Richtigkeit haben.«
Marie, die nicht gern verlor, zwang sich zu einem Lächeln und seufzte: »Das ist kein freiwilliges soziales Jahr, das ist Folter. Wenn ich gewusst hätte, dass alte Leute so anstrengend sind, ich hätte mir eine andere Beschäftigung gesucht.«
»Alte Leute?« Betty sah um sich. »Wo sind hier alte Leute?«
Marie grinste. Betty war vierundachtzig, was sie nicht daran hinderte, ihre ganz eigene Art der Eitelkeit zu pflegen. Sie hatte sich damit abgefunden, ästhetisch zweifelhafte orthopädische Schuhe tragen zu müssen, doch ihre restliche Kleidung war modern und von ausgesuchter Qualität. Altbackene Strickwesten und formlose Pullover suchte man bei ihr vergebens. Am liebsten trug sie Blusen, enggeschnittene Rollis und schwarze Leggings aus diesem neumodischen Zeugs, das sie Elasthan nannten. Hätte es früher schon geben müssen, hatte sie einmal zu Marie gesagt, dann hätten die Röcke nicht ständig gekniffen. Ihr Haar war silbergrau – Färben wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Dafür umgab sie ein leichter Hauch von Chanel Nº5, was Marie wie ein Klischee vorkam. Sie selbst benutzte nur praktisches, nach Vanille duftendes Deo aus der Drogerie. Betty hielt nichts von praktischen Deos, genauso wie sie nichts von orthopädischen Schuhen, dem Altersheim oder ihrem Zimmernachbarn Karl-Theodor hielt.
»Spielen wir noch eine Runde?«, fragte die alte Dame.
Marie blickte auf die Uhr. »Ich fürchte, wir müssen zurück.«
»Nicht doch, jetzt schon?« Betty verzog enttäuscht das Gesicht.
»Bald wird es dunkel, und um sechs gibt es Abendbrot«, sagte Marie. Betty antwortete nicht. Sie setzte sich wieder auf ihre Parkbank, verschränkte die Arme vor der Brust und hielt ihre Nase in die herbstliche Abendsonne. Marie ließ sie gewähren. Sie kannte Bettys Launen. Trotzdem hatte sie die alte Dame ins Herz geschlossen. Sie war anders als die anderen Bewohner des Heimes, die sich die Zeit mit Tratschen, Fernsehen und Brettspielen vertrieben. Ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Schachspielen hatten sie nur durch Zufall entdeckt. Marie hatte Else Bauer im Aufenthaltsraum einen Tipp gegeben, durch den die alte Dame ihren Gegner, den alten Heinz-Ulrich, geschlagen hatte. Seitdem hatte sich Betty hartnäckig an ihre Fersen geheftet, denn es gab nur wenige gute Schachspieler im Heim; glaubte sie Bettys Worten, gar keine.
Im Frühjahr hatte Marie ihre Stelle im Haus Sonnenschein angetreten. Kurz davor war sie von Berlin nach Wiesbaden gezogen. Die Idee mit dem freiwilligen sozialen Jahr war ihr eher zufällig gekommen. Das BWL-Studium war nichts für sie gewesen, genauso wenig wie die Ausbildung zur Bankkauffrau. Mit ihrer Launenhaftigkeit bei der Arbeitssuche hatte sie ihren Betreuer beim Jugendamt, Herrn Paul, zur Weißglut getrieben. Einen aalglatten Burschen, der mit seinen braunen Cordanzügen und der schwarzen Hornbrille wie ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit wirkte, ebenso wie das rote Backsteingebäude, in dem das Jugendamt untergebracht war. Zuletzt hatte sie dieses Gebäude kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag betreten. Herr Paul hatte ihr an diesem Tag persönliche Dinge ihrer Eltern übergeben, die bisher im Jugendamt aufbewahrt worden waren. Darunter eine alte Tasche ihrer Mutter, die mit allerlei Krimskrams gefüllt war. Erst vor einer Weile hatte sie in dieser Tasche zufällig die Fotografie eines alten Hauses in einer Seitentasche entdeckt, die ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Haus Sonnenschein, 1945 war auf der Rückseite zu lesen. Sie stellte Nachforschungen im Internet an und fand das Haus. Es stand in Wiesbaden und war ein Altersheim. Weshalb ihre Mutter diese Fotografie aufbewahrt hatte, erschloss sich Marie nicht. Zufällig wurden in dem Heim junge Menschen für ein freiwilliges soziales Jahr gesucht, und sie hatte sich spontan beworben und war angenommen worden. Vielleicht war die Fotografie ein Wink des Schicksals oder einfach nur Zufall, wer wusste das schon. Es hatte sich gut angefühlt, Berlin hinter sich zu lassen, eine Stadt, die ihr stets fremd geblieben war.
In Wiesbaden angekommen, hatte sie sich schnell eingelebt. Die Stadt am Rhein war gemütlich, dabei mondän und überschaubar. Sie bewohnte ein kleines Zimmer in einer WG, die in einem der für diese Gegend typischen Stadthäuser aus dem neunzehnten Jahrhundert lag. Ihre beiden Mitbewohnerinnen waren grundverschieden. Die blonde Julia war eher eine Nachteule – vor neun Uhr morgens nicht ansprechbar, unordentlich und hektisch. Kerstin hingegen war ruhig und besonnen. Mit ihrem kurzgeschnittenen braunen Haar wirkte sie unscheinbar. Sie studierte Germanistik und Philosophie, und in ihrem Zimmer gab es unendlich viele Bücher. In den Tagen nach ihrer Ankunft hatte Kerstin ihr die Stadt gezeigt. Die prachtvolle Wilhelmstraße, den Neroberg mit seiner kleinen Bergbahn, das Biebricher Schloss, das direkt am Rheinufer lag. Ganz besonders beeindruckte Marie das im Stil der Neorenaissance erbaute Staatstheater, das inmitten altehrwürdiger Villen und Parkanlagen die vergangenen Zeiten Wiesbadens aufleben ließ. Hier hatte sie auch das Freiluftschachspiel entdeckt, im sogenannten Warmen Damm, wie die Wiesbadener den nahe dem Theater liegenden Park nannten.
Betty war ganz verzückt gewesen, als Marie es ihr zum ersten Mal gezeigt hatte, und inzwischen war es zu einer schönen Gewohnheit geworden, dass sie einmal in der Woche hierherkamen.
Marie wusste, dass Betty nicht gern ins Heim zurückging, das sie abfällig als »die Bude« bezeichnete. Viele Freunde hatte die alte, oft eigenwillige Dame dort nicht. Die meiste Zeit verbrachte sie in ihrem Zimmer. Nur Karl-Theodor besuchte sie ab und an. Der alte Herr mit den buschigen grauen Augenbrauen und dem freundlichen Lächeln war eine hartnäckige Frohnatur und ließ sich nicht so schnell vertreiben, was Marie gefiel. Betty konnte durchaus Gesellschaft vertragen, auch wenn sie selbst das anders sah.
Marie räumte die Schachfiguren zurück in die Kisten, setzte sich neben die alte Dame auf die Bank und blickte zu dem großen Weiher in der Mitte des Parks. Die Äste einer Trauerweide trieben im Wasser, auf dem Enten, einige Blesshühner und zwei Schwäne schwammen. Der Herbst hatte die Blätter der Bäume bunt gefärbt, durch die sanfte Sonnenstrahlen ihre Muster auf die Wege zeichneten. Der Duft von trockenem Laub hing in der milden Luft. Auf der nahen Wiese lag eine Gruppe junger Mädchen, die sich kichernd unterhielten. Ein Jogger lief an ihnen vorüber und grüßte knapp. Fahrradfahrer fuhren über die bekiesten Wege. Ein kleines Mädchen, kaum zwei Jahre alt, lief quietschend zum Wasser, verfolgt von seiner Mutter. Kurz vorm Ufer erwischte sie die Kleine, nahm sie lachend in den Arm und wirbelte sie durch die Luft. Marie beobachtete die beiden wehmütig. Als ihre Welt zusammenbrach, war sie nicht viel älter als die Kleine gewesen. Es passierte an einem milden Herbsttag wie heute. Sie hatte auf dem Rücksitz des Wagens gesessen, in dem ihre Eltern den Tod gefunden hatten. Ob ihre Mutter sie jemals so durch die Luft gewirbelt hatte, oder ihr Vater? Sie wusste es nicht. Ihre Gesichter kannte sie nur von Fotos, und ihre Gegenwart war eine vage Erinnerung aus einer unerreichbaren, Geborgenheit versprechenden Welt.
»Wie hieß noch gleich dieses nette Café, in dem wir letztens waren?«, riss Betty sie aus ihren Gedanken. »Da könnten wir noch auf einen Sprung vorbeischauen. Die backen leckere Torten.«
»Maldaner, das Café heißt Maldaner«, erwiderte Marie abwesend. Die Frau und das Mädchen hatten begonnen die Enten zu füttern.
»Richtig, das war der Name. Lass uns dorthin gehen. Das Abendbrot im Heim ist immer derselbe Einheitsbrei – Käse, Wurst, ein wenig Brot, an guten Tagen eine Tomate oder Gurke. Phantasie ist für diese Küche ein Fremdwort.« Die alte Dame stand entschlossen auf.
»Torte ist allerdings auch kein besonders gutes Abendessen«, wandte Marie ein.
»Ja, aber sie macht glücklich. Und ein bisschen Glück ist gut für die Seele.« Betty zwinkerte Marie aufmunternd zu. »Ist nicht immer leicht im Leben. Es hat keinen Sinn, die dunklen Wolken zuzulassen, besonders nicht, wenn die Sonne so schön scheint.«
Marie lächelte. Die alte Dame mochte stur sein, manchmal vielleicht auch wunderlich, doch sie hatte feine Antennen für die Menschen um sie herum. Oftmals kam es Marie so vor, als wüsste Betty alles über sie, obwohl sie ihr nie viel von sich erzählt hatte.
»Also gut. Wenn Torte glücklich macht, ist das natürlich etwas anderes«, lenkte Marie ein.
Die beiden schlenderten Richtung Wilhelmstraße, vorbei an dem altehrwürdigen Nassauer Hof, in dem schon Kaiser Wilhelm II., in späteren Jahren John F. Kennedy oder Audrey Hepburn residiert hatten.
Auch das Café Maldaner, das sie nun betraten, entführte einen mit seinem Charme eines Wiener Caféhauses in alte Zeiten. Eine hölzerne Drehtür, stuckverzierte Decken und Wände, gemütliche Sofas und eine breite, reich gefüllte Kuchentheke sorgten für eine gemütliche Atmosphäre.
Sie suchten sich einen Platz am Fenster und gaben ihre Bestellung auf. Marie entschied sich für ein Stück Obstkuchen und einen koffeinfreien Cappuccino, während sich Betty ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte und eine heiße Schokolade gönnte.
»In Berlin sehen Cafés anders aus«, sagte Marie.
»In Norwegen auch«, erwiderte Betty trocken.
»Norwegen?« Marie zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Ich hab mal in einem gearbeitet, in Kristiansand – ist eine Ewigkeit her. Fühlt sich an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen.« Bettys Stimme klang wehmütig.
»So fühlt sich Berlin für mich auch an«, erwiderte Marie. Die Bedienung brachte die Bestellung. Betty deutete auf Maries Törtchen.
»Dein mickriger Kuchen sieht nicht so aus, als würde er glücklich machen.«
»Das kann schon sein«, bestätigte Marie lachend. »Ich muss auf meine Linie achten.«
»Klar, und morgen kommt der Weihnachtsmann. Von der Statur her sind wir uns sehr ähnlich. Klein, zierlich, aber zäh. Du kannst essen, was du willst, Schätzchen, es bleibt nichts hängen. Das verspreche ich dir.«
Marie lächelte. Sie probierte von ihrem kümmerlichen Törtchen. »Wieso warst du in Norwegen?«
»Ich bin dort geboren«, antwortete Betty und winkte ab. »Ist lange her. In den Fünfzigern bin ich nach Deutschland gekommen, habe geheiratet und bin geblieben. Und was war bei dir in Berlin?« Sie schaute Marie fragend an.
»Ist noch nicht lange her«, gab Marie zurück und nippte an ihrem Cappuccino. »War nicht so berauschend dort.«
Betty trank von ihrer Schokolade und bemerkte trocken: »Du willst nicht darüber reden.«
»Willst du über Norwegen reden?«, konterte Marie.
»Ist wie Schach spielen, sich mit dir zu unterhalten«, gab Betty zurück. »Dem Gegner keine Blöße geben.«
Marie zog eine Grimasse, dann gab sie sich einen Ruck. »Ich war zwei Jahre alt, als meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind.« Betty ließ ihre Gabel sinken. »Insgesamt waren es vier Pflegefamilien, drei Heimaufenthalte und immer derselbe miese Betreuer im Jugendamt, den ich Gott sei Dank nun endlich los bin.«
»Immerhin etwas«, bemerkte Betty. Eine Weile schwiegen beide. Marie leerte ihren Cappuccino in einem Zug. Als sie die Tasse auf den Tisch zurückstellte, legte Betty die Hand auf ihren Arm und sagte: »Ich habe den Schmerz in deinen Augen erkannt – diesen Kummer, der einen nie loslässt.«
Marie wusste nicht, was sie erwidern sollte. Bettys Stimme klang auf einmal anders – zerbrechlicher als sonst. In ihren Augen schienen Tränen zu schimmern. Eine Bedienung trat näher und unterbrach die beiden. Betty zog ihre Hand fort.
»Wir schließen gleich, dürfte ich bitte kassieren?«, fragte die junge Frau schüchtern.
»Das geht auf mich«, bestimmte Betty, noch bevor Marie reagieren konnte. Sie ließ sie gewähren, denn Widerworte hätte Betty ohnehin nicht zugelassen, das wusste Marie. Betty gab ein großzügiges Trinkgeld und zwinkerte dem jungen Mädchen lächelnd zu, was diese mit einem höflichen Dankeschön und roten Wangen quittierte.
Kurz darauf verließen sie das Café und liefen zur nahen Bushaltestelle. Die Sonne war bereits untergegangen, doch der Himmel erstrahlte noch in leuchtendem Rot. Betty setzte sich auf den einzigen freien Sitzplatz an der Haltestelle. Sie nahm ihre Tasche auf den Schoß und schaute in den Himmel, wo ein Schwarm Kraniche laut rufend Richtung Süden zog. »Es gab einmal eine Zeit, da konnte ich mir ein Leben ohne Sicht aufs Meer nicht vorstellen«, murmelte sie. Erneut klang ihre Stimme zerbrechlich. »Oder einen Winter ohne Schnee. Das sind die beiden Dinge, die ich am meisten an Norwegen vermisse, das Meer und den Schnee. Richtigen Schnee, nicht die Matschbrühe, die hier alle drei heilige Zeiten vom Himmel fällt und gleich wieder davonschwimmt. Schnee, der wie Watte aussieht, monatelang liegen bleibt und ganz anders riecht, als das von Streusalz zerfressene Zeug.« Sie seufzte. Der Bus kam, und die beiden stiegen ein.
»Und du bist nie wieder dort gewesen, am Meer, meine ich?«, hakte Marie nach.
»Nein, schon lange nicht mehr. Nur in meinen Träumen sehe ich unser Dorf, die weißen Häuser, den Schärengarten und das Meer.« Bettys Blick wanderte nach draußen, und sie fügte leise hinzu: »Wir durften uns nicht lieben. Nicht wiedersehen, einander nicht finden, in einer Welt, die ganz und gar aus den Fugen geraten war. Und das alles nur, weil sie über den Hügel gekommen sind.«
»Wer ist über welchen Hügel gekommen?«, wollte Marie wissen.
Betty wandte den Kopf zu ihr. Unverständnis lag in ihrem Blick.
»Ich habe dir doch gesagt, du sollst eine anständige Torte essen. Sieh mich an. Ich bin jetzt glücklich.« Die Verletzlichkeit in ihrer Stimme war mit einem Schlag verschwunden. Marie hakte nicht weiter nach. Wenn Betty so weit war, würde sie ihr den Rest der Geschichte erzählen, das spürte sie.
Der Bus hielt, und die beiden stiegen aus. Am Eingang zum Altersheim stand Karl-Theodor und grüßte freundlich: »Guten Abend, die Damen. Sie wurden beim Abendessen vermisst. Es war heute ausgesprochen köstlich.«
»Das glaube ich aufs Wort«, antwortete Betty mit dem altbekannten trockenen Unterton in ihrer Stimme.
Sie gingen an dem alten Mann vorbei zum Fahrstuhl, der sie in den dritten Stock beförderte, in dem es wie immer muffig roch.
»Immer dieser Gestank«, moserte Betty, als sie auf den Flur traten. »Das liegt daran, dass sie nie das Fenster aufmachen. Irgendwann ersticken wir noch in dem Mief von billigem Essen und Bettpfannen.«
Marie brachte die alte Frau zu ihrem Zimmer.
»Nächste Woche wieder Schach?«, vergewisserte sich Betty. »Aber sicher doch«, erwiderte Marie und zwang sich zu einem Lächeln. »Und diesmal werde ich gewinnen.«
»Das glaubst auch nur du«, konterte die alte Dame augenzwinkernd und verschwand in ihrem Zimmer. Marie blieb noch eine Weile auf dem Flur stehen. Plötzlich kam sie sich ganz verloren vor. Sie verstand selbst nicht genau, warum, aber sie hätte gern noch mehr von Norwegen, den weißen Häusern am Meer und dem so anders aussehenden Schnee gehört. Der Aufzug öffnete sich erneut und spuckte Karl-Theodor aus. Mit hängenden Schultern ging er an Marie vorüber zu seinem Zimmer. Die Fröhlichkeit von eben war aus seinem Gesicht verschwunden.
»Ach, guten Abend, mein Fräulein«, grüßte er höflich. »Sie sind noch hier?«
»Ich gehe jetzt.« Er nickte. Marie deutete auf Bettys Tür. »Ist nicht immer leicht mit ihr.«
»Ist, wie es ist.« Er winkte ab. »Sie hat auch gute Tage. Vielleicht ja morgen wieder.« Seine Stimme klang hoffnungsvoll.
»Bestimmt. Sie spielt gern Schach. Wussten Sie das?« Marie bemühte sich um einen aufmunternden Tonfall.
»Wirklich?«, fragte er verwundert.
Marie nickte.
»Sie ist sogar sehr gut darin.«
»Das glaube ich aufs Wort«, gab er zurück und öffnete seine Tür.
Marie ging zum Aufzug. Sicher würde er morgen erneut sein Glück bei Betty versuchen, vielleicht dieses Mal mit mehr Erfolg, denn wenn es um ein gutes Schachspiel ging, würde Betty kaum nein sagen können.
*
Als Marie kurze Zeit später die Tür zur ihrer WG aufsperrte, vernahm sie fröhliches Gelächter aus der Küche. Sicher hatte Julia wieder ein paar Kommilitonen eingeladen. Marie stellte ihre Tasche neben der Garderobe auf den Boden. Hoffentlich würde der Besuch nicht, wie so oft, bis in die frühen Morgenstunden bleiben. Sie hatte am nächsten Tag Frühschicht und musste zeitig aufstehen.
Nun trat Julia, die wie immer hochhackige Schuhe trug, in den Flur und begrüßte sie überschwänglich.
»Marie, da bist du ja endlich. Wir warten schon auf dich. Komm, du musst unseren neuen Mitbewohner kennenlernen.«
»Unseren neuen Mitbewohner?«
Julia zog sie mit sich in die Küche, wo ein dunkelhaariger junger Mann auf der alten Küchenbank saß und sich mit Kerstin unterhielt.
»Jan«, sagte Marie.
»Ihr kennt euch?«, fragte Julia überrascht.
»Klar doch«, stammelte Marie, die nicht fassen konnte, dass der gutaussehende Typ aus der Küche des Altenheimes in ihre WG einziehen sollte. Er stand auf und hielt ihr die Hand hin, die sie zaghaft ergriff.
»Du bist eine der Pflegerinnen, nicht wahr?« Er sprach mit einem leichten Akzent, Marie tippte auf ein skandinavisches Land.
»Marie«, antwortete sie, gefangen von seinen samtbraunen Augen. »FSJlerin.«
»Dann ist ja alles prima.« Julia klatschte freudig in die Hände, während Marie auf einen der Küchenstühle sank und nickte. Das musste sie erst einmal verdauen. Schweigend hörte sie den anderen zu. Kerstin erzählte von ihrem Auslandssemester in England, das sie nächste Woche antreten sollte. Dann wurde schnell geklärt, wann Jan einziehen würde. Bereits in der nächsten Woche könnte sein Umzug stattfinden.
Nicht lange danach löste sich die kleine Runde auf, und Marie hatte sich von ihrem ersten Schock erholt. Ihre anfängliche Begeisterung über den neuen Mitbewohner war schnell wieder verflogen. Es war offensichtlich, dass Julia es darauf anlegte, mit Jan zu flirten, und sich mehr als einen Mitbewohner erhoffte – was das Zusammenleben kompliziert machen würde. Julia war auch diejenige, die Jan zur Tür brachte, während Marie und Kerstin in ihren Zimmern verschwanden.
Marie knipste ihre Schreibtischlampe an, wobei ihr Blick auf einen großen braunen Umschlag auf ihrem Tisch fiel. Die Adresse darauf war durchgestrichen, ein Nachsendeaufkleber befand sich darüber. Absender war das Jugendamt Berlin. Ihr schwante Übles. Sie öffnete den Umschlag und zog ein in braunes Leder gebundenes Buch heraus. Als sie es aufschlug, fiel ihr eine Fotografie in die Hände. Eine junge Frau mit einem Baby im Arm war darauf abgebildet. Der Text in dem Buch war handgeschrieben, doch sie konnte ihn nicht lesen, denn er war in einer ihr unbekannten Sprache verfasst. Vermutlich war es ein Tagebuch.
Warum zum Teufel war ihr dieses Buch geschickt worden?
Sie drehte das Foto um und erstarrte.
Zwei
Marie hörte dem montäglichen Vortrag der Pflegedienstleitung nur halbherzig zu. Sie war müde, denn sie war gestern Abend für ihre Kollegin Vicki eingesprungen, die von ihrem neuen Freund teure Konzertkarten geschenkt bekommen hatte. Die wöchentliche Versammlung des Pflegedienstes war für alle Pflicht. Vicki fehlte trotzdem, angeblich war sie heute krank, doch Marie ahnte den Grund für diese plötzliche Erkrankung: eins neunzig groß, brauner Wuschelkopf und hübsche blaue Augen. Der Larsvirus hatte Vicki befallen. Mal sehen, wie lange er anhalten würde. Seitdem Marie ihre Stelle im Haus Sonnenschein angetreten hatte, hatte es schon mehrere Viren gegeben, die Vicki außer Gefecht gesetzt hatten. Andreas, Günter, Torben und jetzt Lars – selbstverständlich sollten alle die Liebe ihres Lebens sein. Am längsten hatte sie es mit Torben ausgehalten, ganze sechs Wochen. Auch Christine Göbel, die Pflegedienstleiterin, ahnte den Grund für Vickis Fernbleiben und schrieb etwas in ihr blaues kleines Notizbuch, vor dem sich jeder Angestellte fürchtete. Auch Marie hatte schnell erkannt, dass mit Christine Göbel nicht gut Kirschen essen war. Wenn es nach der Mittfünfzigerin mit dem aschblonden kurzgeschnittenen Haar gegangen wäre, dann würde sie heute nicht hier sitzen. Wankelmütige junge Dinger habe sie noch nie leiden können, hatte sie ihr an ihrem ersten Arbeitstag unverblümt ins Gesicht gesagt. Jeder Mitarbeiter bekam bei Arbeitsantritt aus irgendeinem Grund eine Standpauke von ihr, hatte Vicki Marie später erklärt.
Christine Göbel erläuterte die Abläufe der neuen Woche. Es gab Probleme mit der Reinigung, die bereits mehrfach private Namensetiketten vertauscht hatte. Reparaturen an der Heizungsanlage müssen vorgenommen werden, was vermutlich am Mittwoch zu Schwierigkeiten mit dem Warmwasser führen könnte. Im Flur des zweiten Stockes waren mehrere Lampen ausgefallen, die heute von Herrn Richter, dem Hausmeister, ersetzt werden sollten. Maries Blick wanderte zum Fenster. Das Wetter hatte übers Wochenende umgeschlagen. Regen fiel in große Pfützen auf dem Innenhof. Im Wetterbericht hatten sie heute Morgen von einer längeren Schlechtwetterperiode gesprochen. Sie sah Bettys unzufriedenen Blick schon vor sich. Gewiss würde die alte Dame ein Spielchen im Aufenthaltsraum ausschlagen.
»Marie?«
Sie zuckte zusammen. Plötzlich waren alle Augen auf sie gerichtet. Abwartend schaute Frau Göbel sie an und zog missbilligend eine Augenbraue in die Höhe. »Ob du mit Gertrud diese Woche deinen Dienst tauschen würdest? Sie hat eine private Angelegenheit zu erledigen, die dringlich wäre.« Marie sah zu Gertrud. Die stämmige Frau mit dem aschblonden Pagenkopf warf ihr einen flehenden Blick zu. Sicher ging es mal wieder um ihren Sohn, der nur Unsinn im Kopf hatte. Was er jetzt schon wieder ausgefressen hatte, wollte Marie gar nicht wissen. Ihren Dienst zu tauschen bedeutete, dass sie bis Donnerstag frei hätte, dafür aber am Wochenende arbeiten musste. Sie überlegte kurz, dann nickte sie. Erleichtert sank Gertrud auf ihrem Stuhl zusammen. Gewiss würde sie ihr später zum Dank wieder Schokolade bringen. Gertrud arbeitete von allen Mitarbeitern am längsten in diesem Haus, nächstes Jahr würde sie ihr vierzigjähriges Dienstjubiläum feiern. Doch zu mehr als einer einfachen Pflegekraft hatte es die schüchterne, immer leicht abgehetzt wirkende Frau mit dem Herz am rechten Fleck und einem gehörigen Appetit nie gebracht. Ellenbogen einsetzen liegt mir nicht, hatte sie während einer Kaffeepause einmal zu Marie gesagt und dabei verlegen den Blick gesenkt.
Die Versammlung löste sich auf. Eilig entflohen alle dem Besprechungsraum, der mit seinen großen, noch aus der Zeit der Jahrhundertwende stammenden Flügeltüren und seiner stuckverzierten Decke einen ganz eigenen Charme hatte. Marie und Gertrud warteten vorm Aufzug, der wie immer behäbig seinen Dienst tat. Auf die Idee, den in die Jahre gekommenen Fahrstuhl gegen einen moderneren zu ersetzten, war bisher niemand gekommen. Die Ausstattung des Hauses war insgesamt veraltet. Dennoch war der Charme des Fin de siècle in den Fluren, Zimmern und in den mondänen Speise- und Aufenthaltsräumen noch spürbar und zeigte seine Wirkung auf die Bewohner, Menschen aus einer anderen Zeit, die hier Vertrautes wiederfanden, das ihnen Geborgenheit vorgaukelte.
Gertrud warf Marie einen Seitenblick zu und fragte: »Ich hoffe, es ist dir recht. Mein Thomas, er hat …«
»Schon gut«, unterbrach sie Marie. »Ich hatte sowieso keine Pläne fürs Wochenende.«
Gertrud deutete ein Nicken an, sichtlich um Fassung bemüht. Marie wusste nicht, was sie sagen sollte. Irgendetwas Tröstendes, etwas Lustiges. Es fiel ihr nichts ein. Sie spürte, dass Gertrud jemanden zum Reden brauchte, doch sie fühlte sich heute nicht in der Lage, der Kollegin zuzuhören. Ihre Hand wanderte in die Tasche ihrer grauen Strickjacke, und sie umklammerte die Fotografie mit der Frau und dem Kind, die sie, seitdem sie sie aus dem Briefumschlag gezogen hatte, ständig bei sich trug. Der Text auf der Rückseite war mit Tinte geschrieben und verblasste bereits. Die Frau auf dem Bild kam ihr so vertraut vor, sah ihr so unendlich ähnlich. Gestern hatte sie das Bild vor den Badezimmerspiegel gehalten und ihr eigenes Antlitz mit dem Gesicht der Frau verglichen. Die Fotografie war schwarzweiß, die Ecken waren bereits vergilbt. Trotzdem ahnte Marie, dass die Frau rotes Haar hatte. Rotes Haar und helle Haut – wie sie selbst, wie ihre Mutter, die sie nur von Bildern kannte.
Der Aufzug kam, und die beiden Frauen stiegen ein. Verwundert registrierte Gertrud, dass Marie nicht nach unten fuhr.
»Hast doch jetzt frei. Was willst du dann im dritten Stock?«, entfuhr es ihr. Marie schaute auf die Zahlenreihe. Wie selbstverständlich hatte sie auf die Nummer drei gedrückt. Gertrud sah sie abwartend an, während sich der Aufzug in Bewegung setzte.
»Ich wollte noch zu Betty. Hab ihr etwas versprochen«, wich Marie ihrer Kollegin aus. Was sollte sie ihr sagen – dass sie der alten Dame nahe sein wollte? Dass sie mit ihr reden wollte, über das Schachspielen, das Wetter – vielleicht sogar über Norwegen? Oder war das alles Unsinn? Betty war nur eine alte Dame, eine der Bewohnerinnen des Altersheimes eben, nicht viel mehr als eine Bekannte. Und trotzdem zog es Marie zu ihr.
Sie erreichten das dritte Stockwerk, und Marie stieg mit einem knappen Abschiedsgruß auf den Lippen aus. Wie immer war der Flur in helles Neonlicht getaucht. Frau Kahl saß in ihrem Rollstuhl in dem extra eingerichteten Raucherzimmer und unterhielt sich angeregt mit Herrn Dietrich, der gewiss über seine alten Zeiten als Bankdirektor plauderte. Eingenebelt vom Zigarettenqualm, lebten sie in ihrer Welt der Vergangenheit. Marie lief den Flur hinunter. Bettys Zimmertür stand offen. Sie war gerade vom Frühstück zurück und lüftete, wie immer zu dieser Stunde. Marie blieb fröstelnd in der Tür stehen und wickelte sich fest in ihre Strickjacke. Betty saß am offenen Fenster, ihr Strickzeug in der Hand – als wäre Sommer und kein kalter Oktobertag. Der Wind trug den Regen in den Raum. Das Fensterbrett war schon ganz nass. Betty blickte auf und sagte trocken: »Dachte schon, du kommst nicht mehr.«
Marie durchquerte den Raum und schloss das Fenster. »Meine tägliche Dosis kaltes Zimmer kann ich mir doch nicht entgehen lassen.« Sie griff nach einem Handtuch und wischte das Fensterbrett trocken.
»Kaltes Zimmer?« Betty schüttelte den Kopf. »Ihr jungen Dinger wisst doch gar nicht, was Kälte ist.« Sie strickte weiter. Marie schloss die Tür und setzte sich aufs Bett. Schweigend saßen sie sich eine Weile gegenüber. Nur das Klappern der Nadeln erfüllte den Raum. Schlurfende Schritte waren auf dem Flur zu hören, die Stimme von Karl-Theodor, dann war es wieder still. Nur ganz langsam wurde es wärmer im Raum.
»Hast heute keine Arbeit, was?« Betty drehte ihr Strickzeug um.
»Hab unverhofft frei bekommen.«
»Gertrud wird diesem Balg nie beikommen«, erriet Betty den Grund für Maries plötzliche Freizeit. »Sie erzählt es jedem, auch wenn er es nicht hören will. Meine Güte, der Junge ist erwachsen. Irgendwann muss sie ihn ziehen lassen. Ändern wird sie ihn nicht können.«
»Vielleicht hat er wieder einen Gerichtstermin«, mutmaßte Marie, die sich schon gar nicht mehr darüber wunderte, dass die alte Dame sofort begriffen hatte, worum es ging. »Immerhin geht sie hin und lässt ihn nicht allein, auch wenn er ein Kleinkrimineller und ein Versager ist. Für mich ist nie jemand irgendwohin gegangen, egal ob in den Kindergarten oder die Schule. Alles war ihnen egal. Eine meiner Pflegemütter hat mich ständig geschlagen, eigentlich für alles. Sie hat zu viel geraucht, zu viel gesoffen. Die andere war ein Weichei, bei der hat uns ihr Freund verprügelt. Und die eine Familie war zwar ganz nett, gekümmert haben sie sich aber auch nicht. Als der Vater starb, bin ich dort weggekommen – zurück ins Heim.«
»Ist nicht dein Tag heute, oder?« Betty schaute sie kurz an.
»Könnte sein«, erwiderte Marie. Sie überlegte, ob sie Betty von dem Buch und dem Bild erzählen sollte. Ihre Hand wanderte in ihre Tasche, wo sie das Papier berührte. Sie brachte es nicht über sich, es hervorzuholen – es war zu kostbar. Am Ende würde Betty es nicht verstehen, etwas Falsches, gar Verletzendes sagen.
Der Wind peitschte den Regen an die Fensterscheibe und wirbelte Blätter durch die Luft. Missmutig schaute Betty hinaus.
»Ist ein lausiges Wetter heute. Gut, dass du das Fenster zugemacht hast. Sogar der Teppich ist nass geworden.« Sie legte ihr Strickzeug auf den Tisch, füllte Tee in zwei Becher und reichte Marie einen. Marie nahm ihn dankbar entgegen und schloss ihre kalten Finger um das warme Porzellan.
Erneut schwiegen sie, und die Stille fühlte sich gut an. Marie rückte auf dem Bett ein Stück nach hinten und lehnte sich gegen die Wand. Betty hatte ihr Zimmer mit ihren alten Möbeln eingerichtet. Sie saß in einem gemütlichen grünen Sessel mit abgewetztem Stoff, auf dem Nachttisch stand eine beigefarbene Lampe, die den Charme der sechziger Jahre verströmte. Über dem Bett hing ein Ölgemälde, eingefasst von einem kitschigen goldenen Rahmen. Das Meer war darauf zu sehen, Wellen, auf denen Schaumkronen tanzten, schlugen an den Strand. »Das Bild hat ein Mann namens Joakim gemalt«, sagte Betty. »Mein Vater hat es ihm vor vielen Jahren abgekauft. Es ist das Einzige, was mir von zu Hause geblieben ist.« Da war er wieder, der Schmerz in Bettys Stimme. »Er ist jahrelang zu uns nach Loshavn gekommen und hat gemalt. Manchmal habe ich ihn heimlich dabei beobachtet. Meine Güte, ich war sogar neidisch auf ihn, weil er so schön malen konnte und die Geduld dafür aufbrachte, so lange an einem Ort auszuharren, bis das richtige Licht den Himmel erfüllte. Irgendwann tauchte Joakim dann nicht mehr auf – nur das Bild ist geblieben. Es hat in der Stube über dem Esstisch gehangen. Mutter hat es nie gemocht. Sie meinte immer, es zeige die raue Seite des Meeres, vor der sie sich immer gefürchtet habe.« Betty schüttelte den Kopf. »Ein Loshavner Mädchen und fürchtet sich vor dem Meer, das muss man sich mal vorstellen.«
»Was soll daran seltsam sein?«, erwiderte Marie schulterzuckend. »Ich habe so viele Jahre in Berlin gelebt und fürchte mich bis heute vor der U-Bahn. Ich kann nicht einmal genau sagen, was es ist. Aber wenn ich eine U-Bahn kommen höre, krampft sich mein Magen zusammen. Und in dem fahlen Licht der unterirdischen Gänge wirken alle Gesichter grau und eingefallen. Die meisten Menschen blicken grimmig drein. Oftmals kam es mir so vor, als verspürten die Leute um mich herum dieselbe Angst wie ich. Die Angst, für immer in den dunklen Tunneln zu verschwinden.«
»Als würde einen das Meer verschlucken«, pflichtete Betty ihr bei. Marie nippte an ihrem Tee. Betty griff erneut nach ihrem Strickzeug. Wieder waren schlurfende Schritte zu hören, das Klappen einer Tür.
»Das ist bestimmt Karl-Theodor«, bemerkte Marie.
»Und wenn schon.« Betty zuckte mit den Schultern.
»Er hat dich gern.«
Betty warf ihr einen kurzen Blick zu, der alles sagte.
»Gib ihm wenigstens eine Chance. Ich glaube, er ist sehr nett, und Schach spielen kann er auch. Gesellschaft ist doch nichts Schlechtes.«
»Ich mag sie eben nicht, diese verhärmten Gesichter, diese Pullunder- und Cordjackenträger, die müffeln, gelbe Zähne haben und den ganzen Tag nur jammern oder sich über andere Leute aufregen.«
»Das ist aber nicht sehr nett«, verteidigte Marie Karl-Theodor. »Er müffelt nicht und gibt sich Mühe mit seinem Äußeren. Gut, er trägt Cordjacken, aber darunter Hemden, keine Pullunder. Gib dir einen Ruck, wenn er das nächste Mal kommt. Nur eine Runde Schach. Vielleicht macht es dir ja Spaß.«
Betty atmete tief durch, dann nickte sie. »Von mir aus. Aber er muss fragen. Sonst glaubt er noch, ich würde ihm nachlaufen.«
Marie grinste. Da war sie wieder, die eigenwillige Betty, die tatsächlich anzunehmen schien, Karl-Theodor würde mehr suchen als Gesellschaft, um die Einsamkeit zu vertreiben.
»Meinen Vater hat das Meer verschluckt«, kam Betty wieder auf ihr vorheriges Thema zurück. »Ich war nicht da, lebte damals in Kristiansand. Plötzlich war ein Sturm aufgezogen, und das Boot meines Vaters ist gekentert. Die komplette Besatzung ist ertrunken. Vater, Leiff und Kalle, der etwas dumm im Kopf war, aber anpacken konnte. Nach der Beerdigung hat Mutter das Bild mit den Wellen abgehängt. Sie war richtig wütend darauf und hat es zu Boden geworfen.« Betty deutete auf die rechte Ecke des Rahmens, wo tatsächlich zu erkennen war, dass das Gemälde beschädigt war. »Als sie an dem Tag endlich eingeschlafen ist, habe ich es aufgehoben, in ein braunes Tuch gewickelt und zu meinen Sachen in der Dachkammer gestellt.« Sie macht eine kurze Pause. »Eine Weile habe ich oben am Fenster verweilt und auf mein geliebtes Meer hinausgeblickt, das an diesem Tag ganz still war – als würde es bereuen, was es angestellt hatte. Dabei war ich es, die so vieles zu bereuen hatte.« Bettys Stimme wurde leiser. Marie glaubte, Tränen in ihren Augen zu erkennen. »Ich habe es ihr nie gesagt, habe sie nicht zu Grabe getragen, weil ich zu feige war.«
»Was hast du ihr nicht gesagt?«, hakte Marie vorsichtig nach.
Betty sah irritiert auf, sie blinzelte, und ihr Blick wanderte zum Fenster.
»Wird das Wetter die ganze Woche so bleiben? Bei Regen ist es scheußlich im Park.«
Da war sie wieder, diese Veränderung. Marie verfluchte sich für ihre Neugierde. Hätte sie Betty einfach reden lassen. Gewiss hätte sie ihr noch mehr erzählt. Marie ahnte, dass hinter den Andeutungen eine hörenswerte und aufregende Geschichte steckte. Doch wieder war Betty aus ihrer Vergangenheit aufgetaucht, und Marie wusste, dass es keinen Weg zurück geben würde.
»Ja, es soll so bleiben«, antwortete sie seufzend.
»Versuch erst gar nicht, mich dazu zu überreden, im Aufenthaltsraum zu spielen.« Betty strickte hektisch weiter. »Dort läuft andauernd der Fernseher, das schreckliche Ding. Ständig diese Quizshows, ist kaum auszuhalten.«
»Wir könnten hier spielen«, schlug Marie vor, die mit diesem Ausbruch gerechnet hatte. Betty hielt in der Bewegung inne. Verdutzt schaute sie Marie an.
»Hier, auf dem Zimmer, jetzt gleich?«
»Ich könnte in den Aufenthaltsraum hinuntergehen und das Spiel holen. Zeit hätte ich.«
Skeptisch schaute Betty Marie an, dann nickte sie zögernd.
»Das wäre schon was. Nicht so schön wie der Park, aber immerhin.« Marie stand erleichtert auf. Ihre Hand berührte erneut die Fotografie in ihrer Jackentasche. Bettys Gesellschaft würde ihr guttun. Zu Hause würde sie doch nur ins Grübeln kommen.
Als Marie die Tür öffnete, hielt Betty sie zurück. »Warte, Mädchen.« Die alte Frau legte das Strickzeug zur Seite, stand auf und zog ein Portemonnaie aus ihrer Handtasche. »Sei so lieb und lauf zum Bäcker an der Ecke. Die backen fast so guten Kuchen wie die in dem Café neulich. Wie hieß es noch gleich?«
»Maldaner«, half ihr Marie auf die Sprünge.
»Und diesmal kein windiges Obsttörtchen und Kalorienzählen.« Betty drückte ihr einen Geldschein in die Hand. »Sonst wird es nichts mit dem Glück.«
Marie sah die alte Frau verwundert an. Doch Betty grinste nur.
»Du verbringst deinen freien Tag mit einer alten Schachtel in einem Altersheim. Du musst entweder einen an der Waffel haben oder verdammt unglücklich sein. Das sagen doch die jungen Leute von heute. Einen an der Waffel haben, oder?«
Marie nickte. Wieder einmal hatte Betty sie durchschaut. »Nein, nicht unglücklich, vielleicht ein bisschen einsam«, antwortete sie leise.
Betty legte ihren Finger unter Maries Kinn, hob es an, schaute ihr eine Weile stumm in die Augen und stellte dann fest: »Wusste ich’s doch. Also geh schnell zum Bäcker, bevor die Schokosahne ausverkauft ist. Und bring von dem Cappuccino mit. Das scheußliche Zeug, was die hier Kaffee nennen, kann ja kein Mensch trinken.« Sie ließ die Hand sinken. Marie nickte mit Tränen in den Augen. Betty wedelte mit den Armen. »Jetzt geh schon.«
Marie trat zur Tür, wandte sich dann aber noch einmal um und fragte: »Betty?« Die alte Frau, die gerade ihr Strickzeug in einem Korb verstaute, schaute hoch, und ihre Blicke trafen sich. »Ach, es ist nichts«, wiegelte Marie ab, verließ endgültig den Raum und schloss die Tür hinter sich.
*
Im Eingangsbereich empfing sie das bunte Treiben des Alltags. Mehrere kleine Geschäfte hatten hier Platz gefunden. Ein Blumen- und ein Friseurladen, ein Zeitungsladen, und die Filiale eines Sanitätshauses, die Angoraunterwäsche passend zur Jahreszeit im Angebot hatte. Einige der Bewohner des Altenheims saßen in einem kleinen Café, das in einem gläsernen Anbau untergebracht war, drei Damen und zwei Herren. Eine der Frauen strickte, die beiden anderen starrten zum Fenster hinaus. Die Männer diskutierten lautstark, anscheinend über Politik, denn Marie schnappte den Namen eines Politikers auf, als sie an ihnen vorüberging. Die strickende Frau erkannte sie und winkte ihr fröhlich zu. Marie grüßte sie lächelnd zurück. Frau Herbach aus dem dritten Stock war eine unerschütterliche Frohnatur, obwohl sie nach einem Unfall vor einigen Jahren an den Rollstuhl gefesselt war und ihr einziger Sohn, ein Investmentbanker, in New York lebte und sie nie besuchen kam. Er hat dort Frau und Kind, hatte sie Marie erzählt und auf eine Fotografie gezeigt, die eine Bilderbuchfamilie vor einem der typischen amerikanischen Holzhäuser zeigte. Sie war nie dort gewesen, nicht einmal zur Hochzeit. Einmal im Jahr, zu Weihnachten, kam ein Paket, hin und wieder ein Brief, mehr nicht. Das ganze Jahr über strickte sie. Strickjacken und Pullover, Babyschühchen, Strampler und Mützen. Alles ging nach New York; ob es dort jemals getragen wurde, wusste niemand. Neben ihr saß Elke Taler, die gern jammerte. Bis heute hatte sie nicht verwunden, dass sie aus ihrem kleinen Häuschen hatte ausziehen müssen. Doch mit ihrer Gehbehinderung war es immer schwerer mit den vielen Stufen geworden. Ihre Tochter kam zweimal pro Woche, manchmal auch am Wochenende, und dann brachte sie ihre Kinder mit – zwei kleine Jungs, die nur Unsinn im Kopf hatten und laut quietschend die Flure rauf- und runterrannten, was Leben ins Haus brachte, wie Marie fand. Leider war nicht jeder ihrer Meinung, besonders Frau Göbel nicht. Allerdings würde es wohl kaum etwas bringen, die Jungs mit einem Eintrag in das blaue Buch zu strafen.
»Hoppla!« Marie traf ein Rempler an der Schulter. »Pass doch auf«, rief sie. Der Verursacher ihres Zusammenstoßes blieb stehen. Es war Jan. Maries Herz begann höher zu schlagen.
»Entschuldige bitte. Hab ich dir weh getan?«
Marie blickte in seine warmen braunen Augen und schüttelte den Kopf. Ihre Stimme wurde unsicher. »Nein, ich glaube nicht. Ich wollte zum Bäcker, weißt du.« Was redete sie für einen Unsinn. Es war doch vollkommen unwichtig, wohin sie wollte.
Er grinste verschmitzt. »Dann haben wir denselben Weg, der allerdings recht feucht sein wird.« Er deutete nach draußen. Wolkenbruchartiger Regen ging nieder. Wo kam der denn so plötzlich her? Eben hatte es doch nur genieselt. »Soll ich Euch zum Bäcker geleiten, gnädiges Fräulein?«, scherzte er und hielt ihr den Arm hin.
Erst jetzt bemerkte sie den Regenschirm in seiner Hand. Lächelnd nahm sie sein Angebot an, hakte sich bei ihm ein und flötete: »Aber gerne doch, der Herr.« Sie gingen zum Ausgang, und er spannte den Schirm auf. Auf dem Weg zum Bäcker legte er den Arm um sie und zog sie an sich, was sie zuließ. Sein Geruch zog ihr in die Nase, ein Hauch von Aftershave, herb, wie sie es liebte. Das Kribbeln in ihrem Magen verstärkte sich. Sie dachte an den Abend in der Küche, an Julias strahlende Augen. Diesmal, so schien es, hatte sie die Nase vorn. Der Wettkampf schien eröffnet – und plötzlich war es ihr gleichgültig, dass es kompliziert werden könnte.
*
Betty stand am Fenster ihres Zimmers. Ihr Blick folgte den beiden Gestalten auf dem Gehweg, die halb unter einem Regenschirm verborgen innig wirkten. Sie liefen den Weg entlang und verschwanden hinter den Büschen an der Ecke. Ihre Hände verkrampften sich. Der junge Mann. Er war zu ihr gekommen und hatte sie angesehen. Mit ihren Augen. Sie hatte all die Jahre geahnt, dass die Vergangenheit sie einholen würde. Seine braunen Augen, sein dunkler Teint, wie sehr er ihr ähnelte. Durch seinen Anblick war der Schmerz zurückgekommen, doch sie hatte nicht geweint. Er hatte nach Antworten gesucht und trotzdem geschwiegen, wissend, dass sie ihn erkannt hatte. Von neuem spürte sie, wie ihr Herz schneller schlug. So viele Bilder und Begebenheiten waren seitdem vor ihrem inneren Auge aufgetaucht. Gedanken und Worte tanzten durch ihren Kopf, doch kein Wort war über ihre Lippen gekommen. Was hätte sie ihm sagen, ihm erklären sollen? In seinen Augen hatte der Kummer eines verlorenen Lebens gestanden. Das Wissen um die Vergangenheit würde es nicht besser machen. Ihr Blick wanderte nach draußen. Der Weg lag nun verlassen da. Regen prasselte in große Pfützen, in denen bunte Blätter schwammen. Sie wollte nicht, dass er den Arm um Marie legte, obwohl sie das Mädchen kaum kannte und es ihr egal sein könnte. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich mit ihr verbunden. Sie war die alte Frau, die am Ende ihres Lebens einer niemals wiederkehrenden Erinnerung nachspürte, und Marie war das junge Mädchen, das nach seinem Platz im Leben, nach Geborgenheit suchte. Fast erkannte sie sich selbst in Marie. Doch das alte Leben sollte im Verborgenen bleiben. Es war vorbei. Niemand konnte es ändern oder die Zeit zurückdrehen, auch wenn sie es sich manchmal wünschte. Sie trat vom Fenster weg, setzte sich in ihren alten Lehnstuhl und griff seufzend nach ihrem Strickzeug. Gleich würde Marie zurückkommen und mit ihr die Vergangenheit, ob sie wollte oder nicht. Sie hatte die Tür einen Spaltbreit geöffnet und würde sie nicht mehr schließen. Vielleicht sollte es nun so sein.
*
Später am Tag saßen sich Marie und Betty gegenüber. Längst war der Kuchen aufgegessen, der Cappuccino getrunken. Langsam versank der Raum in der heraufziehenden Dunkelheit. Die beiden bemerkten es nicht. Konzentriert waren ihre Blicke auf das Schachbrett gerichtet. Der Spielstand war ausgeglichen. Zwei Partien hatte Betty gewonnen, zwei Marie. Betty bewegte ihren Turm, und darauf hatte Marie gewartet. Sie schob ihre Dame voran und rief triumphierend: »Schach!« Eigentlich Schachmatt, aber bisher hatte es Betty stets geschafft, die Niederlage abzuwenden. Also war sie vorsichtig geworden. Betty lehnte sich zurück und knipste die Stehlampe in der Ecke an, die ein seltsam summendes Geräusch von sich gab. »Bei dem Licht kann man ja nichts sehen«, sagte sie, den Blick erneut aufs Brett gerichtet. Sie überlegte, deutete einen Zug ihres Königs nach links an, nach rechts, verrückte einen Bauern, den Springer, schob die Figuren wieder zurück und warf Marie einen finsteren Blick zu.
»Matt«, fügte Marie breit grinsend hinzu.
Betty ließ sich im Stuhl zurückfallen. »Hast Glück gehabt.«
»Das ist kein Glück, sondern Können«, gab Marie zurück.
»Können.« Betty spie das Wort regelrecht aus, was Marie zusammenzucken ließ. Das gute Gefühl von eben verschwand, und plötzlich fühlte sich der Sieg falsch an.
Einen Augenblick schwiegen beide. Marie hatte sofort gemerkt, dass sich nach ihrer Rückkehr vom Bäcker etwas verändert hatte. Was genau es war, konnte sie nicht sagen. Betty wirkte reserviert, und ihre Antworten klangen geradezu mürrisch. Selbst der Kuchen hatte kein Lächeln auf ihre Lippen gezaubert, und ihre beiden gewonnenen Partien hatte sie nicht wie sonst kommentiert.
»Bist du müde?«, erkundigte Marie sich vorsichtig. »Soll ich besser gehen?«
Verdutzt schaute Betty sie an und schüttelte den Kopf.
»Nein, es ist schön, wenn du da bist. Es ist nur …« Sie brach ab.
»Was ist nur …?«, wollte Marie wissen.
Betty schloss die Augen. Ihr fehlten der Mut und die Kraft. Oder sollte sie endlich loslassen und die Tür in ihrem Inneren öffnen? Marie würde sie gewiss verstehen. War Kummer nicht leichter zu ertragen, wenn er geteilt wurde? Aber es war ihr Kummer, nicht Maries. Sie würde ihr zuhören, schweigend, das wusste Betty. Marie würde nichts kommentieren, nichts bewerten, ihr keine Vorwürfe machen. Doch sie brachte es nicht über sich. Ihr Blick wanderte zu dem Bild an der Wand und blieb an der beschädigten Ecke hängen. Wie wütend war ihre Mutter damals gewesen, als sie es hingeworfen hatte, wie verzweifelt. Betty hatte erschrocken den Kopf eingezogen und sie ihrem Schmerz überlassen, ohne sie in den Arm zu nehmen, wie sie es hätte tun sollen. Fremd waren Mutter und Tochter einander in diesen Zeiten geworden, hatten Geheimnisse voreinander gehabt, die es zuvor niemals zwischen ihnen gegeben hatte.
Marie folgte ihrem Blick und fragte leise: »Das Bild zeigt dein Heimatdorf, Loshavn heißt es, nicht wahr?«
Verwundert schaute Betty sie an. Loshavn, wie lange hatte sie dieses Wort nicht mehr aus dem Mund eines anderen gehört. Der Schärengarten, die weißen Häuser mit ihren Bewohnern voller Geschichten. Wäre sie nur dort geblieben und niemals fortgegangen, vielleicht wäre dann alles gut geworden. Was war die große weite Welt schon wert gegen ein bisschen Geborgenheit und einen Rückzugsort, tief im Herzen? Sie kannte die Antwort. Es war nicht die Sehnsucht nach der großen weiten Welt gewesen, die sie von zu Hause fortgeführt hatte. Die Erinnerung kam ohne Vorankündigung. Sie senkte den Blick und deutete ein Nicken an. Der ganze Schmerz war wach geworden, als der junge Mann in der Tür gestanden hatte. Er hatte sie mit seinen braunen Augen angesehen, hatte Gesichter, Stimmen, Menschen heraufbeschworen, die sie niemals wieder hatte sehen, hören, spüren wollen.
»Das ist lange her.« Bettys Stimme klang abweisend. »Eine andere Zeit, ein anderes Leben.«
»An das die Erinnerung stark ist«, antwortete Marie leise. Betty warf ihr einen kurzen Blick zu.
»Berlin ist doch auch nicht aus deinem Kopf verschwunden, oder?«
»Das habe ich nie behauptet. Berlin bedeutet für mich kein anderes Leben, das war erst gestern. Aber langsam tritt es in den Hintergrund.«
»Ja, langsam tritt es nach hinten«, bestätigte Betty. »Es macht anderen Dingen Platz. Doch es bleibt ein Teil von dir.«
Marie wurde ungeduldig. All die Andeutungen, das ständige Ausweichen.
»Was ist los, Betty? Sind deine Schatten zurückgekehrt?«
»Vielleicht ein wenig«, antwortete Betty. »Aber wen interessieren schon die Schatten einer alten Frau.«
Marie stand auf, ging vor Betty in die Hocke, griff nach ihrer Hand und antwortete: »Mich.«
Betty lächelte, nur kurz, doch Marie hatte es gesehen. Die alte Frau drückte ihre Hand. »Ist lange her, dass mir ein Mensch wie du begegnet ist.«
»Du weichst mir schon wieder aus«, antwortete Marie und blickte Betty tief in die Augen, in denen sie Tränen zu erkennen glaubte.
»Ich hatte mal ein Kind«, sagte Betty plötzlich. »Ein bezauberndes kleines Mädchen. Doch ich habe es verloren. Wir lebten in einer schrecklichen Zeit damals. Das Glück zweier Menschen bedeutete nichts, und ein Menschenleben war keinen Pfifferling wert. So viele Jahre habe ich nach ihr gesucht, doch sie blieb verschwunden.« Da war sie wieder, diese Verletzlichkeit. Der Blick der alten Dame wanderte zu dem Bild an der Wand.
»So gern hätte ich ihr Loshavn gezeigt. Am Strand hätten wir entlanglaufen können, die nackten Füße im Sand. Ich hätte ihr das Fischen beigebracht, und wir hätten auf dem Steg vor Joakims Haus gesessen. Wir alle drei, wie es hätte sein sollen.« Bettys Stimme brach. Nun liefen ihr die Tränen über die Wangen. Hastig wischte sie sie ab.
Marie griff erneut nach Bettys Hand und drückte sie. Sie verstand die Zusammenhänge nicht, doch das war nicht wichtig. Betty redete sich auf ihre Art den Kummer von der Seele. Wieso nachhaken oder Fragen stellen, ihr Angst machen? Marie wusste, wie sich Verlust anfühlte und was es bedeutete, so einsam zu sein, dass es einen zerriss. Dafür brauchte es keine Erklärung. Betty schien ihr Kind verloren zu haben, wie so viele in der damaligen Zeit – und anscheinend auch den Mann, den sie liebte. Die alte Dame war über achtzig Jahre alt. Es war nicht schwer, sich zusammenzureimen, was ihr geschehen sein mochte. Der Zweite Weltkrieg war ein Teil ihres Lebens und ihrer Jugend gewesen. Auch wenn sie selbst nur die Daten und Fakten aus dem stupiden Geschichtsunterricht kannte, glaubte Marie doch, nachfühlen zu können, was Betty meinte.
»Hast du dich schon mal der Unendlichkeit nahe gefühlt?«, stellte Betty nun eine sonderbare Frage. »So unsagbar glücklich, als wolltest du zerspringen?«
Marie überlegte, dann schüttelte sie den Kopf. Sie war durchaus glücklich gewesen, mit dem Gefühl von Unendlichkeit hatte das nichts zu tun gehabt. Noch nicht einmal richtig verliebt war sie bisher gewesen. Vielleicht verknallt, aber verliebt? Nein, das hatte es noch nicht gegeben.
»Dann weißt du nicht, wie sich die Leere anfühlt, wenn das Gefühl fort ist. Sie ist grausam, unerträglich. Ich dachte, ich hätte es überwunden, doch dieser Verlust bleibt immer spürbar.«
Marie wollte etwas erwidern, doch genau in dem Moment klopfte es an die Tür. Beide blickten erschrocken auf. Sie waren völlig in ihr Gespräch vertieft gewesen. Das Tageslicht war inzwischen vollkommen verschwunden, Dunkelheit lag vorm Fenster. Die Tür öffnete sich einen Spalt, und Karl-Theodors Kopf tauchte auf. Verwundert sah er von Marie zu Betty und erkundigte sich vorsichtig:
»Guten Abend, die Damen. Ich wollte nachfragen, ob Sie, liebe Betty, mich zum Abendessen begleiten würden.«
Seine Frage klang unbeholfen, sein Blick war unsicher. Betty schaute zu Marie, die ein Nicken andeutete.
»Warum nicht?«, nahm Betty die Einladung an. »Obwohl es bestimmt scheußlich schmecken wird.«
Karl-Theodor ließ erleichtert die Schultern sinken. Betty stand auf, Marie ebenfalls. Karl-Theodor trat auf den Flur, Marie folgte ihm. Betty zog die Tür hinter sich zu und schloss ab. Auf dem Weg zum Aufzug fragte sie Karl-Theodor beiläufig: »Ich habe gehört, Sie können Schach spielen, mein Freund?« Karl-Theodors Augen begannen zu leuchten. Freudig nickte er. »Wollen wir dann morgen Nachmittag ein Spielchen wagen?« Betty warf Marie einen Seitenblick zu.
Marie drückte auf den Aufzugknopf und unterdrückte ein Schmunzeln, während sie Bettys Hand fühlte, die die ihre suchte und fest drückte. Sie lächelte Betty an. Für den Moment schienen die dunklen Schatten zurückgetreten zu sein, obwohl Karl-Theodor eine Cordjacke und sogar einen Pullunder trug.
Drei
Wenig später lief Marie durch das in dichten Nebel gehüllte Nerotal. In der kühlen Luft hing der Geruch von feuchtem Laub und nasser Erde, den sie tief einatmete. Normalerweise nahm sie den Bus in die Innenstadt, doch heute brauchte sie frische Luft. Das Gespräch mit Betty hatte sie verwirrt, gleichzeitig hatte es gutgetan. Kaum jemals zuvor hatte sie mit einem Menschen so offen über Gefühle gesprochen, obwohl sie durchaus Freunde gehabt hatte. Doch in ihr Innerstes war keiner vorgedrungen, auch nicht die Jungs, mit denen sie zusammen gewesen war. Betty gelang dies mit nur wenigen Worten. Doch wollte Marie das? Wollte sie einen Menschen so nah an sich heranlassen? Tief in sich spürte sie den dumpfen Schmerz des Verlustes. Den Schmerz eines Kindes, das zurückgeblieben und verlassen worden war.
Der Stadtbus fuhr an ihr vorüber. Ein junges Mädchen mit Kopfhörern in den Ohren starrte sie aus dem Fenster an. Marie schob die Hände in die Jackentaschen. Es war schon verrückt. Betty war eine oft eigenwillig und unnahbar wirkende alte Dame. Trotzdem wollte Marie die Nähe zu ihr nicht missen. Unweigerlich würde das jedoch passieren, denn in wenigen Monaten würde sie das Heim wieder verlassen, zudem stand Betty am Ende ihres Lebens. Marie hielt inne, die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Auch Betty wäre irgendwann nur noch eine Erinnerung. Aber war das nicht das Leben? Ein ständiger Kampf, Suchen und Finden. Bestand es nicht aus Liebe und Verlust, aus Leidenschaft und Kummer? Betty hatte ihr Leben gelebt. Sie hatte gekämpft, geliebt und verloren. Was war geblieben von all den Jahren? Ein Stück Unendlichkeit, nach dem sie heute noch suchte?
Ein Fußgänger, einen Hund an der Leine, lief durch den Park, durch den sich der Schwarzbach schlängelte. Er grüßte knapp, als er an Marie vorüberlief. Unheimlich wirkte er, mit seinem tief in die Stirn gezogenen Schlapphut und dem schwarzen Mantel. Plötzlich fröstelte Marie. Vielleicht hätte sie doch den Bus nehmen sollen. Sie beschleunigte ihre Schritte. Das Nerotal war ein eigenwilliger Ort. Luxuriös, fast schon dekadent waren die beschaulichen, zumeist aus dem neunzehnten Jahrhundert stammenden Villen, die den kleinen Park umrandeten. Gleichzeitig wirkte dieser Teil Wiesbadens so heimelig, als könnte man hierher nach Hause kommen, um in luxuriösen Wintergärten und ruhigen Gartenanlagen auszuruhen. Hier konnte man den Alltag hinter sich lassen.
Marie dachte an die Fotografie, die noch immer in der Tasche ihrer Strickjacke war. Sie hatte sie nicht hervorgeholt, hatte das Geheimnis für sich behalten. Ihr war klar, dass das Bild eine Geschichte erzählte – genauso wie das Tagebuch. Gestern Abend hatte sie den Nachsendeaufkleber mit ihrer Anschrift auf dem Umschlag abgekratzt, und darunter war die Adresse ihres Großvaters aufgetaucht. Eines Mannes, den sie niemals kennengelernt hatte, denn Erich Bauer war vor ihrer Geburt an Krebs gestorben. Doch anscheinend folgten auch ihm die Schatten der Vergangenheit – und griffen nun plötzlich nach ihr.
Vielleicht hatte ihr Großvater die Frau auf dem Bild einmal geliebt, wer wusste das schon. Nichts und niemand würde Maries Fragen beantworten, weder die vergilbte Fotografie noch das Tagebuch. Sie hatte die Zeilen überflogen, die Seiten durchgeblättert. Eine Lisbet musste es geschrieben haben oder eine Oda, jedenfalls tauchten diese Namen immer wieder auf. Genauso wie der Name ihres Großvaters. Über ihn wusste Marie fast nichts, nicht einmal eine Fotografie war ihr geblieben, und sie war beim Tod ihrer Eltern zu klein gewesen, um sich an Geschichten über ihn erinnern zu können. Sie besaß nur wenige Gegenstände aus ihrem alten Leben. Eine Halskette mit einem Blumenanhänger daran, die sie in einer kleinen Schatulle aufbewahrte. Die alte Tasche mit dem Krimskrams ihrer Mutter, den sie ab und an hervorholte. Ein Schminkspiegel, Lippenstift, inzwischen eingetrocknet, ein Kugelschreiber und eine Handcreme. Ihre Sonnenbrille, die Marie von Zeit zu Zeit trug. Das Portemonnaie ihrer Mutter mit ihrem Ausweis und zwanzig Mark darin. Oftmals betrachtete sie das Foto ihrer Mutter in dem Ausweis und las wehmütig den mit Maschine geschriebenen Namen: Lieselotte Wegner, geborene Bauer. Von ihrem Vater war Marie ein abgegriffenes Taschenbuch geblieben, in dem sein Name stand, ein Krimi, den sie schon hundertmal gelesen hatte. Auf ihrem Schreibtisch stand ein Bild ihrer Eltern. Jedes Grübchen, das Funkeln in den Augen, die Falte in ihrem Kleid, seine Hand in der ihren, Marie kannte jedes Detail. Einmal hatte sie es aus Kummer zu Boden geworfen, um es gleich darauf wieder aufzuheben. Sie sah ihrer Mutter so ähnlich – was seltsam tröstend war.