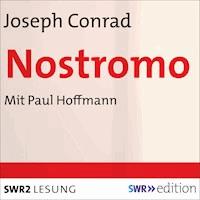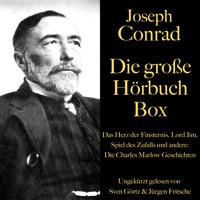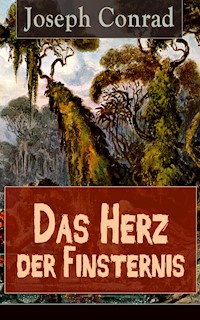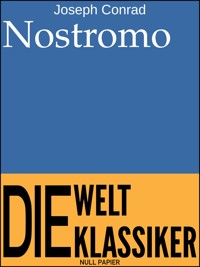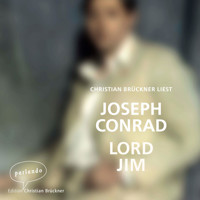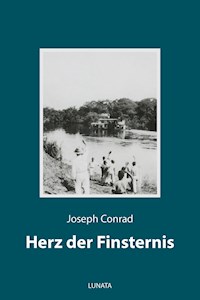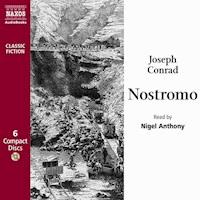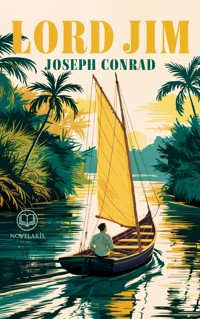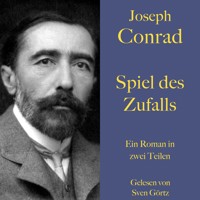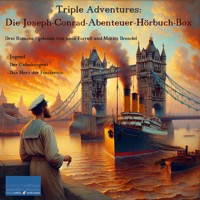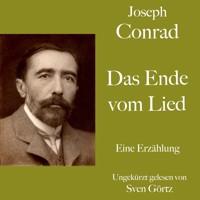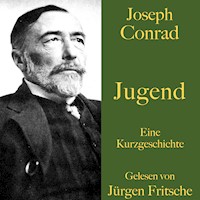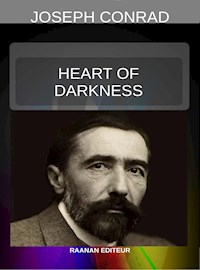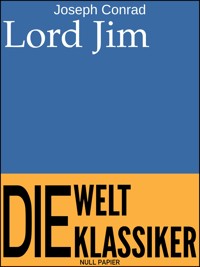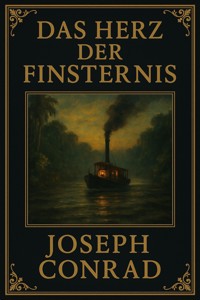
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Fluss, ein Dampfer, eine Reise ins Unbekannte – und in die Abgründe der menschlichen Seele. Als der Seemann Marlow den Kongo hinauffährt, um den rätselhaften Handelsagenten Kurtz zu finden, stößt er auf eine Welt, in der Zivilisation und Barbarei ununterscheidbar werden. Joseph Conrad erschafft mit Das Herz der Finsternis ein Meisterwerk über Macht, Gier und moralischen Verfall – ein Roman, der die Illusion europäischer Überlegenheit zerlegt und den Leser mitten in die Dunkelheit des Menschen führt. Ein zeitloses Werk, das Schriftsteller, Filmemacher und Künstler bis heute inspiriert – von Apocalypse Now bis in die moderne Popkultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joseph Conrad
Das Herz der Finsternis
Heart of Darkness
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
~
I
II
III
Impressum neobooks
Vorwort
In den Nebel des Unbekannten
Es beginnt mit einer Reise – aber nicht einer jener heroischen, die mit Ruhm, Entdeckung und Fortschritt enden. Das Herz der Finsternis ist die Geschichte einer Reise in das Unbekannte, die sich in Wahrheit als eine Reise nach innen entpuppt. Joseph Conrad, der selbst als Kapitän auf einem Kongo-Dampfer diente, verwandelte seine Erlebnisse in einen der dunkelsten Spiegel der europäischen Moderne. Als der Erzähler Marlow den Kongo hinauffährt, auf der Suche nach dem mysteriösen Kurtz, bewegt er sich zugleich durch die Schichten der menschlichen Zivilisation – und findet am Ende nichts anderes als die Finsternis im eigenen Herzen.
Als der Roman 1899 erschien, war er kein Abenteuerroman im klassischen Sinne. Vielmehr war er ein Angriff auf die Selbstwahrnehmung einer ganzen Epoche: auf den Glauben des imperialistischen Europa an seine moralische Überlegenheit. Conrad zeigte, dass hinter der glänzenden Fassade von Fortschritt, Mission und Zivilisation blanke Gier, Gewalt und Selbsttäuschung lauern. Das Herz der Finsternis ist deshalb weniger eine Reise durch Afrika als durch das moralische Labyrinth der westlichen Welt.
Schon in seiner Struktur kündigt sich die Moderne an. Conrad verzichtet auf die lineare Erzählung; er verschachtelt Stimmen, entzieht dem Leser Orientierung und lässt die Wahrheit gleiten wie ein Fluss, dessen Quelle niemand kennt. Diese erzählerische Instabilität – das Gefühl, dass man sich nie ganz sicher sein kann, wer spricht, wer lügt, wer recht hat – ist eine Vorwegnahme des 20. Jahrhunderts, mit seinen gebrochenen Gewissheiten und moralischen Zonen der Unschärfe.
Doch Das Herz der Finsternis ist mehr als ein literarisches Experiment. Es ist ein Dokument der Zerrissenheit. Conrad, selbst polnischer Emigrant im britischen Empire, schreibt aus der Perspektive eines Mannes zwischen den Welten – nicht ganz Europäer, nicht ganz Außenseiter. Sein Blick auf den Kolonialismus ist daher weder moralisch überhöht noch sentimental. Er ist geprägt von Fremdheit, Misstrauen und der Erkenntnis, dass jede Zivilisation ihre eigenen Abgründe in sich trägt.
Heute, über hundert Jahre später, hat dieser Text nichts von seiner Kraft verloren. Er wirkt im Gegenteil aktueller denn je: in einer Welt, in der Ausbeutung, Ressourcenraub und Machtmissbrauch weiterhin globale Realitäten sind. Die Sprache hat sich geändert, die Methoden auch – doch die Mechanismen der Unterwerfung, der Verdrängung und der moralischen Selbsttäuschung sind erstaunlich konstant geblieben. Conrad war einer der ersten, der das erkannte.
Seine Vision war düster, aber nicht zynisch. Er glaubte, dass der Mensch zur Erkenntnis fähig ist – auch wenn diese Erkenntnis schmerzhaft ist. Der berühmte Ausruf „Das Grauen! Das Grauen!“, den Kurtz in seinen letzten Momenten ausstößt, ist kein Schrei der Bosheit, sondern einer der Offenbarung: der Moment, in dem jemand das volle Ausmaß seines eigenen moralischen Absturzes erkennt. In diesem Augenblick blickt der Leser nicht auf Afrika, nicht auf das „Andere“, sondern auf sich selbst.
Und genau darin liegt die ungebrochene Wirkung dieses Romans. Das Herz der Finsternis zeigt, dass der wahre Horror nicht im Dschungel lauert, sondern in uns – in den Strukturen unserer Macht, unserer Geschichte, unserer Sehnsucht nach Kontrolle.
Schatten, Spiegel und Nachhall
Das Herz der Finsternis hat über ein Jahrhundert hinweg eine Spur durch die Weltkultur gezogen – kaum ein anderes Werk des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat so nachhaltige Nachwirkungen entfaltet. Von T. S. Eliots Gedicht The Hollow Men, das Kurtz’ letzte Worte zitiert, bis hin zu Francis Ford Coppolas Apocalypse Now (1979), ist Conrads Dschungel zu einem archetypischen Ort geworden: ein Raum, in dem die Zivilisation sich selbst begegnet und nicht mehr weiß, wer sie ist.
Coppolas Verfilmung, die die Handlung vom kolonialen Afrika in den Vietnamkrieg verlegt, hat das Thema aus dem imperialistischen 19. Jahrhundert direkt in das politische Trauma des 20. transportiert. Der Dschungel ist hier nicht mehr der Kongo, sondern der vietnamesische Urwald; Kurtz ist kein Kolonialbeamter, sondern ein amerikanischer Offizier, der den Verstand verloren hat. Doch der Kern bleibt derselbe: die Begegnung des Menschen mit seiner eigenen Entfesselung. Das Grauen hat nur seine Uniform gewechselt.
Die Tatsache, dass Conrads Roman diese Übersetzung in Raum und Zeit problemlos übersteht, beweist seine universelle Gültigkeit. Ob Kongo, Vietnam, Irak oder das digitale Zeitalter: Überall, wo Macht auf die Verführbarkeit des Menschen trifft, hallt Conrads Dilemma nach. Apocalypse Now zeigt das mit beklemmender Klarheit – und geht dabei noch einen Schritt weiter: Wo Conrad noch fragte, ob Erlösung durch Erkenntnis möglich sei, lässt Coppola offen, ob Erkenntnis überhaupt noch etwas verändert. Der amerikanische Soldat Willard, der den Wahnsinnigen Kurtz töten soll, erkennt in dessen Zusammenbruch nur die Konsequenz eines Systems, das längst jede moralische Orientierung verloren hat.
Doch Das Herz der Finsternis ist nicht nur in der Filmgeschichte weitergeschrieben worden. Auch in der Literatur, Musik und Popkultur hallt es wider. Von Lord of the Flies über Spec Ops: The Line bis zu unzähligen Graphic Novels, Songs und Videospielen – immer wieder taucht die Idee auf: dass Zivilisation ein dünner Schleier ist, dass unter der Oberfläche von Ordnung und Moral das Chaos lauert. Selbst Science-Fiction-Welten – von Star Wars bis Blade Runner – tragen dieses Erbe in sich: das Spannungsfeld zwischen Macht, Entfremdung und innerer Dunkelheit.
Die zentrale Figur des Kurtz ist zum kulturellen Archetypen geworden. Er ist der moderne Ikarus – der, der zu weit fliegt, der das Licht der Wahrheit sucht und daran verbrennt. In der Figur des radikal Entgrenzten, der sich selbst zum Gott erklärt, erkennt man den Schatten aller Machtmenschen des 20. und 21. Jahrhunderts: Diktatoren, Konzernführer, ideologische Heilsbringer. Kurtz steht für das, was passiert, wenn der Mensch seine eigene Moral überschreitet, um sich selbst als Maß aller Dinge zu setzen.
Diese Modernität hat auch eine dunkle Kehrseite. Conrad war kein antikolonialer Aktivist – und seine Darstellung Afrikas wurde, zu Recht, vielfach kritisiert. Chinua Achebe, einer der wichtigsten postkolonialen Denker, nannte Das Herz der Finsternis ein rassistisches Buch, das Afrika nur als Bühne für die moralischen Krisen weißer Europäer benutze. Diese Kritik ist berechtigt – und zugleich ein Teil der Faszination des Werkes. Denn es zeigt, wie sehr selbst die Literatur, die sich kritisch gibt, von den Mustern ihrer Zeit geprägt ist.
Conrads Afrika ist keine Realität, sondern ein Symbolraum – und genau darin liegt seine doppelte Wirkung. Einerseits entlarvt der Roman den kolonialen Blick, andererseits reproduziert er ihn. Diese Ambivalenz macht ihn so vielschichtig: Das Herz der Finsternis ist sowohl Anklage als auch Teil des Problems, das es beschreibt.
Heute kann man den Text nicht mehr lesen, ohne diese Spannungen mitzudenken. Aber gerade das macht ihn lebendig. Er zwingt uns, zu fragen: Wie erzählen wir Macht, Schuld, Fremdheit – und wer darf erzählen? Conrad gibt keine Antwort, aber er öffnet einen Raum, in dem die Fragen weiterklingen.
Das Erbe der Finsternis
Warum bleibt Das Herz der Finsternis so gegenwärtig? Vielleicht, weil es keine Antworten bietet, sondern Widersprüche. Conrad schreibt kein moralisches Traktat, sondern ein Paradox: Er zeigt das Böse, ohne es eindeutig zu verurteilen; er beschreibt das Grauen, ohne es zu erklären. Und genau dadurch wirkt sein Werk in eine Zeit hinein, die selbst aus Widersprüchen besteht.
Im 21. Jahrhundert hat sich der Schauplatz verändert – aber die Themen sind geblieben. Der „Kongo“ ist heute kein Fluss mehr, sondern ein Netzwerk aus Servern, Machtzentren und globalen Ressourcenströmen. Wenn Tech-Konzerne Rohstoffe aus denselben Regionen beziehen, in denen einst Conrads Dampfer fuhr, und gleichzeitig digitale Imperien errichten, die auf Kontrolle und Überwachung beruhen, dann klingt der Roman unheimlich aktuell. Die Finsternis ist nicht verschwunden – sie hat nur ihre Form geändert.
In einer Zeit, in der sich Macht immer subtiler organisiert und Gewalt oft unsichtbar bleibt, wirkt Conrads Dschungel wie ein Symbol für unsere eigenen Systeme: dicht, undurchsichtig, von Mythen durchzogen. Das Herz der Finsternis erinnert uns daran, dass Fortschritt keine moralische Garantie ist. Jede Zivilisation, so aufgeklärt sie sich gibt, trägt die Möglichkeit des Rückfalls in sich – in Brutalität, Ausbeutung, Selbstvergötterung.
Auch die Sprache des Romans – fragmentarisch, kreisend, von Zweifeln durchzogen – ist uns heute näher, als wir denken. Sie passt zu einer Epoche, in der Wahrheit relativ und Perspektive alles ist. Conrad schreibt im Grunde das erste postmoderne Buch, bevor es den Begriff überhaupt gab. Sein Erzähler weiß, dass jedes Wort täuscht, dass jedes Bild eine Konstruktion ist. Der Leser wird zum Mitreisenden im Ungewissen – ein Zustand, der unsere Gegenwart beschreibt wie kaum ein anderer.
In der Popkultur bleibt diese Ungewissheit lebendig. Apocalypse Now hat Conrads Erzählung zu einem neuen Mythos der Moderne gemacht, aber auch Werke wie Heart of Darkness (1993) von Barbara Kingsolver, oder Videospiele wie Spec Ops: The Line (2012) greifen seine Struktur auf: Ein Mann reist in den Abgrund, um jemanden zu finden – und findet sich selbst. Die Erzählung ist zu einem universellen Muster geworden, das in Krieg, Politik, Umweltzerstörung oder digitaler Entfremdung wiederkehrt.
Selbst in Werken wie Apocalypse Now Redux, The Thin Red Line oder True Detective schwingt Conrads Dilemma mit: die Faszination für die Dunkelheit, gepaart mit dem Entsetzen darüber. Der „Kurtz-Moment“ – die Erkenntnis, dass das Böse kein Fremdes, sondern etwas zutiefst Menschliches ist – ist längst zum Archetyp geworden. Jede Generation hat ihren eigenen Kurtz: den Banker, der Märkte ruiniert; den Politiker, der sich über Gesetze erhebt; den Künstler, der an seiner eigenen Hybris zerbricht.
Doch Conrads Text ist mehr als bloß eine Parabel über Macht. Er ist auch eine Warnung vor dem Verlust von Empathie. Wenn Marlow am Ende zu Kurtz’ Verlobter zurückkehrt und ihr nicht die Wahrheit über seine letzten Worte sagt, dann ist das kein feiges Schweigen – es ist eine Geste der Menschlichkeit. Inmitten der Finsternis bleibt ein Rest von Mitgefühl. Vielleicht liegt darin die eigentliche Hoffnung des Romans: dass selbst im Angesicht des Grauens noch ein Funken Menschlichkeit bestehen kann.
In diesem Spannungsfeld – zwischen Erkenntnis und Verdrängung, Grauen und Gnade – liegt die bleibende Kraft von Das Herz der Finsternis. Der Text ist nicht nur ein Spiegel kolonialer Schuld, sondern eine Allegorie auf die moralische Fragilität des Menschen. Er zwingt uns, die eigenen Abgründe nicht zu externalisieren, sondern anzuerkennen.
Das ist es, was ihn so zeitlos macht. Wo immer der Mensch versucht, sich als Herrscher der Welt zu begreifen, lauert der Schatten von Kurtz. Wo Fortschritt zur Ideologie wird, wo Macht sich in Humanität kleidet, beginnt die Reise in die Finsternis von Neuem.
Conrads Roman ist damit weniger eine Erzählung über Afrika als über uns selbst – über den schmalen Grat zwischen Zivilisation und Wahnsinn, zwischen Erleuchtung und Selbsttäuschung. Jede Generation liest ihn anders, doch keine entkommt seiner Frage: Was bleibt vom Menschen, wenn der Glanz der Zivilisation erlischt?
Das Herz der Finsternis schlägt weiter – in unseren Kriegen, unseren Städten, unseren Netzwerken. Und es erinnert uns daran, dass das wahre Grauen nicht das ist, was wir im Dunkeln finden, sondern das, was wir im Licht nicht sehen wollen.
~
Joseph Conrad
Das Herz der Finsternis
Deutsch von Ernst Wolfgang Freißler
S. Fischer Verlag1959
I
Die Nelly, eine seetüchtige Jolle, schwoite an ihrem Anker ohne die leiseste Regung in den Segeln und hielt Rast. Die Flut hatte begonnen, es war fast völlig windstill, und da wir stromabwärts wollten, so hatten wir weiter nichts zu tun, als liegenzubleiben, und das Kentern des Stromes abzuwarten.
Die Themsemündung dehnte sich vor uns wie der Anfang einer ungeheuren Wasserstraße. Draußen waren die See und der Himmel fugenlos zusammengeschweißt, und in dem leuchtenden Raum schienen die gegerbten Segel der Leichter, die mit der Flut herauftrieben, reglos still zu stehen, als scharf umrissene rote Leinwandstücke, vom Lackglanz der Spriete gehöht. Ein leichter Dunst lagerte über den niedrigen Ufern, die gegen die See zu ganz flach verliefen. Die Luft über Gravesend war dunkel und schien noch weiter zurück zu einer finsteren Wolke verdüstert, die unbeweglich über der größten Stadt der Erde lagerte.
Der Direktor der Handelsgesellschaft war unser Schiffer und Gastgeber. Wir vier betrachteten wohlwollend seinen Rücken, während er im Bug stand und seewärts Ausschau hielt. Auf dem ganzen Strom war sicher nichts zu finden, das halb so seemännisch ausgesehen hätte. Er erinnerte an einen Lotsen, der für einen Seemann der Inbegriff der Vertrauenswürdigkeit ist. Es war schwierig, sich vorzustellen, daß seine Berufsarbeit nicht dort vor ihm lag, in der leuchtenden Mündung, sondern hinter ihm, in der brütenden Dunstwolke.
Zwischen uns bestand, wie ich schon irgendwo gesagt habe, das Band der See. Das hatte nicht nur die Wirkung, unsere Herzen während langer Trennung einander zugetan zu halten, sondern auch die andere, daß wir einer für des anderen Geschichten – sogar Überzeugungen – Nachsicht aufbrachten. Der Rechtsanwalt – der feinste aller alten Knaben – hatte kraft der Zahl seiner Jahre wie auch seiner Tugenden das einzige Kissen auf Deck und lag auf der einzigen Decke. Der Buchhalter hatte schon eine Dominoschachtel heraufgebracht und führte nun mit den Steinen Kunstbauten auf. Marlow saß mit gekreuzten Beinen etwas weiter zurück und lehnte sich gegen den Besanmast. Er hatte eingefallene Wangen, eine gelbliche Hautfarbe, einen geraden Rücken und das Aussehen eines Asketen; wie er nun, die Handflächen auswärtsgekehrt, die Arme hängen ließ, erinnerte er an ein Götzenbild. Der Direktor, der sich mit Befriedigung überzeugt hatte, daß der Anker gut hielt, kam nun nach achtern und setzte sich zu uns. Wir tauschten träge einige Worte. Dann herrschte Schweigen an Bord der Jacht. Aus dem oder jenem Grunde begannen wir die Dominopartie nicht. Wir waren nachdenklich gestimmt und fühlten uns nur zu müßigem Schauen aufgelegt. Der Tag ging in stillem Glanz zu Ende. Die Wasserfläche leuchtete friedlich; der Himmel, fleckenlos, erweckte den Gedanken an selige, strahlende Unendlichkeit; sogar noch der Dunst über der Essexmarsch erschien als ein lichtes Schleiertuch, das von den waldigen Höhen landeinwärts niederwallte und die flachen Ufer hinter durchsichtigen Falten verbarg. Nur der Dunst im Westen, über dem Oberlauf des Flusses, wurde mit jeder Minute düsterer, als erzürnte ihn das Nahen der Sonne.
Und schließlich sank die Sonne tief ans Ende ihrer Bahn, wechselte von blendendem Weiß zu tiefem Rot, ohne Strahlen und ohne Hitze, als wollte sie plötzlich verlöschen, zu Tode getroffen von der Berührung mit der Dunstwolke, die über einem Menschenhaufen brütete.
Die Sonne sank, die Dämmerung brach über den Strom herein, und längs der Ufer begannen Lichter aufzutauchen. Der Leuchtturm von Chapman, der auf seinen drei Beinen kerzengerade auf einer Morastbank stand, gab grelles Licht. Schiffslichter kreuzten durch das Fahrwasser – ein Gewimmel von Lichtern, die auf und ab wanderten. Und weiter weg, im Westen, gegen den Oberlauf des Flusses zu, war die ungeheure Stadt immer noch am Himmel zu merken; ein brütender Dunst im Sonnenschein, ein düsterer Glanz unter den Sternen.
»Und auch dies«, sagte Marlow plötzlich, »ist einmal einer der dunklen Orte der Erde gewesen.«
Er war der einzige unter uns, der immer noch zur See fuhr. Das Schlimmste, was man ihm nachsagen konnte, war, daß ihm sein Beruf nicht anzumerken war. Er war ein Seemann, aber auch ein Wanderer, während doch die meisten Seeleute, wenn man so sagen darf, ein seßhaftes Leben führen. Ihr Sinn ist auf Häuslichkeit gerichtet, und ihre Häuslichkeit ist überall um sie – das Schiff; und so auch ihre Heimat – die See. Ein Schiff gleicht dem anderen so ziemlich, und die See ist überall dieselbe. An der Unveränderlichkeit ihrer Umgebung gleiten die fremden Gestade, die fremden Gesichter, der endlos bunte Wechsel des Lebens vorbei; doch kein Geheimnis hält die Beschauer vom Eindringen ab, sondern nur die eigene geringschätzige Unwissenheit; denn nichts Geheimnisvolleres gibt es für einen Seemann als die See selbst, die die Herrin seines Daseins ist und unergründlich wie das Schicksal. Im übrigen genügt nach arbeitsreichen Tagen ein kurzer Streifzug oder eine kurze Zecherei an Land, um ihm das Geheimnis eines ganzen Kontinents zu erschließen, und meist findet er das Geheimnis wenig wissenswert. Die Geschichten der Seeleute sind von unendlicher Einfalt, und ihren ganzen Sinn könnte eine Nußschale fassen. Aber Marlow war, wie gesagt, kein typischer Vertreter seines Berufs (seine Leidenschaft, ein Garn zu spinnen, vielleicht ausgenommen), und für ihn lag der Sinn eines Begebnisses nicht innen wie ein Kern, sondern außen, rings um die Geschichte, die ihn hervorbrachte, wie eine Glutwelle einen Dunst hervorbringt, oder wie etwa einer der Nebelhöfe, die mitunter durch den Mondschein sichtbar gemacht werden.
Seine Bemerkung wirkte durchaus nicht überraschend. Sie sah Marlow ganz ähnlich und wurde schweigend aufgenommen. Keiner nahm sich auch nur die Mühe, zu knurren; und nun fügte Marlow ganz langsam hinzu:
»Ich dachte an die uralten Zeiten, als die Römer zum ersten Male hierher kamen, neunzehnhundert Jahre ist es her – da neulich . . . Licht ist seither von diesem Fluß ausgegangen – Ritter sagt ihr? Ja; aber es ist nur wie ein wandernder Sonnenfleck auf einer Ebene, wie ein Blitz in Wolken. Wir leben in diesem Aufblitzen – mag es währen, solang die Erde rollt. Doch gestern noch herrschte Dunkelheit hier. Stellt euch die Gefühle des Befehlshabers einer – wie nennt ihr sie – Trireme im Mittelmeer vor, der plötzlich nach Norden versetzt wird; er durchquert die beiden Gallien in größter Eile; dann wird ihm eines der Fahrzeuge anvertraut, wie sie die Legionäre – fabelhaft geschickte Leute müssen es gewesen sein – zu bauen pflegten, hundertweise, wie es scheint, in ein oder zwei Monaten, wenn das, was wir lesen, zu glauben ist. Stellt ihn euch hier vor – wahrhaft am Ende der Welt, vor einer bleifarbenen See unter einem rauchfarbenen Himmel, auf einem Schiff, gebrechlich wie eine Harmonika – wie er diesen Strom hier hinaufgeht, mit Vorräten oder Befehlen oder sonst etwas. Sandbänke, Marschen, Urwälder und Wilde – verteufelt wenig zu essen für einen zivilisierten Menschen, nichts als Themsewasser zu trinken, kein Falerner Wein hier, keine Ausflüge an Land. Da und dort ein Militärlager, in der Wildnis verloren, wie eine Nadel in einem Heuhaufen – Kälte, Nebel, Ungewitter, Krankheit, Verbannung und Tod – Tod, der in der Luft, im Wasser, im Busch lauert. Sie müssen hier wie Fliegen gestorben sein. O gewiß, der Mann tat seine Pflicht. Tat sie gut, ganz ohne Frage, und ohne viel darüber nachzudenken, höchstens, daß er später einmal mit alledem prahlte, was er zu seiner Zeit durchgemacht hatte. Sie waren Manns genug, der Finsternis ins Auge zu sehen, und vielleicht hielt ihn die Aussicht aufrecht, nach und nach zur Flotte von Ravenna versetzt zu werden, wenn er gute Freunde in Rom hatte und das schauerliche Klima überlebte. Oder denkt euch einen wohlerzogenen jungen Bürger in einer Toga – ein bißchen zu viel Würfelspiel vielleicht –, der im Gefolge eines Präfekten, eines Steuereinnehmers oder sogar eines Händlers hier herauskam, um seine Finanzen aufzubessern. In einem Morast landen, durch die Wälder marschieren und dann an irgendeinem Posten landeinwärts fühlen, daß die Wildnis, die völlige Wildnis sich um einen geschlossen hat. – Dazu all das geheimnisvolle Leben der Wildnis, das im Wald, im Dickicht und in den Herzen der wilden Männer atmet. Es führt auch kein Weg zu diesen Geheimnissen. Man hat inmitten des Unverständlichen, das im gleichen Maße verhaßt ist, weiterzuleben. Allerdings hat es auch seinen Reiz, dem er sich nicht entziehen kann. Den Reiz des Grauens, wenn ihr das versteht. Stellt euch vor, wie die Reue wächst, zugleich mit der Sehnsucht, zu entrinnen, dem ohnmächtigen Widerwillen der Ergebung, dem Haß.«
Er brach ab.
»Bedenkt«, begann er von neuem, und hob dabei einen Arm mit nach außen gekehrter Handfläche im Ellbogengelenk hoch, so daß er, auf gekreuzten Beinen sitzend, wie ein predigender Buddha wirkte, ein Buddha allerdings in europäischen Kleidern und ohne Lotosblume – »bedenkt, keiner von uns würde genauso empfinden. Was uns rettet, ist die Leistungsfälligkeit. – Das Interesse am Nutzwert. Das nämlich fehlte den Burschen von damals völlig. Sie waren keine Kolonisatoren. Ihre Verwaltung war nichts als eine große Steuerschraube – so scheint es mir wenigstens. Sie waren Eroberer, und dazu brauchte es nichts als rohe Kraft – nichts, dessen man sich zu rühmen hätte, wenn man es besitzt, denn unsere Kraft ist ja immer nur ein Gefühl, das sich aus der Schwäche der anderen ergibt. Sie rafften zusammen, was zu kriegen war, und waren immer auf noch mehr aus. Es war richtiger Raubmord unter erschwerenden Umständen, in größerem Maßstabe, und die Leute gingen blind daran – wie es sich ja auch für die schickt, die sich in die Finsternis vorwagen. Die Eroberung der Erde (ein Wort, das meistens die Bedeutung hat, daß man Leuten, die eine andere Hautfarbe oder flachere Nasen als wir selbst haben, ihr Land wegnimmt), diese Eroberung ist nichts Allzuschönes, wenn man sie sich aus der Nähe betrachtet. Was sie versöhnlich erscheinen läßt, ist nur die Idee, die Idee hinter ihr; kein gefühlsmäßiger Vorwand, sondern die Idee; und ein selbstloser Glaube an diese Idee – etwas, das man hochhalten, vor dem man sich neigen und dem man ein Opfer bringen kann . . .«
Er brach ab. Flammen glitten durch den Fluß, kleine grüne Flammen, rote Flammen, weiße Flammen. Verfolgten, überholten einander, vereinigten sich, um gleich wieder langsam oder hastig sich zu trennen. Das Leben der großen Stadt ging in der sinkenden Nacht auf dem schlaflosen Strom seinen Gang. Wir sahen zu und warteten geduldig – nichts anderes war zu tun bis zum Ablaufen der Flut; doch erst nach einem langen Schweigen sagte Marlow leicht zögernd: »Ich denke, ihr erinnert euch ja, daß ich einmal eine Zeitlang Flußschiffer war«, und da wußten wir auch, daß wir, noch bevor die Ebbe einsetzte, eine von Marlows eigenartigen Geschichten anzuhören haben würden.
»Ich will euch nicht viel mit dem langweilen, was mir selbst geschah«, begann er und bewies damit die Schwäche so vieler Geschichtenerzähler, die häufig gar nicht zu wissen scheinen, was ihre Zuhörer am liebsten hören würden. »Um aber die Wirkung der Ereignisse auf mich zu verstehen, müßt ihr natürlich wissen, wie ich dort hinauskam, was ich sah und wie ich den Fluß bis zu dem Punkt hinauffuhr, wo ich den armen Kerl zum erstenmal traf. Es war der Endpunkt der Schiffahrt und der Gipfelpunkt meiner Erfahrung. Es schien ein Licht auf alles um mich zu werfen – und noch in meine Gedanken hinein. Dabei war es trübe genug und erbarmenswürdig – keineswegs bemerkenswert und auch nicht sonderlich klar. Nein, gewiß nicht sonderlich klar. Und doch schien es Licht auszustrahlen.
Ich war damals, wie ihr euch erinnert, eben nach London heimgekehrt, nachdem ich den Osten reichlich gesehen und mich etwa sechs Jahre lang im Indischen und Stillen Ozean und im Chinesischen Meer herumgetrieben hatte; nun bummelte ich herum, hinderte euch Burschen in eurer Arbeit, drang in eure Häuser ein, als hätte mich der Himmel zu der Aufgabe berufen, euch zur Gesittung zu bekehren. Eine Zeitlang schien es recht nett, aber dann wurde ich des Faulenzens müde. Ich begann nach einem Schiff Ausschau zu halten, was mir die härteste Arbeit auf Erden zu sein scheint. Doch die Schiffe sahen nicht nach mir und so wurde ich auch dieses Spieles müde.
Nun hatte ich schon als ganz kleiner Junge eine Leidenschaft für Landkarten gehabt. Ich konnte mir stundenlang Südamerika, oder Afrika, oder Australien betrachten und mich in die Wonnen der Erforschung versenken. Damals gab es noch viele weiße Flecke auf der Erde, und wenn ich auf einen stieß, der auf der Karte einladend aussah (aber das tun sie ja alle), dann legte ich den Finger darauf und sagte: ›Wenn ich groß bin, will ich dahin gehen.‹ Der Nordpol war einer dieser Orte, wie ich mich erinnere: ich bin nicht dort gewesen und will es auch jetzt nicht versuchen. Der Zauber ist verflogen. Andere Flecke waren um den Äquator herum verstreut und über alle Breiten, über beide Halbkugeln. An einigen davon bin ich gewesen und . . . nun, wir wollen nicht davon reden. Aber einen gab es noch, den größten, den weißesten sozusagen, nach dem mir der Sinn stand.