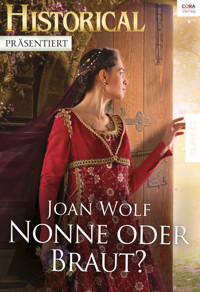Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leidenschaft wider Willen: Das Romance-&-Regency-Highlight "Das Herz des Earls" von Joan Wolf jetzt als eBook bei venusbooks. Diesem Mann liegen im England des 19. Jahrhunderts alle Frauen zu Füßen: Adrian Earl of Greystone. Doch dann ist der begehrte Junggeselle plötzlich mit der jungen Cathleen verheiratet – ein Skandal! Niemand ahnt, dass Adrian das Opfer eines abgekarteten Spiels wurde und sich nun mit seiner Braut wider Willen arrangieren muss. Auch Cathleen hätte sich einen anderen Mann an ihrer Seite gewünscht, doch dann fängt auch ihr Herz Feuer … "Ein faszinierender Roman voller Humor und Leidenschaft" RT Book Review "Joan Wolf ist eine begnadete Erzählerin!" Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight "Titel" von Joan Wolf begeistert mit sympathischen Charakteren und einer leidenschaftlichen Geschichte. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Diesem Mann liegen im England des 19. Jahrhunderts alle Frauen zu Füßen: Adrian Earl of Greystone. Doch dann ist der begehrte Junggeselle plötzlich mit der jungen Cathleen verheiratet – ein Skandal! Niemand ahnt, dass Adrian das Opfer eines abgekarteten Spiels wurde und sich nun mit seiner Braut wider Willen arrangieren muss. Auch Cathleen hätte sich einen anderen Mann an ihrer Seite gewünscht, doch dann fängt ihr Herz Feuer …
„Ein faszinierender Roman voller Humor und Leidenschaft“ RT Book Review
Über die Autorin:
Joan Wolf ist die amerikanische Grande Dame der Liebesromane. Sie wuchs in der New Yorker Bronx auf und studierte Englische und Vergleichende Sprachwissenschaften am renommierten Hunter College in Manhattan. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie längere Zeit als Englischlehrerin an einer High-School, bevor sie ihre internationale Karriere als Autorin begann. Heute lebt sie mit ihrem Mann, ihrer Katze und ihrem Hund in Connecticut.
Bei venusbooks erschienen bereits Joan Wolfs Romane Die Braut des Fürsten, Die Liebe des Königs und Die Leidenschaft des Lords.
Die Website der Autorin: www.joanwolf.com
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/authorjoanwolf
***
eBook-Neuausgabe August 2016
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel Entscheidung des Herzens bei Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Originalausgabe 1996 Joan Wolf
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Lizenzausgabe 2016 venusbooks GmbH, München
Copyright © der aktuellen eBook-Neuausgabe 2020 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Radek Sturgolewski, conrado
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95885-443-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Herz des Earls« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Joan Wolf
Das Herz des Earls
Roman
Übersetzt von Ingrid Rothmann
venusbooks
1. Kapitel
Alles begann mit dem Tod meines Vaters, mit jenem Tag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte. Der Himmel war bleigrau, die kahlen Äste der Bäume schwarz vor Nässe. Als man meinen Vater auf einer Bahre in unser Quartier trug, war sein Gesicht grau wie der Himmel.
»Miß Cathleen, irgendein verdammter Narr hat im Wald herumgeschossen«, sagte Paddy, dessen wettergegerbtes Gesicht vor Gefühl und Kälte gerötet war. »Er muß Mr. Daniel übersehen haben, als er vorüberritt. Freddie ist schon unterwegs und holt den Arzt.«
»Papa.« Ich kniete am Bett nieder. Ein Stück Stoff, noch vor kurzem Paddys Hemd, war zusammengeballt und auf die Brustwunde gedrückt worden. Es war blutgetränkt. Beim Klang meiner Stimme öffneten sich die Augen meines Vaters mit zuckenden Lidern. Seine Wimpern hoben sich, und ich blickte ein letztes Mal in das vertraute strahlende Blau. »Kate«, sagte er. »O Gott, mit mir ist es aus.« Damit schloß er die Augen.
»Papa!« Ich war der Hysterie nahe und mußte mich zu einer Ruhe zwingen, die ich nicht empfand. »Der Arzt wird gleich da sein«, versicherte ich ihm. »Du wirst bald wieder auf die Beine kommen.«
»Hätte nicht gedacht … er würde … argwöhnen … daß ich wußte …«, kam es meinem Vater undeutlich über die Lippen.
»Du hättest nicht gedacht, daß wer argwöhnte, Papa?« Ich fragte es in scharfem Ton. »Weißt du, wer dich angeschossen hat?«
Seine Antwort ließ lange auf sich warten.
»Papa?«
»Weiß nicht … wer …« Wieder öffnete er die Augen und richtete seinen Blick auf Paddy. »Schick nach … Charlwood«, sagte er in einem Ton, der von einem merkwürdigen Gurgeln begleitet war. »Lizzies Bruder.« Es folgte Stille, da er um Atem rang. »… soll sich um Kate kümmern.«
»Niemand wird sich um mich kümmern«, wehrte ich ab. »Sei nur still und warte auf den Arzt. Du wirst wieder ganz gesund, Papa.«
Seine blauen Augen waren noch immer auf den alten Stallknecht gerichtet, der seit seiner Jugend bei ihm war. »Paddy?« »Zur Stelle, Mr. Daniel.«
»Versprich mir …« Wieder Stille, da er um Atem rang.
Beim Anblick seiner Agonie drückte ich die Nägel so fest in meine Handflächen, daß es schmerzte. »Versprich mir, daß du … nach Charlwood schickst.«
»Das werde ich sicher tun, Mr. Daniel.« Paddys weicher irischer Tonfall verströmte Ruhe. »Machen Sie sich bloß keine Gedanken. Ich sorge dafür, daß sich jemand um Miß Kate kümmert.«
Die blutbefleckte Brust meines Vaters hob und senkte sich mühsam. Verzweifelt blickte ich zum Fenster der beengten, ärmlichen Unterkunft. Kein Hufschlag, der das Kommen des Arztes angekündigt hätte. Einziges Geräusch im Raum war das unheilvolle Gurgeln, das jeden Atemzug meines Vaters begleitete. »Papa, sprich nicht«, sagte ich wieder. »Der Arzt kommt jeden Augenblick.«
Mein Vater blickte mich noch einmal an. »Ich war dir ein schlechter Vater, Kate«, sagte er mit schwacher Stimme. »Aber … ich habe dich lieb.«
Seine Augen schlossen sich, um sich nie wieder zu öffnen. Meine erste Reaktion war glühender, blindwütiger Zorn. Der Wirbel, den ich daraufhin veranstaltete, fiel so laut aus, daß die örtlichen Behörden prompt eine Fahndung nach dem Mörder meines Vaters einleiteten, leider ohne Ergebnis. Dann erst setzte meine Trauer ein.
Ich vergoß keine Tränen. Beim Tod meiner Mutter hatte ich geweint, doch war ich damals erst zehn, zu jung, um die Vergeblichkeit von Tränen zu begreifen. Ich hatte es erst im Laufe der Jahre verstehen gelernt. Tränen hatten mir meine Mutter nicht wiedergebracht, und sie würden mir auch meinen Vater nicht wiederbringen.
Kalter Regen hüllte uns ein, als Paddy und ich nach Vaters Beerdigung in unser Quartier zurückkehrten. Die Straßen von Newmarket lagen verlassen da. Die Rennbahn war im November geschlossen, und das öde Aussehen der Stadt war Spiegelbild der Ödnis in meinem Herzen.
»Mr. Daniel würde es gefallen, daß Newmarket seine letzte Ruhestätte wurde«, sagte Paddy in dem Versuch, mich ein wenig zu trösten. »Ich fand es schön, daß so viele zur Beerdigung kamen.«
In der Kirche und auf dem Friedhof hatte sich eine stattliche Schar von Trainern und Pferdeburschen eingefunden, sogar einige Rennstallbesitzer waren erschienen. Auf seine Art war Papa ein bekannter Mann gewesen.
»Ja«, sagte ich und wandte mein Gesicht dem treuen Freund zu, der von Geburt an Teil meines Lebens gewesen war. Ich kam mir gänzlich verlassen vor. »Paddy, was soll ich jetzt machen?«
»Miß Cathleen, wir werden hier auf Ihren Onkel warten«, gab er zurück.
Es war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Ich biß mir auf die Lippen, beugte den Kopf und starrte zu Boden. Ein Stein lag in der Nähe, den ich mit einem Tritt auf die Straße beförderte. Er landete mit leisem Plop im Schlamm. »Du glaubst also nicht, wir könnten das Geschäft allein weiterbetreiben?« fragte ich. »Du könntest die Pferde kaufen, und ich könnte sie trainieren.«
Ich spürte, wie er seine Arme um mich legte. Einmal drückte er mich an sich, ganz fest, und ließ mich gleich wieder los. Sein Ton war bedauernd, aber fest, als er antwortete: »Ihr Vater wollte, daß Sie zur Familie Ihrer Mutter gehen, Mädchen, und ich glaube, er hatte recht. Sie sind jetzt achtzehn, Miß Cathleen. Das wäre kein Leben für eine junge Dame von Stand, mit jemandem wie mir von einem Gestüt zum anderen zu ziehen.«
»Es ist das Leben, das ich immer gelebt habe«, sagte ich.
»Paddy, ich habe dich lieb. Und meinen Onkel kenne ich nicht einmal.« Ich bedachte ihn mit einem Blick, der ihm vor Mitleid das Herz im Leib zerfließen lassen sollte.
Aber die erhoffte Wirkung blieb aus. »Er ist der Bruder Ihrer Mutter und ein Lord«, sagte Paddy energisch. »Ich wäre wahrlich ein schlechter Freund, wenn ich einer solchen Chance im Weg stünde.«
Ich beförderte noch einen Stein mit der Fußspitze auf die Straße. »Wir wissen gar nicht, ob er kommt.«
»Nun, wenn er nicht kommt, haben wir noch immer Zeit, um uns zu überlegen, was als nächstes zu tun ist.« Die Tür unserer Pension rückte bedrohlich näher, und als wir eintraten, sandte ich ein Stoßgebet zum Himmel, mein Onkel möge nicht kommen.
Er kam am darauffolgenden Tag. Seine Schritte auf dem blanken Boden des Flurs vor meiner Tür klingen mir noch heute in den Ohren. Als ich den festen, bestimmten Schritt hörte, wußte ich sofort, wer es sein mußte.
Paddy saß bei mir, und er war es, der die Tür öffnete. Als Charlwood sich vorstellte, ließ der alte Stallbursche ihn ein.
»Hm, Sie sehen aber verdammt jung aus für Miß Cathleens Onkel.« Paddys kritischer Blick taxierte dieses Musterbild eines Aristokraten vom sorgfältig gekämmten Haar bis zu den Schuhspitzen. Doch war der alte Mann Papa zu lange von einem englischen Landsitz zum anderen und von einer Rennbahn zur nächsten gefolgt, um sich von tadelloser Kleidung und blankpolierten hohen Stulpenstiefeln beeindrucken zu lassen.
»Ich bin zweiunddreißig«, sagte Charlwood darauf. »Meine Schwester war sechs Jahre älter als ich.«
»Sie sehen Miß Elisabeth ähnlich«, mußte Paddy widerstrebend zugeben.
Es stimmte. Er hatte dunkelbraunes Haar und meergrüne Augen wie meine Mutter. Waren die Augen meiner Mutter jedoch sanft und verhangen gewesen, so waren seine von fast erschreckender Klarheit. Ich hatte mich zur Begrüßung erhoben. Wir standen einander gegenüber, zwischen uns ein Stück abgetretenen Teppichs, und blickten uns an.
»Kate, ich bin gekommen, um dich einzuladen, bei mir zu leben«, sagte er. »Deine Mutter war meine einzige Schwester, und ich möchte mich um dich kümmern. Ihr zuliebe.«
Seine Miene wirkte aufrichtig. Seine Stimme ebenso. Ich sah Paddy an. »Ich glaube, Sie sollten mit ihm gehen, Miß Cathleen«, ließ er sich leise vernehmen. »Es ist der Wunsch Ihres Vaters.«
Ich nickte. Obwohl mir beinahe das Herz brach, weinte ich nicht. Statt dessen blickte ich mich langsam in dem kleinen, schäbigen Raum um, in dem Papa gestorben war. Wir waren zu dieser unmöglichen Jahreszeit nach Newmarket gekommen, weil er gehofft hatte, dem Marquis of Stade, dessen Landsitz sich in der Nähe befand, zwei Pferde zu verkaufen. Papa hatte den Verkauf mit Stade aber nicht abgeschlossen, und wir hatten die zwei Wallache noch immer hier im Wirtshaus eingestellt. Zwei große, edle Jagdpferde, von mir zugeritten und gutes Geld wert.
»Nimm die Pferde«, sagte ich zu Paddy.
Der alte Mann sah den edlen englischen Lord, meinen Onkel, an.
Charlwood lächelte. »Miß Cathleen soll es an nichts fehlen«, versprach er Paddy. »Du kannst die Pferde behalten.«
Am nächsten Morgen verließ ich Newmarket in der Equipage meines Onkels. Über Nacht hatte der Regen aufgehört, und das strahlende Blau des Morgenhimmels ließ kein Anzeichen der Stürme erkennen, die folgen sollten.
Charlwood Court war riesig groß, leer und kalt. Seit dem Tod seines Vaters vor einigen Jahren lebte mein Onkel, der unverheiratet war, allein.
Dies eröffnete er mir, als wir an einer Poststation anhielten, um die Pferde zu wechseln, und in meinem Kopf schrillte eine Alarmglocke. Ich hatte angenommen, ein Mann seines Alters müßte verheiratet sein. Er bemerkte mein Stutzen und versicherte mir sofort, daß er eine höchst ehrenwerte Kusine aufgefordert hatte, zu ihm zu ziehen und mir Gesellschaft zu leisten. »Du siehst also, der Anstand wird gewahrt, Kate«, sagte er mit einem Lächeln.
Es war dunkel, als wir das fünf Meilen südwestlich von Reading gelegene Charlwood Court erreichten, in dessen frostigem Salon Kusine Louisa uns erwartete. Sie erschien mir als furchtsames Mäuschen von Frau, und wenn in meinem Herzen neben Gram noch Platz für ein Gefühl gewesen wäre, hätte ich Mitleid empfunden.
Sie erschrak bei meinem Anblick, worauf Charlwood leise sagte: »Ja, sie ist das Ebenbild ihres Vaters.«
Ich glaubte, einen sonderbaren Ton aus seiner Stimme herauszuhören, und sah ihn erstaunt an. Er lächelte. Sein Mund lächelte sehr oft, doch war mir schon aufgefallen, daß seine Augen sich nie zu verändern schienen. »Louisa wird dich auf dein Zimmer führen, Kate«, sagte er. »Willkommen auf Charlwood.«
Bis zum heutigen Tag ist mir nur undeutlich in Erinnerung geblieben, wie es auf Charlwood tatsächlich aussah. Ich weiß nur, daß die Räume groß waren und daß alle mit Stille erfüllt schienen, als wären sie seit langem unbewohnt. Schwere dunkle Samtportieren an den Fenstern schlossen die Sonne aus. Auch Kaminfeuer und Kerzenlicht vermochten nicht, die Räume wärmer und anheimelnder zu machen. In den Nächten lag ich lange wach und lauschte der gruftartigen Stille des Hauses. Daß in diesem Gemäuer jemals jemand glücklich gewesen sein sollte, war schwer zu glauben. Noch schwerer freilich konnte ich mir meine Mutter hier als kleines Mädchen vorstellen. Schlief ich endlich ein, dann träumte ich von meinem Vater.
So lebte ich ein halbes Jahr, während mein Herz so erstarrt war wie der Boden vor meinem Fenster. Da mein Onkel das ungebundene Nomadenleben eines aristokratischen Junggesellen führte und seine Zeit zwischen London und den Häusern seiner Freunde teilte, bekam ich ihn nur selten zu sehen. Der einzige Mensch, der mich in Anspruch hätte nehmen können, war Kusine Louisa, die allerdings in ihrem ganzen Leben nie jemanden ernsthaft in Anspruch genommen hatte. Bei Tisch machten wir höflich Konversation, ansonsten aber respektierte sie meinen Kummer und überließ mich meiner Einsamkeit.
Langsam verstrich der Winter. Die tote Erde taute auf und ließ Gras und Blumen sprießen. Narzissen blühten, es duftete nach Flieder. Im Haus stand noch immer leblose Luft, aber draußen war die Welt zum Leben erwacht. Unwillig erwachte auch ich aus meinem langen Winterschlaf.
Anfang Mai kam mein Onkel nach Hause und eröffnete mir, daß er mich nach London mitzunehmen gedächte.
»London?« Wir saßen im düsteren dunkelgetäfelten Speisezimmer, und ich starrte ihn über die Kerzen hinweg erstaunt an. »Warum?«
»Warum nicht?« gab er leichthin zurück. »Für dich kann es nicht gut sein, wenn du hier auf dem Land vergraben lebst. Du siehst schon ganz blaß aus, meine Liebe.« Er steckte ein kleines Stückchen Kartoffel in den Mund und kaute langsam. »Den ganzen Winter über hast du deinen Vater betrauert. Jetzt wird es Zeit, daß du dein eigenes Leben wieder aufnimmst.«
Schon seit einigen Wochen gingen mir ähnliche Gedanken durch den Kopf. Warum regte sich bei mir Ablehnung, als ich nun das gleiche aus seinem Mund hörte?
Ich schob das Essen auf dem Teller hin und her und machte ein finsteres Gesicht. »Was soll ich in London machen?«
»Nun, was jedes normale junge Mädchen macht. Auf Gesellschaften gehen. Nach einem Ehemann Ausschau halten.« Ich schaute jäh auf. Er sah mich an. Seine Augen blickten direkt und klar. »Ausgeschlossen wäre es nicht, Kate«, sagte er. »Dein Vater war zwar ein Niemand, aber deine Mutter war die Tochter eines Viscounts.«
Sofort fühlte ich mich zur Verteidigung meines Vaters aufgerufen. »Papa war kein Niemand! Die Fitzgeralds sind eine uralte irische Familie.«
Er zog die Schultern in die Höhe. »Das mag ja sein, meine Liebe, aber die Fitzgeralds haben sich schon vor langer Zeit von deinem Vater losgesagt. Daniel war nichts weiter als ein Spieler und Pferdehändler. Er hat meine arme Schwester von einer Rennbahn zur anderen geschleppt, von einem schäbigen Quartier zum anderen. Kein Wunder, daß sie vor ihrem fünfunddreißigsten Jahr sterben mußte.«
Ich war außer mir. Oberflächlich gesehen mochte er recht haben, doch hatte er das Wichtigste übersehen. Mit geballten Fäusten sagte ich ganz ruhig: »Hunger mußten wir nie leiden. Papa war ein guter Mensch, und er liebte meine Mutter über alles.«
»Daniel war nichts weiter als ein gutaussehender irischer Charmeur, der meine Schwester verführte, so daß sie gezwungen war, ihn zu heiraten«, sagte Charlwood brutal.
Ich stand auf. Der Diener, der mir eben Limonade nachgießen wollte, erstarrte. Kusine Louisa gab bestürzte Geräusche von sich. »Ich gedenke nicht, dazusitzen und mir anzuhören, wie mein Vater verleumdet wird.«
»Setz dich.« Charlwood sagte es zähneknirschend. Sein Antlitz war weiß, seine Augen glitzerten beunruhigend, so daß er furchteinflößend aussah. Da ich aber mein Leben lang mit Pferden zu tun gehabt hatte, wußte ich, daß man den Kampf von vornherein verloren hat, wenn man sich Angst anmerken läßt. Dasselbe Prinzip gilt für Männer.
In einem Ton, der ebenso frostig war wie der seine, antwortete ich: »Ich werde mich setzen, wenn du aufhörst, meinen Vater zu verleumden.« Ich besaß genug Verstand, um von ihm nicht auch noch eine Entschuldigung zu fordern.
Es herrschte Schweigen, als wir einander über den Tisch hinweg anstarrten.
»Setz dich doch, Kate«, sagte Kusine Louisa voller Nervosität. Ich sah sie an. Die Ärmste war zu Tode erschrocken.
Zögernd setzte ich mich. Langsam griff ich zu meiner Gabel. Nach einer Weile schenkte mir der Diener vorsichtig Limonade nach. Ein anderer schenkte meinem Onkel Wein nach.
»Willst du, daß ich dich nach London begleite, Charlwood?« fragte Kusine Louisa in das angespannte Schweigen hinein.
»Aber sicher.«
Ich führte ein Stück Hammelfleisch zum Mund und sagte nichts. Ich hatte meine eigenen Gründe, nach London gehen zu wollen. Unter gesenkten Wimpern beobachtete ich die Miene meines Onkels und gestattete mir nun die bewußte Erkenntnis dessen, was ich tief in meinem Herzen ohnehin schon wußte. Ich mochte ihn nicht.
»Kate wird neue Kleider brauchen, wenn sie in Gesellschaft gehen soll«, sagte Kusine Louisa. »Ihre Garderobe ist… ein wenig karg.«
»Louisa, du kannst mit ihr Einkäufe machen und mir die Rechnungen schicken«, sagte mein Onkel, der offenbar seine gute Laune wiedergefunden hatte.
Ich kniff die Lippen zusammen. Ich wollte sein Geld nicht.
Kusine Louisa lächelte mir zu. »Meine Liebe, du wirst das schönste Mädchen von ganz London sein«, sagte sie.
Ich erwiderte ihr Lächeln in Anerkennung ihres tapferen Versuchs, meine Lebensgeister wieder zu heben. Daß mir ihr Kompliment zu Kopf steigen würde, war nicht zu befürchten. Ich mochte Papas Gesichtsschnitt geerbt haben, doch war ich irischer Herkunft und dazu auch noch arm, so daß meine Chancen auf eine gute Partie gelinde gesagt dürftig waren. Aber ich hatte nicht die Absicht, den Rest meines Lebens am Geldbeutel meines Onkels zu hängen, und um selbständig zu sein, brauchte ich eine Möglichkeit, mir meinen Unterhalt zu verdienen. Vielleicht, dachte ich mit dem unheilbaren Optimismus der Jugend, vielleicht wird sich in London etwas ergeben.
***
Am nächsten Morgen stand ich zeitig auf, um auszureiten. Seit dem Ende der Jagdsaison im Januar waren die Jagdpferde meines Onkels auf Charlwood, und ich hatte sie geritten, wenn das Wetter es gestattete. Die Sonne ging eben auf, als ich aus meinem Zimmer kommend den dunklen Gang mit den vielen Gemälden entlangging, an dem alle großen Schlafräume lagen. Als ich ein Mädchen aus dem Zimmer meines Onkels kommen sah, stutzte ich.
Es war Rose, eines der Hausmädchen. Sie war vollkommen angekleidet, doch ihr schönes, honigblondes Haar hing ihr lose und wirr um die Schultern. Sie hielt inne, als sie mich sah, und drückte sich verlegen an die Wand. Als ich sie verdutzt anstarrte, bemerkte ich einen häßlichen roten Abdruck auf ihrer linken Wange. Auch ihre Augen waren gerötet, und man sah ihr an, daß sie geweint hatte.
»Rose, ist etwas?« fragte ich.
»Nein, Miß Fitzgerald, es ist nichts«, antwortete sie im Flüsterton.
Ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Mein Blick wanderte von ihrem gezeichneten Gesicht zur Tür meines Onkels.
»Ich habe Lord Charlwood seinen Morgentee gebracht.«
Wie gesagt, die Sonne war kaum aufgegangen. »Ich verstehe«, sagte ich in ausdruckslosem Ton.
Sie bewegte sich Zoll für Zoll den Gang entlang, den Rücken noch immer an die Wand drückend. »Ich gehe jetzt wohl lieber«, sagte sie.
Ich nickte und ließ sie gehen, weil ich ihr ansah, daß es ihr so am liebsten war.
Während ich im Sattel saß, mußte ich die ganze Zeit an Rose denken. Offensichtlich war sie ins Bett meines Onkels befohlen worden, und ebenso offensichtlich war es für sie kein angenehmes Erlebnis gewesen. Immer wenn ich an den roten Abdruck auf ihrer Wange dachte, krampfte sich mir der Magen zusammen. Am schlimmsten aber war das Wissen, daß ich nichts tun konnte, um ihr zu helfen, den Fängen meines Onkels zu entkommen.
Ihnen zu entkommen, würde für mich selbst ein schwieriges Unterfangen werden.
***
Die Londoner Luft wirkte auf Kusine Louisa wie ein belebendes Tonikum. Sie schleppte mich in der Bond Street von einem Laden zum anderen und schüttelte mit jedem Kauf Jahre ab. Ich war bestürzt, wie viel Geld sie ausgab, sie aber beruhigte mich immer wieder mit der Versicherung, daß Charlwood nichts dagegen hätte.
»Louisa, wie alt bist du?« fragte ich, als wir nach einer besonders kostspieligen Sitzung in Fanchons Modesalon bei Günther auf ein Eis einkehrten.
»Einundvierzig«, antwortete sie.
Und ich hatte geglaubt, sie sei über sechzig!
»Aber du bist ja jünger als mein Vater!« platzte ich erstaunt heraus. Als mein Vater mit sechsundvierzig ums Leben gekommen war, hatte sein dichtes schwarzes Haar nicht eine einzige graue Strähne aufgewiesen, während Louisas weiche braune Locken kräftig mit Grau durchsetzt waren.
Die Erinnerung entlockte ihr ein Lächeln. »Daniel ist wohl nicht gealtert?«
»Du hast Papa gekannt?«
»In dem Sommer, als er deiner Mutter begegnete, war ich auf Charlwood.«
Diese Geschichte kannte ich sehr gut. Papa hatte Mamas Vater ein Pferd geliefert und sich nach einem Blick auf Mama zum Bleiben entschlossen, um Großvaters andere Pferde zu trainieren. Den ganzen Sommer über hatten sie sich heimlich getroffen, und im September war sie mit ihm nach Schottland durchgebrannt, wo sie sich trauen ließen.
Louisas Lächeln war erinnerungsschwer. »Kate, dein Vater hat fabelhaft ausgesehen. Lizzie hatte sich Hals über Kopf in ihn verliebt. In der Nacht, als sie durchbrannten, half ich ihr beim Packen.«
Ich starrte sie sprachlos an. Daß Louisa meine Eltern kannte, hatte ich nicht geahnt.
Eine elegante Frau in mittleren Jahren, die an unserem Tisch vorbeiging, warf einen verächtlichen Blick auf meinen braunen pelzbesetzten Mantel, dem man sein Alter ansah. Ich erwiderte ihren Blick so hochmütig, daß sie erschrak. Alte Krähe, dachte ich.
»Ich habe mich oft gefragt, ob Lizzie glücklich geworden ist«, sagte Louisa nachdenklich.
»Ich glaube, daß sie sehr glücklich war«, erwiderte ich. »Papa war …« Ich suchte nach Worten, die geeignet waren, meinen Vater zu beschreiben. »Ach …« Die Welt um Papa war mir immer so lebensvoll erschienen, daß ich schließlich sagte: »Es stimmt, daß er ein Hasardeur war und wir manchmal kein Geld hatten. Aber …« Meine Stimme bebte, ich preßte die Lippen aufeinander.
Louisa ließ mir liebenswürdigerweise Zeit, mich zu sammeln, ehe sie sagte: »Kate, du bist ihm sehr ähnlich.« Ich schüttelte den Kopf. Gewiß, ich war Papa zwar äußerlich nachgeraten, aber vom Wesen her war ich ganz anders. Ich wechselte das Thema. »Wie schön, nicht mehr auf Charlwood sein zu müssen. Das Haus ist wie eine Gruft.« Louisa schauderte zusammen. »So war es immer schon. In meiner Jugend waren mir die Besuche dort ein Greuel.«
»War es auch so, als meine Mutter jung war?« fragte ich neugierig.
Louisa nickte und ließ dann den Blick über die besetzten Tische gleiten, als fürchte sie, jemand konnte mithören. »Dein Großvater…« Innehaltend starrte sie in ihr Zitroneneis.
»Ja?« drängte ich, als ich den Eindruck hatte, sie sei verstummt.
Schließlich sagte sie unumwunden: »Dein Großvater war ein harter Mensch.«
Ich sagte nichts darauf. Am anderen Ende des Raumes ließ ein kleiner Junge seinen Löffel fallen und verlangte lautstark Ersatz. Ein Kellner eilte herbei.
Da blickte Louisa wieder auf und sagte: »Ich bin sicher, daß Lizzie das Leben mit Daniel, mag es auch hart gewesen sein, jenem auf Charlwood bei weitem vorgezogen hat.«
Zwei junge Stutzer in eleganten blauen Jacketts starrten mich im Vorübergehen unverschämt an. Ohne ihnen Beachtung zu schenken, sagte ich zu Louisa: »Warum hast du dann eingewilligt, zu kommen und bei mir zu bleiben, wenn dir Charlwood so zuwider ist?«
Sie seufzte. »Meine Liebe, ich hatte keine andere Wahl.«
»Unsinn.« Ich war noch jung genug, um zu glauben, Erwachsene seien immer Herr ihrer Entscheidungen.
»Es ist kein Unsinn«, sagte Louisa traurig. »Du mußt wissen, daß ich bei der Familie meines Bruders lebe. Charlwood bot Henry viel Geld, falls er auf meine Dienste verzichtete und mir gestattete, Anstandsdame für dich zu spielen. Mein Bruder war einverstanden, und ich mußte gehen.«
»Deine Dienste?« fragte ich erstaunt. »Welche Dienste, Louisa?«
»Ich bin die Haushälterin meiner Schwägerin, auch wenn man mich nicht so nennt«, sagte Louisa. »Und da ich nicht zum Personal gehöre, aber von der Familie abhängig bin, kann man alle möglichen anderen Dinge von mir verlangen.«
Eine hohe Mädchenstimme rief an einem der Tische in unserer Nähe aus: »Ach, Mr. Wetmore, was für ein Witzbold Sie doch sind!«
»Was für andere Dinge?« fragte ich Louisa.
»Ach, ich erledige im Dorf Besorgungen, und wenn die Kinder krank sind, halte ich Wache an deren Bett. Diese Dinge.«
»Bezahlt man dich?«
In ihrem Lächeln lag Resignation. »Man gibt mir ein Zuhause.«
Ich legte meinen Löffel auf das weiße Tischtuch. Das Eis hatte plötzlich allen Geschmack für mich verloren. »Und warum läßt du dir diese Behandlung gefallen?«
»Ich habe weder einen Ehemann noch eigenes Geld«, sagte Louisa. »Und ich muß leben, Kate.«
»Und selbst Geld verdienen kannst du nicht?«
Louisa schüttelte den Kopf. »Einer mittellosen Dame steht nur der Beruf der Gouvernante offen, und das ist nicht das Leben, das ich anstrebe. Ich gelte wenigstens als Familienmitglied, auch wenn ich noch so schlecht behandelt werde. Glaube mir, Kate, das Leben einer Gouvernante ist viel ärger. Man gehört weder zum Personal noch zur Familie. Eine jämmerliche Existenz.«
Mir kam es lange nicht so jämmerlich vor wie das Leben, das sie mir eben geschildert hatte. Als Gouvernante bekam man für seine Arbeit wenigstens Geld! Ich zeichnete mit der Fingerspitze konzentrische Kreise auf das Tischtuch, während ich nachdenklich fragte: »Welche Empfehlungen braucht man, um Gouvernante zu werden?«
Meine Kusine gab keine Antwort, doch spürte ich ihren Blick auf mir. Ich schaute unschuldig auf.
»Kate, das solltest du erst gar nicht in Betracht ziehen«, sagte sie. »Dich würde kein Mensch einstellen.«
Ich war entrüstet. »Warum nicht?« wollte ich wissen. »Mama hat mich bis zu meinem zehnten Lebensjahr selbst unterrichtet. Und Papa hat mir immer bereitwillig Bücher gekauft, so daß ich allein viel lernen konnte.« Ich zog die Brauen in die Höhe und sah sie herablassend an. »Du kannst sicher sein, daß ich sehr wohl befähigt bin, kleine Kinder zu unterrichten.«
»Selbst wenn du eine Gelehrte wärest, würde es dir nichts nützen, meine Liebe«, sagte Louisa daraufhin unverblümt. »Du würdest keine Arbeit finden, da keine Frau, die ihre fünf Sinne beisammen hat, dich in die Nähe ihres Mannes oder ihrer Söhne ließe.«
»Unsinn.«
»Es ist die Wahrheit«, sagte Louisa, und es hörte sich sehr überzeugt an.
Ich entschloß mich, sie ins Vertrauen zu ziehen. »Louisa, es geht darum, daß ich nicht mehr nach Charlwood zurück möchte. Deshalb muß ich einen Weg finden, mich selbst zu versorgen.«
»Dann mußt du dir einen Ehemann suchen«, riet Louisa mir.
Ich spürte, wie mein Gesicht jenen Ausdruck annahm, den mein Vater immer als meine ›Maultiermiene‹ bezeichnet hatte. »Ich möchte aber keinen Mann«, gab ich zurück. Louisa lächelte mir wie einem Kind zu. »Meine Liebe, jede Frau möchte einen Ehemann.«
Nicht gewillt, diese Bemerkung mit einer Erwiderung zu würdigen, dachte ich an den Einkaufsbummel, den wir an diesem Morgen unternommen hatten, an die Dutzende teurer Modesalons und Hutläden, die die Bond Street säumten.
Ich hatte das bedrückende Gefühl, daß Louisa hinsichtlich meiner Chancen, Gouvernante zu werden, recht haben mochte, doch mußte es andere Möglichkeiten geben.
»In London gibt es unzählige Geschäfte«, sagte ich. »Könnte ich nicht in einem Arbeit bekommen?«
Louisa schien entsetzt. »Du glaubst doch nicht etwa, Charlwood würde zulassen, daß seine Nichte sich in London in einem Laden verdingt?«
»Ihm liegt nichts an mir«, sagte ich. »Er wird froh sein, mich loszuwerden.«
»Ihm liegt aber daran, wie man in der Gesellschaft von ihm reden würde, wenn seine Nichte bei einer Hutmacherin arbeitet!«
Darauf wußte ich eine Antwort. »Warum muß es denn jemand erfahren? Ich werde mir Arbeit in einem Laden suchen, dessen Kundschaft nicht zur Gesellschaft gehört.«
Louisa machte ein ernstes Gesicht. Inzwischen hatten wir beide unsere Eisportionen vergessen, die nun langsam in ihren Glasschüsselchen dahinschmolzen. »Du darfst den Schutz, den dir dein Onkel bietet, nicht aufgeben«, sagte sie. »Wenn du das tätest, Kate, wenn du versuchen solltest, in London allein zu leben, wäre es um deine Sicherheit geschehen.«
»Ich kann selbst auf mich aufpassen«, sagte ich.
»Binnen einer Woche würde man dich vergewaltigen«, sagte Louisa mit Schärfe. »London ist nicht das flache Land, Kate. Hier wimmelt es von arbeitsscheuen Elementen, die sich an einem alleinstehenden weiblichen Wesen skrupellos vergreifen würden.«
Ich biß mir auf die Lippen. »Ich werde mir einen Revolver zulegen«, sagte ich. »Schießen kann ich schon.« Ich hatte mich nie leicht entmutigen lassen.
Louisa sandte einen Blick zum Himmel. »Nicht zu fassen, Kate! So überleg doch! Wenn dich jemand aus der Dunkelheit heraus überfällt, hast du keine Zeit zu schießen.«
Ich war kein dummes junges Ding ohne Ahnung von der Welt. Ich wußte noch, wie oft mein Vater zwischen mich und irgend jemanden getreten war, der mich mit heißen und begehrlichen Blicken gemustert hatte. Louisa hatte recht. Leider. Ich aß ein wenig von meinem verflüssigten Eis und zermarterte mein Hirn. Plötzlich explodierte in meinem Kopf eine Idee mit der Helligkeit eines Feuerwerks am Nachthimmel.
»Ich könnte mich als Junge verkleiden!« sagte ich. »Wenn ich mit Pferden zu tun hatte, trug ich immer Hosen. Und wenn ich auch noch mein Haar abschneiden ließe …» Ich lächelte triumphierend. »Louisa, was für eine glänzende Idee! Niemand würde einen Jungen vergewaltigen!«
»Du willst dich wohl über mich lustig machen«, sagte meine Kusine darauf.
»Aber gar nicht. Louisa, sei versichert, daß ich in jedem Stall, bei dem ich mich bewerbe, Arbeit bekomme. Mit Pferden kenne ich mich wirklich gut aus.« Nur keine falsche Bescheidenheit, dachte ich. Je länger ich darüber nachdachte, desto besser gefiel mir diese Idee. »Denke doch an Rosalind in Wie es Euch gefällt«, rief ich begeistert aus. »Sie hat alle hinters Licht geführt. Warum sollte ich es nicht schaffen?«
Louisa sah mich mit einer Mischung aus Bewunderung und Entsetzen an. »Selbst wenn dein Pferdeverstand geniale Ausmaße hätte, würde das wenig zählen.« Ihre noch immer geröteten Wangen ließen sie fast hübsch aussehen. »Egal welche Stellung du vielleicht fändest, Kate, man würde dir niemals den Luxus einer eigenen Unterkunft zubilligen. Du müßtest dein Quartier mit anderen teilen, und wenn du einen Raum mit Männern bewohnst, kannst du dein Geschlecht unmöglich geheimhalten.«
Ich fürchte die Stirn. Es wollte mir nicht gefallen, wie sie alle meine schönen Pläne eiskalt zunichte machte. »Louisa, du bist so pessimistisch!« rief ich aus.
»Ich bin realistisch, meine Liebe«, sagte sie. Das hübsche Rosa verflüchtigte sich aus ihren Wangen. »Suche dir einen Ehemann, Kate. Es ist die einzige Lösung.«
2. Kapitel
Meine Einführung in die Londoner Gesellschaft, den bon ton, wie sie von der Presse genannt wurde, war kaum als überwältigender Erfolg zu bezeichnen. Meinem Onkel und Louisa zuliebe wurde ich zu einigen größeren Bällen geladen, doch war klar, daß man mich nie für würdig befinden würde, mir Zutritt ins innerste Allerheiligste der englischen Aristokratie, nämlich Almacks Salons, zu gewähren.
Auf den Bällen, die ich besuchte, war meine Tanzkarte immer voll, und ich wurde auch zu vielen anderen geselligen Anlässen eingeladen: zu Redouten, Frühstücken, musikalischen Soireen und so fort, doch die jungen Männer, die mit mir plauderten und tanzten, waren zweifelsfrei mehr daran interessiert, mit mir zu flirten, als mir Heiratsanträge zu machen.
Als ehrlicher Mensch muß ich zugeben, daß ich enttäuscht war. Ich sehnte mich aus ganzem Herzen nach einem Zuhause, und so sehr ich Kusine Louisas Rat verabscheute, so wußte ich doch, daß sie recht hatte, als sie sagte, ich müßte erst einen Mann finden, wenn ich ein Heim finden wollte. Ich nehme an, daß dieses starke Verlangen nach Beständigkeit dem Zigeunerleben zuzuschreiben war, das ich in meiner Kindheit geführt hatte. Anscheinend wünscht man sich immer, was man nicht hat.
Da mein Onkel den größten Teil des Winters nicht auf Charlwood verlebt hatte, waren diese Wochen in London die erste Zeit, die ich länger in seiner Gesellschaft zubrachte, und er wurde mir nicht sympathischer. Im Gegenteil, je länger ich mit ihm zusammen war, desto mehr wuchs mein Unbehagen, obwohl ich mir immer wieder vorsagte, daß ich mich lächerlich machte, daß er der Bruder meiner Mutter war, der mich aufgenommen und viel Geld für mich aufgewendet hatte, und dergleichen mehr.
Aber seine Augen gefielen mir nicht. Oberflächlich gesehen wirkten sie überaus klar und direkt, erwiderte man ihren Blick jedoch, vermochte man ihn nicht zu durchschauen. In seinem trügerisch klaren Blick lag etwas, das mich an jemanden erinnerte, jedoch nicht an meine Mutter. Ich hatte das Gefühl, daß diese Ähnlichkeit Grund meiner Abneigung war, aber ich kam nicht dahinter, an wen er mich erinnerte – bis zu jenem Abend, an dem die zweite Tochter der Cottrells mit einem Ball ihr gesellschaftliches Debüt gab.
Ich weiß noch, daß ich im Ballsaal der Cottrells, vor einem üppigen Arrangement aus rosa und weißen Rosen stehend, darauf wartete, daß mir mein Partner ein Glas Punsch brachte. Mein Blick fiel über die Tanzfläche hinweg auf meinen Onkel und erhaschte ihn just in dem Moment, als seine Miene sich jäh veränderte. Es war nur ein momentaner Lapsus, dann trug er wieder seinen üblichen glasklaren Blick zur Schau. In jenem flüchtigen Moment aber fiel mir ein, an wen er mich erinnerte – an Sultan, das einzige Pferd, das mein Vater hatte töten lassen. Der Blick des Fuchswallachs hatte einen undurchschaubaren Schimmer besessen, den ich auch in den Augen meines Onkels sah. Sultan hatte versucht, mich zu töten.
»Das einzige Pferd, das ich kannte, das durch und durch schlecht war«, hatte mein Vater gesagt. »Ich könnte ihn einer gutgläubigen Seele verkaufen, die ihn seines Aussehens wegen nimmt, aber ich möchte mein Gewissen nicht mit dem Verkauf eines Bösewichts belasten.«
Ich blickte zur Tür, um zu sehen, was dieses momentane Aufflackern von Haß im Gesicht meines Onkels bewirkt hatte. Es war das erste Mal, daß ich Adrian sah.
Am oberen Ende der drei Stufen stehend, die in den Ballsaal hinunterführten, lauschte er mit geneigtem Kopf den Worten seiner Gastgeberin. Mrs. Cottrell sah neben ihm klein aus, da ich an diesem Abend jedoch schon neben ihr gestanden hatte, wußte ich freilich, daß sie größer als ich war.
»Hier ist Ihr Punsch, Miß Fitzgerald.« Mein Partner war wiedergekommen.
»Wer ist der Gentleman, der mit Mrs. Cottrell spricht?« fragte ich.
Mr. Putnam blickte über das Gedränge auf der Tanzfläche zu dem Mann auf der Treppe. »Das ist Greystone.« Sein Ton verriet unverkennbare Hochachtung. »Er hat vor einigen Monaten sein Offizierspatent aufgegeben, um nach England zurückzukehren. Es heißt, daß er ein Regierungsamt übernehmen wird. Im Foreign Office, wenn es nach Castlereagh geht.«
Diesen Namen kannte sogar ich. Major Adrian Edward St. John Woodrow, Earl of Greystone, Viscount Wraxall und Baron Wood of Lambourn war einer der größten Helden der Schlacht von Waterloo, die im letzten Jahr stattgefunden hatte. Der Duke of Wellington hatte ihn besonders ausgezeichnet, und das Parlament hatte ihm zusätzlich Lorbeeren gestreut. Nach Waterloo war er in Frankreich geblieben, um Wellington als Oberbefehlshaber der Alliierten Besatzungsmacht zu entlasten.
Die Musik war verstummt, und ich beobachtete ihn, als er sich einen Weg durch die Tanzenden bahnte. Sein Haar war so goldhell, daß es wie Mondschein schimmerte, als er unter der vergoldeten Decke mit den Kristallüstern dahinschritt. Die Leute machten ihm Platz, und ich sah, daß er da und dort mit Bekannten ein freundliches Wort wechselte, ohne im Schritt innezuhalten. Vor einem großen, schlanken Mädchen, von dem ich wußte, daß es Lady Mary Weston, die Tochter des Duke of Wareham war, blieb er stehen. Sie plauderten ein wenig, und als der nächste Tanz angesagt wurde, betraten sie gemeinsam die Tanzfläche.
Mein Onkel erschien an meiner Schulter und engagierte mich Mr. Putnam ab. Mein Widerstreben verbergend, folgte ich ihm auf die Tanzfläche. Er schob sich in die Reihe neben Greystone, und ich nahm neben Lady Mary Aufstellung, die mir lächelnd Platz machte. Wir hatten bei einem der letzten Bälle ein paar Minuten zusammen im Salon gesessen, und sie war sehr nett zu mir gewesen. Viele der jungen Damen, die ich bei diesen Anlässen kennenlernte, waren es nicht.
»Wie geht es Ihnen, Miß Fitzgerald?« fragte sie mit ihrer sanften, wohlklingenden Stimme. »Sie amüsieren sich doch hoffentlich?«
»Ja, sehr, Lady Mary«, erwiderte ich höflich.
Nachdem die Tanzpaare sich formiert hatten, setzte die Musik ein, und der Tanz begann. Es war eine Quadrille, einer der neuen, aus Frankreich importierten Tänze, den ich erst vor wenigen Wochen gelernt hatte, weshalb ich mich sehr konzentrieren mußte. Als die Quadrille zu Ende war, kamen mein Onkel und ich neben Lord Greystone und Lady Mary zu stehen.
»Greystone«, sagte mein Onkel mit seinem charmantesten Lächeln, »darf ich Sie meiner Nichte Miß Cathleen Fitzgerald vorstellen?«
Sein Haar war so blond, daß ich angenommen hatte, auch seine Augen wären hell, doch sie waren von auffallend dunklem Grau, und seine klassisch-vollkommenen Züge hätten sogar das Wohlgefallen des großen Michelangelo erregt. »Freut mich, Miß Fitzgerald«, sagte er mit tiefer, angenehmer Stimme. »Hoffentlich amüsieren Sie sich.«
»Ja, sehr«, gab ich zum ungezählten Mal an diesem Abend zur Antwort. Aus unmittelbarer Nähe konnte ich nun sehen, wie groß er wirklich war.
»Ich glaube, ich bin auf etwas gestoßen, das Sie interessieren könnte, Greystone«, sagte mein Onkel. »Sammeln Sie noch immer Waffen aus der Sachsenzeit?«
»Ja, ich interessiere mich immer noch für altsächsische Artefakte.« Der Ton des Earls war von kühler Höflichkeit. Ich gewann den deutlichen Eindruck, daß die Abneigung, die ich vorhin in der Miene meines Onkels gesehen hatte, voll erwidert wurde. »Was haben Sie entdeckt, Charlwood?«
»Ein Schwert aus dem Besitz König Alfreds, wie mir sein Besitzer erklärte.«
Mir fiel auf, daß alle Umstehenden so taten, als sähen sie uns nicht, obwohl sie uns anstarrten. »Ach, manch einer behauptet, sein Schwert hätte Alfred gehört«, erwiderte Greystone.
»Nun, dieser Bursche war sehr überzeugend.« Mein Onkel strich eine eingebildete Falte am Ärmel seines schwarzen Jacketts glatt. »Das Schwert soll sich seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie befinden.« Er schaute auf, »Er kann es dokumentieren.«
Wider Willen regte sich bei Greystone Interesse. »Nun, dann könnte sich ja ein Blick darauf lohnen.«
»Ich kann Sie morgen aufsuchen, damit wir eine Besichtigung verabreden können.«
Es trat eine Pause ein, ehe Greystone erwiderte: »Ich werde am Morgen zu Hause sein.« Mein Onkel nickte, und das Orchester stimmte die ersten Takte eines Walzers an.
»Darf ich Sie um diesen Tanz bitten, Lady Mary?« fragte mein Onkel prompt.
Wie um Rat suchend blickte sie Greystone an, dessen Miene undurchdringlich blieb. Dann lächelte sie meinem Onkel freundlich zu und ließ sich von ihm auf die Tanzfläche führen. Greystone blieb mit mir allein zurück.
Mit vollendeter Höflichkeit sagte er: »Darf ich Sie um diesen Walzer bitten, Miß Fitzgerald?«
»Hm, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig«, sagte ich muffig. »Wenn Sie mich hier stehenlassen, machen Sie sich einer groben Unhöflichkeit schuldig.«
Um seine Lippen zuckte es. »Das stimmt«, pflichtete er mir bei. »Deshalb bitte ich Sie, zur Rettung meines Rufes mit mir zu tanzen.«
»Aber plaudern dürfen wir dabei nicht«, warnte ich ihn. »Ich tanze erst seit ein paar Wochen Walzer und muß noch sehr auf meine Schritte achten.«
»Ich werde absolutes Schweigen bewahren«, versprach er. Und damit betrat ich mit ihm die Tanzfläche, und er legte seine Arme um mich.
Als der Walzer nach dem Wiener Kongreß in England in Mode kam, wurde er von vielen als unmoralisch verteufelt, aber erst bei dem Walzer mit Adrian verstand ich, warum. Wir hatten noch kein halbes Dutzend Schritte getanzt, als ich merkte, daß die Gefühle, die seine Körpernähe in mir weckte, viel zu aufregend waren, um anständig zu sein. Eine volle Runde um den Saal überzeugte mich, daß sie unmoralisch waren.
Seit ich in London war, hatte ich schon des öfteren Walzer getanzt, aber dergleichen war mir noch nicht widerfahren. Ich wußte nicht recht, was ich davon halten sollte. Er hielt mich mit korrekter Distanz und versuchte auch nicht, meine Taille zu fest zu umfassen, wie viele andere Herren es getan hatten. Und doch war ich mir seiner großen Hand und der Nähe seines Körpers äußerst bewußt.
Es war ein enervierendes Erlebnis, und ich war heilfroh, daß ich nicht auch noch mit ihm plaudern mußte! Als der Walzer zu Ende war, kam mein Onkel, um mich zu holen, und geleitete mich von der Tanzfläche.
***
»Du hast heute ganz reizend ausgesehen, Kate«, sagte mein Onkel, als wir in seiner Equipage durch die Straßen Londons fuhren. »Dieser Meinung waren sicher auch die anwesenden jungen Männer – du hast keinen einzigen Tanz ausgelassen. Sogar Greystone hat mit dir getanzt. Ich bin beeindruckt.«
Sein seidenweicher Ton ließ mich bis ins Innerste verkrampfen.
»Lord Greystone wollte nur höflich sein«, erwiderte ich, um einen leichten Ton bemüht. »Schließlich hast du ihm keine andere Wahl gelassen, Onkel Martin.«
»Er machte nicht den Eindruck eines Mannes, der unter Zwang handelte«, sagte mein Onkel, und sein Ton war noch glatter als vorhin.
Kusine Louisa ließ sich aus dem Dunkel des Sitzes gegenüber vernehmen: »Es ist ein offenes Geheimnis, daß Lord Greystone in Kürze um die Hand Lady Marys anhalten wird.«
Aus irgendeinem Grund schien diese Bemerkung meinen Onkel sehr zu amüsieren, da er laut auflachte.
Das Geräusch beschleunigte meinen Herzschlag höchst unangenehm, und zum ersten Mal gestand ich mir ein, daß ich Angst hatte.
Es war kein Gefühl, mit dem ich allzu vertraut war, daher behagte es mir ganz und gar nicht.
Sei nicht albern, schalt ich mich. Auch wenn du Charlwood nicht ausstehen kannst, du hast von ihm nichts zu befürchten.
Mein Herzschlag beruhigte sich nicht. Meine Magenmuskeln entspannten sich nicht. Mein ganzes Ich schreckte vor dem Mann zurück, der so dicht neben mir in der Finsternis saß. Als er seine Hand ausstreckte und sie auf meine legte, zuckte ich zusammen.
»Habe ich dich erschreckt, Kate?« fragte er. Er drehte meine Hand um, so daß sie mit der Handfläche nach oben auf meinem Schoß lag.
Er stieß mich ab. Er war wie einer aus dem Feenvolk, das ich aus den Geschichten meines Vaters kannte – schön anzusehen, aber todbringend, wenn man ihnen Vertrauen schenkte. Seine Finger glitten in einer intimen Liebkosung über meine offene Handfläche.
Als ich ihm meine Hand entzog, spürte ich, daß er in der Dunkelheit lächelte. Ich muß unbedingt fort von ihm, dachte ich. Ich muß fort.
Mr. Putnam, einer der jungen Männer, mit denen ich auf dem Ball getanzt hatte, traf am Nachmittag des nächsten Tages im Haus meines Onkels am Berkeley Square ein, um mich zu einer Ausfahrt in den Hyde Park abzuholen. Fünf Uhr war die magische Stunde, in der die Londoner Gesellschaft sich im Licht des Tages präsentierte, um lustwandelnd und kutschierend zu sehen und gesehen zu werden.
Nachdem er mir auf den hohen Sitz seines Phaetons geholfen hatte, genügte ein Blick meinerseits, um sein Gespann, zwei gutproportionierte und gepflegte Graue, einzuschätzen, worauf mein Interesse an dem jungen Mann merklich stieg. Er sah zwar aus wie ein Kaninchen, doch jemand, der Pferde wie diese sein eigen nannte, mußte verborgene Tiefen besitzen.
»Mir gefallen Ihre Pferde, Mr. Putnam«, sagte ich.
Er lächelte. »Ich habe sie erst seit einem Monat«, vertraute er mir an. »Hab’ sie von Ladrington, der seinen Stall verkaufen mußte, nachdem er bei Watiers zu hoch gespielt hatte.«
Für den Rest der Fahrt zum Park bildeten Pferde unser Gesprächsthema. Am späten Nachmittag waren die Straßen Londons mit Pferden und Gefährten aller Art überfüllt, doch Mr. Putnam verstand es, die Zügel mit großem Geschick zu führen, und meine Meinung von ihm stieg wieder um etliches. Am Park angekommen, reihten wir uns in die endlose Prozession eleganter Kutschen ein.
Die Fahrzeugparade, die sich auf dem breiten, den See säumenden Weg fortbewegte, war in der Tat höchst eindrucksvoll. Man sah vornehm ausgestattete Kutschen alten Stils mit modisch gekleideten Damen in Begleitung prächtig livrierter Lakaien. Daneben gab es Phaetons, hochsitzig oder niedrig, die von Gentlemen wie Mr. Putnam gelenkt wurden; Landauer, Kabrioletts und zweirädrige Gefährte, Vollblüter, geritten von Damen in elegantem Reitkleid, von Herren in hohen Stiefeln, Lederbreeches und Jacketts aus edlem Kaschmir.
Hyde Park um fünf, während der Saison, war der Traum eines jeden Pferdenarren, und Mr. Putnam und ich begutachteten jedes einzelne Tier, das an uns vorüberparadierte. Ich unterhielt mich glänzend und war ganz in unser Gespräch vertieft, als plötzlich ein Phaeton neben uns die Fahrt verlangsamte.
»Putnam!« rief eine befehlsgewohnte Stimme. »Halten Sie bitte einen Moment an.«
Mr. Putnam zügelte sein Gespann. Der Phaeton hinter uns mußte weit ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. »Lord Stade«, äußerte mein Begleiter verblüfft, und ich kniff die Augen zusammen und starrte den Mann an, um dessentwillen mein Vater jenen verhängnisvollen letzten Besuch in Newmarket gemacht hatte.
Der Marquis of Stade, ein breitschultriger, stierköpfiger Mann, musterte mich unverwandt mit seinen braunen Augen, während er sich mit Mr. Putnam über die bevorstehenden Rennen in Newmarket unterhielt. Mein Begleiter schwankte sichtlich zwischen Stolz, wegen der Aufmerksamkeit des Marquis, und Verlegenheit, weil dieser mich so dreist anstarrte.
»Und wer ist diese junge Person?« fragte Stade schließlich schroff und deutete auf mich.
Mr. Putnam bedachte mich mit einem verstörten Blick. »Diese Dame ist Miß Fitzgerald, Mylord«, sagte er. »Lord Charlwoods Nichte.«
Stade heuchelte großes Erstaunen. »Sie sind also Daniel Fitzgeralds Mädchen?«
»Ja«, sagte ich, seinen Blick unbeirrt erwidernd. »Das bin ich.«
»Tja, wenn ich Sie so ansehe, kann ich die Ähnlichkeit erkennen.« Er hatte die letzten fünf Minuten nichts anderes getan, als mich zu betrachten. Stade wandte sich meinem Begleiter zu und sagte abfällig: »Der Vater dieses jungen Dings war nicht mehr als ein irischer Roßhändler, Putnam. Lassen Sie sich ja nicht zu der Ansicht verleiten, sie hätte auf dem Heiratsmarkt auch nur den geringsten Wert.«
Mr. Putnam, der vor Verlegenheit nicht aus noch ein wußte, zwinkerte wie ein verängstigter Hase. Als ich wieder Stades Blick auf mir spürte, sagte ich ganz ruhig zu meinem verwirrten Begleiter: »Mr. Putnam, was mich angeht, so können Sie jetzt weiterfahren.« Sofort hob er die Zügel, und die Grauen zogen mit einem Ruck an. Als ich Stades hartes, unangenehmes Lachen hörte, ballte ich die Hände in meinen Schoß zu Fäusten.
»Miß Fitzgerald, es tut mir ja so leid«, stieß Mr. Putnam hervor. »Ich hätte gar nicht gedacht, daß Stade weiß, wer ich bin!«
Eine interessante Eröffnung. Der Marquis hatte also meinetwegen angehalten.
»Sein Stall macht sich neuerdings sehr gut«, wagte Mr. Putnam nach ein paar Augenblicken eine neue Bemerkung. »Vor zwei Jahren hat er die Guineas gewonnen, und der Dreijährige, den er in dieser Saison laufen läßt, sieht aus, als wäre er wieder der sichere Sieger. Sein Zuchthengst entpuppt sich als erstaunlicher Erfolg.«
»Sie meinen Alcazar?« fragte ich.
»Das ist er.« Die Sonne ließ einen der Messingknöpfe an Mr. Putnams blauem Jackett aufblitzen, und ich zwinkerte, weil ich geblendet wurde. »Ein Pferd, das selbst in den Rennen nur höchst mittelmäßig lief, aber als Vererber ein echter Trumpf ist.«
»Ziemlich ungewöhnlich, meinen Sie nicht? Ich weiß noch, wie überrascht mein Vater war, als er erfuhr, daß Alcazar Vater des Pferdes ist, mit dem Stade die Guineas gewonnen hat.«
»Alle waren erstaunt«, erwiderte Mr. Putnam, »aber Alcazar ist kein Eintagswunder. Die Pferde, die Stade letztes Jahr ins Rennen schickte, waren sehr gut, und in diesem Jahr sieht es nicht anders aus.«
»Schicken Sie auch Pferde ins Rennen, Mr. Putnam?« erkundigte ich mich, und er zeigte sich den Rest des Nachmittags überglücklich, mir seine Pläne zum Aufbau seines eigenen Rennstalles erläutern zu dürfen.
***
Am nächsten Tag teilte mir mein Onkel mit, daß er sich mit Greystone verabredet hätte, das angeblich aus dem Besitz König Alfreds stammende Schwert in einem Dorf bei Winchester zu besichtigen. Ich dachte nicht mehr an diesen Plan bis zu dem Moment, als mein Onkel mir eröffnete, er hätte von einem zweiten Interessenten erfahren und er müsse vorausfahren, um den Besitzer daran zu hindern, es zu verkaufen, ehe nicht Lord Greystone Gelegenheit gehabt hätte, ihm ein Angebot zu machen.
»Kate, du mußt Greystone begleiten«, sagte mein Onkel. »Ich hinterlasse dir die Wegbeschreibung, und wir treffen uns bei Squire Reston. Wenn ich bis zum morgigen Nachmittag warte, wird das Schwert womöglich verkauft.«
Da mir nicht klar war, warum mein Onkel so drängte, protestierte ich. »Ein paar Stunden können doch nicht so viel ausmachen, Onkel Martin.«
»Kate, ich habe gerade gesagt, daß es etwas ausmacht. Der Squire hat mir eben Nachricht gesandt, daß er einen zweiten Käufer an der Hand hat.« Der Blick, mit dem er mich bedachte, war von entwaffnender Offenheit. »Ich habe einen speziellen Grund, mir zu wünschen, daß Greystone in meiner Schuld steht, und möchte unbedingt derjenige sein, der das Schwert für ihn auftreibt.«
Ich hegte tiefes Mißtrauen gegen diesen Blick. »Warum kann ich ihm dann nicht einfach die Wegbeschreibung geben und ihn allein fahren lassen?« fragte ich ganz vernünftig.
»Weil ich wünsche, daß du mitkommst.« Wie konnte eine so sanfte Stimme nur so bedrohlich klingen? »Ein guter Freund von mir besitzt bei Winchester ein Landgut. Ich möchte, daß du seinen Sohn kennenlernst. Nimm ausreichend Garderobe mit, da wir dort einen Besuch machen, nachdem wir das Schwert besichtigt haben.«
Sein Plan sagte mir nicht besonders zu, aber ich wollte mit meinem Onkel nicht streiten. Mein eigenes feiges Verhalten gefiel mir zwar auch nicht, aber irgendwie konnte ich nichts dafür. Der Mann hatte etwas an sich, das mich nervös machte.
Der Earl of Greystone traf um elf Uhr am nächsten Morgen prompt ein, um meinen Onkel abzuholen. Er trug einen umfangreichen Kutschermantel, der ihn gewaltig aussehen ließ, und er war nicht erbaut, als er von der Änderung des Plans erfuhr.
»Ich fahre meinen Phaeton«, sagte er. »Er hat nur für zwei Personen Platz. Miß Cranbourne könnte Sie nicht begleiten.«
»Onkel Martin erwartet mich bei Squire Reston«, beruhigte ich ihn. Im Blick des Earls lag Skepsis, als er über mein Gesicht glitt. »Mir erschien der Plan auch zu übereilt, Mylord«, gestand ich, »aber mein Onkel war sehr in Sorge, daß der andere Interessent Ihnen zuvorkommen würde.«
Schweigen.
»Ich verspreche, daß ich Ihnen keine Last sein werde«, sagte ich und biß mir sofort auf die Lippen. Ich hatte den flehenden Ton aus meinen Worten selbst herausgehört.
Er blickte mich mit harten grauen Augen an, ehe er mit einem Achselzucken sein Einverständnis andeutete. »Na schön«, sagte er. Pause. »Ist Ihnen auch klar, daß es sich um eine Fahrt von fünf Stunden handelt, Miß Fitzgerald?«
»Mylord, ich bin kein schwächliches Treibhauspflänzchen«, sagte ich voller Würde. »Ich bin durchaus imstande, eine Fahrt von fünf Stunden bei schönem Wetter zu überstehen.«
Zum erstenmal entdeckte ich die Andeutung eines Lächelns auf seinem Gesicht. »Sehr gut.« Er warf einen bezeichnenden Blick zur Straße hin. »Mir wäre lieb, wenn ich meine Pferde nicht warten lassen müßte.«
»Nur einen Moment, ich hole Mantel und Hut«, versprach ich und lief aus dem Zimmer.
***
In Gesellschaft an sich nicht schüchtern, empfand ich in Greystones Gegenwart doch eine gewisse Befangenheit, als wir London in westlicher Richtung verließen. Nicht sein Aussehen war es, das mich so beeindruckte – schließlich hatte ich mein Leben lang Papa vor Augen gehabt –, sondern sein Ruf als Kriegsheld bei Waterloo. Drei Pferde waren unter ihm weggeschossen worden, und doch hatte er, trotz eigener Verwundung, eine siegreiche Kavallerieattacke angeführt, ein Husarenstück, das noch monatelang in aller Munde war.
Aber an einem so schönen Maimorgen fiel es einem schwer, an Krieg zu denken, und als wir den Stadtverkehr hinter uns gelassen hatten, war auch mein ungewöhnlicher Anfall von Einsilbigkeit verflogen. Schon längst hatte ich festgestellt, daß man mit Menschen am leichtesten ins Gespräch kommt, wenn man mit ihnen über ihre Neigungen und Vorlieben plaudert, und deshalb fragte ich ihn, woher sein Interesse an König Alfred stamme.
Seine Antwort kam bereitwillig. »Mein größter Landsitz liegt nahe den Berkshire Downs – Alfreds ureigenem Land – und deshalb interessierte ich mich schon als Junge für ihn. Meine Mutter hat in mir die Sammelleidenschaft geweckt, da sie selbst großes Interesse für unser sächsisches Erbe hatte.«
Ich selbst wußte sehr wenig von König Alfred und stellte ihm daher unzählige Fragen, die er alle gern beantwortete. Es war einfach herrlich, in der Frühlingssonne über Land zu fahren, und ich nahm aller Konvention trotzend meinen Hut ab, um die Sonnenwärme auf meinem Gesicht zu spüren. Die Straße, auf der wir dahinrollten, wurde von ausgedehnten Getreidefeldern gesäumt, und ich sah mit Entzücken, wie die grünen Weizenhalme sich sanft in der leisen Brise wiegten. Der Grasstreifen am Straßenrand war mit dem Blau und Gelb von Fingerhut, Ehrenpreis und Schlüsselblumen gesprenkelt. Ich war froh, daß ich Greystone überredet hatte, mich mitzunehmen.
Nachdem wir das Thema König Alfred erledigt hatten, fragte ich ihn, wie Frankreich sich von den Kriegsfolgen erholte.
Während er sprach, atmete ich die frische Luft tief ein und registrierte genau, wie die Sonne auf sein Haar fiel. An meinen Onkel verschwendete ich keinen Gedanken mehr.
Dann sagte er: »Nun sind Sie an der Reihe, mir alles über sich zu erzählen, Miß Fitzgerald. Von verschiedener Seite habe ich gehört, daß Ihr Vater als Pferdekenner nicht seinesgleichen hatte. Stimmt das?«
Ich war entzückt angesichts der Gelegenheit, über Papa zu sprechen. Greystone war ein so aufmerksamer Zuhörer, daß ich noch redete, als wir an einer Poststation Rast machten, um den Pferden eine Pause zu gönnen. Und ich redete noch immer, als er einen Privatraum für uns mietete, in dem wir einen Imbiß zu uns nehmen konnten. Bei kaltem Fleisch und Käse ertappte ich mich, wie ich ihm die Umstände von Papas Tod schilderte.
»Wie sonderbar, daß er sagte ›Hätte nicht gedacht, er würde argwöhnen, daß ich wußte‹. Ich denke sehr oft daran, Mylord, aber ich kann mir keinen Reim darauf machen. Wen könnte er damit gemeint haben?«
»Vielleicht hat er nur daherphantasiert«, meinte Greystone in erstaunlich leisem Ton. »Ich habe das bei Sterbenden des öfteren erlebt, Miß Fitzgerald.«
Ich hielt es nicht für Phantasien, doch verfolgte ich diesen Punkt nicht weiter. Ich wußte ohnehin nicht, wie es gekommen war, daß ich mit diesem Mann über Papas letzte Worte sprach. Noch nie zuvor hatte ich sie jemandem gegenüber erwähnt.
Nach dem Essen fuhren wir weiter, in südlicher Richtung, nach Hampshire. Eine Stunde vor dem Ziel, als wir gemächlich auf einer verlassenen Landstraße, kaum mehr als ein Feldweg, dahinfuhren, geriet die Kutsche plötzlich heftig ins Schwanken und kippte seitlich um. Es war meine Seite, auf die sie fiel, und ich wurde zum Glück herausgeschleudert.
Bei meiner unsanften und abrupten Landung im Straßengraben scheuchte ich einen Fuchs auf, der friedlich zusammengerollt geschlummert hatte. Der Fuchs huschte davon, und ich lag einen Augenblick reglos da, bis ich wieder zu Atem gekommen war. Dann rappelte ich mich langsam auf. Da meine zahlreichen Stürze vom Pferd mich das richtige Fallen gelehrt hatten, blieb ich bis auf ein paar leichte Prellungen unverletzt. Als ich den Schmutz aus dem neuen blauen Mantel schüttelte, hörte ich, wie Greystone meinen Namen rief.
»Mir ist nichts geschehen!« rief ich zurück. Meinen hoffnungslos zerdrückten Strohhut seinem Schicksal überlassend, kletterte ich mit hochgerafften Röcken den steilen Hang des Straßengrabens hinauf. Als ich auf halber Höhe war, tauchte über mir Greystone auf und bückte sich, um mir zu helfen. Ich streckte die Hand aus und wurde das letzte Stück zur Straße mühelos hinaufgezogen.
»Sind Sie sicher, daß Ihnen nichts zugestoßen ist, Miß Fitzgerald?« fragte er ungehalten mit einem Blick auf meine zerrissene und beschmutzte Kleidung.
»Ja.« Ich strich mir Haarsträhnen, die sich gelöst hatten, aus dem Gesicht. »Was ist passiert?«
»Das Rad hat sich gelockert«, gab er verärgert zurück. »Wenn Ihnen wirklich nichts passiert ist, mache ich mich daran, das Pferdegeschirr zu entwirren. Die Pferde haben es doch tatsächlich fertiggebracht, Zügel und Zaumzeug heillos durcheinanderzubringen.«
Er hatte seine Füchse vor dem Durchgehen bewahren können, doch nun standen sie schnaubend und stampfend da und warfen unruhig die Köpfe hoch, so daß ich Greystone half, sie zu beruhigen. Wir legten ihnen die Lederhalfter an, die er bei sich hatte, und ich bot an, sie zu halten, während er versuchte, das Rad wieder festzumachen.
Er sah mich besorgt an. »Können Sie zwei Pferde halten?«
»Ja.« Ohne einen weiteren Kommentar abzuwarten, führte ich die Pferde zum Grasstreifen am Straßenrand. Kaum hatten sie das Gras erblickt, als sie die Köpfe senkten und sich ans Werk machten.
Auf der linken Straßenseite erstreckte sich ein Weizenfeld, zur rechten Weideland, auf dem eine Rinderherde graste. Falterschwärme flitzten im Gras hin und her, Bienen summten im Klee. Nirgends eine Menschenseele.
Zehn Minuten später erschien ein grimmig dreinschauender Greystone an meiner Seite. Er hatte sein Jackett abgelegt und die Hemdsärmel aufgerollt. Auf seinem nackten rechten Unterarm war eine Narbe zu sehen. Seine Schultern waren sehr breit. Auf seiner Stirn zeigte sich ein Anflug von Schweiß, sein Blick war finster. »Ein Achsbruch.«
»Ach du meine Güte.« Ich betrachtete die friedliche ländliche Szenerie, die uns umgab. Ein weißes Hasenschwänzchen flitzte in einem nahen Weißdornstrauch hin und her. Auf dieser Straße waren wir noch niemandem begegnet. »Sie können den Schaden nicht selbst beheben?«
»Ausgeschlossen. Wir brauchen eine neue Achse.«
Seine Miene wurde immer finsterer. »Nun«, sagte ich so aufgeräumt als möglich, »dann müssen wir eben ins nächste Dorf und den Schmied holen, damit er die Achse ersetzt.«
»Nach meiner Karte liegt das nächste Dorf acht Meilen weiter an dieser Straße.«
Ich sah die zwei Pferde an, sie grasten, als wären sie eine Woche lang nicht gefüttert worden. Ich verscheuchte eine Biene, die um mein Ohr summte. »Könnten wir nicht auf den Pferden ins Dorf reiten, Mylord?«
»Meines Wissen sind sie nie geritten worden. Angesichts der Tatsache, daß wir weder Sattel noch Zaumzeug haben, halte ich einen Versuch für nicht sehr klug.«
Ich kaute an meiner Unterlippe. »Sie haben recht.«
Er ließ den Blick über die bukolische Landschaft schweifen. »Ich kann Sie hier nicht allein lassen, Miß Fitzgerald.«
»Meine Füße sind in Ordnung, Mylord«, sagte ich spitz. Seine grimmige Miene ging mir allmählich auf die Nerven. »Jeder von uns kann ein Pferd führen.«
Er fuhr sich mit den Fingern durch sein wirres Haar und warf einen Blick zum Himmel. Wortlos reichte ich ihm eines der Leitseile. Er ergriff es, und, noch immer schweigend, machten wir uns auf den Weg.
Fast zwei Stunden vergingen, ehe wir erste Anzeichen dafür sahen, daß wir uns einem Dorf näherten. Eine geduckte Kirche ohne Turm tauchte zu unserer Rechten auf, ihr gegenüber ein kleiner umfriedeter Friedhof. Der Kirche am nächsten, hinter einem Obstgarten und einem Dickicht wuchernder Sträucher, ragten zwei Schornsteine zum Himmel.
»Kirche und Pfarrhaus«, murmelte Greystone. »Das Dorf muß direkt vor uns liegen.«
Ich hoffte es inständig. Meine Schuhe, nach modischen Gesichtspunkten und nicht nach Kriterien der Bequemlichkeit ausgesucht, waren keinesfalls das Schuhwerk, auf das meine Wahl gefallen wäre, hätte ich geahnt, daß mir ein Marsch über acht Meilen bevorstand.
Wenige Minuten darauf war das winzige Dörfchen Luster erreicht. Wir entdeckten bald, daß es hier nur ein einziges Wirtshaus gab, The Luster Arms, bestehend aus einem Schankraum und einer Schlafkammer darüber. Als wir dahergehinkt kamen, stand die Wirtin vor dem Haus, in die Betrachtung ihres einzigen Rosenstrauches versunken. Ihr eilig herbeigeholter Mann eröffnete uns, daß der einzige Schmied des Dorfes nicht zur Verfügung stünde, da er auswärts bei einem Bauern namens Blackwell Pferde beschlage.
»Als erstes müssen wir einen Platz für die Pferde finden«, sagte ich zu Greystone.
Er bedachte mich mit dem einzigen beifälligen Blick, den ich seit dem Unfall von ihm abbekommen hatte.
Der Wirt bot uns sofort an, die Pferde über Nacht in seinem eigenen Stall unterzubringen. Als nächstes eröffnete er uns, daß wir Glück hätten, da seine einzige Kammer frei sei.
»Ihr könnt über Nacht bleiben. Meine Frau wird das Bett frisch beziehen und ein köstliches Abendessen zubereiten. Morgen kann der Schmied die Achse reparieren.«