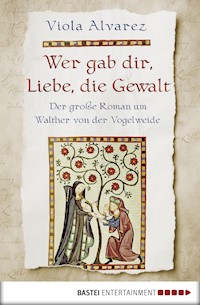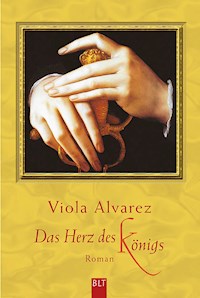
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man kennt ihn als den betrogenen Ehemann - in ihrem fulminanten Roman erzählt Viola Alvarez die Geschichte von Marke, dem legendären König von Cornwall, seiner Frau Isolde und deren Liebhaber Tristan, neu. Befallen von einer unerklärlichen Starre, lässt Marke sein Leben an sich vorüberziehen: seine harte Kindheit in der Bretagne, seine Zeit als mächtigster Herrscher der Britischen Inseln, seine Zwangsheirat mit der naiven Isolde und seine Begegnung mit Brangaene, der großen Liebe seines Lebens, der einzigen Frau, die ihn retten kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
VIOLA ALVAREZ
DAS HERZ DES
KÖNIGS
DAS SCHÖNE UND DAS
TRAURIGE LEBEN
VON MARKE HERRSCHER ZU TINTÂGEL
VON IHM SELBST ERZÄHLT
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
der bei Gustav Lübbe Verlag erschienenen Hardcoverausgabe
luebbe digital und Gustav Lübbe Verlag in der Verlagsgruppe Lübbe
Originalausgabe
© 2003 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG,
Bergisch Gladbach
Lektorat: Daniela Thiele
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
ISBN 978-3-8387-0029-8
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Walter Blank
In diesem Roman
werden bisweilen Motive
aus den mittelalterlichen Tristan-Romanen
Eilharts von Oberge
und Gottfrieds von Straßburg
verarbeitet.
ERSTER TEIL
DER WEGZURÜCK
CORNWALLS CHRONIK (Auszug)
... ez hat gar niemand gewuszt, was füer ein Leides den Küneg hat bevallen, daz war an einem Tage im Summer, als er sô krank fiel, dasz wir dachten, er müesst sterben noch ê der nächste Mond voll ward. Doch er lebet und kann niht herrschen, er lebet und kann niht sterben und ganz Kurnevals ist voll der truire, Fride unde Reht sind swach, Gevalt fäert uf allen straszen. Dâ kommen die Magi und Wîsen, doch keiner kann sagen, was den Küneg gezund wird machen.
(Niemand wusste, woran der König erkrankt war. Es war mitten im Sommer, als er so schwer erkrankte, dass wir befürchteten, er müsste noch vor dem nächsten Vollmond sterben. Aber noch lebt er, auch wenn er nicht regieren kann, er lebt und kann nicht sterben, und ganz Cornwall trauert, Friede und Gerechtigkeit sind in Gefahr, auf den Straßen herrschen gewaltsame Zustände. Viele Ärzte und Heilkundige hat man gerufen, doch auch sie wissen sich keinen Rat, wie der König genesen könnte.)
ERINNERUNGEN
Ich habe in meinem Leben viele Männer auf der Folter gesehen. Es sind grausame Erinnerungen, und heute kann ich mich nicht einmal mehr von der angeblichen Notwendigkeit überzeugen, die all diesen scheußlichen Handlungen zugrunde gelegen haben soll. Mein Geist zerfasert sich ohnehin, doch nicht dergestalt, wie ich es mir wünschen würde. Es ist kein friedlich dumpfes Dahindämmern, eher ist es so, als ob ein Seil sich in die verschiedenen Stränge aufzwirbelt, aus denen es gedreht wurde.
Erinnerungen an die Folter so vieler fremder und vergessener Männer sind nur ein verschwindend kleiner Teil dieses endlosen Taus, das Gott nicht die Gnade hat abzuschneiden. Dabei weiß Gott genau, wie sehr ich auf das Sterben warte, ich erzähle es ihm in jeder Minute.
Die Folterungen, deren Zeuge ich war, waren grausame Akte menschlicher Gewalt, brutal und roh, Spiegelungen der Verbrechen, für die sie angesetzt und ausgeführt wurden, oder barbarische, aber wirkungsvolle Mittel, um Gefangenen Kriegsgeheimnisse zu entreißen.
Doch jetzt, wo ich hier liege, im achten Monat meiner Starre, unfähig, mich zu bewegen, oder auch nur aufzurichten, weiß ich, dass in dieser Bewegungslosigkeit eine ganz andere, wirksamere Form der Qual liegt. Ich starre auf die Ritzen im dunklen Mauerwerk, ich fahre jede Unebenheit zwischen dem Boden und der Decke mit meinen Augen ab, ich sehne mich sogar nach der Berührung des Staubs, der sich auf meinem Bett angesammelt hat.
Dann denke ich daran, wie es gewesen ist, Stein oder Holz mit den Fingern zu fühlen, die Form nachzufahren, zu spüren, ob etwas kalt oder warm ist. Wenn ich die Augen schließe, kann ich meine Fingerspitzen fast bis zu diesen Momenten glückseliger Nachlässigkeit zurückbegleiten, als ich einfach etwas berührte, ohne darüber nachzudenken, dass ich es konnte. Denn so sehr ich auch will, ich kann mich nicht rühren. Und das ist Folter, grausame unbarmherzige Tortur. Sie ist in sich unvergleichlich, aber doch den unzähligen Blendungen und Verstümmelungen, die in meinem Auftrag, auf meinen Befehl hin in den letzten fünfunddreißig Jahren geschehen sind, weit überlegen. Ich würde nun jedem alles erzählen, alles versprechen, jedes Geheimnis, jeden Schwur verraten und jeden Eid leisten, wenn ich mich nur einmal mit eigener Kraft aufrichten dürfte. Manchmal stelle ich mir vor, wie es sein würde.
Wie ich zuerst die Muskeln im Nacken in vorsichtiger Erwartung anspanne, langsam den Kopf vorbeuge, die Schultern hinterher schiebe und dann wie ein Farn meinen Körper nach vorne rolle, um mich schwer atmend aufzusetzen. Ich stütze mich mit der rechten Hand ab und greife mit der linken Hand nach dem unteren Bettpfosten. Und dann spüre ich Holz. Meine Finger erinnern sich, ich spüre es in der ganzen Handfläche, es ist sicher schlüpfriger, als ich es erwarten kann. Und darum müssen sich meine Finger noch fester schließen, sodass ich nicht abrutsche und all meine Mühe vergebens ist. Ich ziehe mich ein Stück weiter hoch und setze zuerst den linken Fuß auf den Boden.
Die riesigen Steinplatten sind eiskalt, aber meine Füße sind seit Monaten wie abgestorben, egal wie viele heiße Ziegel oder Kupferflaschen sie mir bringen. Deswegen suche ich nur kurz Halt und setze dann den rechten Fuß auf. Ich habe genau geplant, wie ich einmal noch ausatme, bevor ich mich dann hochziehe, um endlich zu stehen. Ich werde stehen. Keuchend, wacklig, würdelos, aber ich werde stehen. Ich werde den Rücken trotz der Schmerzen und des Unbehagens nicht strecken, um meinen Fortschritt nicht zu gefährden. Vornübergebeugt bewege ich mich Fuß um Fuß zur Mauer. Ich strecke die rechte Hand aus und fasse die unebenen Vorsprünge des Mittelsteins.
Er ist feucht, glitschig vom Moder und Schimmel, aber ich kann ihn fühlen. Und dann bin ich auch schon nahe genug am Fenster, dass ich diesen elenden Samtvorhang beiseite reißen kann, hinter dem ich Morgen und Abend, Mittsommer und Winter nicht zu unterscheiden weiß. Ich werde das Fenster öffnen, unachtsam, gierig, vielleicht wird das teure römische Glas darin brechen. Wenn schon.
Und dann werde ich endlich wieder das Meer sehen.
Ich hätte gern, dass es gerade Dämmerung ist. Ich wünsche mir eine ungezähmte See, grau und aufgeschäumt, endlos und wütend, ohne einen klaren Übergang zum tiefen Himmel über Cornwalls Küste. Ich will sie laut, mit brüllenden Wellen und fliegender Gischt. Diese reine Kälte wird mich erfrischen, während mir der Seewind Tränen in die Augen treibt und sie sogleich wieder abtrocknet. Ich atme den unbarmherzigen Wind ein, lasse ihn durch mich hindurchfegen, fühle die Luft, ich bin die Luft und die See.
Und dann werde ich mich an nichts mehr erinnern, ich werde an nichts mehr denken. Ich werde mir nichts mehr wünschen. Ich werde nur noch atmen, das Meer eintrinken und sterben. Und alles ist gut.
Aber egal, wie oft ich es mir ausmale, egal, wie sehr ich dafür bete, Gott lässt mich nicht gehen.
Ich habe drei Priestern alle Sünden gebeichtet, an die ich mich noch erinnern kann. Einer war frömmer als der andere, aber es hat nichts genutzt. Sie haben sogar meinen alten Freund, den Bischof von Salisbury, die Reise bis hier zur Küste machen lassen, weil sie hofften, es ginge mit seinem erhabenen Segen schneller zu Ende als unter dem schlechten Latein unserer Provinzpriester. Doch vergebens. Es tut mir Leid um seine alten Knochen, älter noch als meine. Er sorgt sich sehr um mich. »Du musst gesund werden, Marke«, hat er gesagt, »spätestens zum Mittsommer gehen wir dann zusammen tanzen.« Ich hoffe dagegen, bis zum nächsten Mittsommerfest mausetot zu sein.
Nur, irgendetwas lebt noch in mir, das zu stark und lebendig ist, als dass ich damit sterben könnte. Inzwischen rede ich mir gerne ein, dass es egal ist, wie lange ich noch auf den Tod warten muss, ich würde nur einmal gerne noch das Meer sehen. Aber wenn ich erst damit anfange, Wünsche zu haben, werde ich nur noch elender. Es gibt so viel, von dem ich mir wünschte, dass es geschehen, noch mehr, von dem ich mir wünschte, dass es ungeschehen wäre. Keiner der armseligen drei Dorfpfaffen, noch mein lieber Bischof können daran etwas ändern. Nur Gott, an den ich immer geglaubt habe.
Vielleicht hat mein Leben deswegen so lange gedauert, weil ich die wirklich wichtigen Entscheidungen auch immer Gott überlassen habe. Ob das gut war, kann ich nicht sagen. Ich will mich nicht versündigen, doch ich weiß, wie schwer es ist, immer das Richtige zu tun. Ich habe so viel gefehlt in meinen viel zu langen Jahren, und schlimmer noch, so viel Unsinniges getan, dass ich Gott nichts vorwerfe.
Unten in der Halle versammeln sich täglich mehr und mehr Schranzen, die auf mein Ableben warten, vorher aber noch darauf, von mir zum neuen König ernannt zu werden, oder sie warten darauf, vom neu ernannten König mit einem Amt, einem Lehen oder einer bezahlten Fahrt beauftragt zu werden. Der Herzog von Bristol ist sich seiner Sache ganz sicher.
Und da ich schon einen weiteren Tag nicht sterbe, nicht sterben kann, warten sie alle weiter, und das mit verbissener Geübtheit. Die Geduld, mit der sie auf mein Sterben warten, übersteigt die meine bei weitem. Sie fressen uns die letzten Vorräte weg, und im Weinkeller lassen sie nur noch Essig übrig. Cornwall ist arm geworden.
Auch da mache ich mir nichts vor. Solange ich konnte, habe ich ein gutes Haus geführt. Tintâgel war groß, unter meiner Herrschaft größer und reicher als jemals zuvor. Wir hatten auch im Winter Musikanten und manchmal tanzende Frauen aus dem Süden.
Aber ich verliere mich in der Vergangenheit. Heute Nacht hatte ich ein schweres Fieber und quälende Träume.
Ich bin noch nicht alt genug, dass ich mir selber nicht mehr auf die Nerven gehen würde, wenn ich beginne, meine Erinnerungen wie spelzigen Gerstenbrei wiederzukäuen. Ich bin erst sechsundfünfzig Jahre alt, manche leben gute zwanzig, dreißig Jahre länger.
Doch in meiner Familie sterben die Menschen jung. Schon mit fünfundzwanzig war ich der einzige Überlebende der Königssippe von Cornwall, das hat mich in den Augen aller alt gemacht, bevor ich noch eine Falte hatte oder am Stock gehen musste. Das und die Heirat mit Isolde.
Ich will nicht an Isolde denken.
Viele glauben noch immer, dass mich der Schmerz zerreißt, die unerwiderte Liebe, die gekränkte Eitelkeit des gehörnten, ältlichen Ehemannes. Das ist alles Unsinn. Beim Gedanken an diese halbgare irische Gans empfinde ich nichts als die grenzenlose Langeweile, die mich schon überkam, als ich sie zum ersten Mal sah und mich schweren Herzens mit dem Gedanken vertraut machen musste, dass dieses dümmliche junge Ding an meiner Seite Königin sein würde.
Isolde würde sich leicht vergessen lassen. Sie war Zeit ihres unseligen Lebens nur eine Schnatterliese ohne Sinn und Verstand, ich glaube, dass sie in den vier Jahren unserer Ehe in ihrem Herzen nie einen Tag älter geworden ist als die siebzehn Jahre, die sie bei unserer ersten Begegnung zählte. Isolde hätte für keinen wirklichen Mann mehr sein können als eine ungenaue Erinnerung an ein plapperndes Kind, süchtig danach, gesehen und beachtet zu werden.
Doch der Gedanke an Isolde ist untrennbar verbunden mit der Erinnerung an die Frau, die wie eine Welle über mich hingespült ist und Land genommen hat. Die Frau, deren Mann ich gewesen bin, die meine wirkliche Königin war.
Brangaene.
VON MICHAELE DE ZWYYNTEK, MAJORDOMUS
VON TINTÂGEL ZU CORNWALL, AN DIE
EHRWÜRDIGE ÄBTISSIN PERPETUA DES KLOSTERS ZUR GUTEN PFORTE BEI ST. MATERIANA:
Im Namen unseres HERRN JESU CHRISTI etc.
... erlaube ich mir, an Euer Ehrwürden mit der Bitte heranzutreten, dem König an seinem Sterbebett (verhüte GOTT, dass dem unabweichlich so sei) eine Eurer Laienschwestern zur dauerhaften Pflege bereitzustellen. In tiefem Gram verharren wir in ungebrochener Hoffnung auf seine baldige und zweifellos vollständige Genesung, so GOTT will.
Doch einstweilen, wie Ihr wisst, ist der edle Herrscher noch immer gefangen unter dem Bann seiner zehrenden Krankheit, gegen die alle Ärzte ratlos sind, und auch die heiligen Sakramente, die seine Majestät empfangen, mehrfach empfangen, vermochten keine Linderung zu bringen.
Der König befindet sich seit nunmehr fast neun Monaten in dieser körperlichen Starre, wie sie sonst nur die Toten befällt.
Dabei scheint er bei recht klarem Bewusstsein, GOTT hat ihm noch nicht die Sprache genommen, wofür wir sehr dankbar sind, hat seine Majestät doch in seiner Weisheit und in seinem festen Vertrauen auf GOTT DEN HERRN, der ihn sicherst genesen lassen wird, noch keinen Nachfolger benannt. Es gibt keinen Thronanwärter mehr, den die Räte sonders annehmen würden, der Cornwall führen und vor den Habgierigen schützen werde, wenn dereinst unser König nicht mehr bei uns weilen, sondern zu Füßen des HERRN sitzen mag.
Zu meinem Anliegen: Die Knechte werden seiner Pflege nicht mit der rechten Aufwartung gerecht, und wir fürchten, dass er, falls ihn abermals ein Fieber befalle, vor den Dienstmännern und Mägden Dinge des Staates sagen mag, die ihnen zu Ohren nur Unheil und Wirrnis stiften könnten.
Deshalb bitten wir Euer Ehrwürden höflichst um die Übersendung einer der Laienschwestern im Schweigegelübde, namentlich der Frau, die als Brangaene von Irland dereinst mit unserer leidvoll verschiedenen, viel geliebten Königin Isolt mit den Goldenen Haaren von der Insel kam.
Bevor unsere Königin so schrecklich und zu früh ohne Erben verstarb, wurde die Besagte der Liebe zum HERRN JESUS wegen in Euer Kloster eingeführt.
Ich entsinne mich dessen, weil ich damals die Ehre hatte, sie durch eine Garde eskortieren zu lassen, als ihr Wunsch, dem Herrn im Schweigen zu dienen, sich nicht mehr bezähmen ließ.
Die Dame Brangaenen genoss des Königs Vertrauen, und wenn er ihrer Pflege anheim gestellt wird, so glauben wir auf eine schnellere Genesung hoffen zu können.
Ich erinnere Euer Ehrwürden zu diesem Zeitpunkt auch noch einmal demütig an die Schenkung, die ich als armer Sünder und bescheidener Diener des HERRN vor knapp einem Jahr zeitgleich mit dem Einzug der Frau Brangaene dem Kloster machte, um ihrem Wohlergehen und der Gewährleistung ihres Wunsches nach frommem Schweigen gerecht zu werden. Ich bin sicher, dass sich die ehrwürdige Mutter in ihrer Weisheit erinnern werden. Ich bitte demzufolge untertänigst um ihre schnelle Übersendung nach Tintâgel in den nächsten Tagen.
Ich entbiete im Namen des HERRN etc.
Michaele de Zwyyntek de Cornwallis, Haushofmeister seiner erhabenen Majestät, Marke Rex, Fürst und Herzog von Cornwall, Herrscher zu Tintâgel über das Waliserland. (Siegel)
DER FLUSS
Ich wurde vor sechsundfünfzig Jahren zur Hälfte des zweiten Monats nach Mittsommer geboren, in dem Jahr, nachdem die Nordvölker Tintâgel für drei Monate belagert und nicht hatten einnehmen können. Meine Mutter war Cornelia Juvenea, die Enkeltochter des letzten römischen Statthalters des Grenzwalls im Süden, mein Vater hieß Marcus Valerius wie ich. Er war Lehnsherr über Tintâgel, unter der Gnade des letzten Kaisers zum König gekrönt, bevor die Römer genug Schwierigkeiten mit sich selbst hatten und uns unseren eigenen Streitigkeiten überließen.
Es waren für Britannien die Jahre der Nordvölker und Sachsen. Scheußliche Jahre, doch Tintâgel liegt am anderen Ende der Welt.
Die Menschen hier sterben nicht durch Krieg, eher durch Langeweile, scherzten die Bauern, bevor sie es besser lernen mussten. Denn die Iren hielten ihre Beutezüge damals noch weiter nördlich ab, sodass der große Krieg, der uns so viele Jahre Leid brachte, in weiter Ferne lag.
Es ist schwer, auf ein Leben zurückzublicken, ohne der Versuchung zu erliegen, es so aus erhabener Ferne zu sehen, wie man einen Fluss im Tal von einem Hügel aus sieht.
Wenn jemand nahe vor einem Fluss steht, scheint dieser unendlich lang und breit, kaum zu überwinden. Und obwohl wir wissen, dass er von einer Quelle kommt und auf eine Mündung hinfließt, erkennen wir doch nur das Stück, vor dem wir stehen, seine rauschenden und dennoch stehenden Wasser. Vom Hügel aus aber sehen wir einfach einen Fluss, wie er sich durch die Landschaft windet, sich einfügt in seine Umgebung.
In meinen frühen Jahren habe ich vor so vielen Flüssen gestanden, einer erschien mir breiter als alle zuvor, und der nächste wieder und wieder. Jetzt vom einsamen Hügel meiner stillen Tortur, sehe ich alle diese Flüsse, wie sie sich zu einem einzigen Strom vereinigen, der auf ein Ziel zuführt, auf die Frau, die mein Meer wurde. Auf Brangaene.
Ich werde versuchen, die Flüsse wieder zu sehen, wie das dumme Kind, das ich war, als ich vor ihnen stand. Ich werde mir Zeit nehmen, alle diese Flüsse noch einmal zu überqueren. Vielleicht lassen sie mich ein zweites Mal bei ihr ankommen.
Als Kind sah ich meinen Vater als einen Helden, unverwundbar, tapfer und ohne Fehler. Er war zu selten zugegen, als dass er mir in seinem kurzen Leben anderes hätte beweisen können. Als er starb, war ich gerade zu den Zieheltern gekommen. Meine Erinnerungen an die Eltern sind schwach, oft vermischt mit den Wunschbildern des Mannes späterer Jahre, der es eilig hatte, mit der Erinnerung an beide seinen Frieden zu machen. Die Bürden meines Standes erschienen mir bisweilen so groß, dass ich sie nur tragen konnte, wenn ich mir fabulierte, beide Eltern wären mit besonderen, übermenschlichen Gaben ausgestattet gewesen. Diese Gedanken brauchte ich, damit ich nicht wankte unter der Vielzahl von Hindernissen, die sich mir in den Weg stellten. Aber inzwischen bin ich klar genug, mir einzugestehen, wie wenig ich über diese beiden Menschen weiß, wie fern sie mir sind.
Sind die Hände, an die ich mich erinnere, wie sie mich im Bade hielten, die Hände meiner Mutter oder die einer der Zofen und Kammerfrauen ? Wem gehört das Lachen, das mir jedes Mal ein Gefühl im Bauch schenkte, als hätte ich frische heiße Milch mit Honig getrunken ? Ich wünsche mir heute mehr denn je, dass es das Lachen meiner Mutter war, doch ich sehe nicht einmal mehr ihr Gesicht vor mir. Die Erinnerung daran verschwimmt vor meinen Augen wie eine der kostbaren Miniaturmalereien im neuen Gebetbuch des Bischofs, das er mir bei seinem nutzlosen letzten Besuch zeigte, in der freundschaftlichen Hoffnung, mich aufzuheitern.
Klarsichtig ist mir einzig die Erinnerung meines Herzens an etwas Schönes und Warmes und ein Frauenlachen, das solch ein Glück in sich klingen ließ, dass ich bete, es möge wirklich meiner Mutter gehört haben, und dass es mein Vater war, der sie so zum Lachen brachte.
Später habe ich mich nie, nach keinem Sieg, den ich errungen hatte, nach keiner Intrige, die ich sinnlos gewonnen hatte, nach keiner Beute, die ich einbrachte, nach keinem Vertrag, den ich listig zu Ungunsten eines anderen abschloss, größer und mächtiger, nie mehr als ein wirklicher König gefühlt, als wenn ich es vermochte, durch einen Scherz oder durch eine unbeabsichtigte Ungeschicklichkeit Brangaene ihr wunderbares Lachen zu entlocken, dieses Lachen, das nur ich kannte, bei dem sie den Kopf in den Nacken warf und es aus sich heraus- prasseln ließ, ein tiefes und unhöfisches Lachen, ein Lachen reiner Lebensfreude.
Einmal bin ich geprügelt worden, weil ich aus der Aufsicht der Frauen fortgelaufen und in den Schweinestall geklettert bin.
Es war mein erstes großes Abenteuer, doch sicher keines von großer Weite. Wenn mich auch bisweilen mein Gedächtnis im Stich lässt, so weiß ich aus der harten Arbeit späterer Jahre, aus den unbestechlichen Büchern, die meine Haushalter, Schatz- und Stallmeister geführt haben, dass Tintâgel damals nicht mehr als ein etwas größerer Bauernhof mit römischen Mauern drum herum war. Die Hühner liefen den Frauen bei der Spinnarbeit um die Füße, und draußen waren die Schweine im Sommer frei, weil sie die Ratten besser einfingen, als es eine Legion von Katzen je vermocht hätte. Als ich an diesem Tag zu den Schweinen lief, wollte ich mir die neuen Ferkel ansehen, von denen die Magd geredet hatte. Ich weiß nicht, wie alt ich war, doch war ich gerade so groß, dass ich ein Bein auf den Futtertrog legen und mich so über das Hindernis, das zwischen mir und dem Ziel meines Abenteuers stand, hinwegziehen wollte. Aber meine unerfahrenen kleinen Finger rutschten am klammen Stein ab, und ich landete im Schweinetrog inmitten des Gestanks fauliger Rüben und feuchten Roggenschrots, hilflos, überrascht und wütend, als ich das neugierige Schnauben der sich erhebenden Muttersau hörte, wie sie sich schmatzend und behäbigen Trittes dem Trog näherte. Gelähmt vor Schreck, konnte ich mich nicht rühren, ich hörte sie und wartete atemlos, bis sie ihren blassen riesigen Kopf über den Rand der Steinwanne geschoben hatte und mit ihren feucht-schmierigen Nüstern nach mir schnüffelte.
Ich streckte meinen kleinen Zeigefinger nach dem Tropfen aus, der unter ihrer Schnauze zitterte, ich stellte mir vor, dass es ein wertvoller Stein wäre, und sehe genau vor mir, wie er geheimnisvoll funkelte in der trüben Dunkelheit des Stalles.
Die Sau verharrte vor mir. Ihr warmer Atem, den sie nebelhaft ausstieß, stob mir ins Gesicht, als ich mich roh gepackt und aus dem Fraß herausgerissen fühlte.
Unter einem Hagel von plötzlichen Fluchworten und Schmähungen fing ich laut an zu heulen, hing dann baumelnd über einer hohen, unbekannten Schulter und landete kaum ein paar Dutzend Schritte später vor den Füßen meines Vaters in der großen Halle.
Der Mann, der mich von der Sau, meiner Entdeckungsfahrt und dem Anblick der kleinen Ferkel weggerissen hatte, sagte laut etwas wie: »Euer Kleiner will bei den Schweinen liegen, König Marcus, es ist wohl besser, dass Ihr ihn beizeiten lehrt, dass sich ein König eine andere Gesellschaft sucht, sonst mag es übel ausgehen.«
Er lachte hämisch, wischte sich dann seine Hände an den Beinen ab und fluchte, dass ich stänke wie hundert tote Sachsen an einem warmen Sommertag.
Noch immer war ich stumm und starr, unfähig zu begreifen, was geschehen war.
Da aber packte mich mein Vater, warf mich über seine Knie und hieb auf meinen stinkenden kleinen Körper mit der ungebremsten Kraft eines Streiters und Schwertführers ein. Ich jaulte laut auf vor Schmerz, und ich hörte ihn, wie er rief, ich solle ruhig heulen. Da ich offenbar sehr dumm sei, so dumm, ein Schwein anschauen zu wollen, wolle er so lange weiter- schlagen, bis ich wüsste, dass ein König nicht weint und dass ein König nichts mit Schweinen zu tun haben will. Er hielt sein Versprechen. Ich heulte lange, doch er schlug mich länger, bis ich keinen Ton mehr von mir gab, nur noch zitternd und weh auf seinem Schoße hing.
Da setzte er mich in meinem Kittel auf den kalten Boden vor die erloschene Feuerstelle.
»Warum müssen Kinder so klein und nutzlos sein ? Warum muss man überhaupt Kinder haben ?«, grollte er im Weggehen. Mein kleines, blankes Hinterteil war heiß, schmerzte furchtbar und fand nicht einmal Linderung durch die Kühle der Steine.
Der Wunsch, laut zu jammern, um etwas von der tosenden Pein aus meiner Kehle entweichen zu lassen, stieg wieder in heilsamem Versprechen in mir auf, doch die Furcht, dass mein Vater mich hören könnte und zu neuen Schlägen zurückkehren würde, war ungleich größer. Ich hustete gegen den Druck auf meiner Brust, das Stechen hinter meinen Augen an, bis ich spürte, wie der Schmerz verebbte.
Dann weiß ich nichts mehr.
Ich vermute, dass meine Mutter oder eine der Frauen mich gewaschen und getröstet hat, dass die Wundheit schnell verheilte und ich um die Schweine einen großen Bogen machte.
In den harten Wintern damals standen die Kühe und Pferde in der großen Halle, und die Läuse und Flöhe schienen sich auf uns wohler zu fühlen als auf dem Vieh.
Vielleicht war es ein Flohbad, an das ich noch zurückdenken kann. Das Plätschern des warmen Wassers in einem runden Zuber, in dem ich jetzt so gerne meine eisigen Füße baden würde, aber nicht mehr kann. In der Erinnerung kann ich die Wärme an meinem Bauch spüren. Ich erinnere mich auch genau an eine Frauenhand, die mir Wasser über den Kopf schöpft, mich kitzelt und dabei ein Lied singt:
»Klein Marke wird ein großer Held, klein Marke wird ein starker Mann«, immer wieder, diesen anspruchslosen selbst gezimmerten Vers zu einer einfachen kleinen Melodie, die ich bald überzeugt genug mitzusingen wusste.
Ich, Klein Marke, der große König, der jedoch viel zu lange nicht wusste, was es hieß, wirklich ein Mann zu sein, weniger noch, was es bedeutete, ein Mensch zu sein.
Ich bin so müde.
Ich bin dieses Lebens oder besser dieses Sterbens so überdrüssig. Der Stallknecht, der kommt, um meine Liegegeschwüre mit einem viel zu groben Lappen zu waschen, wirft mich hin und her wie einen Heuballen, und die Küchenmagd, die mir den elenden Gerstenbrei, den sie offensichtlich für die rechte Krankennahrung halten, mindestens einmal am Tage einfüttert, kann nicht aufhören, sich dabei ständig die Nase zu wischen.
Wer hätte es gedacht in den Tagen, da ich mich aufschwang, vielleicht sogar der Großkönig Britanniens zu werden, dass ich einmal hier liegen würde, versteinert und hilflos und wieder so dumm wie der Knirps, der bei den Schweinen Freundschaft suchte. Ich war ein hochfahrender Mann, ich war stolz und ich war es zu Recht. Ich bin ein gerechter König gewesen, ein tapferer Krieger. Ich habe mein Volk nicht geschunden oder verhungern lassen, um meine eigene Größe zu nähren. Als ich gerade König geworden war, sang man schon Lieder auf mich, und mir sind mehr Fürstentöchter und adlige Frauen zur Heirat angeboten worden, als ich selbst sagen könnte, ohne mich wie ein Aufschneider zu fühlen.
Aber jetzt ? All das scheint wie ein Traum, undeutlich vergangen. Der Reichtum, den ich errang, ist verzehrt.
Die Schlachten, die ich schlug, haben uns keinen dauerhaften Frieden gebracht. Die Gebiete, die errungen und gesichert waren, sind entweder abtrünnig geworden oder verwüstet.
Und was die Lieder angeht, habe ich mir in meiner Jugend sicherlich darin gefallen, Lobpreis zu hören, mich wie eine Sagengestalt verehrt zu finden. Doch wieder sehe ich den Fluss von einem Hügel aus und habe begriffen, dass mein Verdienst hauptsächlich darin bestand, nicht so grausam, tückisch und gierig zu sein wie die meisten anderen Herrscher. Man hat mir die Lieder nicht für das gesungen, was ich tat, sondern wohl für das, was ich nicht getan habe – und dies scheint mir kaum eine Errungenschaft. Seit der Affäre Tristans mit meiner jungen Gemahlin Isolde gelten die Lieder ohnehin nur noch den beiden. Ich bin so etwas wie der böse Unhold, der eifersüchtige Ehemann, der die Liebenden trennte. Wenn ich es könnte, ohne an einem Hustenanfall zu ersticken, würde ich gerne hin und wieder darüber lachen. Die Leute glauben, was sie wollen. Ich habe das wesentlich eher begriffen als mein Haushofmeister oder auch der gute Bischof, die immer noch versuchen, dem Volk zu sagen, was es zu denken hat. Der strahlende Held und gute König ist nun also der grimme Alte, der ein liebendes Paar auseinander zu halten sucht, wie in einer Jahrmarktsposse. All das tägliche Streben, das Sich-groß-Hungern, die vielen kleinen Finten und Intrigen langen zu nichts als der Erkenntnis ihrer Vergänglichkeit und Vergeblichkeit.
Es kommt mir vor, als hätte ich einen unendlich langen Tag gekämpft, wäre am Abend als unbestrittener Sieger zum Lager gegangen und wache nun am Morgen auf, um zu sehen, dass es weder eine Schlacht noch einen Triumph gab, sondern nur unverrichtete Arbeit, die jetzt auf einen anderen wartet.
Der Haushofmeister kommt schon wieder. »Wie fühlen sich Euer Majestät heute ? Ist die ersehnte Besserung eingetreten ?« Jeden Tag erscheint er morgens und abends, er ist mir das einzige Stundenglas geworden, das ich noch lesen kann. Triefend vor Mitgefühl, welches er sich direkt vor der Tür noch anzwingt, tritt er ein, und an seinen Demutsbekundungen lese ich die Zeit ab, die mir von Tag zu Tag neu berechnet wird. Wenn ich für halbtot erklärt bin, wohl daran gemessen, dass ich so gut wie nichts aß oder dass sie meine Ausscheidungen von irgendeinem Quacksalber untersuchen lassen, so bin ich der »edelste aller Herrscher«, wenn sie mir noch unbestimmte Zeit einräumen, zischt er mir beim Aufrichten aus seiner stetig despektierlicher werdenden Verbeugung nur ein »Sire« zu.
Heute bin ich also »Majestät«, das heißt wohl, es geht mir ganz gut.
Er führt etwas im Schilde, und wenn ich auch nicht weiß, was es ist, so weiß ich doch, diesen in seiner Gesinnung allzu geschmeidigen Mann niemals zu meinen Freunden zu zählen.
DIE ÄBTISSIN PERPETUA DES KLOSTERS ZUR GUTEN PFORTE BEI ST. MATERIANA AN MICHAELE, MAJORDOMUS ZU TINTÂGEL, CORNWALL, STATTHALTER DES REGIS MARKE, ETC.
... Möchten wir Euch freundlich versichern, Eurem Wunsch zu genügen. Doch mag es noch ein paar sieben Tage dauern, bis die Frau Brangaene von Irland wieder ganz hergestellt ist. Die fromme Seele hatte, wie Ihr vielleicht bedenkt, den Wunsch, GOTT nicht nur durch ihr Schweigen, sondern auch durch ihren Rückzug von der Welt zu dienen. So lebte sie seit unbestimmter Zeit, bald nach ihrer Ankunft hier unter unserem bescheidenen Dach, in der Einsiedelei, wo sie im Fasten und stillen Beten sicher den Segen des ALLMÄCHTIGEN erwarb.
Als wir nun auf Euren Boten hin sie aus ihrem bevorzugten stillen Aufenthalt herausreißen mussten, fanden wir sie recht siech und schwächlich vor, sodass ich sogar sagen kann, es ist für Euch ein rechtes Glück gewesen, diesen Boten nicht ein paar Tage später zu senden, da sie wohl schon bei unserem HERRN und Erlöser und ihrem Bräutigam dem HERRN JESUS CHRISTUS geweilt hätte. Nun bekümmern sich mehrere unserer erfahrensten Heilkundigen um sie, und wir beten, die Frau Brangaene binnen ein paar Wochen wiederhergestellt zu haben. Bedenkt immer, dass alles nach GOTTES Willen geschieht. Unser Schöpfer vergisst nichts.
Einstweilen gibt es hier so viel, um das wir uns sorgen müssen, denn das Wachs für unsere Kerzen wird in diesen langen Tagen nicht eben mehr, und es fehlet uns ebenso an Honig, da uns die Immen im Sturm des letzten Mais sonders gestorben sind. Zwar spricht DER HERR: SEHT DIE LILIEN AUF DEM FELDE, SIE SÄEN NICHT, sie ernten nicht. Doch scheint Cornwall noch nicht unter dem gleichen Segen des HERRN zu liegen wie die Felder, die sein Sohn erschaute.
Wenn der Herr Majordomus es also in seiner Macht sehen könnte, unseren unbedeutenden Beitrag zum Wohle des Königs wie immer im Dienste GOTTES durch eine kleine Gefälligkeit erleichtern zu können, würde dies von uns dankbar angenommen und sicher auch der Frau Brangaene in ihrer Genesung beihelfen.
CORNWALLS CHRONIK (Auszug)
» Wurd im Jâr, da es das zwei und dreissigste des Küniges Marcus des Älteren, Gott behüete ihm sîne Sêle, gewest und das zwelfte sîner Herrschaft, sîn Sünelîn, dâz heisset Marcus ebene, zuo den Edelen Gordec und der Frau Berenice im Süden gesendet, da ez lernen sollt, wie ein Künige herrschet. Und ist doch im gelichen Jâr der Künig selbez am Fieber verstorben, gerad noch dass er hat durch Gottes gnad gesen, daz im sîn edele Küneginne hat ein Tochterlîn geborn, waz heisset Blanscheflur, daz meint diu Weisze Bluome ... «
(Als der König Marcus der Ältere selig zweiunddreißig wurde, es war im zwölften Jahr seiner Herrschaft, wurde sein Sohn Marke in den Süden zu den Zieheltern, den Edlen Gordec und Berenice geschickt, um eine angemessene Erziehung zu erhalten. Im selben Jahr verstarb der König am Fieber, er lebte gerade noch lang genug, zu sehen, dass ihm eine kleine Tochter geboren wurde. Sie wurde Blanscheflur getauft, das bedeutet »Weiße Blume«.)
DER KÖNIGSWEG
Der Abschied von Tintâgel, als ich mit sieben Jahren zu den Pflegeeltern geschickt wurde, war überschattet von der Krankheit meines Vaters. Es wusste keiner, was ihn befallen hatte. Er magerte ab und war von Leibschmerzen geplagt, die nicht durch gewärmten Wein, nicht durch fette und nicht durch magere Speise zu lindern waren. Selbst klares Wasser bereitete ihm große Pein, und meine Mutter, die mit meiner Schwester schwanger ging, war besorgt, ärgerlich und den Ratschlägen eines triumphierenden Haushofmeisters ausgeliefert.
Die Truhen für meine Abfahrt waren schon gepackt, da hörte ich, wie eine der Kammerfrauen, die meinen Vater betreute, wenn meine Mutter zu müde war, zu einer anderen sagte: »Es wird nicht mehr lange dauern. Auf dem gedeiht nicht mal mehr eine Laus.« Ich weiß noch, wie mich diese Ankündigung in dumpfe Furcht versetzte. Ich wollte meine Mutter nun umso weniger verlassen und hing an ihr, was sie als Eifersucht auf das neue Kind missverstand. Unwillig schob sie mich fort, sagte mir, ich sei zu groß für solch ein Gehabe und dass sie sich meiner schämen müsste. »Benimm dich wie ein Mann, Marke, nicht wie ein Kleinkind.«
Die Küchenmägde und Knechte machten sich über die Vorgänge auf Tintâgel ihre eigenen Gedanken und tuschelten viel über Zauberei oder Fluch, von denen mein Vater befallen sei. Manche gingen ins Dorf, um sich von den alten Frauen Schutzzauberamulette geben zu lassen. Ich erinnere mich auch an einen Streit, den meine Mutter mit dem Priester hatte, weil sie eine der Kräuterfrauen und Heilweisen kommen ließ, die damals nur noch im Verborgenen lebten.
Der Priester nannte meine Mutter eine Schande für ihren Stand, eine Ungläubige, und prophezeite, das Kind, das sie trug, werde jung sterben, um ihre Schuld zu sühnen. »Ihr werdet sehen«, spuckte er, »es kann allein Übel von dieser Gottlosig keit kommen !«
Es war eine ungeheuerliche Anklage.
Doch der Priester war allgemein ein missgestimmter Mann, er lebte mit zwei Frauen in einer Kate unten vor der Burg. Die beiden Gefährtinnen zankten, da er keine von beiden heiraten wollte, stetig darum, welche ihm näher stehe und auf seine Erbschaft rechnen dürfte.
Als er die Königin so unwirsch anfuhr, lernten er und ich in meinem Versteck eine Seite an meiner Mutter kennen, die mir heute eine der liebsten Erinnerungen an sie ist, und die uns beide im Moment unsäglicher Überraschung einte. Statt ihm Recht und nachzugeben, stemmte sie die Hände auf die Hüften und rief: »Jetzt haltet ein für alle Mal Euer dummes Maul, Pfaffe. Ihr habt nicht mehr Macht, mich und mein Kind zu verfluchen, als Ihr es über Eure zwei hässlichen Weiber habt. Geht mir aus den Augen, ich will Euch vor dem nächsten Sonntag nicht wiedersehen.«
Der Priester grabschte nach seinem Kreuz, holte Luft und drehte sich auf dem Fuße zum Gehen, begleitet von einer bedrohlich anschwellenden Wolke unterdrückten Lachens, das vom Gesinde, den Edlen und meiner Mutter zugleich schließlich erleichtert aus stob.
So wenig in diesem kleinen Gefecht zwischen dem Priester und meiner Mutter auch geschehen war, veränderte sich jedoch an diesem Tag die gedrückte Stimmung, die seit der Erkrankung meines Vaters über Tintâgel gelegen hatte. »Das Leben geht weiter«, sagten die Leute, und auch ich fühlte es genau. Auch wenn der König sterben sollte, das wussten wir in diesem Moment alle, waren wir doch nicht schutzlos und allein. Meine Mutter, Cornelia von Cornwall, würde zu herrschen verstehen. Ich war an diesem Morgen glücklich und sorglos, wie nur ein Kind es sein kann.
Am selben Tage, möglicherweise auf den Rat der Heilweisen hin, ordnete meine Mutter für die ganze Burg einen Waschtag an, dem sich keiner entziehen konnte, so als wollte sie nicht nur den Mief des Priesters, sondern auch die lastende Atmosphäre der Krankheit meines Vaters austreiben. »Alles wird gewaschen«, wiederholte sie unerbittlich in den Kammern, den Ställen, den Gesindehäusern. Kleider des Hofgesindes und auch die Gewänder der Edlen, die älter als fünf Jahre waren, wurden auf einem großen Feuer verbrannt. Alles Seifenkraut, was sich in den umliegenden Dörfern finden ließ, wurde den Bauern zu einem für diese erfreulich hohen Preis abgehandelt. Die Kühe und Pferde wurden dauerhaft aus der großen Halle verbannt, und die Kinder der Burgsassen erhielten neue Aufgaben als Hüter von Hühnern und Gänsen.
Unter Königin Cornelias Anweisung entwickelte sich Tintâgel in den nächsten Jahren zur saubersten Burg Britanniens, wenn ich nach dem urteilen kann, was ich später anderswo sah und roch. Ich habe später an dieser Tradition bis zur letzten Æquinox festgehalten, doch nicht allen gefiel es. Der Bischof sprach zu mir sogar davon, dass er es für möglich hielte, meine Krankheit wäre durch übermäßiges Waschen ausgelöst worden. Man habe, so berichtete er, von grauslichen Krankheitsfällen in den Badehäusern von Londinum gehört.
An diesem ersten Badetage jedoch, der den inoffiziellen Regierungsbeginn einer der resolutesten Herrscherinnen markiert, die Cornwall je gesehen hat, musste ich als Sohn der Machthaber natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Diejenigen, die ihre Hemden so lange trugen, bis sie zerfielen, hatten große Schwierigkeiten, sie vom Leib zu bekommen. Bei den meisten von uns hatte sich der Stoff irgendwo schon mit der Haut verbunden und das Schrubben mit der groben Bürste war ermüdend für die, die es tun mussten, aber sehr schmerzhaft für die, denen es angetan wurde. Nachdem ich gewaschen und mit roter Haut dem Zuber entstieg und neu eingekleidet war, führte mich meine Mutter selbst in die große Halle. »Ich muss mit dir sprechen, Marke. Du wirst dich heute vom König und mir verabschieden«, sagte sie streng. »Von heute an sind wir nicht mehr deine Eltern, sondern das Königspaar, dem deine Treue und Ehre zustehen. Wir werden uns lange Jahre nicht sehen. Ich werde gut herrschen über Cornwall in der Zeit, Marke, aber ich werde ab morgen für die nächsten vierzehn Jahre auch vergessen, dass ich einen Sohn habe.« Ich wollte ihr klar machen, dass ich nicht wusste, wovon sie sprach, und klappte den Mund auf, aber sie hob nur gebieterisch die Hand. »Wenn du zurückkehrst, werde ich dieses Land größer gemacht haben, und ich hoffe, du wirst dann edel und stark genug sein, unserer Familie die Macht zu erhalten und sie zu schützen. Du bist unser Pfand an die Zukunft, Marke, aber verlass dich auf nichts. Trau niemandem. Niemals.« Sie sah mich an mit einer Mischung aus Trauer und Ferne, die mich nach dem gerade wiedergewonnenen Vertrauen ins Leben umso mehr erschütterte. Ich verstand trotzdem nicht. Ich begriff nicht, was sie mir damit sagen wollte. Sie streckte die Hand aus, um mir durchs Haar zu fahren, eine ihrer immer seltener gewordenen Zärtlichkeiten, nach denen ich mich gerade in den letzten Wochen so gesehnt hatte. Doch ihre Augen und ihre kalten Anweisungen hatten mich so aus der Fassung gebracht, dass ich unwillkürlich vor der Berührung zurückschreckte.
Zuerst glaubte ich, in ihrem Blick Schmerz zu entdecken. Ich wollte mich in ihre Arme stürzen, einen Schwall von Entschuldigungen und Zärtlichkeiten schon aus der Kehle hochsteigend, aber ich zögerte. Und dann sah ich ein zufriedenes Lächeln sich langsam über ihr Gesicht ausbreiten, und dieses Lächeln war furchtbarer als alles, was sie bisher gesagt hatte. »Gut so, Marke«, sagte sie ganz sanft, mit der gleichen Stimme, mit der sie mich früher oft zur Nacht verabschiedet hatte. »Gut so. Vertrau niemandem. In jedem von uns wohnt ein Ungeheuer, das nur auf eine Hand wartet, die sich nach ihm ausstreckt, sodass es sie beißen kann. Und je argloser die Hand, umso schmerzhafter ist der Biss. Das sind die Wege der Welt, und wir alle gehen sie. Ich werde sie gehen und du auch.«
Anschließend, noch immer in Aufruhr und Unverständnis, wurde ich zu meinem Vater geführt, der noch bleicher als bei meinem letzten Besuch auf seinem Lager in den Kissen lag.
Er schwieg lange, ob aus Schwäche, Gleichgültigkeit oder innerer Sammlung weiß ich nicht. Dann sprach auch er.
»Te voco, Marce de Cornwalli«, begann mein Vater förmlich, doch wechselte er dann meinem Alter zuliebe in die Volkssprache: »Du wirst einmal Herrscher sein über Cornwall, nach zwei mal sieben Jahren, wenn du zurückkehrst nach Tintâgel, musst du ein König sein. Es ist dein Erbe, dein Blut, dein rechtmäßiger Anspruch. Hörst du ?« Ich nickte und er hustete, wobei binnen eines kurzen Augenblicks kalter Schweiß auf sein Gesicht trat. »Ein König zu sein verlangt zuerst, dem Menschlichen zu widerstehen. Lass die anderen lachen und weinen, saufen und fressen. Du musst stets Maß halten. Wenn andere nicht weiterwissen, musst du einen Ausweg kennen. Wenn andere sich fürchten, musst du vorangehen. Du musst Gott berühren, Marke, um ein König zu sein. Zeige nie, dass du ein Mensch bist. Hast du verstanden ?« In der Einfalt des Knaben, der gefallen wollte, nickte ich. Da hob mein Vater seine kränkliche Hand wie zu einem Segen, nur um mir dann eine Ohrfeige zu verabreichen, die in ihrer Kraft umso überwältigender war, weil ich sie dem siechen Mann gar nicht mehr zugetraut hätte.
»Lüg mich nicht an, Marke von Cornwall, ich bin dein König, mich zu belügen ist ein Vergehen, das ich strengstens bestrafe. Selbst jetzt noch, mein Sohn. Selbst jetzt noch.« Er hustete wieder. Das gab mir Zeit, aufzustehen und mich dem Bett erneut zu nähern. Doch diesmal hielt ich einen anderen Abstand ein.
Er nickte. »Die Lüge ist der erste Schritt zum Verrat. Und jeder Verrat findet Förderer.« Ich nickte wieder, vorsichtig, aber mit dem Versuch, das, was er sagte, zu verstehen. Gerade jetzt war ich so ärgerlich, dass ich gerne irgendeinen anderen beim Tun zum Schaden eines Menschen oder einer Sache unterstützt hätte, ohne nach dem Warum und Wohin zu fragen.
»Wenn du König bist, Marke, herrsche mit Strenge. Sei unberührt von dem, was die Menschen bewegt, aber nimm es ernst, nur so bist du schneller als der Verrat. Und du wirst stets Urteile fällen, die Gerechtigkeit bringen. Hast du das verstanden ?«
Ich zögerte, dachte nach und glaubte, ihm diesmal ein ehrliches Ja geben zu können. So kam ich näher und nickte beflissen: »Ich verstehe, Vater.« Da schlug er mich erneut.
»Dann vergiss es nicht, Marke. Und hör nie auf, um das zu kämpfen, was dir schon gehört. Solange du lebst. Sei auf der Hut.« Mein Vater sank in die Kissen zurück und schloss die Augen. Ich wartete noch einen Moment unschlüssig, doch dann öffnete sich die Tür und ich wurde hinausgewunken. Es war das letzte Mal, dass ich meinen Vater sah. Und ich habe seine Worte nie vergessen.
Höfische Manieren, Kriegsstrategie, Gerichtsbarkeit und Verwaltung, all diese Dinge sollte ich in den nächsten zwei mal sieben Jahren lernen. Doch glaubte ich unbeirrbar mein Leben lang daran, dass mir Mutter und Vater an diesem Tag die einzige Versicherung für einen König gegeben hatten, die es gibt: misstrauische Wachsamkeit, Herzenskühle und immer einen Schritt schneller zu sein als der Verrat.
Der verzärtelte und hilflose Knabe, der ich war, hätte sich gewünscht, von den Eltern unter Tränen geherzt und gekost zu werden. Diese Träume blieben unerfüllt. Und doch ahnte ich, dass ich einmal dankbar sein würde für die ebenso kalten wie klugen Ratschläge.
Meine Mutter kam nicht auf den Hof am Tag, als ich Tintâgel verließ. Ich hatte ihre Silhouette, die ihre fortgeschrittene Schwangerschaft zeigte, noch in der Küche gesehen, als ich aus der Halle kam, doch war ich zu stolz oder vielleicht auch zu vorsichtig, um zu ihr zu gehen und um einen Abschied zu betteln. Ich hatte in meiner Mutter etwas Hartes, Unbarmherziges und Unbezwingbares erkannt, das ich umso mehr fürchtete und fortwünschte, als ich seit dem Tag dieser Lektion wusste, dass es auch in mir zu finden sei. Zwischen uns durfte keine Rührseligkeit mehr sein. Eines Tages würden wir uns vielleicht gegenüberstehen wie zwei gekreuzte Klingen, und wenn ich den Kampf gewinnen wollte, durfte ich ihr keine Möglichkeit geben, meine Gefühle für sie auszunützen.
Ich drehte mich auch nicht um, als ich aus dem großen Tor ritt. So verließ ich Tintâgel, eine Hoffnung auf den Fortbestand der Familie, Garant für zukünftige Tage, doch zunächst vergessen und nur noch als der Sohn im Süden bedacht.
Die Weggefährten, Corbin, Aryff, Swelth und die anderen, die mich nach Kanelegres begleiteten, scherzten mit mir, um mich abzulenken. So sehr ich mich verlassen fühlte, hörte ich doch wieder und wieder die röchelnde Stimme meines Vaters, der mich ermahnt hatte, dem Menschlichen zu widersagen.
So lächelte ich nur zu den wohlmeinenden Possen, ich sagte den Männern nicht, wenn ich müde oder hungrig war, und als ich des Abends mich so verlassen fühlte, dass ich den Mond hätte anheulen können, biss ich mir in den unteren Arm, bis ich Blut schmeckte. Noch heute kann ich die Narben meiner kleinen verbissenen Zähne sehen, die den einsamen Jungen auffraßen und den zukünftigen König gebaren.
Marcus Rex de Cornewallis, rechtmäßiger König, wurde ich nur wenige Wochen später, als mein Vater schließlich starb – drei Tage nach der Geburt von Blanscheflur, meiner armen Schwester, die wirklich schön war wie eine Blume, unbeschwert wie eine Lerche und die früh und unglücklich sterben sollte, wie der Priester es in seinem Zorn meiner Mutter prophezeit hatte, an dem Tage, als sie Königin und furchtbar in ihrer Größe wurde.
Ich glaube kaum, dass ein bitterer Mann, wie der Hauspriester einer war, genug Anhören vor Gott finden konnte, um einen Fluch zu bewirken. Aber letztendlich ist es egal, wie man die Gleichung zieht, am Ende steht der Tod.
VON MICHAELE MAJORDOMUS ZU CORNWALL
AN DIE EHRWÜRDIGE ÄBTISSIN DES KLOSTERS
ZUR GUTEN PFORTE BEI ST. MATERIANA:
Im Namen des HERRN JESU CHRISTI etc.... Möget Ihr Euch nur die rechte Zeit nehmen, die Frau Brangaene wieder herzustellen, es ist gewisslich vonnöten, dass sie ganz und gar bei Kräften ist, um ihren Dienst hier auf Tintâgel anzutreten. Auch scheint, gelobt sei GOTT, das Ableben des Königs nun ein Stück weiter in die Ferne gerückt. Er spricht wieder, führt leidlich in nicht immer klaren Anweisungen die Staatsgeschäfte von seinem Lager aus und hat, wie Ihr in aller Bescheidenheit versichert sein könnt, in mir den treuesten aller Diener. Aber, des herren Wege sind unergründlich, und so hoffen wir, dass er uns in seiner Weisheit den Landesvater nicht nehmen wird, eh er einen Amtsfolger bestimmt. Schon mein Vater war ein treuer Diener des Königshauses, so wie ich dereinst hoffe erinnert zu werden. Doch will ich Euer Ehrwürden mit den Staatserwägungen eines weltlichen Lakaien nicht langweilen, wo Ihr doch in einem Dienste steht, der höher ist selbst als der des Königs, im dienste gottes. Das Wachs wird Euch dieser Tage durch Boten erreichen.
Achtet mir nur gut auf die Frau Brangaene.
Ich entbiete Euch in demütiger Dankbarkeit etc. Michaele, Majordomus de Cornewaiis, Regis Marke etc.
LA MER
Was mir aus Tintâgel in den ersten Wochen und Monaten nach meinem Auszug noch berichtet wurde, war für mich nicht mehr als die unwillkommene Verbindung mit einer Welt, die ich hinter mir lassen wollte. Ich traf in Kanelegres nach einer langen Schiffsfahrt ein, die mir die See für immer als irdisches Gesicht ewiger Gottheit erscheinen ließ. War ich in Cornwall allein am Strande entlanggestreift, so hatte mir das Meer nur eine Kulisse geboten, auf der ich mir Nordleute und Araber vorstellte, die ich durch das wilde Luftfechten meines Holzschwertes zurücktrieb, verloren in mein eitles Spiel von schnellem Helden tum und Sieg.
Doch die Fahrt nach Kleinbritannien ließ mich erkennen, was das Meer sein konnte, wenn es der sicheren Betrachtung von der Küste aus einmal entbunden war.
Nun sah ich mauloffen und furchtsam, wie sich aus dem Nichts meterhohe Wellen, größer als Tintâgel selbst, erheben konnten, Kathedralen aus brüllender Wassermacht, geschaffen nur für einen winzigen absichtslosen Augenblick, die Leben schenken, Leben nehmen konnten. Und dieselben Türme, die das arme Schiff umtosten, fielen schon im nächsten Moment zurück in die harmlose Ruhe eines stillen Dorfweihers. In der Nacht beobachtete ich das geheimnisvolle Leuchten der Fischschwärme unter dem Wasser. Ich sah das Meer wie Anbeginn und Ende der Welt, eine Macht ohne Falsch und Recht, ein Wesen, die Vorstellung vielleicht nur eines Wesens, das ungleich größer war, als alles Menschliche jemals sein oder werden könnte.
Am Morgen, bevor wir anlegten, waren wir ganz von Nebel umgeben. Die Sonne musste zwar aufgegangen sein, denn der Dunst war hell, wie von einer unsichtbaren Quelle beleuchtet, aber man sah sie nicht.
Um uns herum herrschte, außer dem verhaltenen Knarren der Schiffsplanken, bewegungslose Ruhe. Die Zeit stand still, und selbst das träge Schaukeln des Bootes konnte den Eindruck einer völligen Entrücktheit nicht mindern. Der bretonische Schiffer kam zu mir, wie ich so an der Reling stand, und legte mir wider allen Zeremoniells den Arm um die Schulter. »Siehst du, mein Junge«, flüsterte er halb in Cornisch, halb in Bretonisch, aber ich verstand ihn. Dann wechselte er ins Französische: »La mer.« Ich nickte, während ich seine raue Hand im Nacken fühlte. »Es ist ganz einfach«, raunte er dann, »ob König oder Fischer, la mer, hein ?«
Ich schauderte und hielt die Luft an. In mir formte sich ein Gebet. Es war der Atemzug, in dem ich aufhörte, ein brabbelnder kleiner Junge in der Kirche zu sein, der sich langweilte und sich die Beine in den Bauch stand.
In diesem winzigen Moment wusste ich, wie ich es heute weiß, dass unser aller Leben einem höheren Zweck dient, dass es einen Gott gibt, vielleicht nicht die Götter, um die sich die Kirchenmänner mit den alten Druiden und Hexen stritten, sondern einen Gott, der genau so war wie dieser Nebel über den Wassern: still, allumfassend, übermächtig und friedlich – jenseits dessen, was ein Mensch je sagen, doch in allem, was er zu fühlen vermag.
»La mer«, sagte ich dem Fischer nach, und er nickte, ohne zu lächeln oder zu blinzeln.
Mit seinen großen rissigen Fingern griff er erstaunlich sanft nach meinem Handgelenk und legte meine Jungenhand in die Fläche seiner eigenen. »Du heute, ich gestern«, sprach er, während er auf meine Hand zeigte, dann wies er auf die seine: »Ich heute, du morgen«, radebrechte er weiter. »Aber toujours«, und er wies mit meiner Hand in seiner ins unbestimmte Draußen, »toujours la mer«.
»Toujours la mer«, übte ich, und ein großer Trost durchströmte meinen klammen Körper. Er lächelte und entblößte seine gelichteten Zahnreihen hinter dem Gestrüpp seines Bartes. Seine Augen waren von tiefem Blau, und in ihnen sah ich dasselbe Lächeln, das mir seine Lippen zeigten.
Ein Lächeln bedingungsloser Freundlichkeit.
Ich hätte so gern für immer meine Hand in seiner warmen rauen Faust gelassen und mit ihm auf das Meer gesehen. Mir kamen in der kalten klaren Morgenluft die Tränen, und ich wandte den Kopf ab.
»Oui«, sagte der Seefahrer ruhig, »das macht das Meer.« Er hatte Recht wie niemand zuvor, der mir je hatte etwas beibringen oder erklären wollen.
Und ich hatte verstanden.
Es würde immer etwas geben, das klar blieb, egal wie schwierig das Leben sein mochte, ich musste es nur finden. In mir breitete sich tiefes Vertrauen aus, eine Heimat in der Menschlichkeit gefunden zu haben. Und dann erinnerte ich mich der Worte meiner Eltern, ich hörte ihre Warnungen, nicht zu vertrauen und den menschlichen Regungen zu widerstehen, so als wären sie mir von einem Schatten gerade in diesem Augenblick nochmals eingeflüstert worden.
Und ich wusste, dass der König, der ich werden sollte, diesen sanften Bretonen und seine Menschlichkeit nicht lieben durfte, dass es mich verwundbar, unköniglich machen würde.
So beging ich, nur ein paar Wimpernschläge, nachdem ich Gott gesehen hatte, wissentlich und deswegen umso schwerer wiegend, die erste wirkliche Sünde meines Lebens, die mir kein Beichtvater ablösen und niemand vergeben kann, und ich mir selbst am wenigsten.
Ich wischte seine Hand von meiner verkrampften Schulter und zischte: »Es geziemt sich nicht, den Kronprinzen von Cornwall wie einen Bauernjungen zu betatschen. An Land soll man Euch weniger zahlen, weil Ihr vergessen habt, wen Ihr an Bord Eures Schiffes hattet.«
Ich ging unter Deck, roch den Gestank der Seekranken und erstarrte in meiner Scham. Ich hatte das Geschenk wahrer Freundlichkeit böse zurückgewiesen. Ich hatte gesündigt.
Im Laufe meines Lebens habe ich alle Gebote gebrochen, die die Kirche uns aufgestellt hat, um uns Recht und Unrecht nach ihren Maßstäben begreiflicher zu machen. Manche dieser Dinge waren unsinnige, andere ungebührliche Taten und wieder anderer kann ich mich kaum noch erinnern, so wenig bedeuteten sie mir. Doch weiß ich, seit jenem Tag auf dem Schiff, als ich lernte, das Meer zu lieben, als ich im Gesicht des Seefahrers und im stillen Nebel jenes fernen Morgens Gottes Lächeln sah, was wirkliche Schuld bedeutet. Ich weiß noch, dass ich das Schiff hocherhobenen Hauptes verließ und ebenso kalt und unbewegt das Pferd bestieg, das am Hafen auf mich wartete. Auch fühle ich noch die bittere Versuchung, der ich kaum später erlag, als ich aufhorchte, wie einer der Gefährten im Gespräch zu dem anderen sagte, dass ich dereinst einen guten König abgeben würde. »Der ist jetzt schon kalt wie ein Fisch«, sagte Aryff.
Und wie sich dann die Schuld in eine doppelt glühende Eitelkeit wandelte, die mich meinen Frevel vergessen ließ, solange sie andauerte. Doch Eitelkeit brennt wie Stroh, egal, wie hoch die Flammen lodern mögen, sie geben weder Wärme noch dauerhaftes Licht, und wenn sie ersterben, ist die Kälte umso stärker fühlbar.
Vielleicht würde es mir ja meine Gesundheit zurückgeben, wenn ich das Meer sehen könnte, und vielleicht ist es meine Sühne, dass ich es nicht kann. Denn das einzige Meer, das ich nun habe, ist das der Bilder in meinem Herzen. Vergib mir, mein bretonischer Freund, vergib einem dummen, verängstigten Kind, das dich kränkte und um deinen gerechten Lohn betrog. Und auch wenn ich deinen Namen nicht kenne, so bist du doch seit jenem Tag das Gesicht gewesen, das ich jedes Mal sah, wenn ich das Meer betrachtete. Deine Prophezeiung hat sich erfüllt, ich bin heute der, der du gestern warst, und die elend lange Zeit zwischen diesen beiden Tagen, die meine Hand zu deiner werden ließen, scheint kaum länger gedauert zu haben, als eine Kerze braucht, um bei einer Böe zu verlöschen. Gestern noch war ich ein Knabe. Ein Leben von fünfzig Jahren ist verstrichen wie ein Atemzug.
Als ich ein Kind war, erschien jeder Tag lang, neu und voller Dinge, die ich in Erinnerung behalten wollte. Jeder Stein, den ich umdrehte, war es mir wert, für ein paar Wochen aufbewahrt zu werden.
Aber was habe ich tatsächlich aus den ersten Jahren auf Kanelegres behalten ? Ich weiß, dass bald nach meiner Ankunft ein Bote kam, der den Tod meines Vaters verkündete und zugleich die Geburt meiner Schwester, und dass beide Ereignisse mir fern blieben. Der Tag, an dem der Bote Kanelegres erreichte, war die Vollmondnacht vor Æquinox, und ich war aufgeregt gewesen wegen der Feuer, die die ganze Nacht brennen sollten. Ich wurde aus der Lateinstunde abgerufen. Dies war mir eine so willkommene Unterbrechung, dass ich kaum in angemessener Betroffenheit auf die Botschaft reagieren konnte. Ich wusste lang, dass mein Vater sterben würde, und sein Tod bedeutete dem verwirrten Kind, das ich damals war, kaum mehr als eine Erleichterung und die dümmlich siegreiche Gewissheit, dass nun trotz meines geringen Alters ich der König von Cornwall war, vertreten für die nächsten Jahre durch die Regentin, meine Mutter. Ich selbst dankte dem Boten für seine Mühen und wies altklug an, dass man ihm zu trinken geben sollte, um ihn dann am nächsten Tage mit dem Ausdruck meiner tiefen Trauer, ungebrochenen Sohnestreue und Vaterliebe nach Tintâgel zurückzuschicken. Der kleine Hof zu Kanelegres fand mich gesammelt würdig und einmal mehr einen geradezu geborenen König – und ich war es zufrieden. »Er nimmt es erstaunlich gut auf«, hörte ich meine Ziehmutter im Hinausgehen sagen. Wenn ich kein Kind mehr sein durfte, so wollte ich doch bereits das Morgenlicht jenes Herrschers sein, der dereinst Cornwall regieren sollte.
Meine bretonischen Zieheltern, Berenice und Gordec, versuchten ihr Bestes, mir das Gefühl zu geben, wirkliche Eltern zu sein. Sie bevorzugten mich ihren eigenen Kindern gegenüber in der Auswahl der Kleider und der Speisen. Sie sorgten dafür, dass ich die besten Pferde reiten konnte, und wiesen mich umsichtsreich in ihr höfisches Zeremoniell ein, das nicht eben geschliffen war, um das Mindeste zu sagen. Unwillig, was ich später noch oft bereuen sollte, lernte ich leidlich Latein zu schreiben, zu sprechen und zu lesen. Das Bretonische wurde mir schnell vertraut, und wären die Gefährten nicht gewesen, so hätte ich das Cornische wohl schon im ersten Jahr außer Landes vergessen. Nur für die Musik wollte ich kein rechtes Talent zeigen, vielleicht habe ich deswegen später Tristans Begabung als Harfner und als Sänger so bewundert. Auch die Dichtkunst, wo sie nicht von Heldentaten und Schlachtenruhm erzählte, ließ mich kalt. Vielleicht lag es auch an dem kümmerlichen Priester, den die Gasteltern einzig hatten bezahlen können, für drei Jahre mein Lehrer zu sein.
Es ist, als sei zu jener Zeit nur erst ein geringer Teil meiner Seele geboren gewesen, ein Teil, der mich überleben ließ, aber nicht leben. Und sicher war dies nicht mein bester. Ich weiß nicht wirklich, was ich in dieser Zeit dachte. Ich würde mir wünschen, dass ich ein gutes und verständiges Kind war. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Hauptsache wollte ich nur ein guter Kämpfer sein, selbst die Aussicht auf den Thron zu Tintâgel war mir, je länger ich von zu Hause fortblieb, wenig gegen die Träume, von blutigen Feldzügen, die ich ruhmreich anführte.
Ich war schnell mit dem Langschwert, zielte leidlich mit dem Bogen, und ich wurde bald ein exzellenter und leidenschaftlicher Reiter. Doch andere Erinnerungen an die zwei Mal sieben Jahre in Kanelegres sind wie in ein dunkles Zimmer eingeschlossen. Berenice und Gordec blieben mir fern, wie es sich für Eltern geziemte, und die Ziehgeschwister, vor allem Gâles, der Älteste, mieden mich mit dem Neid aller Kinder einem Bevorzugten gegenüber. »Cornwall ist ein Hosenscheißer«, sang Gâles den Kleineren vor, und sie plapperten seine Ansichten in bewundernder Monotonie nach. Ich verstand sie und härtete meinen Geist und mein Herz gegen die Einsamkeit. Die Gefährten, die mich aus Tintâgel begleitet hatten, waren in der Stille der Bretagne sich selbst überlassen. Einige nahmen Gefährtinnen aus den umliegenden Dörfern und zeugten Kinder, denen sie während der Zeit, als sie mich bewachten und schützten, gute und sorgende Väter waren.
Ich sah sie häufig, und sie waren immer freundlich zu mir.
Wenn ich das Gefühl hatte, völlig allein und verlassen auf der Welt zu sein, ging ich in den Stall und hielt mich an meiner alten Stute fest, die mich hierher getragen hatte. Ich legte meine Arme um ihren Hals und atmete ihren Duft ein. Ihr sanftes Schnauben tat mir wohl, und bisweilen legte sie ihren Kopf über meine Schulter, wenn ich in ihren Verschlag trat. Dann drückte sie sanft gegen mich, bis ich ein paar kleine Schritte zurücktat, um sogleich ihrerseits zurückzuweichen. So ging es ein paar Mal hin und her, es war ein wundervoller Tanz innigster Freundschaft, eine Gunst, die sie nur mir gewährte und die mein Herz davor schützte, ganz und gar zu Stein zu werden. Denn wenn ich auch keinem Menschen nahe sein konnte, so war ich doch diesem warmen und sanften Tier für wenige und kostbare Augenblicke so nah, wie zwei Kreaturen es einander nur sein können. Ihretwegen bevorzugte ich bis zum letzten Tag, an dem ich noch auf einem Pferd sitzen konnte, weibliche Tiere.
Die Jahre, die in der Bretagne folgten, waren langsam gelebt, doch schnell erzählt. Ich lernte zu kämpfen, an Ziegen und Schafen übte ich das erste Töten fremden Lebens, sodass es mich in der Schlacht nicht unvorbereitet treffen sollte. Es erschreckt mich, dass ich heute sagen muss, dass es mich weder belastete noch mir schwer fiel.
Ich beobachtete die alten Kämpfer, wie sie ihre Hiebe und Stiche setzten, und erkannte, dass einige schnell vorgingen, präziser als so mancher Schlachter, als wollten sie dem Vieh oder Mensch Schmerz, Leid und das ungläubige Erschrecken im Augenblick des eigenen Sterbens so kurz wie möglich halten. Andere hingegen suchten die Stelle, an der das Blut hervorbrach, ohne den Getroffenen rasch zu töten. Sie weideten sich – so schien es mir – nicht nur an seinem Leid, sondern waren beglückt, dass sie durch einen so geringen Aufwand und oft nur durch das Glück eines Augenblicks dieses Schauspiel hervorrufen konnten. Ich weiß nicht, ob ich wirklich über das Sterben nachdachte, als vielmehr über die besten und sichersten Techniken, den Tod anderer zu erwirken. Mein eigener Tod war mir unvorstellbar, ebenso wie Altern, Schmerz und Krankheit, die ich überall um mich herum sah.
Hier in der Fremde hatte ich es nach den ersten Monaten des Kummers vermocht, mir in der Einsamkeit meiner Seele eine Feste zu errichten, die weder andere Menschen noch ihre menschlichen Sorgen einließ. Dabei waren mir die Adligen ebenso gleichgültig wie das einfache Volk.
Ich war mir der einzige Verbündete, den ich brauchte, der einzige Verbündete, den ich noch hatte, und ich dachte nicht daran, diese karge Allianz aufs Spiel zu setzen für einen trügerischen Moment des Gefühls oder der Nähe.
Als ich dreizehn war, im Winter vor meiner ersten Schlacht, begann ich, die Frauen anders anzusehen. Es war, als suchte ich an ihren Gestalten oder in ihren Gesichtern nach etwas Wichtigem, doch ich konnte nicht sagen, was es war.