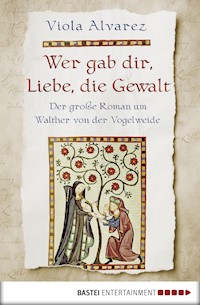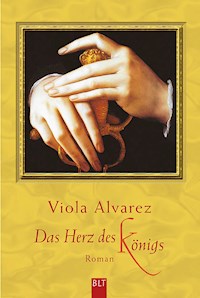9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lange war Hayso fast blind, von der Dorfgemeinschaft verstoßen. Als er wie durch ein Wunder wieder sehen kann, lässt er sich in der Priesterstadt Wydlu'n nieder. Doch dann stolpert er eines Morgens über die Leiche der jungen Frau, mit der er die Nacht verbracht hat. Kurze Zeit später stirbt eine zweite Frau. Auch sie kannte Hayso.
Aufgeschreckt versucht Hayso herauszufinden, wer in der Stadt die Macht in den Händen hält, und gerät in ein dichtes Netz aus Lügen und Intrigen. In ihrem Zentrum: das Geheimnis des Himmels, die Himmelsscheibe, die im Turm des Dunklen Meisters verborgen ist. Hayso und seine Freunde fassen den waghalsigen Plan, sie zu stehlen und an ihren Ursprungsort zurückzubringen, und geraten in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Viola Alvarez
Der Himmel aus Bronze
Die Steine des Gorr Roman
luebbe digital
luebbe digital
März 2009 Vollständige eBook-Ausgabe der bei Gustav Lübbe Verlag erschienenen Hardcoverausgabe luebbe digital in der Verlagsgruppe Lübbe Originalausgabe © 2008 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach Lektorat: Daniela Thiele Datenkonvertierung eBook: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8387-0001-4
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Para Carlos Alvarez (11. 01. 1911–18. 03. 1979)Lo que fuiste, nunca muere.
Eins
Der Tod der Fünfzehn
Diese furchtbaren Bilder, wenn ich nachts die Augen schließe. Jede Nacht, immer noch.
Fünfzehn Männer liegen in einer Reihe nebeneinander, wie zerbrochene Zweige. Als ob ein Kind mit ihnen gespielt hätte. Als hätte jemand an ihnen zu zählen geübt.
Der Tod?
In einer Reihe geradezu wie aufgebahrt. Schlafende Krieger, der lange Schlaf der Toten. Und alle glänzen sie. Sie glänzen vom Eis, das ihre Körper und Gesichter überzogen hat.
Es sieht still aus, friedlich.
Wenn nur das Geschrei nicht wäre. Gellendes Geschrei eines ganzen Dorfes. Ich höre die sich überschlagenden Stimmen: »Tod!«, kreischt es.
Die zänkische Berra, sie wohnt ganz nahe am Morgentor und bildet sich viel darauf ein, alle Neuigkeiten zuerst zu wissen.
»Der Tod ist gekommen«, schreit eine andere Frau, »der Tod ist vor unsere Tür gekommen!«
Es ist das Jahr des Raben im zweiten Kreis des Wolfs.
Die Alten sagten, dass dies ein Jahr der Kriege werden könnte, ein Jahr voll Übel.
Wir haben viel von dem vergessen, was die Alten wussten; vergessen jeden Tag mehr – fast alle, fast alles.
Ich bin Hayso. Mein Name birgt Gefahr für alle, die ihn hören.
Der Morgen der fünfzehn Toten.
Mir wird kalt, als ich mich vor die Tür schiebe.
»Tod«, gellen weitere Schreie.
Ich renne los, stolpernd, renne auf das Morgentor zu wie die anderen, und bleibe hinter ihnen zurück wie immer.
Sie liegen vor dem Morgentor.
Ich hätte eigentlich schneller da sein müssen, aber ich wohne nicht in der Hütte der Junggesellen. Noch nicht, sage ich mir vor. Jedoch im Innersten weiß ich, sie werden mich nie dort einziehen lassen. Meine Hoffnung ist längst Täuschung geworden.
Aber manche Winter überlebt man nur mit Hoffnung. Und dieser Winter war der kälteste von allen.
So kalt, als hätten die Götter gerade erst die Kälte erfunden. Als wäre sie noch unbenutzt, noch nicht erprobt in ihrer verheerenden Grausamkeit.
Brennende Kälte, trocken, dass sie einen in der Nase sticht wie Hornnadeln in die Finger, wenn man nicht aufpasst beim Nähen. Oder auch, wenn man nicht gut sehen kann – wie ich.
»Tod!« Lautere Schreie: »Tod!«
Dabei schreien sie nicht aus Trauer, weil die Männer tot sind, denn keiner von uns kennt sie. Sie sind fremd, vollkommen fremd. Unbekannte Tote.
Das Dorf trauert nicht. Die Menschen fürchten sich. Sie schreien, weil diese Fünfzehn fremd sind. Ja, und weil sie – vereist sind. Vereist, in diesem trockensten aller Winter. Es ist der Mond der weißen Nächte, aber seine Nächte sind diesmal nie weiß geworden. Keine Schneeflocke. Nur Kälte, unbarmherzige, nicht abbrechende Kälte. Die Götter schickten uns eine Botschaft. Eine Botschaft ihres Zorns.
Ich schob mich unbemerkt durch die Schreienden, das war nicht schwer, denn niemand achtete je auf mich. Ich ging vorsichtig auf die Knie und kroch ganz nahe an die Toten heran. Ich musste an alles ganz nah herangehen, damit ich etwas sehen konnte. Die vereisten Toten, ihre Gesichter waren ernst und traurig.
Es waren schöne Gesichter starker Männer. Ich beugte mich über einen von ihnen nahe herab, näher an sein Gesicht, und zuckte entsetzt zurück.
Der Mann unter dem klaren Eis hatte keine Augäpfel mehr. Mein Herz stolperte, mir wurde schlecht. Ich beugte mich zitternd über den Toten neben ihm. Er auch nicht. Ich krabbelte auf allen vieren an der Reihe der Toten entlang. Keiner von ihnen. Fünfzehn Männer ohne Augen, blind in ihrem stillen Schlaf unter dem Eis.
Jetzt wollte ich auch schreien, aber kein Laut kam aus meiner Kehle. Was hatten diese Männer, bevor sie starben, gesehen? Welches Bild hatte mit ihnen sterben sollen?
Ein Mensch ohne Augen, es war die tiefste Blindheit, die ich mir vorstellen konnte. Offene, leere Höhlen, dunkel und dumpf in der Helle des Tages, ungeschützt und erbarmungslos gleichzeitig.
Unter dem grellen Schreien der Dorfbewohner, das sich über mir formte, kroch ich herum und sah mir die Fünfzehn an.
Sie waren sehr ähnlich, fast gleich gekleidet. Weiße Wolfsfänge auf dem Kopf, alle hell und sauber gekämmt. Sie trugen fein gewebte Hosen und Hemden aus gegerbtem Hirschleder darüber, keines geflickt.
Nur die Gürtel, die sie trugen, waren unterschiedlich.
Sie waren bestickt, bei jedem in einer anderen Farbe und mit anderen Zeichen. Die Zeichen waren zu klein für mich. Dennoch trank ich ihren Anblick geradezu in mich hinein.
Auf der Stirn, genau in der Mitte über den leeren Augenhöhlen, trugen die Männer alle ein Mal.
Es war ein Kreis, umgeben von kleinen Punkten. Ich versuchte, sie zu zählen, aber sie waren zu klein, verschwammen vor meinen unfähigen Augen, siedelten in ineinanderfließenden Gruppen an der Linie des Kreises. Innen? Außen? Wie viele? Ich konnte es nicht ausmachen, fünf, sechs …
»Hayso!« Jemand rief meinen Namen. Es war meine Tante, die mich suchte. Ich duckte mich.
Das Angstgeschrei verlangte nach einer Bahn, einem Gesang, in den es ufern könnte. Aber unsere Gesänge waren schon fast vergessen. Vergessen kommt schnell.
Wenn es noch Älteste gegeben hätte, hätten sie es uns vielleicht erklären können, was es bedeutete, die Männer so zu finden, dachte ich. Sie hätten einen Schutzgesang gewusst oder einen Gegenzauber. Vielleicht …
»Hayso!«, kreischte meine Tante. »Habt ihr den Jungen gesehen?«, fragte sie herum. Niemand machte sich die Mühe, ihr zu antworten. Ich hielt die Luft an und wartete.
Es gab bei uns keine Ältesten mehr, keinen einzigen. Keine Seher, keine Knochenrenker, keine Sterndeuter, keine Kräuterweisen.
Wir hätten gewarnt sein sollen; Zeichen der Götter:
Zum Ende des letzten Sommers, bereits im Mond der Zweiten Frucht, hatte der große Ginsterbusch draußen am Abendtor zur Unzeit geblüht.
Und Wynerr, der Alte, hatte gesagt: »Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn es im Mond der Zweiten Frucht noch eine Blüte gibt, kann nichts daraus gedeihen.«
Zwei Tage später war Wynerr tot.
Wynerr war unser Knochenrenker. Bald danach waren die anderen Weisen auch gestorben, noch bevor der Winter so kalt wurde, wie er jetzt war. In nur einem Herbst wurden wir zu einem Dorf ohne Älteste – und damit: ohne Geschichte. Und damit: ohne Zukunft.
Jetzt wusste keiner irgendetwas, was zu sagen war zu den Fünfzehn. Schreien ist kein Sagen. Und die Gesänge konnte keiner ausführen, nicht ohne die Alten. Die Alten hatten gewartet, zu lange, sie hatten versäumt, sich rechtzeitig Nachfolger heranzubilden.
Mein Dorf war ein dummes Dorf, das weiß ich jetzt. Dumm und ängstlich. Heute weiß ich, dass Angst nichts mit Klugheit oder Dummheit zu tun hat. Heute weiß ich, was geschehen war, um es dumm zu machen – und ängstlich.
Heute weiß ich manches, was ich vielleicht lieber nicht wüsste. Die Götter haben mir keine Wahl gelassen.
Ich denke an den halbblinden Jungen von damals, der ängstlich um die Toten herumschlich, versuchte, das Unbegreifliche zu begreifen: Hätte dieser Junge gewusst, welch unfassbares Geheimnis an seine Tür gekommen war, was hätte er getan? Wie viele Wege gibt es für uns? Einen? Mehrere?
Auch wenn diese Bilder in fast jeder Nacht in meinem Schlaf wiederkehren: Es war kein Traum, damals.
Fünfzehn fremde Männer, tot und mit Eis überzogen, lagen vor dem Morgentor. Das war die Wirklichkeit.
Der Wächter der Zweiten Dunkelheit musste auf seiner Wache geschlafen haben, denn er hatte sie nicht kommen und nicht sterben sehen. Und den Zauber, der das Eis über sie ausleerte, hatte er auch nicht gesehen.
Da kam Rinn.
»Still«, befahl er, noch bevor er durchs Tor war. Er sah gar nicht weiter nach den Fünfzehn, schrie nur den Wächter an. »Hundsfott!«, brüllte er und schlug nach ihm.
»Du hast geschlafen!« Rinns Schlag ging ins Leere, der Wächter hatte sich geduckt.
Er warf sich auf den Boden und stammelte Entschuldigungen. »Ich habe nicht geschlafen. Es war ein Zauber, sieh doch! Eis! Wie können sie mit Eis überzogen sein?«
Aber Rinn wollte nicht sehen. Er trat nach ihm und fluchte, als würde das helfen, das Geheimnis zu lüften.
»Ich lass dich in Jauche ertränken«, drohte Rinn dem Wächter an und trat weiter.
»Tod, der Tod ist gekommen, es sind die Krieger des Todes«, kreischte Berra, und die anderen Weiber fielen ein:
»Krieger des Todes«, jaulten sie in Wechselgesängen.
Rinn ließ schwitzend von dem Wächter ab, der rollte sich ächzend zur Seite und rannte in den Wald. Was sollte er auch machen? Gegen Rinn kam niemand an.
Rinn war der Firstho der Dorfes. Kein wirklicher Häuptling, er nannte sich nur so seit dem Winterbeginn. Wir nannten ihn schließlich alle so. Niemand widersprach ihm, egal, was er tat oder sagte.
Es widersprach ihm niemand, weil alle Angst hatten.
Er war der Stärkste der Jäger und hatte auf einmal seit dem letzten Tagesfest im Mond der Ersten Ernte außerdem einen Sack voll Salz – auch wenn niemand wusste, woher das Salz kam.
»Wo Salz ist, ist besser auch Schweigen«, lautet ein wahres Wort.
Jetzt gab es kein Schweigen mehr. Als Rinn sich endlich umgedreht hatte, entlud sich die Angst, gierten alle nach einer Erklärung, danach, dass er uns sagen würde, was es bedeutete. Dass es nicht der Tod wäre, der zu uns gekommen war, dass er wenigstens nicht uns gelten würde.
»Wer sind die?«, jammerte Anvis, eine der reichen Jungfrauen, die im Frühjahr im Haus der Jäger dienen sollte. »Warum ist der Tod zu uns gekommen?«
»Also, wir haben geopfert«, zischte Wisturp, meine Tante, selbstgefällig.
Die Männer schrien nicht mit. Sie starrten Rinn nur an. Rinn sollte erklären.
Er sah sich gehetzt um. »Beruhigt euch, Leute«, rief er mit heiserer Stimme.
Aber weder wusste er zu sagen, wer die Toten wären, woher sie kämen und warum sie vereist und ihrer Augen beraubt waren. Vor allem aber vereist – in einer Zeit ohne Wasser, ohne Regen, selbst ohne Schnee, jede noch so muntere Quelle war gefroren. Die Furcht vor diesem Zauber war größer als die Furcht vor Rinn und seinem Salz.
Eghar, der Rinn in allem nachlief wie ein Hund, trat in die Luft, wo zuvor der Wächter gekauert hatte. Das Gekreisch der Frauen ebbte nicht ab.
»Still, hab ich gesagt!«, brüllte Rinn.
»Still, hat er gesagt«, zischelte Eghar beflissen.
Die Frauen klagten weiter, rauften jetzt schon ihr Haar, willens in Trauer, die Strähnen über der Stirn auszureißen und mit Dornen in die Kopfhaut zu ritzen.
Als Rinn seine eigenen Frauen und Töchter unter den Klagenden sah, schreiend, spuckend, die Dornen für das Trauerblut schon im Haar, erstarrte er: Er straffte sich wütend und ging auf sie zu. Rinn konnte sich vier Frauen leisten, aber er mochte keine von ihnen.
Er riss seiner Hauptfrau den Dornenkamm fort. »Nicht!«, brüllte er und schlug sie ins Gesicht.
Es machte ein dumpfes Geräusch. Sie schrie kurz auf. Sie war an Schläge gewöhnt. Die anderen drei Frauen Rinns stoben winselnd von den Toten weg. Auch die Klage der anderen Weiber ebbte ab, als wäre es mit einem Mal weniger erschreckend, was geschehen war.
Eghar stand jetzt neben Rinn und drohte den Heulenden noch mehr Schläge an, die sie sich nur bei ihm abzuholen bräuchten.
Aber eine Antwort war all das nicht.
Die fünfzehn Männer lagen still da. Sie waren völlig unversehrt, und das war das Unheimlichste.
Keinem war der Schädel eingeschlagen, keinem war ein Stich gesetzt worden, keinem ein Strick um den Hals gelegt.
Wie waren sie also gestorben?
Wynerrs Sohn, der zwar kein wirklicher Knochenrenker war, aber seinem Vater lange genug zugesehen hatte, betastete wichtig die Arme und Beine der Eismänner. Er steckte fröstelnd seine Hände unter die Achseln und schüttelte sich.
Dann flüsterte er mit Eghar, der an Rinn weitertuschelte, dass wohl nichts gebrochen wäre. Wynerrs Sohn sähe keine Schwellungen oder Verfärbungen unter dem Eis, wie sie in solchen Fällen zu sehen sein müssten.
Auch nicht an den Augen. »Es ist fast«, tuschelte er, »als ob ihnen die Augen einfach so aus dem Kopf gesprungen wären!«
Rinn spuckte aus.
Die Frauen kauerten in einem wogenden Haufen, die Männer standen im Kreis nebeneinander und versuchten, ihre Ratlosigkeit zu verbergen.
Die paar Sklaven, die das Dorf hielt, spähten ängstlich um die Pfähle des Wachturms.
Blau gefrorene Füße scharrten auf der harten Erde. Sie hüpften in ihren Lumpen umeinander und freuten sich. Für sie konnte unerklärlicher Tod zu jedem Tag, jedem Augenblick kommen.
Rinn gab den Männern ein Zeichen, und sie stellten sich etwas weiter vom Tor entfernt im Halbkreis auf, als wäre dies eine gesetzgebende Versammlung.
Die Frauen wagten wieder, leise miteinander zu sprechen.
»Wir sollten ihnen die Ohren durchstoßen«, schlug Berra vor. »Dann hören wir, was sie als Letztes gehört haben.«
Zwei Mädchen kicherten.
»Was?«, keifte Berra nach hinten. »In meiner Jugend wurde das bei Fundleichen immer so gemacht.«
»Ja, von denen, die es können«, keifte Rinns dritte Nebenfrau giftig. Niemand sagte etwas darauf.
Zu viele dachten wohl insgeheim, dass Rinn etwas mit dem Tod der Alten zu tun hätte, von denen es vielleicht einer gekonnt hätte.
Ich stand dumm zwischen ihnen allen.
Zwischen den Männern, den Weibern, den Kindern, den Sklaven. Nie war mir so sehr aufgegangen, dass das mein Leben war. Allein zwischen allen.
Ich konnte nicht gut sehen. Alles, was weit entfernt von meinen Augen war, verschwamm zu einem Farbenbrei. Das war immer schon so gewesen.
Ich war über sechzehn Winter hinaus in diesen Tagen.
Längst schon hätte ich bei den Junggesellen einziehen sollen. Dass ich es nach dem letzten Tagesfest wieder nicht tun durfte, redete ich mir ein, war nur ein Versehen, eine Verzögerung. Aber ich wusste die Wahrheit trotzdem.
Wer würde mich in seiner Sippe haben wollen? Ich würde nie ein Handwerk lernen können mit meinen Augen, nie jagen gehen, nie Waffen tragen.
»Hayso!«, zischte mir meine Tante Wisturp da ins Ohr. Jetzt hatte sie mich also gefunden. Im Dorf hielten alle meine Tante für verrückt. Vermutlich war sie das auch.
Ich versuchte, mich umzudrehen, ohne meine Beschämung zu offen zu zeigen.
Verwischt machte ich das Zeichen der Ehrerbietung, das der eigenen Mutter gebührt. Ich war zu alt für dieses Zeichen, aber solange ich in ihrem Haus wohnte, musste ich es in der Öffentlichkeit machen.
»Hayso«, sie zog mich beiseite, ihre knorrigen Finger gruben sich in meinen Nacken. »Das hier ist gefährlich.«
Sie ließ mich gleich wieder los, wedelte mit den Händen gegen die Erde, als Wehrzauber, während sie sprach.
Ich hoffte inständig, dass uns niemand beobachtete. Die unpassenden Vertraulichkeiten meiner Tante waren mir jeden Tag schmerzhaft peinlich.
»Ja«, sagte ich nur.
Meine Tante war sehr aufgeregt, sie zog an mir.
»Einer muss dafür sterben«, fuhr sie fort und schnalzte drei Mal, um das Gesetz anzurufen.
»Rinn wird einen der älteren Sklaven wählen«, flüsterte ich, ich hoffte, sie würde mich damit in Ruhe lassen. Natürlich musste einer dafür sterben.
Einen der älteren Sklaven hinzurichten, der bald ohnehin nur noch hätte versorgt werden müssen, das wäre ein guter Richtspruch. Rinn war zwar nicht klug, nur gerissen, aber so würde es sein. Da fasste sie mich wieder am Arm, als wäre ich noch ein Kind und kein Mann, den zu berühren ihr nicht gestattet war.
»Das wird er nicht.« Sie zitterte jetzt, und ihre Augen flackerten irre. »Er wird dich wählen.«
Zwei
Das Mooropfer
Ich hätte lachen wollen – wenn ich nicht gleichzeitig voller Entsetzen gefühlt hätte, dass es sogar stimmen könnte.
Einer musste sterben, um das Dorf zu beruhigen und die Götter zu besänftigen, wenn schon niemand deuten konnte, weswegen sie in Aufruhr waren.
Ein Sklave wäre zu gering für das Ausmaß des Grauens, einer der anderen Männer zu notwendig. Ich war nicht notwendig, ich war verzichtbar.
»He, ihr«, herrschte Rinn da und schüttelte seinen Gürtel.
Die Frauen duckten sich, die Sklaven rannten, dass sein Blick nicht auf sie fallen sollte. Die Männer standen stumm. Sie waren notwendig, arbeitsam. Sie konnten sich sicher fühlen.
»Ihr«, Rinn hob die rechte Hand mit gespreizten Fingern.
Er wollte also tatsächlich Gesetz sprechen.
Rinn war unser Gesetz. Er war groß. Größer als alle anderen. Rinn war stark, sein Gesicht zeigte jene rücksichtslose Verbissenheit und Wut, die viele Menschen als die Wahrzeichen eines Anführers ansehen. Laut und schmetternd rief er: »Es gibt keinen Grund zur Unruhe! Diese Männer sind nur eine Fopperei böser Geister. Blendwerk. Schatten. Wir werden sie verbrennen und nie wieder von ihnen sprechen. Wer von ihnen spricht, ruft die Schatten zurück.«
Die Frauen schnarrten sofort mit der Zunge, um die Schatten von sich und ihren Sippen fernzuhalten.
»Nie wieder soll von ihnen gesprochen werden«, wiederholte Rinn und schnalzte. Die anderen Männer klickten auch.
Blendwerk? Wo sie hier alle lagen, und jeder sie hatte anfassen können? Schatten?
Meine Tante grabschte nach meinem Ärmel und zog an mir, als wollte sie mich hinter den Frauen vor Rinns Blicken verbergen.
»Es wird ein Opfer im Moor geben«, fuhr Rinn fort. Mir wurde noch kälter, als es ohnehin war. Moortod. Langsames Versinken im grünen Schlamm. Vor allen ersticken und ertrinken. Und dabei keinen Mucks von sich geben, um die eigene Sippe nicht zu entehren und um die Götter nicht zu verstimmen. Seit jeher hatte ich vor nichts so viel Angst wie vor dem Moortod. Ich hatte schon viermal dabei sein müssen, als ein Opfer gebracht wurde. Wie sollte ich das können? Es wäre eine Ehre, hieß es immer. Ich war dieser Ehre offensichtlich nicht würdig.
Rinn machte eine Pause, als würde er nachdenken.
»Maver wird das Opfer sein«, verkündete er.
Alles zuckte zusammen. Maver, die schönste unter den Frauen! Maver gab einen unterdrückten Schrei von sich. Alle wussten, dass Rinn sie in diesem Winter dauernd beschlafen hatte. Sie trug schon sichtbar sein Kind, aber sie war keine seiner Frauen.
Mavers Vater und Brüder hatten Rinn gewähren gelassen, weil sie dachten, er würde sie mit dem Frühlingsfest zu seiner fünften Frau nehmen. Weil er jetzt so viel Salz hatte, schien es möglich zu sein. Das Dorf hatte den Mund gehalten.
Nun hatte er sie mit dem Kind zum Opfer bestimmt.
»Maver«, drohte er, »zeige, dass du Ehre hast! Grüße den Moortod mit Freude.«
Niemand widersprach. Eine Schwangere war ein großes Opfer. Leben im Leben, hieß es. Die Götter könnten es nicht ablehnen. Egal, was sie erzürnt hatte, damit müssten sie zufrieden sein. Beifälliges Raunen ging durch die Menge.
»Mehr ist nicht zu sagen«, Rinn spuckte aus.
Mavers Mutter bohrte sich den Dornenkamm in die Handballen. Maver hielt sie fest. Sie war sehr blass.
»Das ist gut«, zischte meine Tante und kicherte.
Für sie war es gut.
Ich war der einzige männliche Nachkomme, den sie noch hatte. Mein Onkel lag sehr krank, lange schon. Es war im Jahr des Kaninchens gewesen, als er sich tagsüber aufs Lager gelegt hatte und seitdem kaum mehr aufstehen wollte. »Eine gute Wahl«, rief meine Tante laut. Berra warf ihr einen verächtlichen Blick zu.
Wenn Rinn mich für den Moortod gewählt hätte, dann hätte meine Tante sich bald die Finger abschneiden müssen. Das war in meinem Dorf damals ein fester Brauch. Wir waren zu arm für Witwen.
Letztes Jahr erst hatte sich die Witwe des Gerbers die Finger abschneiden müssen, nachdem ihr Sohn bei der Jagd umgekommen war. Wir hatten ihr alle zugesehen, wie sie die Hand an den Türpfosten legen musste und dann selbst die Klinge zog, um ihr Einverständnis mit dem Willen der Götter zu bekunden.
Rinn hatte danach allen wertvollen Besitz aus ihrem Haus in seines tragen lassen und es anschließend angezündet. Bis zum nächsten Mondwechsel hatten alle der armen Alten noch etwas gegeben, von dem sie so eben überleben konnte. Oder man hatte sie heimlich im Stall schlafen lassen. Heimlich, weil es ja der Wille der Götter war, dass sie nun sterben sollte.
Als dann die Kälte begann, fingen die Leute erst an, ihr auszuweichen, dann sie zu verjagen.
In der ersten scharfen Frostnacht im Mond der Dunklen Nächte war sie erfroren – vor Rinns Schwelle, die Hand ohne Finger noch im Tod nach Hilfe ausgestreckt.
Meine Tante wusste viel besser als ich, wie es den sohnlosen Witwen erging, deswegen war sie froh über Rinns Entscheidung. Natürlich zählte ich nicht wirklich als ein Sohn – und nie, nie, nie hätte ich als Jäger ihr Überleben sichern können. Nicht mal mein eigenes in einer Herde schlafender Rehe.
Aber solange mein Onkel noch lebte, würde das niemand allzu offen sagen. Solange mein Onkel lebte, lebten wir in seinem Schutz.
Alle außer Mavers Sippe waren zufrieden mit Rinns Entscheidung. Er hatte keinen Jäger wählen können und keinen Handwerker und auch keine ihrer Frauen.
Es musste jemand sein, den das Dorf nicht brauchte, und den die Götter trotzdem nicht als zu gering einschätzen würden. Maver war in der Tat die beste Wahl.
Dass ihre Schönheit mit ihr verschwand, war Männern und Frauen gleichermaßen recht.
Auf einmal schien die Ordnung wiederhergestellt. Rinn nickte voller Genugtuung über seine weise Entscheidung.
Die ersten Männer fingen an, die Fünfzehn – sie waren steif wie Pfähle – ins Dorf zu tragen. Rinn ging sehr zufrieden voran.
Die Frauen zauderten um Maver und ihre Mutter herum und schnatterten von hoher und höchster Ehre – tauschen wollte aber keine, als Mavers Mutter ihnen das anbot. Die Frage allein schon war eine Schande.
»Früher wäre so etwas nicht möglich gewesen«, plusterte Berra sich auf.
Meine Tante wandte sich dem Pulk dann ebenfalls zu, um nichts zu verpassen. »Also, wir haben immer geopfert«, hörte ich sie noch sagen, dann verschlang das Gemurmel der anderen Frauen ihre Stimme.
Ich stand vergessen. Soweit ich erkennen konnte, waren nun die Männer alle mit dem Wegtragen der ersten Eisleichen beschäftigt und die Frauen mit Maver.
Niemand achtete auf mich, hoffte ich. Ich ging ganz nahe an einen der Fünfzehn heran und versuchte, mehr zu erkennen.
Das Haar unter dem Eis war fein gesetzt und vermutlich mit Talg in Windungen gekämmt, dann aus zwei Strängen in Schnecken über der rechten Schläfe gedreht. Eine fremde Haartracht. Fremd und kunstvoll. Niemand trug so etwas hier. Auch die Bärte waren gekämmt und seitens geflochten, viel feiner, als es selbst einer wie Rinn mit seinen vier Frauen hinbekommen konnte.
Und ihre Stiefel waren kaum abgelaufen, die Sohlen heil. Die linke Hand hatten sie alle auf die Schwertknäufe gelegt. Die Finger sahen locker und entspannt aus, ohne Absicht, die Schwerter zu ziehen. Ich ging so nah an die Hand eines der Toten heran, dass mein Atem das Eis ein bisschen zum Schmelzen brachte.
Da sah ich, dass die Fingernägel ganz waren, nicht eingerissen, die Fingerkuppen nicht verhornt. Und dann völlig überraschend: Die Männer hatten frische Blasen auf der vornehmen Haut ihrer Hände, als hätten sie kurz vor ihrem Tod noch eine schwere Arbeit verrichtet, die sie ansonsten nicht zu tun brauchten.
Was für ein Zauber konnte solch mächtige, starke und gesunde Männer mit Eis überziehen und töten? Das musste ein gewaltiger Zauber sein. Warum fragte niemand danach? Warum wunderte sich niemand?
Schatten, hatte Rinn gesagt. Das waren keine Schatten. Schatten konnte man nicht anfassen, und sie hatten keine Blasen an den Händen.
»Hau ab, Nichtsnutz!«
Eghar! Ich hatte ihn nicht kommen hören. Er trat mich in die Rippen, dass ich umfiel. Eghar, Rinns hündischer Beisteher.
Ich biss mir auf die Zunge und robbte zur Seite.
Auch er war groß, aber kahl; mit einem Mund, dem man seine Schwatzhaftigkeit ansah. Ich mochte Eghar noch weniger als Rinn.
»Hau ab!«, wiederholte er.
»Hayso«, zischte meine Tante und gab mir einen Schlag auf den Kopf. »Der Junge ist einfach nur ein Tollpatsch«, sie lächelte Eghar an und zeigte verächtlich auf mich. »Eine Prüfung«, sagte sie und lachte albern, »eine wahre und wahrhaftige Prüfung ist der.«
Manchmal fragte ich mich, wie lange ich diese Schmach noch aushalten konnte.
Aber welche Wahl hatte denn einer wie ich?
Alles verfügbare Holz wurde umgehend aus den Häusern des Dorfes zusammengetragen, um die Fünfzehn zu verbrennen.
Ich lugte aus dem Koben meines Onkels hervor, dessen Haus direkt am Versammlungsplatz stand. Ich hatte mich versteckt, denn ich wollte mich nicht wieder treten lassen. Oder schlagen. Oder anspucken. Oder versengen. Es gab nichts, was ich noch nicht kannte, wenn es um das andauernde Strafen meiner Unvollkommenheit ging.
Hayso, der Nutzlose, das war ich. Ich war fast blind, und ich war dicklich, schon immer gewesen, weil ich mich nicht bewegen konnte wie die anderen.
Weil meine Tante mich lächerlich ausfütterte, um den Reichtum des Onkels herzuzeigen.
Im Alter und bei Frauen war Beleibtheit natürlich ein hoher Wert. Aber ich war einfach nur dick. Ein nutzloser Esser, ein Vielfraß. »Ein Kuckucksei«, sagten sie über mich und lachten geifernd. »Ein richtiges Kuckucksei!«
Mein Vater war ein reisender Schmied gewesen, ein »Zähmer des Feuers«, hieß es. Von ihm hatte ich die dunklen und die schwarzen Haare, was es in unserem Dorf noch nie gegeben hatte
Er war vor langer Zeit umgekommen, damals in den ersten Tagen im Jahr des Eichelhähers, im ersten Kreis des Wolfs. Angeblich nur Tage nachdem er mich gezeugt hatte. Meine Mutter war dann bei meiner Geburt gestorben, verblutet.
Ich bin im Mond der Hohen Sonne geboren, im Jahr des Dachses.
Mein Leben lang gab es nur die Kreise des Wolfs; schlechte Jahre. »Absteigend schlechter, einer nach dem anderen«, sagte der Onkel oft in einem Ton, als ob es an mir läge.
Ich habe diese viel zu kurze Geschichte vom Tod meiner Eltern nie ohne den Unterton gehört, dass es schade um beide war – und dass nichts dabei herausgekommen war, das Nichts war eben ich. Nichtsnutz, unwürdig.
Warum der Onkel und die Tante mich damals aufnahmen und mich nicht einfach als Sklave verkauften, wusste ich nicht. Die Tante wird nie müde zu erwähnen, wie sie über zwei Jahreskreise lang eine Amme zahlten, um mein Überleben zu sichern.
»Für das, was mich der Junge schon gekostet hat«, sagte sie jedem, der ihr noch zuhörte, »könnte ich mir zwei Türpfosten beschlagen lassen.« Dazu gackerte sie dann, begeistert von sich selbst.
Türpfosten konnte man verkaufen, mich nicht.
Jedenfalls nicht so leicht.
Gynn, mein Onkel, war der Bruder meiner Mutter.
Er war früher ebenfalls Schmied, Waffenschmied, gewesen. Er wurde sehr reich und wurde dann ein Waffenhändler, der andere Schmiede für sich arbeiten ließ.
Mein Onkel und meine Tante hatten zwei Töchter, die in andere Dörfer geheiratet hatten, und drei Söhne, die mannbar geworden waren.
Der Älteste war ein Jäger gewesen, und ein Bär hatte ihn erledigt, hieß es. Daran sieht man gut, wie reich der Onkel war. Der Älteste war in Wahrheit betrunken auf die Jagd gegangen, hatte übermütig einen Bären verfolgt und war auf einem bemoosten Stein ausgeglitten. Er hatte sich beim Sturz den Hals gebrochen und den Schädel eingeschlagen, aber niemand durfte das sagen.
»Bärenjäger, Bärentod, Bärenehr!«, dröhnte mein Onkel Gynn gerne wichtig, und die Leute nickten dann höflich dazu.
Der zweite Sohn war an faulem Fleisch oder faulem Wasser gestorben, vor vier Sommern. Der dritte Sohn war von einem Räuber erschlagen worden. Vier andere hatten die ersten Jahre gar nicht überlebt. Nur ich war übrig.
»Ein verfluchtes Haus«, sagte die gehässige Berra gerne, »Tote und ein Nichtsnutz.«
Der Onkel trank seit dem Tod seines zweiten Sohnes den Rest des Reichtums weg, den er angehäuft hatte. Er verließ das Haus schon lange nicht mehr. Nur mit Rücksicht auf das, was er einmal gewesen war, sagte man immerhin noch, dass er »leidend« wäre, nicht einfach versoffen.
Aber seit Rinns Selbsternennung zum Herrscher wurden die alten Höflichkeiten ausgemustert. Viel zu wenig galt noch von den althergebrachten Gesetzen.
Eigentlich galt dieser Tage nur noch, was Rinn sagte.
Wen er bevorzugte, dem huldigte man besser. Wen er ablehnte, dem durfte man ausweichen, ihn nicht grüßen. Was den Onkel anging, hatte sich Rinn wohl noch nicht entschieden. An dem Tag, an dem er es tun würde – wenn der Onkel solange noch lebte –, würde es für mich wirklich gefährlich werden.
Nicht nur der Winter war kalt in diesem Jahr, alles war kalt und gefährlich geworden. Manchmal spürte ich die Angst im Dorf wie ein wildes Tier, das knurrend und doch körperlos herumschlich, breit, Beute zu schlagen.
Eines Tages würde sich das Dorf in seiner Angst ein weiteres großes Opfer suchen, dessen war ich sicher.
Im Dorf am großen Versammlungsplatz, an dem schon seit jeher die wichtigsten Sippen wohnten, wurde der Scheiterhaufen errichtet. Rinns Haus lag nicht an diesem Platz, deswegen wurde der alte Platz seit Kurzem immer unwichtiger. Oder besser, das klägliche Viereck vor Rinns Haus wurde langsam der neue Versammlungsort.
Auch diese Zeremonie hätte Rinn sicher gerne vor seinem eigenen Haus abgehalten, aber es gab dort nicht genug Platz, das Feuer hätte sein Haus abbrennen können.
Der alte Versammlungsort war schäbig geworden, vernachlässigt.
Die alten Familien, deren Häuser seit dem Ende des Großen Weges an diesem Platz gestanden hatten, wussten in den letzten Monden nicht, was mit ihnen geschah. Ihr Einfluss schwand.
Rinn kam aus einer unbeachteten Sippe. Ihr Zeichen war das Eichhörnchen. Er war bis vor Kurzem nur ein Jäger gewesen, wenn auch ein sehr erfolgreicher.
Aber die Veränderungen waren wie ein Sturm gekommen. Sie fegten die alten Bräuche fort und die Gesetze. Seit er etwas galt, galten nur noch Jäger etwas. Seine Jäger.
Jäger, die, von Eghar angeführt, gegen alle Regeln und Riten verstießen, ohne dass es geahndet wurde. Von wem auch?
Zweimal waren schon Mädchen aus dem Haus der Jungfrauen entführt und brutal vergewaltigt worden. Eines der Opfer starb sogar, das andere war im ganzen Gesicht verstümmelt, auch die Zunge verschnitten. Es gab kein Gericht. Wenn der, der Recht sprach, der Verbrecher war, was wäre der Schiedsspruch gewesen?
Aber das durfte man nur denken, nie sagen, nicht einmal in den Baum der Götter durfte man einen solchen Verdacht wispern. »Der Wille der Götter«, sagten die Leute zueinander, nach dem Verbrechen an den beiden Mädchen. Aber sie sahen dabei nicht ergeben aus, nur ängstlich. Vor allem die, die Eltern von Töchtern waren.
Aber auch die mit Söhnen hatten Sorgen.
Die jungen Männer, deren Väter viel Geld bezahlt hatten, damit der Schmied, der Schneider oder der Waffenmeister sie als Gehilfen und mögliche Nachfolger in Betracht ziehen würden, zeigten nun keinerlei Interesse mehr an den ehrwürdigen Fertigkeiten dieser Meister.
Alle wollten nur Rinns Jägern angehören.
Vielleicht, wenn meine Unfähigkeiten mich nicht von vorneherein ausgeschlossen hätten, hätte ich das auch gewollt. Ein Jäger sein; Ruhm und Ehre einlegen. Beute und Verdienst für alle. Ich, Hayso, der Nichtsnutz.
Vom Koben her sah ich zu, wie sich das Dorf um die Leichen der Fünfzehn scharte, den Scheiterhaufen bereitete.
Rinns Jäger waren in vollen Waffen angetreten, sie bliesen in ihre Luren und pochten auf ihre Schilde, als wären dies anerkannte Sitten. Vielleicht waren es die neuen Sitten, die dem Dorf seine alten Gesänge und eigentlichen Geschichten ersetzen würden. Der Gedanke ekelte mich.
Spott und Hochmut, das waren meine einzigen Waffen – und ich richtete sie gegen alle. Stumm natürlich, stumm und nutzlos.
Als das Feuer entzündet wurde, wollten einige der Weiber wenigstens die notwendigen Todesrufe ausstoßen. Rinn wisperte mit Eghar, und der knurrte und keifte in die Menge der Frauen, bis Stille herrschte. Ich hörte das Krachen der unteren Holzscheite und sah verschwommen die Farben der auflodernden Flammen.
Rinns Männer warfen die erste Leiche auf den Scheiterhaufen. Da fiel mir ein, dass man sie ja erst mal in der Nähe des Feuers hätte auftauen können, um zu sehen, ob sie vielleicht geheime Zeichen oder etwas in ihren Taschen trugen. Aber niemand sonst schien auf diesen Gedanken zu kommen.
Ich war sicher nicht der Klügste im Dorf. Andere mussten vor mir daran gedacht haben und hielten auch den Mund. Schweigen überall um das Feuer herum. Das Schweigen des Dorfes war eine Zustimmung – wozu?
Dunkler Rauch stieg auf, und mit ihm wehte der übliche Gestank einer Verbrennung über uns hinweg. Meine Tante hustete und wandte das Gesicht ab. Da wehte, als der zweite Tote in die Flammen geworfen wurde, eine starke Böe über den Versammlungsplatz.
Berra kreischte auf.
»Der Brunnen«, rief sie, »deckt den Brunnen ab!«
Aber es war schon zu spät. Ein Hauch wirbelnder Asche war über dem Brunnen niedergegangen. Die Frauen verbargen aufheulend das Gesicht in den Händen.
Die Männer taten es ihnen nach, sogar Eghar.
Dann herrschte Stille. Niemand heulte mehr, niemand sprach.
»Ruhe«, brüllte Rinn dumm, obwohl außer dem Flackern der Flammen nichts zu hören war. Wenn einer in der Stille Ruhe befiehlt, klingt es noch schlimmer, dass niemand etwas sagt. Alle hielten ihre Gesichter verborgen. So großes Unglück wollte niemand auf sich ziehen, dass er zugesehen hätte, wie Feuer und Wasser sich begegneten. Nur Rinn und ich, wir sahen hin. Er gehetzt, rastlos, weil er um seine Macht fürchtete. Ich starrend, dämlich, weil ich gewohnt war, alles zu beobachten, ohne selbst bemerkt zu werden.
»Was ist?«, schrie Rinn und wischte sich den Mundwinkel, als hätte er gegeifert. Niemand antwortete. Der Glaube an das Unheil, was das Zusammentreffen von Feuer und Wasser bringt, war zu alt, den konnte auch ein Winter mit Rinn nicht auslöschen.
Scheite im Feuer rutschten auseinander. Es wurde Zeit, sich darum zu kümmern.
Aber niemand regte sich. Feuer und Wasser waren sich »ohne Spruch« begegnet. Ein unvorstellbares Übel, ein Frevel, Vergehen an allen Göttern.
Es gab nur eine Abhilfe:
Der Sitte nach musste nun Wasser von einer unbeschmutzten Quelle geholt werden, bevor wieder jemand aus dem Brunnen trinken durfte. Nur wenn dieses Wasser vor Sonnenuntergang desselben Tages noch in den Brunnen gegossen würde, würden die Götter vergeben. Was für ein Tag! Vielleicht das Ende der Welt. So schien es mir jedenfalls. Ich hätte abwarten sollen. Die Welt war nicht am Ende. Nur ein kleiner Teil von ihr.
Rinn sah sich um, aber keiner seiner Diener und Gefolgsleute stand ihm bei in diesem Augenblick.
Auch seine Frauen hielten die Köpfe gesenkt und verharrten in der Stille. Stille, in der gespannt und sprungbereit ein Aufstand hockte. Rinns Blick flackerte, suchte nach einer Möglichkeit.
Da sah er mich.
Er sah mich an, und plötzlich breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. So groß und strahlend, dass sogar ich es erkennen konnte, nur für einen Augenblick. Dann wurde er wieder ernst und hart wie immer.
»He, du«, herrschte er mich an. Ich wollte es nicht, aber ich zuckte zusammen. »Du, Nichtsnutz! Hayso, Neffe des Gynn, Sohn eines Toten«, rief mich Rinn. Einige seiner Jäger lachten leise.
»Hast du etwa gewagt, mit anzusehen, wie sich Wasser und Feuer begegneten?« Ich schluckte, wollte gerne eine tapfere Antwort geben und senkte dann doch nur feige den Blick.
»Wisturp, Gynns Weib, dein Neffe hat unser Dorf entehrt«, verkündete Rinn hämisch. Meine Tante hatte den Blick noch gesenkt und hielt sich an Rinns zweiter Frau fest. Rinn machte weiter:
»Es gibt nur einen Weg, wie er das gutmachen kann!«
Ich sah wieder hoch, gelähmt vor Angst, und bemerkte, wie Mavers Sippe ebenfalls erwartungsvoll die Köpfe hob. Würde ich nun doch das Mooropfer sein?
»Ihr wisst es!«, tönte Rinn und breitete die Arme aus.
»Er muss uns reines Wasser holen, um den Brunnen zu retten.« Rinn grinste und berührte mit vorgetäuschter Ehrerbietung seine Kehle, den Sitz des Wassergottes im Mann. Immer mehr Köpfe hoben sich, andere Männer berührten ihre Kehlen, und schließlich sah ich auch einige der Frauen ihre Bäuche berühren, wo bei ihnen der Wassergott lebte.
»Hayso, Nichtsnutz«, plärrte Rinn wieder. »Du musst gehen und Wasser holen.«
Dann wisperte er Eghar etwas ins Ohr, der gleich losstob, den heimlichen Befehl auszuführen.
»Er muss gehen«, wiederholte Rinn, die Hand an der Kehle. Das Feuer fiel schnell weiter auseinander und verlor an Hitze. Er musste handeln, um das Dorf unter Kontrolle zu behalten.
»Zu den Steinen«, fügte er an, und alle hielten den Atem an. Rinn sah sich um. »Zu den Steinen«, beharrte er.
»Er muss zu den Steinen gehen«, wiederholte da auch schon Berra, natürlich Berra, und stieß meine Tante an, die sich an ihrem Amulett festhielt, schwächlich wankend, soweit ich erkennen konnte.
»Er muss zu den Steinen!«, rief Berra abermals. Da hielt meine Tante es nicht mehr aus und sagte es auch. Leise und heiser. Aber sie sagte es: »Hayso – zu den Steinen.«
Und auf einmal riefen sie es alle: »Hayso zu den Steinen, Hayso zu den Steinen!« Wie ein Gesang der Befreiung – oder der Vernichtung, für mich wenigstens. Mavers Familie rief am lautesten. Rinn nickte selbstgefällig.
Eghar kehrte zurück. Er hielt eine alte Schale aus Himmelsmetall in der Hand. Sie glänzte im Schein des zerstiebenden Feuers.
»Hierher, Hayso«, rief mich Rinn, wie einen Hund.
Ich konnte mich nicht bewegen.
»Sollen meine Jäger dich holen?«, brüllte er da.
Davor hatte ich Todesangst, also bewegte ich mich auf ihn zu, zwei Schritte immerhin, dann fiel ich, weil ich vor lauter Furcht nicht auf den Weg geachtet hatte.
Eines der Kinder hatte mir wahrscheinlich ein Bein gestellt, das machten sie oft.
Alle lachten, Rinn am lautesten.
»Falls der überhaupt mal aus dem Dorf rausfindet«, juchzte Eghar. Daraufhin lachten alle noch mehr. Lachten, kreischten vor Lachen und wischten sich die Augen.
Rinn nickte vor sich hin.
Meine Tante hielt beschämt den Ärmel vor ihr Gesicht.
Rinn gab ein unauffälliges Zeichen an seine Jäger. Zwei von ihnen sprangen zum Feuer, um sich um das Holz zu kümmern, zwei andere packten einen weiteren der Toten und warfen ihn gleich hinein. Jetzt waren nur noch zehn übrig. Die vereisten Leichen verbrannten und verkohlten zischend.
Eghar kam indessen auf mich zu, packte mich von hinten und schleifte mich über den Boden, bis ich vor Rinns Füßen lag.
»Da ist er. Hayso ist ein Frevler«, versetzte er.
»Darum muss er zu den Steinen gehen. Hayso, der Nichtsnutz, muss zu den Steinen gehen.«
Ich zitterte. Eghar hatte seinen Fuß auf meinen Rücken gesetzt und urinierte plötzlich auf meinen Nacken. Ich fühlte die Erniedrigung so scharf wie eine Klinge. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nach all den täglichen Demütigungen noch etwas in mir hatte, dem dieses Schauspiel etwas ausmachen würde. Aber es machte mir etwas aus. Bevor ich es verhindern konnte, krümmte ich mich und erbrach mich – auf Rinns Füße.
Er sprang überrascht zwei Schritte zurück, strauchelte und fiel schließlich auf den Hintern, sodass wir uns auf gleicher Ebene befanden. Ich wischte mir hustend den Mund. »Du Untam!«, fluchte er.
Eghar stieg umgehend von meinem Rücken herunter, um seinem Meister beflissen aufzuhelfen. Die Schale behinderte ihn. Er wusste nicht, was er damit machen sollte, auf den Boden setzen durfte er sie nicht.
»Gib schon her«, herrschte Rinn Eghar an und riss ihm die Schale aus der Hand.
Er hätte die Schale gerne nach mir geworfen, vermutete ich, aber auch das war verboten.
»Hier, Nichtsnutz«, er rammte sie mir absichtlich hart vor die Stirn, die anderen konnten es nicht sehen, es tat sehr weh. Ich sah Funken in der klaren Luft, die nicht vom Feuer stammten.
»Zu den Steinen.«
Ich suchte in meiner völligen Verzweiflung den Blick meiner Tante, aber sie schämte sich so sehr, dass sie sich mit abgewendetem Gesicht in die Hocke hatte sinken lassen. Ich sah, wie sie schluchzend vor und zurück schaukelte.
Rinn machte aufmunternde Zeichen mit beiden Händen: »Zu den Steinen!«, wiederholte er, und alle fielen ein.
Ich rutschte erst auf den Knien, dann versuchte ich aufzustehen, nahm mit zitternden Fingern die Schale in die linke Hand und lief unter dem bedrohlichen Chor der Dörfler, begleitet vom Prasseln der Flammen, auf das Morgentor zu, Eghars Nässe und Gestank im Nacken. Mir kamen die Tränen.
Wie durch ein Wunder fiel ich kein zweites Mal.
Es war seit jeher meine Gewohnheit, meine Schritte zu zählen. Es half mir, weniger anzustoßen. Bevor ich zählen konnte, hatte ich einen Singsang, der für mich bestimmte Schrittabfolgen im Haus meiner Tante und meines Onkels begleitete. Als ich das Haus schließlich manchmal verließ, reichte der Singsang nicht mehr aus. Deshalb lauschte ich den Händlern am Versammlungsplatz ihre verschiedenen Zählsysteme ab. Viele rechneten nur bis zu den Fingern, die meisten. Dann gab es welche, die Elle, Arm und Spanne noch mitzählten. Außerdem hörte ich Reisenden zu, die Kiesel in einem Tontopf zum Rechnen benutzten. Die ersten zehn hatten die gleichen Namen wie die »Zehnfinger«, danach aber begann ein kompliziertes System von Dopplungen und Klicklauten, mit dem man aber ein paar Mal so weit zählen konnte. Das versuchte ich mir zu merken.
Ich konnte inzwischen unendlich oft die »Zehnfinger« zählen, auch wenn ich nicht wusste, wozu mir das je nützen sollte. Ich hatte meine eigenen Zählweisen erfunden und unterhielt mich damit, wenn ich mal wieder untätig irgendwo herumsaß.
Vom Versammlungsplatz bis zum Morgentor waren es zwölf mal »Zehnfinger«, die lief ich jetzt aber, ohne nachzudenken, noch blinder als sonst, wegen der Tränen, die ich nicht verhindern konnte. Endlich sah ich den Herzpfahl des Morgentores und hielt mich einen Augenblick daran fest.
»Was machst du denn hier, Junge«, rief der Wächter hinunter. »Wieso bist du nicht bei den anderen am Feuer?«
Es war Nohm.
Der Wächter der Zweiten Dunkelheit war wohl noch nicht wiedergekommen. Jedenfalls hatte Nohm seinen Platz eingenommen. Ich erkannte ihn an der Stimme, sein Gesicht war zu weit fort.
Nohm war der Schwestersohn meiner Tante. Er gehörte zwar auch zu Rinns Jägern, aber er war freundlich. Als ich noch klein war, hatte er mir manchmal Geschichten erzählt, von sprechenden Kieseln und Geistern, von Vögeln, die die Zukunft weissagten, und vom Dachs, der mit dem Fuchs jagen ging.
»Ich muss zu den Steinen«, rief ich mit noch immer wackliger Stimme zu Nohm hinauf.
»Wieso das denn?«, wollte er erschrocken wissen.
»Es ist Asche in den Brunnen geweht. Ich habe hingesehen. Rinn will es.«
»Warte«, sagte Nohm und kletterte durch die Luke zu mir hinab.
Er legte mir die Hand auf die feuchte, klamme Schulter, eine freundliche Hand, wie ein großer Bruder, der mich beschützen wollte.
»Er kann dich doch nicht alleine zu den Steinen schicken, an so einem Tag! Das ist lebensgefährlich.«
Ich fing wieder an zu schluchzen und hielt mich zitternd an der Schale fest.
»Warte, Kleiner«, sagte Nohm, »ich komme mit, ich muss nur eben Ersatz finden.« Ein Wächter durfte seinen Posten nie verlassen, Nohm wusste das besser als ich. Schon zu mir herunterzuklettern, war ein Verstoß.
Selbst Ersatz holen zu gehen, wäre ein Verstoß gegen alle Regeln. Er könnte dafür hingerichtet werden. Dennoch hörte ich in seiner Stimme, dass er es ernst meinte. Es war ein so schrecklicher Tag. Ich wollte nicht noch mehr Unheil anrichten.
»Nein«, antwortete ich schwach. »Ich gehe alleine.«
Ich fühlte auch so etwas wie Trotz. Ich dachte wütend und vermessen, ich würde es ihnen zeigen können, wenn ich lebendig von den Steinen zurückkäme.
Nohm berührte mit beiden Daumen seine Stirn, als wäre ich ein gleichwertiger Mann, ein Krieger oder Jäger, vor dessen Mut er Achtung hatte. Dabei war niemand mutiger als Nohm.
»Die Gefahren deines Weges mögen stets einen Schritt hinter dir gehen«, sagte er, in seiner Stimme klang echte Zuneigung.
»Vielleicht sind die noch langsamer als ich«, versuchte ich einen Witz.
Nohm lachte aber nicht. »Wenn du zum Abendhorn nicht zurück bist«, meinte er besorgt, »werden wir dich suchen.«
»Rinn würde das nicht wollen«, antwortete ich.
Nohm legte nun seine Daumen an meine Stirn. »Bruder«, hieß das, »Waffenbruder.«
Mir wurde ganz heiß vor Freude. Nohm war mein Freund, mein einziger Freund.
»Ich würde das wollen«, sagte er nur und kletterte dann wieder auf den Ausguck des Morgenturms.
Ich machte einen Schritt aus dem Tor heraus und begann zu zählen.
Drei
Bei den Steinen des Gorr
Das Zählen meiner Schritte lenkte mich von meiner Angst ab. Ich schleppte sie dennoch mit mir herum wie einen Steinquader.
Es war gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, wovor ich mehr Angst hatte. Vor dem, was mir so alleine im Wald geschehen konnte, oder vor dem, was mir geschehen konnte, wenn ich bei den Steinen ankam.
Ich zählte und versuchte, nicht an halb verhungerte Wölfe oder einen vor der Zeit erwachten Bären zu denken.
Ich hätte ja doch nicht weglaufen können, nicht mal vor einem tollwütigen Fuchs. Vermutlich hätte ich ihn nicht mal gesehen, bis er mich beißen würde. Aber die Aussicht, was geschehen könnte, wenn ich möglicherweise lebend bei den Steinen ankäme, war auch nicht viel besser.
Die Steine sind ewig und elend. Es ist schwer zu erklären, was die Steine sind und was sie meinem Dorf bedeuteten; alle hatten Angst vor ihnen.
Dies ist ihre Geschichte:
Vor dem Morgen der Zeit, vor der Zeit der Großen Kälte, im Zweiten Alter der Bärin waren die Steine vom Waldgott mitten in die dichtesten Bäume hineingesetzt worden. Sie standen dort, wo das Grün der Blätter auch bei hellstem Sonnenschein alles so dunkel machte wie zur Mitternacht. Die Steine ragten höher als zehn Männer aus dem Grün heraus und schimmerten auch bei Nacht hell wie Pilzkappen.
Dann im Dritten Alter der Bärin waren unheimliche Wesen in die Steine eingezogen. Dort führten sie seitdem gefährliche Riten aus, die kein Mensch je überlebt hatte, um Genaueres davon zu berichten.
Man hörte nichts außer den Liedern, die der Wald sang, wenn man nahe an den Steinen war. Wissen konnte keiner, was dort vor sich ging. Aber der Priester hatte es gesagt.
Als das Dorf noch einen Priester gehabt hatte, das war nun auch schon drei Jahreskreise her, im Jahr des Bibers, hatte er allen strengstens verboten, sich den Steinen zu nähern.
»Geht ruhig, Neugierige«, hatte er gesagt. »geht ruhig, wenn ihr den Anfang der Welt zu Ende machen wollt.«
Natürlich wollte das niemand.
Er selbst war dennoch bisweilen hingegangen und hatte sich dafür in höchsten Preisen vom Dorf für die Gefahr bezahlen lassen, die er auf sich nahm. Was er dort tat, oder warum ihm nichts geschah, begriff keiner – fragte keiner.
Oder vielleicht wusste ich es nur nicht. Der Priester hatte mich am wenigsten von allen gemocht.
»Du, Hayso«, hatte er mir stets mit seinem faulen Atem ins Gesicht gezischt, »du bist ein Unfall der Götter.«
Das Dorf erzählte außerdem Folgendes:
In der Zweiten Zeit der Pferde oder noch früher, war es wohl schon vorgekommen, dass Wasser von der Quelle an den Steinen geholt werden sollte, um einen Frevel zu sühnen. Woher das Gesetz stammte, war vergessen.
Entweder waren damals die tapfersten Jäger alle zusammen gegangen, oder Verbrecher, auf deren Tod es nicht ankam. Auch das hatten wir nur vom Priester gehört. Erlebt hatte es zu meiner Zeit im Dorf noch keiner, dass jemand zu den Steinen ging.
Auf meinen Tod kam es auch nicht an, niemandem – nur mir. Ich war schon vierzehn Mal die »Zehnfinger« gegangen und versuchte anders zu zählen, um mich weiter abzulenken. Ich musste mich sehr konzentrieren, um nicht zu fallen, nicht zu stolpern über die Wurzeln und die anderen Fangarme des Waldgottes.
Meine Hände, die krampfhaft die Schale hielten, waren blau und zittrig. Ich war es nicht gewohnt, so lange draußen zu sein. Meistens saß ich bei meinem Onkel am Feuer. Die Kälte tat meinem ganzen Körper weh. Mein Atem verfing sich in meinen Haaren und vereiste sie.
Ich blieb stehen, als es mir auffiel. Konnte ein Zauberer oder ein Gott die Fünfzehn vielleicht mit seinem Atem getötet haben?
Da riss mich ein Geräusch aus meinen Gedanken. Ich glaubte, Stimmen zu hören.
Keuchend sah ich mich um.
»Ganz ruhig«, redete ich mir selbst zu, als wäre ich ein aufgescheuchtes Tier.
Immerhin ging ich noch auf dem richtigen Weg, dem Handelspfad, der wegen der Trockenheit diesen Winter nicht zugewachsen war. Im Winter wucherten die Wege jenseits der Wetterscheiden sonst unkenntlich zu. Die ersten Händler, die nach dem Lichtfest kamen, schimpften immer, dass sie sich teuer Sklaven mieten mussten, die ihnen mit Äxten und Schwertern den Weg frei zu hauen hatten.
Es war nicht nur teuer, es war vor allem gefährlich, einem Sklaven eine Axt oder ein Schwert zu geben – es mussten ja auch kräftige sein, keine Alten oder Verstümmelten.
Oft fanden die ersten Jagdzüge nach dem Winter erschlagene Händler, deren Sklaven sie überwältigt hatten und geflohen waren.
Ich stand still und lauschte auf mein Keuchen.
»Wohin geflohen?«, fragte ich mich zum ersten Mal.
So ungewohnt wie das Laufen im Freien war mir auch das Denken ohne die Zäune der begrenzten Selbstverständlichkeit des Dorfes.
Mein Dorf lag in den Höhen der Wälder des Gorr, zu Mittag der großen Heideflächen Lynmallis, zu Abend der wilden Flüsse, zu Morgen der Minen, zu Mitternacht der Zwuas Berge. Damals war mir das alles kein Begriff.
Außer meinem Dorf kannte ich so gut wie nichts. Es war schwierig genug für mich, mich dort zurechtzufinden. Und dann war ich zu bestimmten Festen natürlich wie alle anderen auch hin und wieder im Wald direkt vor dem Abend- oder Morgentor gewesen. Und im Moor, wenn geopfert wurde. Aber nie alleine. Und nie so weit.
Ich wusste – wie alle es wussten –, dass man auf dem Handelspfad gehen musste bis zur Gespaltenen Eiche, um die sich einst zwei Dämonen gezankt hatten.
Dort würde der Handelspfad sich zu einer Seite biegen, und ein kleiner Pfad führte auf der anderen Seite zu den Steinen. Ich fing an, ein Lied zu singen: »Der Frühlingsgott lehnt am Zaun und lockt die feinen Flügel …«
Ein Kinderlied, aber mit einem Mal vergaß ich die Verse.
Hinter mir knackte es, mein Herz schlug so laut, dass ich mich verschluckte.
Ich hielt den Atem an. Da war jemand. Etwas.
Aber nichts passierte, obwohl ich die kahlen Zweige immer wieder rascheln und knacken hörte. Ich starrte verzweifelt hierhin und dorthin, von wo ich die Geräusche hatte kommen hören. Endlich meinte ich erschrocken, Schatten zu sehen, die hin und her schwankten.
Bäume? Äste? Mörder, die Toten ihre Augen stahlen?
Nichts geschah.
Da ging ich weiter, überall Schweiß auf der eiskalten Haut. Egal wie ich es drehte und wendete: Ich ging meinem Tod entgegen.
Ich hatte folgende Möglichkeiten:
Ich könnte ins Dorf zurückkehren. Dort würde man mich dann entweder auch im Moor oder über dem Brunnen opfern, weil ich meinen Auftrag verfehlt hatte.
Ich könnte weitergehen und mich verlaufen.
Spätestens gegen Abend würden mich – wenn ich nicht erfroren wäre – wilde Tiere fressen.
Ich könnte natürlich auch bei den Steinen ankommen. Aber auch da wartete der Tod.
Es war ein Spiel, das ich mein Leben lang gespielt hatte, zu überlegen, was ich alles tun könnte – weil ich ja eben nichts tat. Dann suchte ich mir immer in aller Ruhe die beste Möglichkeit zu handeln aus, ohne dass ich sie in die Tat umgesetzt hätte.
Jetzt war es fraglos die beste Möglichkeit, mich nicht umzudrehen und nicht hinzufallen, sondern weiterzugehen und lebend bei den Steinen anzukommen, um Wasser zu holen und wieder lebend im Dorf anzukommen.
Hinter mir knackte es erneut. Das trieb mich voran.
Als ich an der Gespaltenen Eiche ankam, hatte ich noch sechzig weitere Zehnfinger-Schritte zurückgelegt.
Noch nie in meinem Leben war ich so weit vom Dorf entfernt gewesen.
Ich konnte es nicht mehr hören, den Rauch nicht mehr riechen.
Ich zitterte mehr als zuvor. Ich stand vor der Gespaltenen Eiche. Weiter oder zurück? Ich merkte, dass ich auch noch nie in meinem Leben alleine etwas hatte entscheiden müssen, ohne zu wissen, was verboten und was erlaubt war. Zum Schlafen, zum Essen, zum Waschen, zum Schwitzhaus, zum Arbeiten – für alles gab es Erlaubnisse oder Verbote. Die meisten Dinge, die erlaubt waren, standen mir natürlich sowieso nicht zu.
Und die Dinge, die verboten waren, die konnten mir natürlich dauernd passieren, weil ich so ungeschickt war.
Da, auf einmal, wie ich vor der Gespaltenen Eiche fror und mich fürchtete, ergriff mich großer Leichtsinn.
Vielleicht hatte er mit diesem ganzen seltsamen Tag zu tun, der mit Tod begann, und der gut auch mit Tod enden könnte – mit meinem Tod.
Ohne weiter zu grübeln, streckte ich die Hand aus und berührte die Gespaltene Eiche.
Unerwartete Hitze durchfuhr meinen ganzen Körper. Fast hätte ich die Schale fallen lassen, so durchzuckte es mich.
Ich war aber nicht tot – jedenfalls, wenn nicht das nächste Leben einfach genau da weitergeht, wo das augenblickliche aufhört.
Also lebte ich. Und mit der plötzlichen Wärme im ganzen Körper hatte ich auch erstmals ein leises Gefühl der Hoffnung weiterzuleben, diesen grässlichen Tag überleben zu können.
»Wie ihr es wollt«, sagte ich zu den Göttern, und meinte es.
»Aber ich will leben«, sagte ich zu mir selbst – und meinte es auch. Und suchte dann nach dem kleinen Weg auf der anderen Seite der Gespaltenen Eiche, der mich zu den Steinen führen sollte.
Ich sah nichts. Die kahlen Zweige und losen Blatthaufen foppten meine schwachen Augen.
Da berührte ich die Eiche noch einmal:
»Du bist mein Freund«, sagte ich zu ihr. »Hilf mir, den Pfad zu den Steinen zu finden.« Nichts geschah.
Ein Wintervogel schrie irgendwo über mir, unheimlich.
Es klang nicht wie die üblichen Vögel des Waldes.
Wie eine Mischung aus einem Habicht und einer Krähe klang es.
»Bitte«, sagte ich. Der Vogel schrie abermals, sehr hoch, sehr weit entfernt. Ich drehte den Kopf. An einem dünnen Stamm links über mir bewegte sich etwas.
»Das?«, fragte ich die Eiche und den Vogel. Ich machte zwei Schritte darauf zu.
Es war ein Lederband, fest um den Stamm geknüpft. Jeder Jäger, der einen guten Jagdgrund kennzeichnen wollte, benutzte solche Bänder, das wusste ich von Nohm.
Wenn ein junger Mann seine erste große Beute gemacht hatte, hatte mir Nohm erklärt, dann durfte er sich ein Knüpfmuster auswählen, das die Geschichte seiner ersten großen Jagd erzählte. Ich hatte Nohms Muster fühlen dürfen. Das hier war ein anderes.
Es war auch ein anderes Leder, als ich je eins gefühlt hatte, viel weicher, feiner und dünner gegerbt. So fein gegerbt wie die Hemden der toten Fünfzehn.
Ich hielt eines der hängenden Bänder ganz nah an die Augen. Abwechselnd kniff ich eines zu, um besser sehen zu können. Jemand hatte Zeichen darauf gemalt. Zwei sich voneinander fortneigende Bögen – die Gespaltene Eiche? Dann viele kleine Wellen, die einen sich windenden Weg hätten darstellen können. Und dann: die Steine. Auch wenn ich sie noch nie gesehen hatte, wusste ich gleich, dass die Zeichen am Ende des Bandes die Steine darstellen sollten. Es war ein Wegweiser.
Aber wer würde den Weg zu den Steinen markieren?
Für wen? Ich blickte angestrengt an dem dünnen Stamm vorbei und sah schließlich einen zart ausgetretenen Pfad inmitten der Wildnis.
Ich begann neu zu zählen und tastete mich auf diesem Pfad voran. Kleine verfrorene Dornzweige zerkratzten meine Beine. Eins meiner Stiefelbänder musste aufgegangen sein. Ich hörte es über die Erde schleifen.
Meine Nase lief, und ich fühlte ein Stechen unter den Rippen, weil ich das viele Laufen nicht gewohnt war. Der seltsame Vogel schrie erneut, und diesmal dachte ich, er wolle mir etwas sagen. Dass ich lieber langsamer machen sollte oder sonst eine Warnung. Ich blieb stehen, wollte die Schale absetzen und bückte mich nach meinem Stiefelband.
Genau in dem Moment, als ich in die Knie ging, hörte ich ein Sirren und dann den dumpfen Einschlag einer Pfeilspitze. Ich warf mich flach auf den Boden, die Schale bohrte sich in meinen Bauch. Jetzt!, dachte ich. Jetzt kommen sie.
Dann hörte ich Schritte, durch das Dickicht zischelnde ungehaltene Stimmen. Jetzt, dachte ich wieder, aber die Stimmen entfernten sich. Ich weiß nicht, wie lange ich mich nicht rühren konnte vor Angst. Die Kälte und die Schale unter mir wurden irgendwann aber schmerzhafter als meine Furcht. Zunächst versuchte ich, mich hinzuknien. Ich sagte mir die ganze Zeit die Schrittzahl vor, die ich gelaufen war, als könnte mich das wie ein Wunder am Leben erhalten. Mit zusammengebissenen Zähnen wartete ich auf den zweiten Pfeil.
Nichts geschah. Ich wartete weiter. Mit der linken Hand tastete ich schließlich nach dem nächsten Baumstamm, um mich hochziehen zu können. Ich stand und suchte nach dem Pfeil, den ich hatte einschlagen hören. Schließlich sah ich den Schaft in einem Buchenstamm nur wenig von mir entfernt.
Es war ein Pfeil völlig fremder Machart, viel schöner als unsere, besser als unsere, soweit ich das beurteilen konnte.
Nohm machte unbestritten die besten Pfeile des Dorfes, ganz gerade und mit zwei absolut gleichen Seiten an der Spitze. Aber diesen Pfeil hier, den hätte nicht mal Nohm machen können. Es ist eine seltsame Sache, einen Pfeil zu bewundern, der im eigenen Kopf hatte stecken sollen.
Ächzend versuchte ich, ihn aus dem Baum zu ziehen, damit ich eine Art Waffe hätte.
Der Pfeil musste mit ungeheurer Wucht, also von einem ebenso guten Bogen, geschossen worden sein, so fest steckte er im Holz. Ganz gegen meine Gewohnheit gab ich aber diesmal nicht auf, zog und ruckte, bis er schließlich herauskam. Von der Spitze war ein Stück abgebrochen, aber sie war auch an den Seiten so scharf, dass sie eine gute Waffe abgeben würde. Natürlich würde auch die beste Waffe mir nicht wirklich helfen können, aber es fühlte sich besser an, sie bei mir zu tragen.
Für einen Augenblick, als ich weitergehen wollte, konnte ich mich nicht mehr an die Zahl meiner Schritte erinnern. Wie viele Schritte seit der Gespaltenen Eiche? Mit zitternder Hand hob ich die Schale auf.
»Denk doch nach«, drängte ich mich selbst.
Der hohe unbekannte Vogel schrie. Es klang, als wäre jemand bei mir.
Ich ging weiter. Mit einem Mal hatte ich ein unbekanntes Gefühl der Zuversicht in mir.
Ich würde bei den Steinen ankommen. Lebend. Ich würde es schaffen.
Und ich kam bei den Steinen an. Nach endlos weiteren Zehnfinger-Schritten. Noch nie in meinem Leben war ich so müde gewesen. Die Angst, die Kälte, die Erschöpfung, die ungewohnte Bewegung, die Anstrengung auch, so weit zu zählen und es zu behalten – all das hatte mir so sehr zugesetzt, dass ich geradezu glücklich war, die Steine zu sehen.
Für einen Moment machte es nichts mehr, dass ich hier vom Schweigenden Zauber, von den Geistern der Steine auf fürchterliche Art gemordet werden konnte.
Es machte auch nichts, dass ich – sollte ich hier nicht sterben – den ganzen Weg zurückfinden müsste. Ich, Hayso, der halb blinde, blöde Nichtsnutz war angekommen. War nach zweihundertfünfundzwanzig mal zehn Schritten angekommen.
Keuchend trat ich aus dem Wald heraus und sah die Steine.
Vier
Das Rätsel des Wandbehangs
Alles, was ich je über die Steine gehört hatte, verblasste zu einem nichtigen Flüstern, als ich an ihrem Fuß stand.
Auf einer vertieften Lichtung gelegen, ragten sie in der Tat höher als zehn Männer aus dem Wald hervor.
Sie waren von einer atemberaubenden Schönheit.
Glatt und weiß, als hätte sie jemand aus der Erde herauspoliert. Kein Moos wuchs auf ihnen, kein Pilz, kein Schimmel. Ich sah zu meinen Füßen auch keine Kotspuren oder Hufabdrücke von Schweinen, Ziegen oder anderen Tieren. Der Weg, der aus dem Wald heraus auf die Steine zu führte, war sauber, als wäre er gekämmt worden wie Wolle für einen Firstho.
Ich verharrte nur einen Moment und begann dann vorsichtig, nach einem Eingang zu tasten, um dort nach der Quelle zu suchen, aus der ich das Wasser schöpfen sollte.
»Die Macht aller Wesen sei gesegnet«, rief ich einen bekannten Haussegen, von dem ich blödsinnigerweise hoffte, er würde die fürchterlichen Bewohner freundlich stimmen.
Außer dem Wind in den kahlen Ästen und dem Rascheln im Unterholz war nichts zu hören. Ich folgte dem sauberen Pfad und kam schließlich an einer Mulde im Felsen an. Die Vertiefung war von Menschen in diese Steine gehauen, das fühlte ich an den scharfen Kanten, an denen nicht so viele Jahreskreise vorbeigegangen waren, wie an den Steinen selbst.
Ich ging einen Schritt vor und sah weniger als sonst.
Es wurde schummrig. Ich ertastete eine geflochtene Tür, die unverschlossen aufschwang. Im Gang klappte sie ebenfalls gegen Stein. Diese Geister hier brauchten offenbar keine Wächter, so machtvoll waren sie.
»Hallo«, rief ich trotzdem in den dunklen Gang hinein, der sich vor mir zum Inneren der Steine verjüngte.
»Die Macht aller Wesen«, fing ich an und brach ab.
Keine Antwort.
»Hallo«, rief ich. Nachdem sich meine Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, meinte ich am Ende des Schachtes einen Lichtschein zu sehen.
Feuer! Eine Feuerhüterin! Mein Herz stolperte einen Moment. Dann dachte ich, dass ich der Feuerhüterin ja alles erklären könnte. Die Feuerhüterinnen in unserem Dorf, als sie noch lebten, waren meist sehr nett zu mir gewesen.