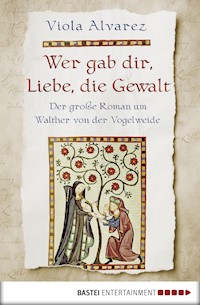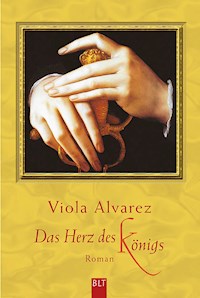9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Europa im späten fünften Jahrhundert. Ein Skalde wird von zwei Soldaten entführt und verschleppt. Obwohl der Dichter seit zwei Jahren kein Wort mehr gesprochen hat, ist er für den machtgierigen Auftraggeber der Entführung, einen minderen Burgunderkönig am Rhein, wertvoller als pures Gold.
Denn er ist Bryndt Högnisson, das Kind von Königin Brynhild und ihrem heimlichen Geliebten Hagen von Tronje. Und Bryndt ist der Einzige, der die Wahrheit über die namenlose Tragödie im Hunnenland kennt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 839
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungTeil 1: Vegur, Der Weg, AufgesangDas Land der Untergegangenen. Die erste ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die zweite ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die dritte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die vierte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die fünfte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die sechste ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die siebte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die achte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die neunte ErinnerungTeil 2: Hjartan, Das Herz, AbgesangDas FestDas Land der Untergegangenen. Die zehnte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die elfte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die zwölfte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die dreizehnte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die vierzehnte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die fünfzehnte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die sechzehnte ErinnerungDas Land der Untergegangenen. Die Letzte ErinnerungDas Vermächtnis des Bryndt HögnissonÜber dieses Buch
Europa im späten fünften Jahrhundert. Ein Skalde wird von zwei Soldaten entführt und verschleppt. Obwohl der Dichter seit zwei Jahren kein Wort mehr gesprochen hat, ist er für den machtgierigen Auftraggeber der Entführung, einen minderen Burgunderkönig am Rhein, wertvoller als pures Gold. Denn er ist Bryndt Högnisson, das Kind von Königin Brynhild und ihrem heimlichen Geliebten Hagen von Tronje. Und Bryndt ist der Einzige, der die Wahrheit über die namenlose Tragödie im Hunnenland kennt ...
Über die Autorin
Viola Alvarez, in Lemgo/Westfalen geboren, schreibt seit 2003 historische Romane, u. a.»Die Nebel des Morgens«, eine Neufassung des Nibelungenlieds. Mit »Der Himmel aus Bronze« legt sie zwei spannende Romane um das größte Geheimnis der Bronzezeit vor. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in der Nähe von Köln.
Viola Alvarez
Der Nebeldes Morgens
Verbotene Erinnerungendes letzten Nibelungensohns
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2006/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Friedrich Pustet, Regensburg
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0030-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Mutter
VegurDer WegAufgesang
Das Land der Untergegangenen.Die erste Erinnerung
Das wahre Nebelland liegt zwischen gestern und heute. Aber was ist schon wahr? Wer kann schon behaupten, dass die Bilder in seinem Kopf wirklich das zeigen, was gewesen ist?
Schaut dieses Bild, Ihr Fremden.
Glaubt Ihr mir, was ich jenseits der Nebel sehe?
Ein Boot mit zwei Männern darin. Es ist Nacht, der Wind weht träge, aber kalt. Beider Umhänge, einer rot, einer schwarz, sind feucht und klamm. Der von ihnen rudert, der Rote, lehnt sich so in die Strömung, dass ihm schließlich ein Ruder bricht, das Boot trudelt, treibt ab. Der andere Mann beginnt zu schreien.
Er fürchtet sich und fängt zu seinem Schutz mit der Anrufung seines Gottes an.
»Was soll das?«, grollt der Rudernde mit der Stimme eines wilden Tieres. »Was glaubst du, dass so was jetzt hilft!«
Das Boot schlingert weiter, Ufer ist nirgendwo mehr zu sehen. Der Mann in Schwarz will ohnehin nicht in das fremde Land. Die Wasser gurgeln, als würden die Geister lachen, den Feigen verlachen, wie sein Fährmann ihn gewiss verlacht.
Der Betende wird still, weil es ihm übel ist von den schnellen unvorhersagbaren Wendungen des Bootes, der Nässe, der Angst.
Er ist zum Heldentum nicht bestellt gewesen, nie.
Hilflos erbricht er sich in die schwarzen Wasser des schwarzen Flusses. Dann sagt er ganz leise: »Ich hab nun mal nicht Euren Mut, Herr. Ich möchte nur nach Hause.«
Es ist so dunkel und schwadig, dass keiner von beiden des anderen Gesicht mehr sehen kann. Aber es scheint dem Betenden, dass der Fährmann seine ewige Augenbinde abnimmt. Nie hat jemand den Finsteren ohne dieses Tuch über seinem fehlenden Auge gesehen. Dann blitzt dumpf eine Klinge in der Finsternis.
»Nein! O Herr Jesus, nein!«, flüstert der Betende. Dann zerreißt ihm ein Schrei die Seele, den er nicht mehr vergessen wird, ein Schrei, der die Nacht und die Wasser und die Fremde aufhören lässt.
Der Schrei eines Tieres, denkt er – und weiß doch, es ist sein wilder Fährmann, der so geschrien hat. Der Schrei eines Menschen, den er nie als Menschen gesehen hat. Eine Wolke lässt den Mond frei, nur einen Augenblick, und er sieht den großen Mann, den Unbesiegten, wie er mit gefletschten Zähnen keuchend etwas in seinem Schoß birgt. Das Boot dreht sich weiter, die Finsternis kehrt wieder. »Herr?«, fragt der Schwarzrock bestürzt. »Was ist Euch?«
Er versucht zu verstehen: alles zu verstehen. Wie er auf diese Höllenfahrt kam, weit weg der Welt, wie er sie kennt, allein mit dem Unheimlichen, der ihm das Blut gefrieren ließ, jenseits der Kälte mit seinem Schrei.
»Du willst nach Hause, ja?«, knurrt da der Held noch immer in seinem verborgenen, unbegreiflichen Schmerz. Der Schwarzrock nickt. Er will leben, er will es warm haben, er will seine Tage ohne Überraschungen aneinander reihen, Perlen der Bescheidenheit an einer einfachen Schnur, bis zu seinem Ende. Dies soll nicht sein Ende sein, denkt er immer wieder. Da greift sein fürchterlicher Begleiter nach seiner Hand und zwingt ihm etwas hinein, etwas, das in diese Binde gewickelt ist. Er fühlt den Stoff und etwas darin, das ist warm und feucht, aber auch metallen. »Halt mir das«, raunt der Fährmann.
»Lass es nicht los, bis du wieder in der Heimat bist. Lass es nicht los –« Er bricht ab, aus Schmerz? Der Schwarzrock kann keinen Finger rühren, er traut sich nicht, zu fühlen oder zu schauen, was er da in der Hand trägt.
Da erhebt sich der Fährmann im kreiselnden Boot und packt den Wimmernden. Er flüstert ihm etwas ins Ohr, das nicht einmal die Wassergeister hören können, das selbst den Winden entwischt.
»Ohh«, stöhnt vor Schreck und Erkennen der Schwarze, der so klein und schutzlos in den Armen des Herrn hängt.
Eine Winzigkeit lang sehen sich die beiden ins Gesicht.
»Ich verspreche«, haucht der Schwarzrock.
»Ich weiß«, antwortet sein Henker mit fast einem Lächeln.
Dann wirft er ihn aus dem Boot in die Kälte des schwarzen Flusses. »Ich verspreche«, gurgelt der Schwarzrock, er hält die Hand mit dem ihm Anvertrauten hoch aus den Fluten, die gierig an seinem Mantel ziehen.
»Ich verspreche«, schreit er und schluckt Wasser, er weiß gar nicht, wo das Ufer wäre, nach dem er sich sehnen könnte.
»Ich verspreche«, spuckt er hustend, er sieht das Boot schon gar nicht mehr. Er ist kalt, er strampelt und verliert einen Schuh.
Tausend unsichtbare nasse Hände drücken ihn unter die kleinen und großen Wellen. Wenn er beide Arme zum Schwimmen nehmen könnte, dann wäre es leichter. Aber in der rechten Hand hält er, was er nie wieder loslassen darf, bis zur Heimat.
Er taucht wieder unter, Wasser in der Nase und dem Mund, Dunkelheit überall. Er will schreien, wie der andere eben noch schrie. Ein Schrei, das wird dem Schwarzrock jetzt klar, der etwas mit einem Ende zu tun hatte. Er strampelt matter mit den Beinen. Ihm ist kein solcher Schrei vergönnt. Nur den Großen gebührt es, ihre Seele so herauszuschreien. Er ist kein Großer. Aber er will nicht loslassen. Wenigstens will er sein Wort halten. Auf seine kleine Art hat er immer versucht, wacker und aufrecht zu sein. Gerade jetzt musste er nun noch so ein großes Versprechen geben. »Nicht loslassen«, hämmert es noch in seinem Kopf, als die Wasser von allen Seiten gegen seinen Schädel drücken.
Als er am Morgen erwacht, halb erfroren, aber lebend, liegt er am Ufer, das zu seiner Heimat führt. Er hustet und schämt sich. Denn es ist ihm, als wären in der höchsten Not dieser furchtbaren Nacht nackte Weiber mit schilfgrünem Haar ihm zu Hilfe geschwommen und hätten ihm mit tiefen Küssen die schönste Luft seines Lebens geschenkt. Ihn ans Ufer gezogen und ihn gerettet. Ihn in seinem vierzigsten Jahr eines kleinen, bescheidenen Lebens abermals geboren aus den Fluten des Schreckens und der Angst.
Der müde Schwarzrock schüttelt den Kopf.
All seine Erinnerungen an die letzte Nacht, die allmählich in sein verängstigtes Bewusstsein dringen, müssen Trugbilder sein, Narrheiten seiner Pein.
Da öffnet er die rechte Hand, die er um etwas gekrampft hält. Und trotz des tiefen Grauens, das sich sogleich auf ihm niederlässt wie ein sirrender Schwarm Stechmücken, wirft er nicht von sich, was er sieht.
Dann ist es doch wahr? Alles? Er rappelt sich auf und versucht, zum anderen Ufer zu sehen. Aber da ist niemand mehr. Oder war nie jemand. Wie weit mögen sie wohl abgetrieben sein?
Er hat geschworen, er wird nicht loslassen. Er wird diesen Schwur halten. Sein kleines Leben, schlichte Perlen an einer schlichten Schnur. Nun ist für immer ein Knoten in dieser Schnur, den kann er nur lösen, wenn er sein Versprechen hält. Er schließt seine blau gefrorenen Finger wieder um das Grausige, das er nach Hause tragen muss.
»Im Namen Gottes«, flüstert er und geht mit dem rechten Fuß, an dem ihm der Schuh fehlt, voran den ersten Schritt eines unendlich langen Weges zurück. Er trägt ein Pfand und ein Geheimnis.
Seht Ihr ihn, Ihr Fremden?
Da geht er.
Und die Nebel des Morgens, wie auch die Nebel des Vergessens schließen sich schon hinter ihm.
Vor dem Anfang
Eine Geschichte mit ihrem Anfang zu beginnen, hieße zu glauben, dass es ein Ende geben könnte. Beides ist eine Lüge. Diese Geschichte hat keinen Anfang, und sie hat kein Ende.
Es gibt nur Erinnerungen und Vergessen. Das Vergessen gewinnt schließlich immer. Der Kampf zwischen Lügen und Wahrheit endet auf einem verlassenen Schlachtfeld, und nichts bleibt außer stummen Trümmern, die beiden gedient haben.
Dies ist die Geschichte meiner Familie. Alle haben sie mittlerweile so oft gehört, dass es jedem so vorkommt, als ginge es dabei um Leute, die man wirklich kennt. Für mich trifft das zu.
Ich erzähle von wirklichen Menschen, nicht jenen Sagengestalten, die überlebensgroß durch hehre und doch simple Lieder sirren. Ich weiß, wie sie aussahen, wie sie klangen, wie sie rochen.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass dies wirklich nur meine Geschichte ist, eine Familiengeschichte. Etwas, das wir alle haben, vor dem wir alle fortlaufen, was uns trotzdem sagt, wer wir sind.
Heimlich, verborgen hinter meiner Stille, der Gleichmut gegen die Dummheit und Brutalität, die mich umgibt, wünsche ich mir, dass es allein meine Erinnerung an Untergegangene, Vergessene und Verzerrte wäre, die mir erklären würde, was unerklärlich ist. Eine Geschichte, die mich in dieser Welt verankert, in der es mir immer so schwer gefallen ist zu sein. Ich wünsche mir, dass mein Leben einen Sinn hätte durch meine Geschichte, das Leid, die Tränen, das viele ungewollte Sehen, die Worte, die mir so leicht kommen. Aber es ist nicht nur meine Geschichte. Es ist die Geschichte so vieler Menschen, fast alle tot zu dieser Zeit, eine Geschichte der Untergegangenen. Es gibt Menschen, die habe ich gesehen, in Nord, Ost, Süd und West, denen ist nie etwas Besonderes geschehen. Sie leben, sie arbeiten, sie sterben. Ich habe diese Menschen lange beneidet.
Was macht meine Geschichte anders?
Es ist etwas daran, das mit Recht zu tun hat.
Vielleicht ist das der Sinn meines Lebens, vielleicht der einzige, diese Geschichte zu erzählen, um das Unrecht zu Recht zu machen, die Lügen zu Wahrheit. Mag sein, dass ich nicht das Ende dieses Liedes bin, sondern nur eine Wendung.
Ich überlasse es, Ihr Fremden, Eurem Urteil.
Wenn meine Mutter diese Geschichte erzählte, später in ihrer Krankheit, dann fing sie immer so an:
»Als die Götter sich langweilten, begannen sie ein Spiel.
Sie warfen uns alle in einen Beutel wie Runen und schüttelten uns im Dunkeln hin und her. Dann leerte Odin selbst den Beutel aus und lachte. ›Jetzt wollen wir sehen!‹, sagte er, ›jetzt wollen wir sehen, wo sie hingehen werden, wenn ihnen nicht mehr schwindlig ist!‹ Und seine Raben lachten auch.
Dann sahen die Götter uns zu, wie wir versuchten, uns zurechtzufinden. Aber es unterhielt sie nicht lange. Als die Götter sich langweilten und spielten, gaben sie nicht Acht. Es geschahen Fehler«, sagte sie. Dann sah sie mich an.
War ich das in ihren Augen? Ein Fehler? Oder bat sie im Gegenteil mich um Verzeihung für die Fehler, die sie selbst gemacht hatte. Fehler, die mein Leben lange formen sollten, zu lange. Ich brauchte so viele Jahre, bis ich aufhörte, nur der Sohn meiner Eltern zu sein. Alte Fehler, junge Fehler, es ist egal.
Ich bin lange kein Kind mehr. Ich glaube nicht an die Götter und ihre Spiele. Ich glaube nur an den Wind und seine Worte. Ich bin nicht verrückt, auch wenn alle das denken.
Meine beiden Wächter unterhalten sich oft darüber, wie seltsam ich ihnen vorkomme. »Der hat sie doch nicht alle«, sagt der, der wie ein Hahn aussieht. Das sagt er jeden Morgen, seit sieben Tagen. »Der ist so verrückt wie eine Fledermaus«, sagt dann der andere jedes Mal in seiner nervtötenden Einfallslosigkeit. Jeden Morgen, seit sieben Tagen. Der Hahn und der Einfallslose – das ist nun meine Gesellschaft. Sie finden alles, was ich tue oder meistens eher nicht tue, bemerkenswert, als Beweis meiner Verrücktheit. Mein Geisteszustand scheint sie sehr zu beschäftigen, ich vermute, ihr Auftraggeber hat sie entsprechend vorbereitet. Ich finde es viel eher bemerkenswert, dass jemand so beschränkt sein kann und doch die weite Reise gemeistert hat, um mich zu finden. Zumal ich mich selbst schon fast vergessen hatte. Es macht mir nichts aus, dass sie mich umbringen wollen.
Ich warte.
Sie wollen, dass, was ich weiß, mit mir verloren geht. Was für eine dumme Vorstellung. Was ich weiß, kann jeder andere auch wissen, wenn er nur zu hören wüsste. Es ist das Zuhören, das die anderen nicht können. Ich kann.
Wenn ich mein Ohr in den Wind lege, auf schrägem Hals, sodass mir kein Flüstern verloren geht, dann weiß ich genau, wie es war. Ich erinnere mich an alles. Ich kenne sie genau, die Lebenden und die Toten, jeden ihrer Gedanken. Und wenn auch das Vergessen schließlich gewinnen muss, dann habe ich aber noch nicht aufgegeben. Mit meinem Atem will ich noch einmal an ihm vorbeireiten, ihm meine Wortkrieger zeigen, meine ganze Macht des Erinnerns. Dann kann es kommen und mich vernichten. Ich habe nicht gelernt, wie man aufgibt.
Woher hätte ich es lernen sollen? Von ihr? Von ihm? Der Wind lacht. Ich lache auch. Ich weiß genau, was geschah. Ich habe keine Angst. Wenn mein Tod kommen wird, werden zwei herrliche Frauen in goldenem Glanz mich in die Halle meiner Ahnen führen, wo meine Lieben schon jetzt auf mich warten, alle.
So wird es sein, oder?
Als die Götter sich langweilten, da flüsterten sie den irdischen Herrschern ins Ohr, dass sie sich erheben, dass sie herumziehen und sich an Erfahrungen bereichern sollten. Aber die Könige und Fürsten des Südens, des Ostens und des Westens hörten den Göttern nur schlecht zu. Sie verstanden nur »Reichtum«. Sie sprangen auf und schrien nach ihren Pferden. Und alle ritten nach Rom, wo sie reich werden wollten, diese Toren.
Allein die Herrscher des Nordens hörten besser zu. Sie erzählten zuerst ihren Frauen und dann ihren Räten von den Worten der Götter. Sie saßen zusammen und dachten nach. Dann beschlossen sie zu warten. Die Götter hatten nicht gesagt, dass sie sofort aufbrechen sollten. Deswegen zogen sie nicht nach Rom, noch nicht. Wenn alle nach Rom zögen, dachten sie, dann gäbe es wohl nur einen, der dort auch ankäme. Mit dem könnte man sich ja dann später treffen. Wenn Odins Raben schon fett wären.
»Das ist gut, wir warten, wer ankommt«, sagten die Räte.
»Warten ist immer gut«, sagten die Frauen, »es wird auch Winter. Da muss man nicht unbedingt nach Rom fahren.«
Und die Herrscher und Könige des Nordens warteten.
Meine Mutter war Königin auf den Inseln.
Nur die ganz Alten wissen noch von ihr. Niemand lernt die Namen ihrer Ahnen, denn sie wollte vergessen werden. Selbst die ganz Alten, die sie noch kennen, haben Angst, sich zu erinnern. Mittlerweile reden alle so, als wäre meine Mutter eine Göttin, aus Feuer und Eis geboren, kein Mensch. Was für ein Unsinn.
Ich kenne meine Ahnen.
Meine Mutter war Brynhild Svenkesdottir, Tochter der Ylva, Tochter des Svenke, beide aus dem Geschlecht der gefürchteten Königin Yenka mit den blauen Zähnen.
Die Namen meiner Ahnen strahlen heller als jeder polierte Schild in der Morgensonne. Es waren tapfere Krieger und starke Bauern, große Lügner und herrliche Denker, große Könige und Königinnen zu ihrer Zeit. Ich vergesse keinen.
Es begann zu einer Zeit, da die Sonnenbarke einen Tag lang verankert geblieben war und viele sich um den Fortgang des Lebens sorgten. Das war vor mehr als einhundert Jahren.
König Vymanrik, der Tapfere, erschreckt durch die Dunkelheit dieses Tages, ließ verkünden, dass er zur Fortsetzung des Lebens eine Frau nehmen wolle. Und von überallher brachten ehrgeizige Leute sogleich ihre Töchter, eine schöner als die andere. Starke, gesunde Mädchen, an denen nichts auszusetzen war. Mein Ahnvater jedoch hatte keinen Sinn für schöne Frauen, er war ein alter Kampfstier, dem man außer Schnauben und Scharren nichts Neues mehr beibringen konnte. Er sah die vielen Mädchen nur an und zuckte die Schultern: »Die sehen alle gleich aus«, klagte König Vymanrik seinen Räten. »Woher soll ich wissen, welche sich zur Königin eignen würde, die mein Reich verteidigt, wenn ich tot bin?«
Die Räte berieten eingehend und verkündeten: »Versprecht allen eine Kleinigkeit, schenkt sie ihnen und nehmt sie ihnen dann wieder weg. Eine wahre Königin wird sich daran beweisen.«
Und König Vymanrik schenkte jeder von ihnen einen Ring aus rotem Gold, in den war Wolfshaar eingeflochten. Und jeder sagte er, nur sie erhalte diesen Gunstbeweis. Dann, als alle sich freuten, die Auserwählte zu sein, ging er hin und forderte den Ring zurück. Einige Mädchen weinten, einige schmollten, einige riefen nach ihren Vätern. Aber alle gaben den Ring zurück.
Nur eine weigerte sich: »Das ist mein Ring, König«, sagte sie und sträubte sich.
»Gib ihn mir, ich will ihn wiederhaben«, forderte Vymanrik und streckte die Hand aus, ihn der Störrischen vom Finger zu ziehen. Da biss sie ihm, so fest sie konnte, in den Daumen, dass schon Blut kam. Hätte er nicht aufgegeben, sie hätte ihm den Daumen abgebissen, das ist sicher.
»Donnerwetter!«, sagte König Vymanrik und war auf einmal ganz verliebt. Er sah dann auch, dass das Mädchen vorn zwei blaue Zähne hatte, und fand sie unvergleichlich schön. Keine der anderen hatte blaue Zähne. Keine der anderen hatte überhaupt ihre Zähne benutzt, um Vymanriks Herz zu gewinnen.
Die es getan hatte, hieß Yenka Fyrlissdottir und kam von den östlichen Bergen, wo zwischen Steinen und Regen die größten und stärksten unserer Leute siedeln.
»Die will ich heiraten«, verkündete Vymanrik seinen Räten, »und wenn ich nicht mehr bin, wird sie das Reich mit Klauen und Zähnen verteidigen.«
So ließ er alle anderen Ringe einschmelzen, und nur Yenka mit den blauen Zähnen behielt den ihren zum Zeichen, dass sie Königin auf den Inseln war, Verwalterin von Vymanriks Reich.
König Vymanrik und Yenka Fyrlissdottir hatten acht Töchter. Jeder hatte sie auf Vymanriks Geheiß mit ihren blauen Zähnen in den Hintern gebissen, als sie sie gebar, damit sie niemand stehlen würde.
In seinem achtzigsten Jahr, neunzehn Jahre, nachdem er Yenka geheiratet hatte, starb König Vymanrik.
»Was ich meinen alten Kerl doch vermisse, das hätte ich nicht kommen sehen«, sagte Yenka oft und starrte schwermütig ins Feuer. Sie trauerte sehr um ihn und nahm trotz einer reichen Auswahl keine Liebhaber, nachdem er tot war. Aber sie verteidigte, wie vorausgesagt, sein Reich mit Klauen und Zähnen, und niemand nahm ihr auch nur ein Hammelbein weg. Sie starb schließlich zu Mittwinter. Das war in einem Jahr, als es so kalt war, dass die Felsen barsten und das Wasser der Küsten gefroren war, sodass man sie nicht zur See verbrennen konnte, sondern ihr Feuer auf dem Eis entzünden musste.
»Yenka mit den blauen Zähnen wird sich schon bis zum Wasser durchbeißen, bis nach Walhalla, wenn es sein muss«, sagte einer ihrer Räte, und alle lachten und fanden, das wären die besten Worte, die man zu Königin Yenkas Tod hätte finden können.
Vymanriks und Yenkas zweite Tochter, Ylva die Ältere, blieb als Einzige an Königin Yenkas Hof und hatte zehn Kinder mit einem Mann, den ihr das Meer vor die Füße gewaschen hatte. Hver nannten sie ihn – wer? Denn er sagte nie, woher er kam oder wie er hieß. Und weil er aus dem Meer kam, nannte man ihn schließlich Hver Sjórson, Sohn des Meeres. Hver und Ylva waren dreißig Jahre verheiratet. Vier ihrer zehn Kinder überlebten. Und Ylva schärfte ihren Kindern sämtlich ein, nie Angst vor der Fremde zu haben, denn Hver war schließlich aus der Fremde gekommen, somit wären sie alle Kinder des Unbekannten.
Ylvas und Hvers dritte Tochter, Laila Hversdottir, wurde meine Urgroßmutter. Sie wollte erst nicht heiraten, sondern fuhr zur See. »Das ist Hvers Blut«, sagten alle, »der kam ja direkt aus dem Meer.«
Vier Jahre war Laila mit den Seefahrern fort, und wann immer sie wiederkam, brachte sie genauso reiche Beute mit wie jeder andere ihrer Gefährten. Als sie nach den vier Jahren heimkehrte, beschloss sie, sich einen Mann zu suchen.
Sie heiratete Auslís Ansson, der nur einen Hof entfernt lebte.
Auslís Ansson war ein wackerer Mann, ein guter Krieger, aber vor allem ein Künstler: Er konnte auf einer Flöte blasen, dass die Felsen schluchzen mussten, so schön war es. Noch heute gibt es auf den Inseln Wasserfälle, die tragen seinen Namen, Auslís Vatn werden sie genannt, denn als Auslís vor diesen Felsen spielte, da brachen die Tränen nur so aus ihnen heraus und versiegten nie mehr, auch nicht als Auslís schon lange weitergezogen war.
Vermutlich war es sein Flötenspiel, was Laila Hversdottir ans Herz gegangen war. Sie war ihm eine gute und zugewandte Ehefrau, da weiß niemand anderes zu berichten.
»Bevor ich euren Vater heiratete«, sagte Laila ihren Söhnen oft, »wusste ich mit Männern nicht mehr anzufangen, als ihnen bisweilen eins aufs Maul zu geben!« Zwischen Laila und Auslís war es eindeutig er, der der Empfindsamere war.
Laila und Auslís hatten sechs Söhne, einer größer und stärker als der andere, sodass Laila immer mal wieder zur See fahren musste, um diese Kinder überhaupt zu ernähren.
Ihr zweiter Sohn, Svenke Auslíson, war mein Großvater.
Als Ylva die Ältere starb, war sie schon sehr alt. Aber sie war eine gute Frau und Königin gewesen, deswegen tat es allen leid.
»Manche könnten gut ein bisschen kürzer leben, und es würde einem nichts abgehen«, sagte Auslís zu Laila, die untröstlich war, »aber deine Mutter hätte noch was bleiben können. Ich wäre nicht dagegen gewesen.«
Daran kann man sehen, was für ein angenehmer Mensch Ylva die Ältere war, denn selten vermisst ein Mann die Mutter seiner Frau, zumal wenn sie im gleichen Haus lebt.
Es kamen viele Trauernde an den Hof, um Lailas Mutter auf die letzte Fahrt zu schicken. Auch Orm Bengtson, ein Fürst von der anderen Seite des Meeres, und seine Frau Asgard, die von Stammmutter Yenkas ältester Tochter abstammte.
Asgard war schwanger. Sie hatte schon lange geträumt, dass es eine Tochter werden würde.
Orm und Asgard beschlossen, dass sie das Kind, das Asgard trug, nach der Verstorbenen benennen wollten.
Svenke Auslíson, mein Großvater, war damals sieben Jahre alt, und er hat genau gesehen, wie seine spätere Frau geboren wurde.
Kaum war das Kind ganz an der Luft, drängte er sich zu Asgards Lager vor und sagte: »Ich nehm sie dir schon ab, Tante. Das macht mir nichts aus.«
Als Asgard und Orm nach drei Jahren wieder abreisten, um nach ihrem Hause jenseits des Meeres zu fahren, blieb Ylva die Jüngere bei Königin Laila und König Auslís.
Das heißt, sie blieb bei Svenke, denn die Eltern konnten das Kind nicht von ihm fortlocken, so sehr sie sich auch mühten. Immer wieder, wenn die Eltern aufbrechen wollten, versteckte sich meine Großmutter Ylva bei den Kühen oder in der Waffenkammer, und einmal lief sie sogar ins Moor. Solcher Eigensinn ist ein Erbgut von Yenka mit den blauen Zähnen, das wissen alle. »Hier bleiben!«, heulte die kleine Ylva jedes Mal, wenn man sie fand. Da sahen Orm und Asgard schweren Herzens ein, dass sie ihre Tochter nicht mitnehmen konnten, wenn sie sie nicht ganz und gar unglücklich machen wollten.
Sie besprachen sich mit Auslís und Laila, die ihre Nichte gerne als Kind im Hause aufnehmen wollten.
»Ich pass schon auf sie auf«, sagte außerdem mein Großvater Svenke, »das macht mir nichts aus.« Als ihre Eltern fortritten, strahlte Ylva und sagte sehr zufrieden: »Hier bleiben!«
Man sagt also zu Recht, dass meine Großeltern, Ylva und Svenke, nie Augen für andere hatten, und es ist bekannt, dass sie schon, als Ylva vierzehn war, vor dem Stor Ting erschienen und eine Heiratserlaubnis haben wollten. Alle im Rat fanden, dass Svenke ein besonnener und kluger junger Mann wäre, der von seinen Eltern nur das Beste ererbt hatte, und sie erlaubten ihm deswegen, Ylva schon im nächsten Jahr zu heiraten. Es wurde eine Hochzeit, die sieben Tage lang dauerte, wenn auch die Brautleute nur für die erste Stunde anwesend waren.
Dann zog Ylva Svenke eilig in die Kammer.
»Das macht ihm sicher nichts aus«, johlten seine Brüder, die alle noch unverheiratet waren. Es heißt, dass Urgroßmutter Laila daraufhin jedem einen Schlag verpasst hätte. Am achten Tag nach Svenkes und Ylvas Hochzeit dankten Auslís und Laila als Könige ab.
»Der Junge soll ruhig machen«, sagte Auslís, »der kann das.« Nun hatte er noch mehr Zeit, seine Flöte zu spielen, als vorher, wo er doch herrschen musste.
Obwohl, wie ein anzügliches Wort ging, an Ylvas und Svenkes Hof in den nächsten Jahren eifrig an einer Verlängerung der Ahnenkette gearbeitet wurde, bekamen beide vierzehn Jahre lang keine Kinder. Vielleicht wurde Svenke deswegen ein so mächtiger und reicher König, weil er sich nicht um die Erziehung seiner Kinder kümmern musste, sondern mehr Zeit hatte als andere Könige, die Beutezüge und Kriege zu besorgen. Nach nur fünf Jahren Ehe war ihr Hof zwölf Mal so groß wie zu Zeiten Hvers und Ylvas der Älteren, und alles war aus Stein gebaut. Die endlosen Schnitzereien der Verkleidungen an den Türen und Erkern erzählten die Geschichten aller Götter, bezeugten den Hergang der Erschaffung der Welt, der Himmelslichter und der großen Helden. Wir hatten im Norden keine Städte wie die Römer oder die Aquitanier, aber wir haben unsere Burgen. Svenkes und Ylvas war die schönste von allen.
Járnsteinn nannten sie ihre Feste, weil die Mauern im Winter schimmerten, als wären sie aus Eisen. Vom Turm ihrer Burg aus konnte man weiter schauen, als man an einem Tag reiten oder an einem Morgen bei gutem Wind segeln konnte.
Händler aus allen Ländern kamen zu ihnen, und man tauschte gute Waren. Innen wie außen war es in Járnsteinn bestens bestellt.
Sie hatten viele starke Krieger, die Svenke alle treu ergeben waren, Pferde und Schiffe und mehr Vieh als jeder andere König im Land. Nur Kinder hatten sie nicht.
Svenke verstand das nicht. Die Geburtsweiber und Heilfrauen hatten Ylva zigmal untersucht und immer wieder verkündet, sie wäre ganz gesund. Obwohl er sich nicht krank fühlte, hatte er zunehmend Angst, dass es an ihm liegen könnte. Er ging häufig zu den Priestern und fragte sie um Rat, aber es kam nichts dabei heraus. Sie sahen nur Wohlwollen der Götter für ihn und Ylva. Und keine Anzeichen für den Fluch der Kinderlosigkeit.
»Mir macht es nichts aus. Aber bist du nicht unglücklich, dass wir keine Kinder haben?«, fragte Svenke Ylva mit den Jahren immer häufiger. »Die werden schon noch kommen«, antwortete Ylva mit Zuversicht, »wenn es so weit ist, werden wir Kinder haben.«
Als Ylva schließlich achtundzwanzig war und Svenke bereits fünfunddreißig Jahre zählte, wurde sie eines Sommers plötzlich schwanger. Svenke erschrak fürchterlich, aber Ylva lachte ihn aus. Sie überstand trotz ihres hohen Alters die Schwangerschaft und die Geburt, als hätte sie jedes Jahr ihrer Ehe ein Kind geboren.
Meine Mutter, Brynhild Svenkesdottir, Königin auf den Inseln, wurde siebzehn Tage nach der Tagundnachtgleiche im Morgengrauen eines besonders wilden Frühlingssturms geboren.
»Das ist das Temperament deiner Mutter«, sagte Ylva zu ihrem Mann, wenn Brynhild mal wieder die Beherrschung verlor. »Genau das gleiche Wesen!«
»Es liegt am Frühlingssturm, in den du sie geboren hast«, behauptete Svenke dann immer ein wenig trotzig, denn auf Laila ließ er nie etwas kommen.
Sie hatten wohl beide Recht. Brynhild war wild und streitsüchtig wie die Seefahrerin Laila Hversdottir und wechselhaft wie ein Frühlingssturm. Sie dachte immer erst nach, wenn es zu spät war. Manchmal ging es gut, aber einmal sollte es ihr zum Verhängnis werden.
Weil Svenke nach der Aufregung der Geburt viel zu erschöpft und an Ylvas Seite eingeschlafen war, ging mein Urgroßvater Auslís mit seiner ebenfalls schlafenden Enkelin herunter ans Meeresufer und zeigte sie den Göttern. Er schwor, dass sich die Wolken des Sturms aufgetan und einen goldenen Sonnenstrahl auf die Neugeborene hätten fallen lassen. Götterlicht hieß es, das Kind sah aus wie mit Bronze überzogen.
Deswegen nannten sie sie Brynhild, die Gepanzerte.
»Odin selbst hat gelächelt, als er sie zum ersten Mal sah«, sollte er später sagen, als es schon vielen anderen Männern ebenso ergangen war.
Es waren überall ums Haus und am Himmel nur die besten Vorzeichen zu sehen. Als Svenke sich einigermaßen erholt hatte, ging er mit einem Ochsen und zwei Ziegen zu den Priestern und dankte ihnen. Der jüngere der beiden Priester war sehr eifrig und bot an, die Götter zum Schicksal des Neugeborenen zu befragen. »Der Vater hat es nicht gewünscht«, tadelte der Ältere, »also schickt es sich nicht!«
König Svenke jedoch war so glücklich, dass er nicht wollte, dass der junge Priester seinetwegen ausgezankt wurde.
»Es sind zwar nur die besten Vorzeichen am Himmel und am Haus gewesen«, sagte er, »aber sicher kann es nicht schaden, nach dem Willen der Götter zu fragen. Mir macht das nichts aus.«
Der ältere der beiden Priester schüttelte besorgt den Kopf, aber der jüngere warf gleich beflissen die Runen.
»Ah«, rief er beglückt, »Schönheit, Kraft und Scharfsinn.«
König Svenke lächelte, er hätte von der Tochter seiner Frau und der Enkelin seiner Mutter nichts anderes erwartet.
Der Priester warf erneut. »Wieder Kraft, doppelt und dreifach«, freute er sich, »ein starkes Kind, eine zukünftige Königin. Sie wird Waffen tragen und viele Siege erringen.«
Er warf zum dritten Mal: »Eigensinn, aber ein gutes Herz, etwas wild vielleicht, aber viel Liebe, ich sehe Frigga lächeln!«
Der junge Priester lachte selbstsicher.
»Drei Mal ist genug«, schaltete sich der Ältere nun doch ein.
Aber da hatte der junge Priester schon zum vierten Mal geworfen, vielleicht wollte er sich selbst mit guten Wahrsagungen übertreffen. Er lachte schon siegessicher und wollte weitermachen in seinem Lobpreis. Aber es kam anders.
Erschrocken starrte er auf die Runen und blieb stumm.
Svenke wurde es ganz kalt im Nacken: »Was?«, flüsterte er.
Der ältere Priester blickte ebenfalls auf die Zeichen.
»Eine Reise«, murmelte er schließlich. »Eine große Reise, weit fort.«
König Svenke schluckte: »Vielleicht geht sie zur See. Meine Mutter ist auch zur See gegangen. Und mein Großvater kam direkt aus dem Meer.«
Der junge Priester war ganz blass: »Ja. Vielleicht«, sagte er mit heiserer Stimme.
Der Ältere stieß ihn beiseite, er war sehr aufgebracht.
»Die Götter zeigen uns eine Reise. Aber es ist keine gute Reise, König. Lasst sie nicht auf diese Reise gehen. Verhindert es. Möglicherweise vergessen es die Götter dann.«
»Was?«, wollte Svenke wissen. »Was sollen die Götter vergessen?«
»Den Schmerz, König, die Reise führt in den Schmerz. Schmerz und namenloses Leid.«
Svenke wankte.
»Vergessen die Götter denn je etwas?«, fragte er.
Die beiden Priester schwiegen. »Sie hat dennoch all diese Gaben«, sagte der Ältere schließlich, »Kraft, Eigensinn, Stolz und Scharfsinn. Und die Liebe. Mit solchen Gaben kann man es mit dem Schmerz wohl aufnehmen.«
»Mit namenlosem Leid? Damit auch? Namenloses Leid?«, sagte Svenke erschüttert. Er hasste diese zwei Worte, er fühlte sie im Herzen wie eine Wunde.
»Macht sie stark, König Svenke«, sagte der Priester da, »die Zeiten werden für uns alle nicht leichter. Die Welt ist in Unruhe.«
Verstört kehrte Svenke auf seine Burg zurück. Ylva war schon auf, obwohl sie das Stehen noch sehr schmerzte, und wusch das Kind. »Schau sie dir an, Liebster«, rief sie, »ich hab ja gesagt, wenn sie so weit ist, dann kommt sie.«
Der König trat still neben seine Frau und legte den Arm um sie.
Namenloses Leid, hörte er den Widerhall in seinen Gedanken.
»Ich habe Angst um sie, Ylva«, flüsterte er seiner Frau ins Ohr, »dass ihr etwas passiert.«
»Halt sie mal«, sagte Ylva und ging mit zusammengebissenen Zähnen nach etwas suchen.
»Haben dir die Priester einen Floh ins Ohr gesetzt?«, fragte sie über die Schulter. Sie klang gereizt, ihrer Ansicht nach lief Svenke zu oft zu den beiden Sehern.
Svenke zuckte ertappt und knurrte etwas Unbestimmtes.
»Wusst ich’s doch«, fauchte Ylva und stöhnte, als sie sich bückte, um in einer Kiste unter ihrem Bett nach etwas zu suchen. »So ein Unsinn! Immer rennst du zu diesen Priestern. Kannst du was dran ändern, wenn sie dir heute schon sagen, dass es morgen regnet? Das Morgen gehört niemandem!«
Svenke brummte wieder, und Ylva fuhr gereizt fort, in ihrer Kiste zu kramen. Das Kind quäkte in seinen Armen, und er schuckelte es, wie er Ylva nach ihrer Geburt beruhigt hatte, damals vor neunundzwanzig Jahren.
Die kleine Brynhild verzog wie ungehalten das Gesicht, war aber gleich still. Svenke lächelte. Er fühlte sich schon etwas besser. Ylva hatte Recht. Er wusste das, weil Ylva eigentlich immer Recht hatte. Natürlich hatte sie sich auch schon geirrt, aber Svenke war zu höflich, sich daran zu erinnern.
Mit einem Schmerzenslaut richtete Ylva sich auf.
»Ich muss mich wieder hinlegen«, sagte sie, ging aber auf Svenke und Brynhild zu. »Hier, du Angsthase!« Mit diesen Worten ließ sie ein Beutelchen auf das Kind in seinen Armen fallen.
»Was ist das?«, fragte Svenke.
»Gib mir das Kind und mach’s auf«, befahl Ylva. Brynhild wurde an ihre Mutter überreicht. Svenke fingerte an dem Beutel herum und schüttelte überrascht einen Ring heraus, der in seiner Handfläche zu liegen kam. Der Ring war breit und golden, mit eingeflochtenem Wolfshaar, das stumpf und schwarz den rotgoldenen Glanz teilte.
»Was ist das für ein Ring?«, fragte er entgeistert.
Ylva mied seinen Blick. Sie ging mit dem Kind zum Bett und legte sich umständlich hin: »Das ist der Ring von Yenka mit den blauen Zähnen«, teilte sie erschöpft, aber auch etwas schuldbewusst mit. »Sie gab ihn meiner Großmutter Tjonte, die gab ihn meiner Mutter Asgard. Und die gab ihn deiner Mutter zum Aufbewahren für mich, als sie damals abreisten. Jetzt gehört er der Kleinen. Er schützt die älteste Tochter aus unserem Geschlecht vor allem Schaden und zeigt jedem unserer Verwandten überall auf der Welt, dass die Trägerin die Nachfahrin von König Vymanrik und Königin Yenka mit den blauen Zähnen ist. Wo immer deine Tochter hingeht, wird sie Königin sein. Beruhigt dich das, Angsthase?«
Svenke sah auf den Ring, dann auf Ylva und das Kind, und dann wieder auf den Ring. Die Angst, die er seit dem Besuch bei den Priestern empfunden hatte, war ganz und gar verflogen und von einem anderen unbekannten Gefühl ersetzt worden.
Er atmete tief durch:
»Also wirklich, Ylva«, stieß er schließlich hervor, »dass du und Mutter Geheimnisse vor mir habt, das macht mir nun wirklich was aus!«
So kam es, dass an dem Tag, als meine Mutter geboren wurde, König Svenke erst müde, dann glücklich, dann stolz, dann furchtsam, dann beruhigt und dann ärgerlich wurde.
Niemand konnte sich erinnern, dass er je so viele Stimmungen hintereinander gezeigt hätte, und schon gar nicht, dass ihm je eine Sache »etwas ausgemacht« hatte.
Jedenfalls sagten die alten Frauen schon gleich damals, dass Brynhild eine war, die Dinge in Unordnung bringen würde.
Es war an diesem Tag dann auch das erste Mal, dass Königin Ylva sich bei König Svenke entschuldigen musste.
»Das ist mal ein ganz neues Gefühl«, sagte er zu ihr, »es gefällt mir.«
Brynhild lernte noch im Winter ihres ersten Jahres laufen, an der Hand von meinem Urgroßvater Auslís, dem großen Flötenspieler.
Und erst zur zweiten Hälfte des darauf folgenden Jahres, weit nach Mittsommer, sprach sie ihr erstes Wort, klar und deutlich und mit einem Lächeln: »Nein!«
Am anderen Ende der Welt
Der Wind lacht heute den ganzen Morgen über. Er redet vom Frühling. Mir gefällt der Frühling auch, es ist dann so neu. Wer kann im Frühling ans Sterben denken. Es ist, als erlebte die Welt alles zum ersten Mal. Im Frühling waschen die Götter die Erde und bleichen den Himmel. Dann dichten, schnitzen und hämmern sie uns ein neues Jahr. Ich kann das alles hören, sehen und riechen. Meine Sinne sind ganz wach. Ich lache meine dummen Wärter aus. Sie hören den Wind natürlich nicht.
Der Wind kommt von Süden her, vom anderen Ende der Welt. Vielleicht sollte ich Heimweh haben nach dem Süden.
»Wo bin ich denn zu Hause?«, habe ich meine Mutter früher immer gefragt vor Ewigkeit und Ewigkeit, als es noch wichtig war, zu sprechen. Als ich dachte, es gäbe Antworten für mich. Heute weiß ich, dass alle Antworten nur Krücken sind, für die, die die Wahrheit des Lebens nicht ertragen. Ich bin stark geworden.
Als mein Kind starb, da dachte ich, sterben zu müssen.
Und als dann auch meine Frau starb, da dachte ich, erst jetzt zu wissen, was wirklicher Schmerz ist. Ich jammerte und zürnte den Göttern jahrelang. Dann verstand ich. Es gibt keinen Trost. Ein Zuhause brauche ich nicht mehr. Ich komme von hier und da. Ich bin wie der Wind. Und mein Name ist überall verboten.
Ich mache die Geschichten zu meinem Namen. Zum Namen der Verbotenen, der Erschlagenen, der Vergessenen, der Untergegangenen.
Und die Geschichten hören nie auf.
Als die Götter die Herrscher der Welt aufriefen, sich in Bewegung zu setzen, da zogen die Könige aus dem Osten, dem Süden und dem Westen nach Rom. Vielleicht waren sie neugierig, was mit Rom geschehen würde, jetzt, da es zerfiel.
Rom war wie ein alter Hund, der zu lange gelebt hat. Erst böse und gierig, dann fett, dann blind und nun wehrlos. Und wenn man erst einmal weiß, dass ein alter Hund blind und wehrlos ist, dann fürchtet man ihn nicht mehr, egal wie gefährlich er einmal war. Roms Knurren war nur noch ein Husten; die, die seinen Untergang ersehnten, witterten seine Schwäche. So kamen sie:
Aus dem Westen kam ein Fürst, der Angst hatte. Aus dem Osten kam ein Herrscher, der siegen wollte. Aus dem Süden kamen Fürsten, die essen wollten. Und bevor sie sich auf den blinden, alten, fetten Hund Rom stürzen konnten, trafen sie einander.
Sie trafen einander in Burgund.
Ich werde Burgund bald wiedersehen. Mir wird der Atem faul, wenn ich nur an ihn denke, dieser schwache Schlächter, wie viel wird er für meinen Tod bezahlt haben, frage ich mich? Was ist es den Herren am Rhein wert, dass sich wirklich niemand mehr erinnert?
Von Osten zog ein Fürst nach Burgund, der viele Namen hatte. Er war wie ein Feuer, fraß alles, was ihm im Weg lag, und zog rastlos weiter, wenn er nichts als Tod und Asche übrig gelassen hatte. Noch heute erschrecken sie die Kinder am Rhein mit seinem Namen. Den »schwarzen Mann«, nennen sie ihn.
Er war der fürchterlichste aller Könige. Egal wie oft er siegte, er wurde doch nicht satt davon. Wenn er Gold gewann, warf er es in eine Truhe, Land wollte er nicht, dann hätte er bleiben müssen.
Étešil war sein Name, der große Herrscher, der große Vater.
Étešil, den wir im Norden Attlá nannten und die im Süden Attila und von dessen Ruhm wir hörten. Étešil kam nach Burgund, um zu siegen, zu töten und weiterzuziehen, er kam nicht, um zu bleiben.
Der Fürst des Westens war jung und unbeherrscht, er kam nach Burgund, weil er Angst hatte. Er fürchtete sich vor Stimmen in der Luft und Schatten in seinem Zelt. Sein Bruder musste stets mit ihm ziehen und mit ihm auf seinem Fell schlafen. Luideger, der Furchtsame, und Luidegast, der Wächter des Furchtsamen – zwei, die vor allem Angst hatten. Luideger kam nach Burgund, weil es ein Gesellenstück wäre, die Probe für Rom.
Der Fürst des Südens hieß Theothmarich. Er führte eine ewig wandernde, heimatlose Armee des Hungers, der Kranken und Lahmen. Nur wenige Soldaten marschierten mit ihm, er zog an der Spitze von wimmernden Bauern und müden Frauen, Sklaven ihrer verlorenen Länder.
Die Männer kämpften voll Furcht, die Frauen fraßen vor lauter Hunger ihre eigenen Kinder. Theothmarich zog im Kreis. Er brauchte Land für seine elende Brut. Theotmarich kam nach Burgund, um Nahrung zu stehlen, falls er siegte. Wenn er verloren hätte, dann hätte er gebettelt.
Das kommt davon, dass sie den Göttern nicht zuhörten, diese Fürsten des Todes, der Angst und des Hungers. Sie hatten nicht aufgepasst, jetzt bezahlten sie.
Und die Raben Odins wurden fetter an jedem Tag, der verging.
Étešil, Luideger, Theothmarich, taube Narren voll Ehrgeiz, Not und Furcht.
»Jetzt wollen wir sehen«, hatte Odin gesagt, als er seinen Beutel ausgeschüttelt hatte, »jetzt wollen wir sehen, wo sie hingehen!«
Ein Vielfraß, ein Feigling und ein Hungerleider, alle auf dem Weg. Es muss sie gefreut haben, auf Burgund zu stoßen. Gemästet, prall, sinnlos stolz, wie Gunther, Burgunds König, Herrscher zu Worms am Rhein.
Nun ist es so weit.
Wie kann ich von Gunther erzählen, diesem Herrn, der kleiner war als der Letzte seiner Untertanen. Nur mein Hass macht ihn groß. Er verdient meinen Hass nicht. Er verdient es nicht, dass man sich überhaupt an ihn erinnert, auch nicht im Zorn. Gunther sollte der Erste sein, den das Vergessen frisst, ein fettes Schwein, das in Todesangst quiekt.
Immer wieder belüge ich mich, so zu tun, als wäre er mir gleichgültig. Aber ich kann nicht aufhören, ihn zu hassen.
Auch heute, so viele Jahre nach seinem Tode, kann ich nicht aufhören, mir seinen Tod vorzustellen. Ich fühle, wie mein Hals im Zorn anschwillt, wenn ich nur an ihn denke. Mein Mund wird trocken, und meine Finger zittern. Was für ein Schnurrer ich doch bin. Ich täusche mir selber vor, meine menschlichen Regungen der Weisheit untergeordnet zu haben. Dabei steht das Menschsein hinter mir und lächelt, während ich mir Augen und Ohren zuhalte. Ich höre nicht einmal mehr die Worte des Windes, nur das Tosen meines eigenen Blutes. Nicht einmal meine Mutter hasste ihn so, wie ich ihn hasse.
Sie sprach nie von ihm. Ich habe sie an all die anderen mit Wut oder auch mit Trauer denken sehen, an ihn nie. Nicht, weil die anderen unschuldiger gewesen wären, sondern vielleicht nur, weil sie klarer waren als er.
Gunther ist wie ein Strauch im Moor gewesen, geduckt und ängstlich. Man sieht hin, kneift die Augen zusammen und denkt, ich sehe einen Strauch im Nebel. Dann streicht ein Wind, und es könnte doch eher ein Baumstumpf sein, aber auch ein Stein, oder ein verirrtes Schaf. Und wenn der Nebel stärker wird, ist er bald ganz verschwunden.
Gunther von Burgund, der schwache König.
Sohn des Gibich, Sohn der Uote. Ich kenne auch seine Ahnen.
An seinem Anfang war Gundahari der Rote, vor über hundert Jahren zu Zeiten, als an unseren Küsten der Steinkönig Hroder herrschte.
Gundahari schloss einen Pakt mit Rom. Er verkaufte seine Herkunft und sein Volk, nahm Roms Götter, Roms Bräuche, Roms Lügen an. Dafür bekam er dieses Land am Rhein und dachte, er wäre ein König. Gundaharis Sohn Diannaun herrschte nach ihm, sie nannten ihn Darius, nach Römerart.
»Niemand ist ein römischerer Römer als ein entlauster Burgunde«, lachten alle über Diannaun. Er rasierte sich den Bart und schabte sich die Haut nach dem Baden mit der Ölsichel, bis sie vernarbt war wie altes Leder. Es war Diannaun, der Worms zum Sitz seiner Macht erwählte, er baute einen römischen Palast und umgab ihn mit hohen Mauern aus Stein. Er ließ Gärten anlegen und Wasserspiele. Von jedem Kriegszug brachte er Gold nach Worms und wurde sehr reich.
Ihm folgte sein Vetter Giswillid. Dessen Sohn, Gosvild, war König für nur sechs Jahre, und er verlor jede Schlacht, in die er zog. Die Wasserspiele waren sehr bald hin, und die Gärten verkamen. Sein Nachkomme war Duoderich der Sänger. Der wollte lieber dichten als regieren. Duoderich der Sänger heiratete eine Frau aus dem Norden, die sich mit ein paar Gefolgsleuten auf einer Reise durch die Welt befand. Diese Frau aus dem Norden war Muadh, die jüngste Tochter meiner Ahnmutter Yenka mit den blauen Zähnen. Als eine Kammerfrau bei Muadhs Bad die Abdrücke von Stammmutter Yenkas blauen Zähnen auf ihrem Hintern erblickte, schrie sie laut auf und erzählte überall, was sie gesehen hatte.
Deswegen nannten sie die neue Königin »die Gebissene«.
Muadh und Duoderich der Sänger hatten vier Kinder, ihr dritter Sohn war Gibich, Gunthers Vater.
Gibich wurde König mit gerade sechzehn Jahren.
Es stand in den ersten Jahren eine bange Frage hinter seinem Thron, die niemand laut stellte. An einem römischen Festtag im Frühjahr gab es ein Feuer, und die halbe Burg brannte ab. Muadh und Duoderich starben in den Flammen, und auch Gibichs Geschwister und viele andere mehr. Gibich blieb verschont, weil er am Morgen allein zur Jagd geritten war.
Manche Zufälle sind zu zufällig, um kein Misstrauen zu erregen. Eine kurze Weile nach dem Unglück starb auch Gibichs bester Freund und Diener, der das Feuer einzig überlebt hatte. Er fiel beim Waffenputzen in sein eigenes Schwert. Man sagt zu Recht, dass die Südländer verglichen mit unseren Helden schlechte Krieger sind. Aber nicht mal ein Burgunde kann so dumm sein, in sein eigenes Schwert zu fallen, das schwöre ich. Wie konnte das geschehen, argwöhnten viele. Aber nach einer Weile wurde auch diese bange Frage vergessen, wie viele andere Fragen, wie immer, wenn ein neuer König bleibt und seinen Thron festigt.
Es hat wohl nur selten einen Mann gegeben, der dringender König sein wollte als Gibich. Man muss wissen, Gibich hatte zwei ältere Brüder, die würden ihn nicht gelassen haben. Er hatte auch eine jüngere Schwester, Hildiko, die ebenfalls bei dem Feuer starb. An der soll er wirklich gehangen haben.
Die Eltern, drei Geschwister, ein treuer Freund und Unzählige des Gesindes – alle tot. Daran kann man sehen, wie dringend es ihm war mit der Königswürde.
Fünfzig Jahre herrschte Gibich am Rhein. Er diente weiter den Göttern der Römer, oder dem neuen Gott mit seinem armen Sohn, sollte ich sagen, der zu Gibichs Zeiten große Mode wurde.
Wenn man sich auf diesen neuen Gott umschwor und für ihn einmal ins kalte Wasser stieg, bekam man ein Hemd von den Priestern, die für ihn warben. Deswegen gingen viele hin, obwohl man sich leicht einen Schnupfen holen konnte. Das Hemd bekam man auch erst, wenn man sich die Familiengeschichte des Gottes angehört hatte, die sehr unwahrscheinlich klang. Seine Mutter war nicht mit dem Gottvater zusammen gewesen und hatte ihn in ihrem Ohr empfangen. Später musste der Sohn dann sterben, weil andere Menschen böse waren. Der Gemordete grollte aber nicht, und seine Verwandtschaft verübte auch keine Blutrache, sondern wollte im Gegenteil, dass niemand sonst mehr Blutrache verüben sollte. Es war eine sehr lange, sehr verwirrende Ansprache, und wenige verstanden, worum es ging. Das Publikum nahm ein ungutes Gefühl mit, denn die Priester redeten lange von der Schlechtigkeit der Menschen und wollten ihnen so ein böses Gewissen für die einfachsten Dinge einreden. Sie forderten Keuschheit und Furcht und andere Unsinnigkeiten.
Offenbar halten manche Leute viel aus, nur um ein Hemd zu bekommen. Als die Priester dann aber keine Hemden mehr hatten, wurden die lange Beschimpften wütend, und ein paar Männer, die einen weiten Weg extra für die Hemden zurückgelegt hatten, erschlugen sie.
»Was nützt einem das kalte Wasser und die Meckerei, wenn es nachher kein Hemd dafür gibt. Das ist doch ein ganz schlechter Handel«, sagte einer von denen, die die Priester umgebracht hatten.
Das fanden die anderen Leute auch, und es gab einen kleinen Aufstand, als Gibich die Totschläger dann auch noch hinrichten ließ. Die Männer warfen Steine und Knüppel. Deswegen musste König Gibich notgedrungen bald das ganze Dorf niederbrennen und morden lassen, wo die Bekehrung stattgefunden hatte. Anschließend baute er auf dem verbrannten Grund einen Tempel für den Gott mit den Hemden. Weil aber fast alle aus dem Dorf starben, als Gibich die Aufständischen strafte, war es für die neuen Priester hinterher umso schwerer, den restlichen Leuten zu erklären, dass der Gott mit den Hemden sie im Grunde alle liebte und ihnen wohl wollte.
Am Anfang kamen nur die ganz Neugierigen in den Tempel und natürlich die Händler, die mit Gibich gute Geschäfte machen wollten und sich weder um Hemden noch Götter sorgten.
Gibich jedoch lernte aus der Geschichte und schickte von da an immer ein paar Soldaten mit den herumziehenden neuen Priestern, die ersatzweise aus Rom geschickt wurden. Er gab den Priestern Unterschlupf und Geld für Hemden oder etwas anderes, wenn sie es unbedingt wollten, und auch er opferte mit seinem ganzen Gefolge ihrem milden Gott mit den traurigen Augen. Dafür wiesen die Priester in ihren Ansprachen darauf hin, dass der neue Hauptgott Gibich selbst durch ein geheimes Öl erwählt und gezeichnet hätte, um König zu sein. Das wunderte die Leute sehr, denn Gibich selbst war weder milde noch traurig: Er stahl und kämpfte, und er gewann fast immer. Sein Reich war groß und mächtig, seine Schatzkammern und auch seine Waffenkammern sollten zum Bersten voll sein.
Sicher war Gibich ruchlos, stark und entschlossen, aber er konnte sich kaum anderer Gaben rühmen, die einen König groß machen. Er wäre bald vergessen worden, ausgehöhlt von seiner eigenen verzehrenden Kraft, wenn er nicht zwei Mal Glück gehabt hätte.
Zwei Mal in seinem Leben nämlich traf Gibich eine wirklich kluge Wahl. Diese beiden Entscheidungen zusammen reichten aus, Burgund über Jahre hinaus zu sichern, auch als er längst gestorben und Gunther nach ihm König war.
Das erste Mal wählte Gibich so weise, als er heiratete. Da war er schon dreiunddreißig Jahre König und stand in seinem fünfzigsten Lebensjahr, ein starker alter Mann, der sich vor nichts auf der Erde fürchtete und den Tod verlachte.
Er heiratete die wunderbare Uote von Franken, eine Prinzessin aus dem Nordwesten. Sie war gerade zwanzig Jahre alt und wunderschön. Ich habe Frau Uote noch gekannt, müsst Ihr wissen, natürlich als Witwe und alte Frau. Es ist wirklich kein Verdienst, in der Jugend schön zu sein. Aber Frau Uote war noch schön wie ein Sonnenstrahl, als sie schon alt war. Sie leuchtete von innen heraus, und ich habe sie nie ein böses Wort sagen hören, zu niemandem, über niemanden.
Ich halte Frau Uote am höchsten im leidigen Lied von Gunthers Ahnen, die ich nicht ehren will. Für sie mache ich eine Ausnahme. Frau Uote ehre ich für immer; ich spreche ihren Namen mit Achtung und Dankbarkeit.
Denn es war Frau Uote, die uns in jener einzigen, fürchterlichen Nacht die Tür öffnete, damit wir fliehen konnten.
Ich sehe sie vor mir, ihre freundliche Stimme zwitschert im hallenden Gewölbe des geheimen Ganges, so traurig, so gebrochen, sie wusste, dass alles verloren war. Alles. Ihr Leben, unseres, das ihrer Kinder. Alle ihre vier Kinder waren tot, miteinander, voneinander erschlagen. Es waren nicht nur die Menschen. Burgund war tot. Die lange Linie Gundaharis fast ganz verloschen. Worms nur noch ein Traum, aus dem alle allzu bald erwachen würden. Sie hätte Grund gehabt, uns zu hassen, meine Mutter zu hassen. Ihr hätte ich es vergeben, wenn sie die Lügen und Bösartigkeiten geglaubt hätte, die man über meine Mutter schon anfing zu erzählen.
Vielleicht hat sie die Wahrheit immer gewusst.
Und dennoch war sie es, die uns gehen ließ, die uns einen Weg wies, wo uns niemand finden würde.
Es war Nacht, und mir war kalt. Diese Nacht war anders als alle anderen Nächte zuvor. Wir standen in einem feuchten Gang, die Fackeln rußten, und überall rannten Menschen, schrien die Trauernden. So viele Witwen in einer Nacht, so viele Waisen.
So viele tote Menschen. Keiner von ihnen würde wiederkehren, keine Leiche könnte je beweint, je bestattet werden. Ihr Tod blieb ein Wort, ein unfassbares Wort. Die Nachricht vom Untergang, die doch so leise gekommen war, hatte sich in einen Brand des Schmerzes verwandelt. Nur Frau Uote weinte nicht. Sie war die Einzige in dieser Nacht, deren Augen trocken blieben. Vier Kinder, alle tot, niemand hätte es ihr angemerkt.
Sie ging gemessen und langsam, wie jeden Tag ihrer vielen Jahre als Königin. Wir hielten vor einer Tür an.
Frau Uote umarmte meine Mutter ganz vorsichtig, als könnte sie sie aus Versehen zerbrechen. Meine Mutter, die Stärkste, die Gepanzerte, Frau Uote hielt sie wie römisches Glas: »Geh irgendwohin, wo du vergessen kannst, meine liebe Tochter. Wenigstens vergessen. Glücklich werden wir alle nicht mehr.«
Frau Uote dachte wohl, dass es möglich wäre, das Vergessen! Dass es gut wäre. Es war eine barmherzige Lüge, mehr nicht.
»Mutter Uote«, flüsterte meine Mutter unter dem Torbogen, sie war heiser von ihren Schmerzensschreien, die Augen vom endlosen Weinen verquollen, die Wangen fleckig und bleich. Sie sprach die verhasste Sprache der Burgunden: »Es tut mir so leid, Mutter Uote.«
Und gleich fing sie wieder an zu weinen. Ich fürchtete mich, hatte Angst, dass sie nie mehr aufhören würde, dass sie sich zu Tode weinen könnte, wie ein zerbrochener Krug, aus dem Wasser rinnt und dann versickert. Ich zerrte an ihrer Hand, damit sie aufhörte, aber sie beachtete mich nicht.
»Mein armes Kind«, sagte Frau Uote und streichelte meiner Mutter die Wange: »Ich bin schwach gewesen, als sie dich herbrachten. Ich bin schwach gewesen, als sie dich hier hielten. Als sie dir unrecht taten und dich verleumdeten. Ich bin jeden Tag, an dem du mich gebraucht hättest, schwach gewesen.« Meine Mutter schluchzte heftiger, es klang, als müsste sie ersticken. Nur Frau Uote blieb ganz ruhig.
»Heute bin ich nicht schwach«, sagte die alte Königin sanft. »Ich werde dafür sorgen, dass du gehen kannst. Bei meinem Leben. Geht und versucht zu vergessen. Du und – dein Sohn«, sagte sie.
Dann küsste sie mich auf den Scheitel, legte zwei ihrer kühlen weichen Finger unter mein Kinn: »Ich wünsche dir ein wunderbares Leben, mein Kind.« Wenn ich ihre Augen in diesem Augenblick vor mir sehe, dann denke ich, dass sie es gewusst hat.
Und – hätte es nicht jeder wissen müssen, der mich sah?
»Ein wunderbares Leben«, wiederholte die alte Königin und richtete sich mühsam auf. Sie küsste auch meine Mutter und lächelte, als wäre dieser Abschied das Traurigste, was ihr in dieser schrecklichen Nacht widerfahren war. Sie machte das Schutzzeichen ihres Gottes über unseren Köpfen.
Dann gingen wir, rannten wir, die ganze Nacht, in dieser furchtbarsten aller Nächte.
Frau Uote war Gibichs Trumpf über den Tod hinaus. Seit sie in Worms war, konnte man den alten König nicht mehr nur verachten. Frau Uote machte Recht, was Unrecht war – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie rettete Gibichs Ruf. Ob sie ihn auch nur gemocht hat, diesen Gatten ohne Seele? Wer kann das wissen? Sie hatten vier Kinder zusammen, alle lebten.
Gunther, genannt nach seinem Stammvater Gundahari war der Älteste, dann kam Gernoth, dann Krimhild, Gibichs Tochter, die er allen anderen vorzog. Er hatte bei ihrer Geburt gefordert, dass sie nach Hildiko benannt werden sollte, seiner Lieblingsschwester, die verbrannt war. »Sie sieht auch genau aus wie sie!«, behauptete er stolz.
Aber das wusste niemand zu bestätigen, alle, die Hildiko noch gekannt hatten, waren längst tot oder hatten es vorgezogen, die ehemalige Königsfamilie zu Worms gründlich zu vergessen.
Gibich liebte Krimhild so viel mehr als seine Söhne. Es war auch nicht viel dran an den beiden, das einem Mann wie Gibich hätte gefallen können. Wenn Frau Uote sie liebte, dann nur weil sie so ein guter Mensch war. Gunther war dicklich und ungeschickt. Er ritt nicht gerne, fand die Waffen anstrengend und saß ständig bei seiner Mutter in der Kammer. Er aß gerne, sonst zeigte er keinerlei erkennbare Vorlieben.
Gernoth war dumm. Körperlich stark und zu allem entschlossen wie Gibich selbst, aber mit noch weniger Geist. Dauernd machte er etwas kaputt. Er konnte die Titel der Würdenträger am Hof nicht behalten, egal, wie oft man sie ihm vorsagte, und lauerte den Mägden auf, da war er noch keine zehn Jahre alt.
Gunther und Gernoth hatten Gibichs schlechteste Eigenschaften, aufgeteilt auf ein ungleiches Brüderpaar. Wenn sie eins einte, dann die Wut auf diesen Vater, der sich über sie lustig machte und sie sonst nicht beachtete. Denn Krimhild war sein Ein und Alles.
»Hildiko, mein Häselchen«, sang er ihr vor, und wann immer er nur einen Augenblick Zeit hatte, sah er nach ihr.
Kaum war sie ein halbes Jahr alt, hatte er sie den ganzen Tag bei sich, Uote traf ihre Tochter gar nicht mehr an. Wo immer Gibich saß, nahm er die Kleine auf den Schoß, auch in den Ratssitzungen oder bei Festen hatte er sie ständig dabei, ließ sie nur zum Füttern aus den Augen. Einmal hatte sie ihm sogar bei einer Ratssitzung mit ausländischen Würdenträgern auf den guten Mantel gepinkelt. König Gibich hatte begeistert gelacht.
»Da macht meine kleine Hildiko einen Bach«, hatte er laut gerufen und das noch pinkelnde Kind in die Höhe gehalten, als führte er den ausländischen Würdenträgern eine bemerkenswerte technische Errungenschaft vor. Er fing jede Sitzung erst an, wenn Krimhild ruhig war und auf seinen Knien saß oder zu seinen Füßen spielte.
Das ging so, bis Krimhild ihr zweites Jahr vollendet hatte. Sie war das glücklichste kleine Mädchen, das man sich vorstellen konnte.
Aber dann riet einer der römischen Priester König Gibich strikt davon ab, seine Tochter so zu verwöhnen. Der Priester fürchtete einen Rückfall in die alten Sitten, als Frauen noch im Rat saßen und manchmal Königinnen waren.
Die römischen Priester hatten im Allgemeinen etwas gegen Frauen. Man sagt, es rührt daher, dass vor langer Zeit eine Frau in einem weit entfernten Land ihrem Mann ein Obst weggegessen hatte. Daraus entwickelten sich dann alle möglichen Schwierigkeiten, die noch schwerer zu verstehen waren als die übrigen Geschichten. Jedenfalls sollten wegen der Obstdiebin nun keine anderen Frauen mehr Königinnen sein, und auch sonst sollten sie sich besser ruhig verhalten.
Von Gunther und Gernoth war nicht viel zu erwarten, das sah jeder, der Augen hatte. Der Priester fürchtete deswegen wohl, dass auf Burgunds Thron irgendwann eine Königin Krimhild sitzen würde, wenn er nicht einschritt.
König Gibichs Mutter, sagte man, war noch nicht einmal getauft gewesen. Man fing damals an, von den »Heiden« zu reden, damit meinten sie alle, die sich kein Hemd abholten. Das waren allerdings noch einige.
Muadh aus dem Geschlecht König Vymanriks und Königin Yenkas war eindeutig eine Heidin gewesen.
Der Priester ahnte einen späten, unheilvollen Einfluss der »Gebissenen« aus dem unheimlichen Norden, wo man die Priester der Einfachheit halber ja schon vor der Hemdenvergabe erschlug. Deswegen musste er hart durchgreifen und schnell eine Wende der Gepflogenheiten herbeiführen.
Prinzessin Krimhild dürfe den Ratssitzungen keinesfalls mehr beiwohnen, bedrängte er also den König zu dessen Überraschung.
Seine Uote hätte er ja auch nicht mitgenommen, aber die Kleine? Was für ein Harm war darin, wenn er die Kleine auf dem Schoß hielt und sie mit ihren Klötzchen spielte?
»Es ist überhaupt nie gut, wenn eine Frau mit den Räten im Raum ist«, erklärte der Priester. »Jede Frau ist von Übel, egal wie jung sie ist. In ihr lauert Evas Sünde.« Eva hieß die Frau, die das Obst gegessen hatte. »Sie könnte uns alle fälschlich beeinflussen, durch ihre bloße Anwesenheit! Denkt an Eure Todesstunde, Herr König!«
Diese letzten Worte sagte der Priester häufig, heißt es. Der Priester redete nämlich viel vom Tod und von einer sonderbaren Gerichtsverhandlung, die die Verstorbenen zu erwarten hätten.
Für alles, was sie im Leben getan hatten, würde dann Gericht gehalten, und jeder Verstoß gegen die Regeln des Gottes wurde mit furchtbarer Gewalt geahndet. Der beflissene Priester zählte mögliche strafbare Vergehen auf, von denen Gibich keines fremd war, wie er erschrocken feststellen musste.
König Gibich, der sich im Leben vor nichts gefürchtet hatte, wurde nun mit einem Mal unsicher, fragte nach, was er bei dieser Gerichtsverhandlung nach seinem Tod für ein Urteil zu erwarten hätte. Die vielen stummen Fragen seiner langen Regentschaft suchten plötzlich nach einer Stimme. Es ist nicht bekannt, ob der Priester von Gibichs Feuersbrunst, dem Tod seiner Familie oder so vielen anderen Geschehnissen wusste, aber er machte seine Sache auch so sehr gut.
»Ich sag es Euch nur ungern, König, aber vermutlich wird man Euch bei lebendigem Leibe verbrennen, wieder und wieder!«