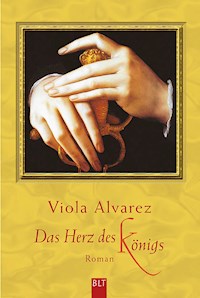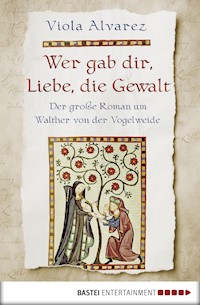
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Walther von der Vogelweide - das Leben eines Genies zwischen Rausch und Sehnsucht
Seine Geburt ist geheimnisumwittert, seine Kindheit die eines Wunderkindes. Er wird der Hofsänger und Dichter des Mittelalters - geschätzt von Fürsten und Königen, begehrt von Frauen.
Man nennt ihn Walther von der Vogelweide.
Als enfant terrible und auf dem Höhepunkt seines Schaffens nimmt er sich jede Freiheit, jeden Rausch. Doch sein Herz ist einsam, Genie und Wahnsinn sind nah beieinander. Walthers ganze Liebe gehört einem Mädchen, das er nicht haben kann: Anna. In ihr sieht er das Gute, Reine in einer Welt, die ihm feindlich und verlogen zu sein scheint. Sie ist der einzige Mensch, dem sich der sensible Dichter öffnen kann. Sie begleitet ihn durch seine dunkelsten Nächte - und bis in den Tod.
Ein großer Roman über einen Mann, dessen Namen jeder schon einmal gehört hat und dessen Leben doch weitgehend unbekannt und voller Geheimnisse ist. Spannend und mit großem Einfühlungsvermögen in Mensch und Zeit füllt Viola Alvarez diese historische Lücke und macht Walther zu einer kinskihaft zerrissenen Persönlichkeit, die zwischen genialem Wahn und der Sehnsucht nach Liebe schwankt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumAnmerkungPrologTeil ITeil IITeil IIIEpilogÜber dieses Buch
Walther von der Vogelweide – das Leben eines Genies zwischen Rausch und Sehnsucht Seine Geburt ist geheimnisumwittert, seine Kindheit die eines Wunderkindes. Er wird der Hofsänger und Dichter des Mittelalters – geschätzt von Fürsten und Königen, begehrt von Frauen. Man nennt ihn Walther von der Vogelweide. Als enfant terrible und auf dem Höhepunkt seines Schaffens nimmt er sich jede Freiheit, jeden Rausch. Doch sein Herz ist einsam, Genie und Wahnsinn sind nah beieinander. Walthers ganze Liebe gehört einem Mädchen, das er nicht haben kann: Anna. In ihr sieht er das Gute, Reine in einer Welt, die ihm feindlich und verlogen zu sein scheint. Sie ist der einzige Mensch, dem sich der sensible Dichter öffnen kann. Sie begleitet ihn durch seine dunkelsten Nächte – und bis in den Tod. Ein großer Roman über einen Mann, dessen Namen jeder schon einmal gehört hat und dessen Leben doch weitgehend unbekannt und voller Geheimnisse ist. Spannend und mit großem Einfühlungsvermögen in Mensch und Zeit füllt Viola Alvarez diese historische Lücke und macht Walther zu einer kinskihaft zerrissenen Persönlichkeit, die zwischen genialem Wahn und der Sehnsucht nach Liebe schwankt.
Über die Autorin
Viola Alvarez, in Lemgo/Westfalen geboren, schreibt seit 2003 historische Romane, u. a. »Die Nebel des Morgens«, eine Neufassung des Nibelungenlieds. Mit »Der Himmel aus Bronze« legt sie zwei spannende Romane um das größte Geheimnis der Bronzezeit vor. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in der Nähe von Köln.
Viola Alvarez
Wer gab dir, Liebe,die Gewalt
Der große Roman umWalter von der Vogelweid
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2009/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Bentele-Hendrick
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0031-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieser Roman erzählt eine Idee des Lebens Walthers von der Vogelweide – nicht sein Leben, wie es war.
Niemand weiß, wie es war. Da nur ein einziges nichtliterarisches Zeugnis von Walthers Leben vorliegt (eine Rechnung über einen Mantel), seine Herkunft, exakte Lebensdaten und Wege bislang von der Forschung weitgehend ungeklärt blieben, handelt es sich bei allen Episoden und Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten, auch wenn diese in aller Wahrscheinlichkeit tatsächlich stattgefunden haben mögen, um reine Fiktion.
Walthers Gedanken, Fragen, Verhaltensweisen und Handlungen sind jedoch direkt von den Inhalten seiner uns überlieferten Sprüche und Lieder inspiriert.
PROLOG
Bozen 1229
Später dachte er auch, er hätte etwas merken müssen, doch außer einem Anflug von Ungeduld in Annas Stimme schien alles wie immer.
»Braucht Ihr noch was zur Nacht, Jungfer Anna?«, fragte Hubil freundlich, wie jeden Abend seit Jahren, wenn er sie zu ihrer Kammer geleitete.
»Nein danke, mein Lieber«, antwortete Anna lächelnd, ebenfalls wie jeden Abend seit Jahren.
»Soll die Hrosvilt Euch noch eine Milch bringen, oder soll ich noch Holz holen?«, kam die unvermeidliche Nachfrage ihres hilfsbereiten Freundes.
»Nein danke, mein Lieber«, antwortete Anna geübt.
»Ja, dann«, machte Hubil und stand unschlüssig auf den engen Stufen, wartete linkisch auf den Abschluss ihres Rituals.
»Gelobt sei Jesus Chistus, Hubil«, sagte Anna denn auch folgerichtig, und Hubil strahlte sie voll einfältigen Vertrauens an.
»In Ewigkeit, amen«, erwiderte er. Anna lächelte und sah ihm zu, wie er auf der dunklen Stiege den Kopf einzog, um sich nicht zu stoßen, als er herunterging.
Da geschah etwas Merkwürdiges:
»Hubil«, rief Anna ihn noch einmal zurück.
»Ja, Jungfer Anna«, er drehte sogleich um, voller Willigkeit, ihr wobei auch immer beizustehen. Die alte Frau lächelte ihn an, man konnte im Dunkeln wohl nicht gut sehen, aber es schien ihm, sie habe Tränen in den Augen. Jedoch als sie sprach, klang sie so ruhig und heiter wie immer:
»Hubil, du und die Hrosvilt, ihr wart so gut zu mir, wie es eigene Kinder nicht hätten sein können. Sagst du ihr das von mir?«
»Ich, das, äh«, stotterte Hubil und verstummte dann überwältigt. Er wollte einen Dank erwidern oder sagen, dass sie auch besser zu ihm gewesen war als seine eigene Mutter, aber sie hatte sich schon umgewandt und die Tür zu ihrer Kammer geschlossen, ehe er sich entschieden hatte, ob solch eine Offenbarung gegen ein Gebot verstieß.
Weil Hubil außerdem wie alle wusste, dass man Jungfer Anna bei ihren Abendgebeten nie stören durfte, schlich er – dennoch leicht beunruhigt – zu Hrosvilt hinunter, um ihr diesen seltsamen Gruß zu überbringen.
Anna, allein im Licht der flackernden Kerze, zog das Pergament aus ihrer Schürze, das ihr die beiden Pilger gegeben hatten. Sie kniete vor dem Kreuz an der Wand und dankte Gott voll liebender Inbrunst für seine Gnade. Die Worte, die man ihr vorgelesen hatte, hallten in ihren Gedanken wider, mischten sich mit den vielen Wünschen ihrer schier ewigen Gebete und tanzten als eine Säule der Freude vor ihren Augen auf und ab.
Sie küsste den weit gereisten Brief vorsichtig und zart.
So wie das Mädchen, das sie einmal gewesen war, gerne den jungen Mann geküsst hätte, der derjenige, von dem dieser Brief geschrieben wurde, einmal gewesen war.
Als sie seinen Namen sagte, halblaut, wie in jedem Gebet seit so vielen Jahren, liefen ihr dann doch die Augen über, und diesmal verhinderte sie es nicht.
»Walther«, flüsterte sie und sah ihn vor sich: Sah ihn, wie er damals war, dann, wie er beim letzten Mal ausgesehen hatte, und sah schließlich nur noch das, was man nicht sehen konnte: diese wundervolle Schönheit, die in ihm war, wie ein Schatz in einer verwunschenen Truhe, die sich nur für sie einen Spalt geöffnet hatte.
Sie weinte nicht, weil er tot war. Sie weinte auch nicht, weil die Pilger ihr erzählt hatten, dass es kein leichter Tod gewesen war.
»Der Bluthusten«, hatte der Größere leise und betreten gesagt, »es ging über Jahre.«
All das war so weit weg, als sie sich aufrichtete und den Brief, den sie selbst nicht lesen konnte, in die Flamme ihrer Kerze hielt.
Er fing nur langsam Feuer und brannte umständlich herunter, sie musste ihn mehrfach in der Hand drehen, bis nur noch ein kleines, angeschwärztes Stück übrig war, das sie in ihren Wasserkrug warf.
»Gelobt sei der Herr«, sagte Anna und machte sich glücklich auf, den letzten Teil ihres Handels zu erfüllen, den heimlichen Teil, der nur für sie war, auf den sie so lange gewartet hatte.
Sie hatte die Schlinge seit Jahren unter ihrem Kopfkissen aufbewahrt und sich manche Nacht dankbar an ihr festgehalten wie an einer leitenden Hand. Sie musste sie mehrfach werfen, bevor sie über dem Deckenbalken hing und zu ihrer Zufriedenheit befestigt werden konnte. Anna hatte keine Angst vor Sünde, als sie den Strick zu sich zog, und keine Angst vor dem Tod.
Sie war sich sicher, dass gleich in dem Moment, da der Heiland sie aus seiner begrüßenden Umarmung entließ, einer da sein würde, der auf sie wartete.
Barfuß kletterte sie auf den kurzbeinigen Schemel und kicherte mädchenhaft, als sie fast das Gleichgewicht verlor, bevor ihr die Schlinge um den Hals lag.
Sie fühlte die düsteren Wände ihrer Kammer sich öffnen, sah sie den Blick freigeben auf jene weit entfernte Wiese, die sie nie vergessen hatte. Die Wiese war so schön wie damals. Anna sprang.
Hubil und Hrosvilt waren fassungslos, als sie sie am Morgen fanden. Hubil versuchte noch verzweifelt, sie am Strick hochzuhalten, als könnte er so ihren Tod rückgängig machen, während Hrosvilt heulend auf seinen breiten Rücken einschlug und ihm vorwarf, er hätte etwas merken müssen.
Man sagt ja, dass die Erhängten von allen Toten am schlimmsten anzusehen sind, aber für Anna stimmte das nicht.
Auf ihrem eingefallenen Gesicht, zur Seite geknickt über dem gebrochenen Hals, lag der spitzbübische Ausdruck einer heimlich Entwichenen. Einer Ausreißerin, die alle genarrt hatte, um sich schließlich aufzumachen zu dem, dem sie ihr ganzes Leben gewidmet hatte.
Gegen alle Vernunft und gute Ordnung.
Und doch hatte es sein müssen.
TEIL I
Die Jahre der Lerche 1171 – 1188
Die Prophezeiung
Im Tal stand ein Hof, auf den ein schmaler Pfad zuführte, der nicht einmal von Pferdehufen, nur von ein paar Ziegen ausgetreten war. Man konnte schon von weitem sehen, wie arm die waren, die hier wohnten – vielleicht nicht immer arm gewesen waren, denn das Haus hatte ein zweites Stockwerk. Wenn man von Osten über den Hang kam, dann lag der Hof ungünstig zwischen zwei Bergen; wenn es, bedingt durch den heftigen Herbstregen, einen Erdrutsch gäbe, dann wäre das Anwesen samt und sonders verloren. Im Süden stand eine Linde, die im Sommer dem Haus wohl Schatten spenden sollte. Es war früher November, und es regnete. Herbstkinder starben leichter als andere, keine gute Zeit, ein Kind zur Welt zu bringen.
Drinnen schrie eine Wöchnerin seit Stunden, die Hebamme war schon am Abend gekommen, aß und trank ungeniert auf Kosten der werdenden Eltern, die wohl kaum selbst genug hatten. »Es wird noch dauern«, sagte sie dem Herrmann, dessen Erstes es werden sollte, ohne Freundlichkeit. »Die Ersten dauern immer. Und mit der ihrem Becken.« Die Hebamme winkte ab, als sei die Unzumutbarkeit ihrer Aufgabe mit Worten gar nicht angemessen zu beschreiben.
Herrmann hielt die Schreie Gunis’, seiner Frau, gepaart mit der dumpfen Gleichgültigkeit der Hebamme nicht aus. Er trat in den Regen hinaus und blickte den verschlammten Pfad empor. Der Regen fiel so dicht, dass er kaum die Wegstrecke nach Ried erkennen konnte, nur eine nasse Mulde vor dem Schatten der Berge. Obwohl es sehr kalt war, schwitzte Herrmann, die Haare klebten ihm am Kopf, und sein Rücken juckte unter der Rupfenjacke, die er trug. Er hatte Bauchschmerzen vor Anspannung, Furcht und Hunger, da die Hebamme sich mit Genuss von dem nährte, was eigentlich für die Woche hätte reichen sollen. Der Rest blieb besser für die Gebärende.
Oben am Weg stand zwischen den grauen, teuflisch tanzenden Strichen des Regens eine Gestalt, schien es. Die Wolken hingen so tief, dass Herrmann dachte, an ihnen ersticken zu müssen. Er keuchte und kniff die Lider zusammen, um besser sehen zu können. Der Schweiß, den er sich nicht erklären konnte, brannte ihm in den Augen.
»Hallo«, glaubte er jetzt gehört zu haben, gedämpft vom Prasseln des Regens, verschluckt von den Schwaden des Nebels, die sich körperlos der überfeuchten Erde entwanden und fetten, riesigen Würmern gleich umherkrochen. »Hallo.«
Der schemenhafte Schatten bewegte sich fließend mit dem endlosen Guss, dem boshaften Plätschern, der alles Leben und alle Hoffnung abschnürenden feuchten Luft. Herrmann sah über die Schulter zum Haus, vom Dach troff das Wasser, sammelte sich in Pfützen, der Regen warf Blasen, die eine um die andere endlos zerplatzten. Im Haus war es still, Gunis schrie nicht mehr. Vielleicht war sie kurz eingeschlafen.
»Hallo«, rief die Stimme wieder von der Anhöhe aus.
Herrmann griff sich einen Knüppel und machte sich auf, den schlammigen Pfad hinaufzuklettern, er keuchte, ihm wurde noch heißer, der Rücken juckte unter dem herabfließenden Schweiß noch schlimmer. Er kam der Gestalt näher; wer immer es war, ihm schien der Regen nichts auszumachen. Still wartete das Wesen auf den Bauern. »Höchstens der Teufel ist bei so einem Regen unterwegs«, keuchte Herrmann zwischen den Zähnen, packte den Knüppel fester und spuckte aus.
In den Dörfern zwischen den Bergen muss man die Gedanken nicht weit schweifen lassen, wenn man sich über den Teufel klar werden will. Er saß kichernd in den zerklüfteten Felsen, die sich lösten, um einem Wanderer den Schädel einzuschlagen. Oder er lockte einen Unwissenden auf die Weiden, um dann mit dem Blitz nach ihm zu werfen. Dass der Teufel im Regen nach einem Bauern rief, das hatte Herrmann zwar noch nicht gehört, aber das hieß nichts. So kurz vor dem allseits verkündeten Weltenende fand der Teufel immer neue Wege.
Die Gestalt war ein Mönch in einer grauen Kutte, völlig durchnässt wie der, den er gerufen hatte, aber lächelnd, heiter, als wartete er die Ankunft des Aufsteigenden bei Maienluft und Sonnenschein ab.
»Was willst du?«, rief Herrmann, als er nahe genug heran war. »Wer bist du? Wo kommst du her?«
Der Mönch war klein, sein Gesicht von einer verstörten Zartheit, zu der das heitere Lächeln nicht passen wollte. Zwischen den Vogelaugen standen ihm tiefe Falten, als wäre er gezwungen, zu häufig Dinge zu sehen, die ihn schmerzten. Herrmann blieb stehen, doch da der Mönch keinerlei Anstalten machte zu sprechen, bewegte er sich nach einiger Zeit weiter auf ihn zu. »Was?«, bellte er.
»Im Dorf sagen sie, dass du einen Sohn erwartest.« Die Stimme des Mönchs verwischte sich in ihrer plätschernden Sanftheit fast vollkommen vor dem Hintergrund des tückischen Regens, der ungestört in seiner brodelnden Gleichförmigkeit niederrauschte. Hatte die Gestalt wirklich gesprochen?
»Ich kann dir nichts zahlen fürs Beten«, sagte Herrmann lauter, als er wollte, wie um das Stimmchen des Mönchs durch sein Beispiel zu heben. »Und Platz haben wir auch keinen. Die Hebamme ist da.«
»Ich will doch gar nichts«, sprach der Mönch, bescheiden schüttelte er den Kopf. »Ich wollte nur etwas weitergeben.«
Herrmann starrte den kleinen Mann an.
»Gebt mir die Hand«, forderte der Mönch in seiner sanften Stimme, der Mund schlingernd hinter den silbernen Bindfäden des Regens, wie die Bewegungen eines Forellenfisches. Herrmann hielt den Knüppel erst fester, nahm ihn dann nur mit der Linken und streckte die schwielige Rechte zögerlich nach dem nassen Mönch aus.
»Oh«, lachte der Mönch überrascht und fasste dann mit beiden Händen schnell zu. So heiß es Herrmann auch gerade gewesen war, mit einem Mal war ihm eiskalt.
»Dein Sohn wird mit Sand in den Schuhen geboren«, redete der körperlose Forellenmund schmeichelnd. Herrmann hörte die Stimme ganz dicht an seinem Ohr, als flüsterte der Mönch direkt hinein.
»Der bleibt dir nicht lange, der geht dir durch.« Herrmann wollte seine Hand zurückziehen, war aber gefangen zwischen seinem Aberglauben, seiner Machtlosigkeit und seiner Furcht.
»Und du musst es wissen, damit du ihn gehen lassen kannst, ja. Weil er Wichtiges vorhat.«
»Was redest du da für einen Unsinn«, wollte Herrmann brüllen, aber es kam nur ein Flüstern heraus.
»Ich geb’s nur weiter. Es ist, wie es ist. Auf dem Hof bleibt der nicht«, meinte der Mönch nachsichtig und entließ die große Hand aus seinem zierlichen Gefängnis.
»Vergelts Gott«, plätscherte er noch und ging dann weiter auf dem Weg nach Ried, seine Fußspuren nach ein paar Schritten schon aufgelöst, als wären sie nie da gewesen.
Herrmann schüttelte den Kopf, dass die Tropfen flogen. Er hörte eine Krähe und kniff die Daumen ein. Um überhaupt etwas zu tun, spuckte er noch mal aus.
»Weibergewäsch, Bangemacherei«, sagte er sich vor, als er den schlammigen Pfad wieder hinabstieg, vorsichtig, damit er sich nichts brach. Ein Scherz war es vielleicht gewesen, ein Jokus, den sich der Hannis und der Fede gemacht hatten. Woher hätte der Mönch sonst gewusst, dass er auf sein Kind wartete. Und Mönch! Das war ein Gaukler gewesen, ein Schnurrer. »Wenn nur alles gut geht!«
Als er dem Haus näher kam, hörte er, dass Gunis wieder zu schreien begonnen hatte. Der Regen nahm kein Ende. Herrmann blieb trotzdem draußen sitzen.
Am frühen Abend kam das Kind zur Welt. Es war gesund und schlief gleich. »Haare hat es schon!«, rief die Hebamme begeistert aus und naschte vom Kindsfett.
Es war ein Sohn. »Meinst du, du kannst morgen hier alleine fertig werden?«, fragte Herrmann seine Frau, die, obwohl die Geburt nun hinter ihr lag, weiter weinte und nicht recht beisammen schien. »Ich muss ins Dorf.«
»Ich kann ja noch einen Tag bleiben«, bot die Hebamme berechnend an und zeigte stolz das Kind der Mutter, die kaum kräftig genug war, es zu halten. Schließlich drehte sie sich, den ruhigen Sohn auf der Armbeuge liegend, einfach auf die Seite und starrte vor sich hin.
»Du kriegst noch andere«, erklärte die Hebamme wohl zu ihrem Trost. »Ich kenn mich aus. Wer beim Ersten nicht draufgeht und halbwegs heil bleibt, der kriegt noch andere.«
»Ich muss ins Dorf«, erinnerte Herrmann vorsichtig an sein Anliegen. Sein Sohn begann zu wimmern; draußen rauschte der endlose Regen.
Fede und Hannis schworen beide, dass sie weder einen Possenreißer angestiftet noch einem Wandermönch von der bevorstehenden Geburt erzählt hätten. Auch weitere Nachforschungen im Gasthaus blieben ohne Ergebnis, so- dass Herrmann beschloss, das Vorgefallene zu vergessen.
Das Herbstkind überlebte, und Gunis rappelte sich bald hoch. Zum Fest der Unbefleckten Empfängnis tauften sie den Sohn Walther. Sonst wären sie vor Lichtmess nicht mehr zur Messe gekommen, so hoch wie der Schnee lag.
Alle redeten davon, wie schön er sei, zumeist wegen seiner vielen Haare. Aber Herrmann behielt noch für Monate ein mulmiges Gefühl, und als sein Sohn laufen lernte, das war schon im späten Sommer darauf, konnte er sich nicht recht freuen. Irgendetwas stimmte nicht.
»Besser, wir haben noch andere«, sagte er seiner Frau. Aber damit wurde es einstweilen nichts.
Herrmann mühte sich redlich, und wenn auch Gunis seinen ehelichen Umarmungen nicht mehr als ein paar Augenblicke selbstmitleidigen Trotzes abgewinnen konnte, so verhalfen seine nutzlosen Versuche, die Brut des Vogelweidhofes zu vergrößern, doch wenigstens dazu, zwischen den Eheleuten klare Fronten zu schaffen. Gunis’ Verachtung für ihren Mann wuchs in gleichem Maße wie ihre abendlich im Halbschlaf beschworene Überzeugung, dass sie ein besseres Leben verdiente, ohne Ziegen, Schlamm und ständig kränkelnde Felder, die nie genug abwarfen. Sie hatte Herrmann nie heiraten wollen und besaß nicht das Geschick so vieler Bäuerinnen, sich mit dem zu bescheiden, was die Sippe ihr zugewiesen hatte.
Herrmann hingegen fühlte weiter eine undeutlich wachsende Furcht, zuerst nur, wenn er seinen schlafenden Sohn betrachtete, doch bald auch, wenn er eine Rast von der Arbeit seines Tagewerks nahm. Um wenigstens diese Momente zu verkürzen und auch, um nicht den ihn boshaft schwächenden Blick seiner Frau zu spüren, arbeitete er bald zweifach so hart wie jeder andere Bauer in der Umgegend; leider, ohne dass auch seine Erträge sich demgemäß verdoppelt hätten. Gunis half immer weniger mit, sie entwickelte eine Vielzahl Herrmann nicht einsichtiger und schwer nachprüfbarer Leiden, die es ihr auch fast unmöglich machten, dem Ehegatten seine diesbezüglichen Rechte einzuräumen. Wenn sie eine Ziege gewesen wäre, hätte sich Herrmann über den Kauf geärgert.
Eines Abends, als Herrmann vom Feld kam, stand nicht einmal Essen auf dem Tisch. Das Kind lag fest gewickelt und bewegungslos auf der Ofenbank, aber das Feuer war lange heruntergebrannt. Es starrte an die Decke, und Herrmann beugte sich erschrocken hinunter, um festzustellen, ob es überhaupt noch lebte. »Gunis!«, brüllte er, vermutete am Ende einen Unfall, ein Verbrechen. »Gunis! Wo bist du?«
Er rannte die schmale Stiege in das obere Stockwerk zu ihrer Schlafkammer hinauf. Gunis saß auf dem Bett und kämmte sich die Haare.
»Was denn?«, fragte sie gereizt über die Schulter, als ihr Mann, den sie längst gehört hatte, hereinpolterte. Die nachlässige Belanglosigkeit, mit der sie ihm begegnete, nahm ihm den Atem.
»Das Kind ist da unten in der Kälte«, stammelte er schließlich. »Und nichts zu essen.« Sie fuhr fort, sich zu kämmen. »Was ist denn los?«, fragte Herrmann noch mal. Er konnte nicht verstehen, was sie tat, war aber sicher, dass es eine ganz normale Erklärung geben musste. »Gunis!«, herrschte er, als sie weiter still blieb und kämmte.
»Stell dir vor«, redete sie da endlich, noch immer, ohne ihn anzusehen. »Ich hatte keinen Hunger. Warum soll ich dann kochen und Feuer machen?«
»Was?«
»Ja, ehrlich, warum? Wieso bin ich dazu da, mich nur um dieses Ding zu kümmern, das sich an mich hängt wie eine Klette und immer was braucht? Oder warum soll ich für dich kochen und immer auf dich warten, wenn ich schon zwei Stunden vorher hungrig bin?«
Herrmann wusste nicht, was er fühlte, als er diese ganz und gar unverständlichen Worte hören musste. »Das kann doch nicht sein«, sagte er in erster Abwehr in seinen überforderten Gedanken. Dann versuchte er, freundlich zu sein: »Ja, aber Gunis, ich bin doch den ganzen Tag auf dem Feld, da willst du doch nicht hin.«
»Ich kann nicht, wegen meiner Krankheit«, unterbrach sie ihn, noch immer in stoischer Gleichgültigkeit.
»Aber hier im Haus, da …«, versuchte er es, »ich meine, jemand muss doch –«
Wieder schnitt sie ihm das Wort ab: »Weißt du, Herrmann, ich bin einfach nicht für solche Arbeit geschaffen. Und wenn du essen willst, melk die Ziege.«
Seit diesem Tag sollten sich die Abende, an denen Gunis sich aufs Bett setzte und kämmte, häufen. An solchen Abenden traute er sich dann gar nicht mehr, sie in den Arm zu nehmen. Manchmal, wenn er sein stummes Kind sah, seine kalte Frau und die endlos harten Felder, fühlte Herrmann sich als der einsamste Mensch unter der Sonne.
Wenn das Weltenende käme, dachte er, wäre es ihm ganz recht.
Er sprach schließlich mit dem Pfarrer unten im Ried über seine häusliche Situation, beichtete sogar nach innerem Kampf an Walthers zweitem Geburtstag seine unheimliche Begegnung mit dem regennassen Mönch, die ihn lange noch in Albträumen heimsuchte. Irgendetwas Seltsames hatte an diesem Tag auf dem Vogelweidhof Einzug gehalten.
»Was glaubst du denn, was an anderen Ehen anders ist?«, fragte der Pfarrer nur zum ersten Punkt von Herrmanns Sorgen, und: »Ein Mönch kann gar kein schlechtes Vorzeichen sein! Das ist rein christlich unmöglich!«, bekräftigte er fromm zum zweiten. »Lass gut sein, Herrmann, das legt sich bald.« Damit hatte er seiner seelsorgerischen Pflicht nach eigenem Gewissen und im Angesicht der kaum nennenswerten Bezahlung durch den grüblerischen Vogelweidbauern vollends genügt.
Aber Herrmann wusste, wie er es an jenem Tage geahnt hatte, dass nur der Teufel bei einem solchen Regen unterwegs gewesen war und dass der Teufel sich im fischig durchsichtigen Gesicht des Mönchs verborgen hatte, um ihm die Freude an seinem Sohn zu verleiden. Was nun seine Frau anging, wollte er dem Teufel ihre Ablehnung für seine ungeschlachte Person nicht zu Unrecht in die Schuhe schieben.
Ein unzufriedenes Weib brauchte keinen Teufel, um missgelaunt zu sein und seinen Ehemann zu verabscheuen. Das ging wohl ganz von allein. Es war wie mit dem Unkraut. Für den guten Ertrag der Ernte musste einer sich mühen, bis ihm der Rücken brach. Und jede Regung des Wetters konnte alles zunichte machen.
Für die Gewächse aber, die die Ernte kleiner hielten, musste man im Gegenteil nichts tun. Sie wucherten und wucherten, in Regen wie in Dürre, breiteten sich aus und verschlangen schließlich alles, ohne dass man ihnen auch nur einen Augenblick Aufmerksamkeit gewidmet hätte.
Das Gute kam schwer, das Schlechte allzu leicht.
Herrmann war ein gläubiger Unglücklicher, ein demütiger Mensch, wenn auch unwissend; und er versuchte sowohl in seinen Feldern, denen das Unkraut zusetzte, als auch in seiner Ehe, in der ihn die angewiderten Blicke seiner Frau trafen, Gottes Ordnung zu erschauen.
Dann aber sah er seinen Sohn an und wusste, dass er die Rechnung wohl nicht allein mit Gott machen durfte. Etwas an seinem Kind widersprach der Ordnung. Aber er wusste nicht, was es war.
Gott zusehen
Als Walther vier Jahre zählte, sorgten sich beide Eltern immer häufiger um seinen Zustand. Diese Überlegung war nicht unbegründet. Die einander fast zu nahe stehende Familienbeziehungen, die bei der Heirat Besitz zusammenfügen und auch -halten sollten, trugen vielleicht zu der Eigenart des Kindes bei. Und auch wenn seine Eltern kaum Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern hatten – beide hatten im letzten Jahr bei einem Feuer einen Großteil ihrer Angehörigen verloren –, spürten sie, dass Walther anders war als andere Kinder.
Im Haus war Walther, wie es üblich war, meistens mit einem Strick an einen der Trägerbalken angebunden, sodass er sich der mütterlichen Aufsicht nicht entfernen konnte. An den Tagen, an denen es Gunis nicht gelang, sich vor der Arbeit auf den Feldern zu drücken, erfolgte diese Sicherstellung ebenso draußen am Heuwagen. Wenn Gunis nicht so sehr mit sich selbst und ihrer Verdrossenheit beschäftigt gewesen wäre und Herrmann nicht zu unglücklich und immer überarbeitet, dann wäre es ihnen vielleicht schon eher aufgefallen, wie wenig dieses Kind schrie, wie wenig es – gesund, wie es glücklicherweise war – sich auslaufen wollte und nie gegen das Seil rebellierte.
Wie Walther mit dem Hanfseil an den Heuwagen gebunden dasaß, in der hellen Sonne, unbeschäftigt, ohne Geschwister, von Insekten umsummt und mehr als einmal schlimm von den Pferdefliegen gestochen, war er ein Bild, das auch harte oder eben eitle Herzen in ihrer Verschlossenheit rühren konnte. Seine Haare, dicht und lockig, haselnussfarben mit goldenen Spitzen, schimmerten in der Sonne. Das klare, ebenmäßige Gesicht, der volle Mund von einem unwirklichen Kirschrot; dann die Augen, die einen jeden stutzen ließen, der hineinsah. Augen von der Weite des Himmels, von unendlicher Tiefe und erschreckender Klarheit. Er glich niemandem, weder Vater noch Mutter und auf seine Art nicht einmal einem Kinde, in solchen Augenblicken. Er wirkte wie ein kleiner, fertiger Mensch, der voll besonnener Ungeduld auf die Erfüllung einer Pflicht wartete, die er noch nicht kannte. Die Hand, die man nach seinen weichen Haaren ausstrecken wollte, um das Kind zu kosen, kam aber nie an ihrem Ziel an, erstarrte vielmehr, wenn man die Augen sah, die eine solche Berührung nicht wünschten und nicht fürchteten. Und wenn Walther, süß lächelnd, seine Eltern wieder in einiger Entfernung von sich wusste, dann senkten sich diese Augen in die aufmerksame Betrachtung kleiner und kleinster Dinge, die er ganz für sich und mit ernstem Verständnis entdeckte.
Er sprach schon früh, und von den wenigen Wörtern, die sich Gunis und Herrmann hin und wieder lieblos zureichten, beherrschte er schnell alle. Er verblüffte beide an einem Septemberabend in seinem dritten sich neigenden Jahr, als er mehr für sich mit zwei Holzlöffeln in einer Ecke saß und Szenen aus der Ehe seiner Eltern nachspielte. »Pass doch auf, du blöder Bauer, jetzt hast du mir wieder den halben Acker mit nach Hause gebracht. Wie soll ich das putzen, so wie ich leide«, sagte der Gunis-Löffel in exakt ihrem Tonfall und Gift. »Ach, das hab ich gar nicht gesehen, tut mir ja leid, Liebes«, duckmäuserte der andere Löffel mit nachgemachter Herrmann-Stimme. Beide Löffel klangen so echt, dass die Eltern sich bemühen mussten, nicht hinzuhören, die Wahrheit, die mit ihrem Sohn im Winkel saß, wieder aus dem Haus zu kehren.
In der Kirche quengelte Walther nie, sondern hing mit weit offenem Mund, Augen und Ohren im Arm der Mutter, alles in sich hineinsaugend, das er hörte. Oft saß er auch des Abends still in der Kammer und bewegte lautlos die Lippen.
Schließlich konnte Herrmann, dem es auf seine Art auch lieber war, die Angst vor einer unerfüllten Prophezeiung gegen die Schmach einer erfüllten Gewissheit zu tauschen, nicht mehr schweigen.
»Ich glaube, der ist nicht ganz richtig im Kopf.« Er flüsterte aus Rücksicht auf das Kind: »Wie der immer nur dasitzt und stiert. Das ist nicht richtig.«
»Du hast es also auch gemerkt!«, rief Gunis mit großen Augen, einen Glanz von erregter Angst darin.
»Ich, ja«, bekannte Herrmann, nicht wissend, ob dies eine seiner vielen tadelbehafteten Eigenschaften war.
»Es ist bestimmt der Teufel, Herrmann, der ist verhext, der ist besessen. Weil er so hübsch ist, den hat eine auf dem Markt verhext!«
Der Ehemann und Vater, der das Kind eigentlich nur für schlicht oder verblödet gehalten hatte, witterte aber in seiner Zustimmung zu den verstiegenen Thesen seiner Frau, dass eine spätere eheliche Annäherung folgen könnte. Da ihm an dieser Gelegenheit vieles lag, verfolgte er seinen eigenen Ansatz nicht weiter und pflichtete in der folgenden, zumeist von Gunis bestrittenen, Unterhaltung ihren Bedenken bei, die sich auf eine Begebenheit im Frühjahr des Vorjahrs konzentrierten. Eine fremde Marktfrau hätte Walther auf Gunis’ Arm erspäht und ihm die Hand unter das Kinn gelegt. »So hübsch, ein Engelchen«, hätte die Alte gesagt. Daraufhin wäre das Kind – und Herrmann wüsste selbst, wie selten das passierte – in helles Schreien ausgebrochen, was noch mehr für eine Verhexung spräche. »Der hat das gefühlt!« »Ja, wenn du meinst«, sagte Herrmann in geübter Ergebenheit in den Willen einer ewig Unzufriedenen.
So wurde der Priester bemüht, von Ried den steilen Weg zum Vogelweidhof erst auf- und dann wieder abzusteigen und den Knaben zu begutachten, ob er entweder zurückgeblieben oder verdammt war.
Der Priester, derselbe, der Herrmann auch schon anlässlich seiner ehelichen Sorgen beraten hatte, nahm sich auch wegen des langen Rückwegs Zeit mit dem seltsamen Kind, das ihn mit aufmerksamen Augen und an leichter Hand zu einem Platz auf der Wiese führte, wo es sich niederließ. Ohne Sorge oder Unsicherheit ging es mit dem fremden Mann von den Eltern fort.
Mit leiernder Stimme und mattem Pflichtgefühl begann der Priester dann, dem Kind die ritualisierten Fragen zu stellen, auf die er keine Antwort erwartete, nämlich, ob er den Teufel in sich trüge, ihm Unterschlupf gewährte, ihn befreundet hätte und dergleichen mehr, was einem so kleinen Wesen gar keine Vorstellung sein konnte.
»Nein, Ehrwürden«, sagte da das Kind deutlich. »Das tue ich nicht.«
Der Priester wäre fast hintübergefallen. Nur mühsam wahrte er die Fassung. Er sah sich verunsichert um.
»Wieso wolltest du hier auf die Wiese?«, fragte der Geistliche.
»Die Wiese ist schön«, antwortete das Kind.
»Und was machst du hier auf der Wiese?« Er setzte sich ächzend neben das Kind ins Gras. Es war feucht.
Der unwirkliche Kirschmund lächelte, aber er schwieg.
»Was machst du hier?«, fragte der Priester nochmals.
»Gott zusehen«, sagte der Kleine und redete erstmals in verwischter Kinderart, sodass der Gottesmann noch einmal nachfragte, um sicherzugehen, dass er richtig gehört hatte. Nachdem dies – umso erstaunlicher – sichergestellt war, bekreuzigte er sich, und das Kind folgte artig seinem Beispiel. So gut es konnte, versuchte es zu erklären, was es tat, wenn es glaubte, »Gott zuzusehen«, und der Priester zog daraus den richtigen Schluss, dass dieser seltsame Knabe gerne auf der Wiese saß, um nachzudenken. Wenn es auch keinen Grund gab, in dieser Beobachtung satanische Besessenheit zu vermuten, war es doch höchst ungewöhnlich, womit das Kind sich unterhielt. Walther machte den Priester auf seine Erkenntnisse bezüglich des Verhaltens der Fliegen, Vögel und Bienen aufmerksam.
»Die streiten«, fasste er seine Gedanken zusammen; und der Priester konnte es nicht verhindern, dass er sich bei diesen Worten unwillkürlich nach den vom Hof her um die Stallecke lugenden Eltern umdrehte, die einen seltenen Moment der Einigkeit teilten, wenn auch nur Einigkeit in Neugierde. Der Junge lächelte vor sich hin, er schien heiter, fast amüsiert, als kenne er ein Geheimnis, das niemand sonst verstehen würde.
»Auf Wiedersehen, mein Kind«, beendete der Priester die ungewöhnliche Untersuchung schließlich und trat, selbst verwirrt, aber gesammelt, zu Herrmann und Gunis.
»Er ist nicht vom Teufel besessen, und er ist auch nicht krank im Kopf«, teilte er mit. Er fand des Kindes unschuldige Kritik an Gottes Schöpfung – »die streiten« – auf seine Art sehr zutreffend, fast göttlich wiederum in ihrer Einsicht und Genauigkeit. Trotzdem war etwas an dem jungen Walther, was einen vorsichtig sein ließ.
»Aber er ist seltsam«, bebte Gunis, die ihrerseits den Gedanken an etwas Außergewöhnliches, das sich in ihrem Leben ereignen könnte, nicht schon fahren lassen wollte.
»Er ist wirklich seltsam«, bekräftigte Herrmann in eilfertiger Unterwürfigkeit. Alle drei sahen wie verabredet über die Schulter zu dem stillen Kind hin, als wäre es ein Vogel, eine Feldlerche, klein, heiter und viel zu leicht, die, durch Lärm oder üble Gedanken aufgeschreckt, einfach davonfliegen und ihren Blicken über den sie umarmenden Feldern entschwinden könnte.
»Ja«, nickte der Priester entschieden. »Er ist seltsam.«
Und dann, sich an Herrmanns vormaliges Anliegen erinnernd, fügte er in gut gemeinter männlicher Solidarität an: »Es wäre sicher besser für ihn, wenn er ein paar Geschwister hätte.«
Damit schlug er ein aufforderndes Kreuz über Gunis, die zu Boden sah. Im Innern Buße tuend für den Verdacht, den sie gegen ihr eigenes Kind gehegt hatte, ergab sich Gunis daraufhin den ängstlich tastenden Annäherungen ihres Mannes in zwei Nächten hintereinander. Herrmann fühlte sich deshalb so ungewohnt glücklich, leicht und befreit, dass er sich am dritten Abend in Ried betrank und erst am nächsten Morgen nach Hause kam.
Gunis’ Gesicht zu seiner Rückkehr war ein deutlicher Hinweis, dass die vorherigen zwei Nächte von ihr inzwischen bedauerte Ausnahmen darstellten, und Herrmann wurde wieder traurig, schwer und ein Gefangener seines eigenen Hauses.
Er nahm Walther jetzt mit auf die Felder und trug ihm kleine Arbeiten an, die das Kind pflichtbewusst und nicht ungeschickt ausführte. Aber wann immer der Vater ihn nicht mit einer Aufgabe betraute, stand Walther, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, auf erschreckende Art einsam in den Furchen oder Halmen, blickte in den Himmel oder nach den Bergen und sah Gott zu.
Auf den Festen im Dorf, zu denen sie ihn mitnahmen und auf denen er auch andere Kinder traf, fügte Walther sich ohne Schwierigkeiten in die Reihe jagender, spielender Dorfrangen ein; tollte mit ihnen, johlte um die gleichen Nichtigkeiten und bot ein überzeugendes Bild kindlicher Freude und Ausgelassenheit. Er hielt sich nicht abseits, starrte auch nicht vor sich hin, sondern mengte lachend und forschend mit bei den Spielen und Streichen, mit denen sich die Jungen und Mädchen seines Alters gemeinhin vergnügten.
Doch dann, auf der Hochzeit eines jungen Paares im Leyertal, sah Herrmann, wie Walther nach einer Hatz der Kindesmeute hinter einen Koben trat und sich erschöpft mit geschlossenen Lidern an die Wand lehnte. Herrmann wusste plötzlich, dass es nicht die Tollerei war, die das Kind ermüdet hatte, sondern die Gesellschaft, die es dabei hatte. Wusste mit eisigem Erschrecken, dass Walther ein glückliches Kind unter anderen Kindern zu sein nur gespielt hatte, nicht aber nur für einen Augenblick eines gewesen war.
»Walther«, rief er den Sohn besorgt zu sich. »Was ist denn mit dir?«
»Die sind alle so laut«, flüsterte der Knabe, und Herrmann fand, dass Walther plötzlich Schatten unter den Augen hatte, dass seine Haut nicht mehr milchig zart, sondern fast durchscheinend war. Er streckte die Hand aus und legte sie dem Kind auf die Stirn. Was auch immer dahinter vor sich gehen mochte, Herrmann nahm sich vor, es nicht mehr zu fürchten.
»Komm, wir gehen«, führte er den Kleinen fort und hielt ihn den ganzen Weg, bis sie zum Hof zurück waren, an der Hand. Vielleicht war es Zufall, aber an diesem Abend teilte Herrmann seiner Frau mit, dass es wohl keinen Sinn habe, auf weitere Kinder zu hoffen, und dass sie von nun an wie »alte Leute« zusammenleben sollten. Der Hinweis auf Alter als einzig natürlichen Grund für eheliche Enthaltsamkeit kränkte Gunis, gerade zweiundzwanzig geworden, aber ihre Erleichterung, kein nächtliches oder gar morgendliches Tasten ihres Mannes mehr erwarten zu müssen, war ungleich größer.
»Ist wohl fürs Beste«, nickte sie mit verkniffenem Mund.
Herrmann hatte sich entschieden. Gleich ob es der Teufel, ein Engel, ein einfacher Mönch, ein Gaukler oder nur das Hirngespinst seiner eigenen Angst gewesen war, das ihm an Walthers Geburtstag zugeplätschert hatte, dass er den Sohn gehen lassen müsse, er glaubte nun, dass es in jedem Fall die Wahrheit war, die er gehört hatte. In den müden Augen des Kindes hatte er mit dem Mut seiner Fürsorge eine so zerbrechliche Feinheit gesehen, so ohne Vergleich zu allem, was Herrmann kannte, dass ihm klar wurde, diese Zartheit könnte auf dem Vogelweidhof keine Heimat finden. Es gab nichts in seiner engen Welt der harten, fordernden Berge, was der ernsthaften Empfindlichkeit in Walthers Blick ähnelte, doch eben dahinter hatte Herrmann eine ganze Welt gesehen, voller Farben und Länder, die ihm fremd, verheißungsvoll und doch unerreichbar waren.
Die Bestrebungen seiner eigenen Eltern, das karge Land zu erhalten und wenigstens etwas zu mehren, hatten zu der nahen verwandtschaftlichen Ehe mit Gunis geführt, aus der kein Glück gekommen war. Der nie ausgesprochene Pflichtauftrag an ihn, der ja auch ein Sohn gewesen war, diese Pläne zu guter Vollendung zu führen und weiterzugeben an die, die nach ihm kämen, erschien ihm nun völlig sinnlos.
Von Walthers Bettstatt aus ging er hinaus in den späten Abend und hörte, wie sein Sohn gesagt hätte, den Bergen zu. Dann schließlich griff er vor sich in den Staub und nahm eine Hand voll trockener Erde mit ins Haus. Er streute sie liebevoll in die kleinen ledernen Schuhe seines Kindes. Wenn er gehen müsste, so sollte es zumindest der Sand vom Vogelweidhof sein, der ihm das Laufen befahl.
Herrmann berührte die zarte Haut von Walthers Wange.
Er blieb ein seltsames Kind, doch vielleicht war er das einzige Gute in Herrmanns Leben, das ohne ein Zuviel an sinnloser Arbeit trotzdem gedeihen würde.
Wenn ich ein anderer gewesen wäre …
Wenn ich ein anderer gewesen wäre, wie sehr hätte ich meinen Vater geliebt für alles, was er mir zu sein versuchte. Ich wäre vielleicht auch dann mit ihm auf die Felder gegangen wie der, der ich war, aber ich hätte mehr zu ihm stehen können. Hätte vielleicht seine Hand genommen, wenn er sie mir entgegenstreckte. Ich sehe uns, wie es hätte sein können. Arbeitend, lachend, Sorgen teilend, zusammen. Wenn ich etwas gefunden hätte, was ich nicht verstand, dann hätte ich ihn gerufen. Hätte bei ihm auf den Schultern sitzen wollen, so wie andere Kinder mit anderen Vätern, die kleinen Hände auf der Stirn des großen Mannes gefaltet, klein und machtvoll, vertrauensselig und glücklich.
Ich sehe die Sonne untergehen, westlich vom Bissner-Land, die Berge errötend, der Himmel gewölbt, den abendlichen Hauch von Sterben in der Luft – und dann wir beide. Vom Feld kommend, ich auf seinen Schultern, lachend, er bockt wie ein Pferd, ich versuche mich festzuhalten: »Papa, Papa, nein«, quietsche ich und will doch, dass er weitermacht. Und er versteht es und bockt und galoppiert trotz des schweren Tages weiter bis hin zur Tür, wo ich »Hooo!« rufe, und er schnaubt und schüttelt sich. »Braves Pferd«, kichere ich, und er hebt mich herunter.
Wie sehr hätte ich meinen Vater geliebt. Ich stelle mir dieses nie gewesene Bild, diesen unschuldigen Ritt vor, vom Feld bis zur Tür. Aber dann wische ich es weg. Denn hinter dieser Tür hätte Gunis uns erwartet, und all meine Vorstellung reicht nicht aus, mir auch noch zu denken, dass nicht nur ich, sondern auch sie eine andere hätte sein müssen, damit ich Herrmann so sehr hätte lieben können wie er mich.
Er war, wie er war. Ich hätte ein anderer sein sollen.
Der Pflaumenbaum
Im Sommer, bevor Walther sechs Jahre alt wurde, kamen Reisende, die den Weg nach Ried der einbrechenden Dunkelheit wegen nicht mehr bis zu ihrem ursprünglichen Ziel gehen wollten, schließlich zu der Entscheidung, lieber den schmalen, von Ziegenhufen ausgetretenen Pfad zum Vogelweidhof hinunterzusteigen, um bei Herrmann und Gunis um Nachtquartier zu bitten. Gunis entbrannte für den einen der beiden Fahrenden, einen Welschen, sofort in mädchenhafter Schwärmerei, die zuerst kaum ihrem Mann, umso mehr aber ihrem Sohn auffiel, dessen Fähigkeit zur Beobachtung kleinster Dinge sich mit den Jahren verstärkt hatte. Sie leckte sich die Lippen, sodass sie nach kurzem Glanz recht rissig davon wurden, und zog sich immer wieder für kurze Augenblicke aus dem Gespräch mit den Männern zurück, um sich das Haar neu zu setzen, wie sie sagte.
Walther nahm diese Begründung, abgelenkt durch das fesselnde Interesse, das er den Wanderern vom ersten Moment an entgegenbrachte, zunächst als wahrhaftig hin, stellte dann jedoch fest, dass Gunis den gleichen Satz wieder und wieder mit immer neuer Dringlichkeit in Richtung des Welschen formulierte. Der folgte ihr aber – sei es aus Sprachunkundigkeit oder mangelnder Begeisterung für Gunis – trotzdem nicht nach, wie es offensichtlich ihre heimliche Absicht war, wenn sie vor die Hütte trat und mit immer gleich gewundenen Zöpfen nach einiger Zeit zurückkehrte, den Gast umso zwingender anstarrend.
Der Welsche war in der Tat ein Mann von besonderem Aussehen, gänzlich anders, so stellte das Kind Walther, geleitet von den Blicken seiner Mutter, fest, als die hiesigen Bauern und selbst die Händler. Er war von geringerem Wuchs, doch dabei von einer lodernden Dunkelheit; trotz der langen Reise im Staub des späten Sommers glänzte sein Haar unter der Kappe, die er höflich abgenommen hatte, als er und sein Gefährte die Stube betraten.
»Wo kommt denn ihr zwei her?«, hatte Herrmann gefragt und einen Napf mit kühlem Wasser und einen Laib Brot auf den Tisch befördert. Es hätte an diesem Abend Grütze geben sollen, aber es wäre nicht genug für alle gewesen.
Der Welsche redete nichts, überließ die Erklärungen seinem Gefährten, einem überfreundlichen Mann mit schmeichelnder Stimme, der, wie er freimütig preisgab, aus Regensburg stammte. Die beiden Gäste waren Fahrende, der Welsche ein Scholar, der bei verschiedenen gelehrten Herren studiert hatte, um nun als Lehrer in seine römische Heimat zurückzukehren. Der Regensburger befand sich auf einer Wallfahrt und hatte sich ihm angeschlossen, wegen der vielfältigen Gefahren einer solchen Reise.
»Ja, da kommt ihr ja viel herum«, redete Herrmann freundlich, und Walther bemerkte, wie die gespannte Wachsamkeit des Welschen sich etwas erweichte, fast so, als veränderte sein Körper die Gestalt.
»Der Giacomo, das ist ein Misstrauischer«, erklärte der Regensburger auch gleich das stille Wesen seines Begleiters.
»Giacomo«, wiederholte Gunis hauchend den fremdländischen Namen und schlug sich dann mit der Hand vor den Mund, als wollte sie diesen unleugbaren Beweis ihrer sehnenden Gedanken wieder zurückbefehlen.
Herrmann schüttelte nur den Kopf.
»Wie das?«, fragte er, die peinliche Stille unterbrechend, »war Ärger unterwegs?«
»Ist für einen Welschen nicht so ganz einfach in den Städten«, erklärte der Regensburger. »Die Leute haben nicht viel übrig für die Römer. Wer für den Kaiser ist, kann ja nicht für den Papst sein.«
»Sicher, sicher.« Herrmann nickte mit dem Kopf, doch es entging Walther nicht, dass er den Gast dabei nicht ansah. Er vermutete, dass der Vater nicht wusste, um was es ging.
»Ha, so was!«, unterbrach Gunis, »diese Zöpfe. Ich geh mir mal eben die Haare aufsetzen.« Der Welsche starrte einfach weiter auf den Tisch, und Herrmann schüttelte in stummer Verzweiflung unmerklich den Kopf.
»Und deswegen spricht er nicht viel. Hat in der Nähe von Passau eine Abreibung von ein paar Übermütigen kassiert. Meist rede ich, aber er sieht ja nun auch so ausländisch aus, dass alle gleich nachfragen«, fuhr der Regensburger fort. Etwas in seiner Stimme war falsch, dachte Walther.
Gunis kam wieder herein, die Haare unverändert. »Ja, also, ein Wind ist das heute Abend!«
»Und wo wollt ihr nun hin? Seid ihr auf dem Wege nach Ried?«, fragte Herrmann schnell, um von der erbarmungswürdigen Vorstellung seiner Frau abzulenken. Der Regensburger erklärte die vor ihnen liegende Route, die Giacomo ihm anvertraut hatte. Er ließ nicht aus zu erwähnen, wie gefährlich die Reise sei, an deren Ende aber die größte Belohnung stünde, die ein Christenmensch sich erhoffen könnte: Rom zu sehen.
»Was«, fragte Walther, völlig ergriffen von den Worten des Reisenden mit der falschen Stimme, »was ist ein Rom?«
Der Vater und der Regensburger lachten, der Welsche aber schien erstmals von dem stillen Kind Notiz zu nehmen, hatte vielleicht aufgrund der einfachen Formulierung auch die Bedeutung der für ihn fremden Laute verstanden.
»Roma«, sagte Giacomo und legte beide Hände nach oben aufgefächert auf den Tisch, »Roma est corona mundi.« »Das heißt Weltenkrone«, erklärte der Regensburger. »Nicht etwa Welfenkrone! Hahaha. Der Giacomo, der redet lateinisch. Ist eben recht studiert, der Welsche.«
Seine Fröhlichkeit blieb ob ihrer gewollten politischen Feinsinnigkeit unverstanden von den Gastfreunden und daher auch unbeantwortet, bis auf ein eher dümmlich anmutendes Lächeln von Gunis, die sich nicht entblödete zu sagen: »Ich wollte auch überhaupt immer schon mal nach Rom.«
Herrmann sah zu Boden.
Da klopfte es an die Tür, als wollte jemand das Holz einschlagen. Kaum eine Aufforderung zum Eintreten abwartend, kam der Lapps-Bauer in die Stube getrampelt.
»Beim Bissner ist ein Ast vom Pflaumenbaum abgebrochen! Ein ganz großer. Vom Wind!«
»Nein!«, rief Herrmann aus. »Das muss ich sehen.«
Und er lief sofort mit dem Nachbarn hinaus, als wäre der Retter der Welt auf dem vom Pflaumenbaum gestürzten Ast zu finden. Gunis, hin und her gerissen zwischen ihrer bislang unerwidert gebliebenen Bewunderung für den Welschen und der Angst, ein so wichtiges Ereignis des dörflichen Lebens zu verpassen, zuckte schließlich bedauernd die Schultern und verließ das Haus ebenfalls. »Walther, komm mit«, forderte sie ihren Sohn auf, sah sich aber kaum nach ihm um.
Walther blieb sitzen, wo er war, die beunruhigenden Augen auf den Regensburger geheftet, den er als das eigentliche Zentrum dieser unerwarteten Unterweisung begriff.
»Na, Kleiner«, redete der auch gleich in der unvorsichtigen Art, wie er sie Kindern gegenüber gerne als freundlich ansah. »Wie alt bist du denn, gehst du schon aufs Feld, wirst auch ein wackerer Landmann wie dein Vater?«
»Ich würde lieber noch ein paar Fragen nach diesem Rom stellen, wenn es Euch recht ist«, erwiderte der Junge, und der Regensburger hätte nicht verblüffter sein können, wenn die Katze, die über dem Rauchfang lagerte, angefangen hätte, mit ihm zu sprechen.
»Was willst du? Was?«, fragte er nach.
»Ich möchte gerne wissen, was eine Weltenkrone ist und wieso man nicht für den Papst und den Kaiser sein kann, bitte«, trug das Kind sein Anliegen bescheiden und höflich vor. Der Kirschmund lächelte. Es lag etwas Unheimliches in diesem Lächeln, etwas Unberechenbares.
»Quid dixit?«, fragte Giacomo wachen Auges nach.
»Äh«, der Regensburger, vorher so weltläufig und erklärungswillig, hob abwehrend die Hand. »Das ist eine, also, Rom«, verzettelte sich der Gast und runzelte schließlich ungehalten die Brauen. Er schätzte, dass die Eltern eine Weile wegbleiben würden. Es gab keinen Grund mehr, sich gefällig zu verhalten. »Das ist alles noch viel zu schwer für so ein Kind. Geh dir nur die Pflaumen ansehen. Was weißt du schon …« Damit stand er auf und setzte sich, dem Begleiter und dem Knaben den Rücken gekehrt, an den Herd.
Giacomo, der Welsche, aber lächelte dem Kind aufmunternd zu. »Roma«, sagte er und tippte sich zuerst auf das Herz und dann an die linke Schläfe. Walther nickte.
»Roma«, wiederholte Giacomo und mimte, als würde er sich frisches Wasser von einem Brunnen oder einer Quelle schöpfen und ins Gesicht spritzen.
»Habt ihr keinen Speck im Haus, Junge?«, fragte der Regensburger, dessen lustige Persona sich gleichsam mit der Abwesenheit der Eltern von ihm entfernt hatte. Er stand auf und begann das Innere der Stube auf eigene Faust zu erkunden, sah in Beutel und Krüge, wohl auf der Suche nach Vorräten, von denen er fürchtete, dass sie ihm durch die magere Gastfreundschaft der Bauern hier verwehrt bleiben würden.
»Corona mundi«, sagte Giacomo, völlig in seinem Spiel für das Kind mit den seltsamen Augen gefangen, und ließ seine Hände auseinander fächern, wie eine Blume sich öffnete.
Da griff Walther verstehend den Welschen bei der Hand und zog ihn hinaus auf seine Wiese. Er deutete auf die Linde und die Berge und sagte auch: »Roma.«
Erst wollte der Fahrende ihn korrigieren, dachte, dass das Kind ihn doch missverstanden hatte, als Walther vorsichtig sprach: »Corona mundi. Hier.« Er zeigte auf sich und den Boden, auf dem er stand.
Der Welsche sah das seltsame Kind an und nickte: »Si«, sagte er, »tua corona mundi, hic.«
Die Sonne ging gerade unter, die Luft war von einer schmerzhaften Milde. Walther stand mit Giacomo in einem Moment dem Kind unbekannter Nähe und Verbundenheit. Die Eltern kamen vom Bissner-Hof her über den Hang zurück; Gunis hatte die Schürze voller Pflaumen.
»Was nicht alles so an einem Tag passieren kann«, rief sie ausgelassen, als sie ihren Sohn mit dem Gast unter der Linde stehen sah. Ihre Augen strahlten, und sie schüttelte ihren Kopf, dass ihr nun wirklich die Zöpfe verrutschten.
»Da denkt man nichts Böses und dann! Der ganze Ast ist einfach abgefallen! So auf eins. Ist das nicht schrecklich aufregend?! Komm, Walther, probier mal. Sind schon reif.«
Sie zog Walther auf die Haustür zu. »Ich wette, das sehen die in Rom auch nicht alle Tage«, fügte sie kokett an und gab durch diese kleine Eitelkeit dem Regensburger glücklich Gelegenheit, einen nicht angebotenen Streifen Speck zu verschlucken, bevor er gesehen wurde.
Am nächsten Morgen zogen die beiden schon früh weiter. Gunis war schlechter Laune und bemühte mit halbherziger Darstellung eine ihrer vielfältigen Krankheiten, um nicht aufs Feld zu müssen. Herrmann war es nur recht. Er wollte mit seinem Sohn sprechen, er hatte Walthers Interesse an den beiden Vaganten wohl bemerkt; und aus seinen eigenen Beweggründen fand er es an der Zeit für eine väterliche Unterweisung, wenn es auch nicht die war, die man von einem Bauern im Allgemeinen erwarten würde.
Nachdem sie eine Weile Hamster gejagt hatten, die in diesem Jahr eine furchtbare Plage waren, winkte Herrmann, dass Walther sich setzen sollte. Es war heiß.
»Machen wir eine Pause. Gott zusehen, ja?«, lockte er. Walther setzte sich in einigem Abstand zu seinem Vater und sah sofort auf den Boden, als gäbe es dort Wichtiges zu entdecken. »Na, die zwei, die werden jetzt schon in Ried sein, mindestens, oder schon durch, was meinst du?«
Walther blieb still. Der warme Wind fuhr in seine schönen Haare und ließ die blonden Spitzen wehen. »Besser, wenn sie vorm Herbst über den Pass kommen. Sonst schneit’s. He?« Leutselig, obwohl er wusste, wie ungern sein Sohn diese Form von Berührung hatte, schlug er dem Kind sanft auf die Schulter. Er konnte sich nicht helfen.
Wie sollte man sich denn nur immer im Zaum halten, nicht einmal das eigene Kind zu herzen, es nicht zu drücken, wenigstens ihm hin und wieder durchs Haar zu fahren, alles Dinge, die von Walther mit abwartender Steifheit erduldet, aber nicht erwünscht wurden. Aus Liebe zog Herrmann dann auch die Hand zurück, die ebenfalls aus Liebe im Nacken des Jungen liegen wollte.
»Der Giacomo und der Diederich, das sind Fahrende. Die kommen viel in der Welt herum. Das sind so die Arten von Leuten, gell? Die Bauern, die bleiben, wo sie geboren werden, und die Fahrenden, die treibt’s in der Gegend herum. Da kann man bis Rom kommen. Als Bauer kommt man nur bis Ried oder ins Leyertal.«
Walther schwieg, er sah weiterhin nach unten; aber Herrmann hatte das untrügliche Gefühl, dass das Kind ihm trotzdem zuhörte.
»Ja, so ist das«, fuhr er deshalb leichthin fort, »Bauern und Fahrende. Die einen so gut wie die anderen. Die einen bleiben, und die anderen gehen. Sonst gibt’s keine Unterschiede.«
Mit dem Zeigefinger malte der Junge Kreise in den Staub. Herrmann versuchte es noch einmal: »Da soll man nichts Schlechtes über die Fahrenden sagen, nur weil einer Land und einen Hof hat, ist er noch kein guter Mensch. Manche haben eben Sand in den Schuhen.«
Ruckartig hob der Sohn den Kopf.
»Was ist das?«, wollte er wissen, in der Stimme eine drängende Neugier. »Sand in den Schuhen?«
Herrmann stiegen Tränen auf. Er räusperte sich, bevor er weitersprechen konnte: »Also, wenn einer Sand in den Schuhen hat, dann ist er kein Bauer. Dann muss er wandern, immer weiter. Von einer Straße zur anderen. Da drängt es ihn. Da kann er nichts machen. Das fühlt er.«
Er lächelte sein seltsames Kind an, das ihm schon jetzt so entrückt wie eine liebliche, aber schmerzhafte Erinnerung vorkam. Eine Libelle flog vorbei.
»Du bist Bauer«, sagte Walther schließlich leise, aber in eher fragendem Ton.
»Ja«, sagte Herrmann scheinbar unbeschwert, »das stimmt, ich schon.«
»Und ich?«, Walthers helles Stimmchen zitterte. »Bin ich auch Bauer?«
Er sah weiter auf den Boden. Der Wind wehte seine Wange frei, die Herrmann zugewandt war. Die liebliche Rötung seiner Haut, die großen Augen voll von ungeweinten Tränen, die anderen Kindern so leicht und schnell kamen, die kirschroten Lippen fest aufeinander gepresst, all diese Kleinigkeiten sah Herrmann in diesem Moment mit der gleichen Bewunderung, die er den Altarschnitzereien in der Kirche manchmal entgegenbrachte, wenn er dem Priester nicht zuhörte.
Er legte seine rechte Hand, die wieder den Kopf tätscheln, den zarten Nacken streicheln wollte, fest in die andere in seinem Schoß.
»Na, was du bist, das wissen wir doch noch gar nicht. Du kannst das eine oder das andere sein. Nur weil ich ein Bauer bin, musst du das schließlich nicht auch sein! Ich sag ja, eins ist so gut wie das andere. Kann sein, dass du ein Fahrender bist.«
»Wirklich?« Die kleine Stimme schoss auf wie eine Lerche. »Das ginge auch?«
»Ja, sicher, das wird sich zeigen«, bestätigte Herrmann und hielt sich weiter an sich selbst fest.
»Wie merken wir es denn, was ich bin?«, fragte Walther aufgeregt. Herrmann musste das Gesicht abermals abwenden. Was er tat, brach ihm das Herz, aber vielleicht rettete es seinen Sohn. »Das ist so wie mit den Feldern, wenn man gesät hat, weißt du. Zuerst kommt man nur so vorbei und sieht den Acker, aber man weiß deswegen noch nicht, was mal darauf wächst.« Das Kind nickte eifrig.
»Und wenn es dann geregnet hat und die ersten Sprösslinge kommen, dann weiß man es auch noch nicht genau, wenn man nicht ganz nahe hingeht. Erst, wenn die Pflanzen ein wenig größer sind, dann kann man es sagen, dann gibt es keinen Zweifel mehr.«
»Wie bei der Gerste?«
»Genau, ganz genau wie bei der Gerste.«
Das Kind blieb still und dachte nach. Schwalben flogen, und oben über ihnen schrie eine Gabelweihe. Walther kaute an seiner Unterlippe. »Wenn man Sand im Schuh hat, das scheuert einen doch dann immer«, sinnierte er.
Herrmann nickte.
»Da ist es vielleicht doch besser, ein Bauer zu sein«, mutmaßte Walther, »sonst tut einem immer was weh.«
Herrmann schwieg. »Steh auf, Junge«, sagte er schließlich.
»Gibt sicher Pflaumen heute, mit der Grütze vielleicht.«
Walther folgte, war aber noch in seinen Gedanken gefangen: »Kann man sich aussuchen, was man sein wird?«
»Ich glaub’s nicht«, antwortete der Vater ernst. »Die Gerste kann es sich ja auch nicht aussuchen.«
»Oh«, sagte das Kind und blieb etwas zurück.
Herrmann stapfte weiter über den Acker. Wer auch immer der große Sämann war, der Bauern und Fahrende machte, Herrmann fand es schlimm, dass er sie dann nicht auch von Anfang an voneinander trennte, so wie man Gerste und Roggen auch nicht in den gleichen Säcken verwahrte.
Wie sollte er diesen Sohn denn nur ziehen lassen, wenn es so weit wäre? Wie sollte er damit leben, zu wissen, dass, selbst wenn er ginge, dem Kleinen immer etwas wehtäte, vom Sand in den Schuhen? Wie sollte er nicht selber daran zugrunde gehen, dieses seltsame Wesen in eine Welt zu entlassen, die er selber nicht kannte und vor der niemand das Kind schützen würde, wenn die Zeit käme?
Kirmes in Ried
Kurz nach den Heiligen Drei Königen gab es in Ried immer einen Jahrmarkt. Seit Allerseelen war auf den Berghöfen von nichts anderem mehr geredet worden, abgesehen davon, dass der morsche Pflaumenbaum vom Bissner im ersten Schnee gleich noch einen Ast verloren hatte, der zudem auf dem trunken heimkehrenden Großknecht Gerold gelandet war. Der Großknecht hinkte seitdem, und der Bissner hatte den Baum noch immer nicht gefällt, worüber alle viel zu sagen hatten.
Der Jahrmarkt fand einen Vollmond nach Dreikönig statt, und das ganze Dorf war in Aufruhr. Die Winterkinder von den abgelegenen Höfen wurden zur Taufe gebracht, und die Messe dauerte ganze drei Stunden, was den Priester schon seit der Heiligen Nacht bedrückte. Es waren noch drei Wochen bis zur Fastenzeit, und das hieß, dass der Jahrmarkt ein erschreckendes Besäufnis werden würde, für die meisten jedenfalls. Die Frauen würden wohl schon fasten, weil das Essen knapp war, und in der Kirche reihenweise ohnmächtig werden. Die Taufkinder würden brüllen, und die verkaterten Väter würden, säuerlich stinkend, schwankend daneben stehen. Noch am Abend vor der Messe betete der Priester inbrünstig, dass Gott ein Einsehen in die Köpfe der Bauern und Dörfler pflanzen möge, damit sie gewaschen und vor allem nüchtern zum Gottesdienst erschienen.
Doch wie so oft hielt Gott es für das Beste, etwas anderes zu tun als das, was sich der Priester wünschte.
Die Taufkinder schrien, die Frauen sackten bei jedem Amen zusammen, und die Männer schwankten mit schweren Köpfen mürrisch hin und her. Da half es wenig, dass der Priester besonders inbrünstig zu dem Bibelwort sprach, dass der Weg des Frommen besser sei als der der Gottlosen, die da wären wie Spreu im Wind.
Er redete seine Litanei herunter und wusste, dass die Frauen aus Furcht, die Männer der guten Ordnung halber in der kalten Kirche standen, dass aber alle, sobald er den Gottesdienst endete, sich wie eben die Spreu, die sie nicht sein sollten, unter den Marktschreiern und Gauklern verteilen würden, die nur darauf warteten, den Leuten ihr bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen.
»Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten«, mahnte der Priester in der Volkssprache und sah in seine Gemeinde, die, wie er ahnte, keine rechte Furcht vor ihm hatte. Er brachte nicht die nötige Statur mit, um ihnen Angst zu machen. Das bisschen Glauben, was er durch sein Leben für sich selbst hatte retten können, war nicht genug, um wie eine Flamme der Herrlichkeit durch die Kirche zu fahren. Er war mehr wie eine Öllampe, die nur durch die Nacht reichte, wenn man die Lohe nicht zu groß werden ließ. Der Priester dachte sich, dass seinen Gläubigen die Flamme der Herrlichkeit sicher lieber gewesen wäre – ihm selbst vielleicht auch.
Die Wagenmeisterin gähnte unverhohlen, dass ihr die Tränen in die Augen traten, und der Lapps-Bauer bohrte sich in der Nase.
»Aber der Gottlosen Weg vergeht«, verkündete der Priester mit schwacher Überzeugung; meist hatten die Gottlosen Glück, hatte er beobachtet. Da sah er den seltsamen Kleinen vom Vogelweidhof. Er stand neben seiner Mutter, dieser gefährlich unzufriedenen Frau, nicht an ihre Hand geklammert wie viele der anderen Kinder und auch nicht verschlafen. Das Kind starrte den Priester mit brennenden Augen an, die Brauen leicht gerunzelt, mit den Lippen die Worte nachformend, die er gerade gehört hatte.
»Herr, wer darf weilen in Deinem Zelt? Wer darf wohnen auf Deinem heiligen Berge?«, übersprang der Priester ein paar Psalter, ohne recht zu wissen warum.
Das Kind von den Vogelweidbauern formte wieder Worte mit den Lippen. Herzog Friedehalm, der ganz vorn stand, räusperte sich gereizt, deswegen brachte der Priester alles schnell zu Ende. Vor der Kirche drückte er Hände und segnete die Alten, die den Frühling wohl nicht mehr sehen würden. Als die Vogelweidbäuerin vorbeikam, hielt er sie an: »Was hat euer Junge eben gesagt? Grade in der Kirche?« Gunis’ Augen wurden weit.
»Hat er etwa gestört, Ehrwürden?« Ihre deutlich ausgestellte Sanftmut verlor sich zugunsten allumfassender Scham: »Walther!«, begann sie zu schimpfen.
»Nein, nein«, beschwichtigte der Priester. »Er hat nicht gestört; ich wollte nur wissen, was er gesagt hat.«
»Los, Walther, gib Antwort«, zischte die Mutter und sah sich ängstlich um, ob jemand mithörte.
Das seltsame Kind mit den fremden Augen blickte auf.
»Corona mundi«, sagte Walther.
»Was?«, riefen der Priester und die Mutter wie aus einem Mund, wenn auch in verschiedenem Ton; der eine unsäglich überrascht, die andere ungehalten. Sie dachte, ihr Kind wäre entgegen seiner unbeteiligt entfernten Art plötzlich ungezogen, redete in einer frechen Plappersprache zu dem ehrwürdigen Geistlichen. Schuld keimte überdies in ihr auf, da sie doch vor ihm selbst den Sohn der Besessenheit bezichtigt hatte. Was, wenn er Walthers dummes Schnattern nun als Teufelswerk hören würde? Wie der Priester auch gleich mit bebender Stimme nachfragte, machte sie noch unbehaglicher. »Weißt du denn, was das heißt?«
»Weltenkrone«, sagte Walther zur gleichen Zeit, als Gunis mitkeuchte: »Natürlich nicht!«
»Wieso Weltenkrone?«, fragte der Kleriker.
»Wer darf wohnen auf Deinem heiligen Berge«, wiederholte Walther mit Selbstverständlichkeit den Psaltervers, der ihn an Giacomo erinnert hatte.
»Wo hat er das denn her?«, fragte der Priester entgeistert und wurde um seine Antwort betrogen, da in diesem Moment die Gaukler mit ihrem Krach anfingen und die Menge sich johlend um sie scharte. Gunis knickste noch entschuldigend, dann rannte auch sie vor, um die Musikanten und Feuerschlucker zu sehen und die peinliche Befragung ihres Kindes so zu beenden.
Walther, wie immer unangenehm berührt von Lärm und Gedränge, hielt sich unwillig an der Hand seiner Mutter, die ihn bald hierhin, bald dahin zog, Stoffe befühlte, Gewürze roch und sich von einem Wagen, auf dem unendlich teure Spiegel verkauft wurden, gar nicht wieder entfernen wollte.
Um Mittag kaufte sie sich selbst einen Schweinefuß und Walther ein paar Nüsse, da er für ihren Imbiss nicht zu begeistern war. Langsamer nun, weil sie aß und beide Hände für den Schweinefuß brauchte, schlenderte Gunis zur anderen Seite des Kirchhofs, wo bis vor kurzem ein paar Frauen getanzt hatten, die Schellen an den Füßen trugen.
»Ist denen nicht kalt?«, fragte Walther, da die Frauen barfuß gingen. »Das sind bloß Fahrende«, sagte seine Mutter nachlässig und leckte sich mit großer Aufmerksamkeit herabrinnendes Fett vom Handballen. Nach dieser Aussage interessierte sich Walther noch mehr für die Füße der Frauen. Er hoffte, dass sie nun bald Schuhe anlegen würden, damit er den darin befindlichen Sand sehen könnte.
Die Frauen setzten sich aber nur zu einem kleinen Feuer und rieben sich die Zehen. Wahrscheinlich war ihr Auftritt nur kurz unterbrochen.