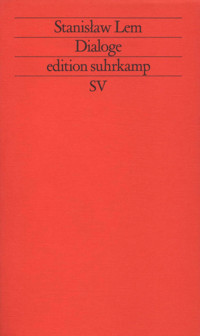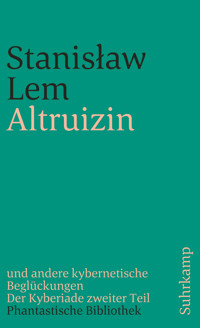12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stanisław Lem, einer der profiliertesten polnischen Autoren nicht nur der Science-fiction-Literatur, hat seine Kindheitserinnerungen niedergeschrieben. In Das Hohe Schloß entsteht das Lwów der zwanziger und dreißiger Jahre, »mit bewundernswerter Akkuratesse beschrieben«, wie Mario Szenessy in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemerkte: »Ich habe selten Beschreibungen von solch zwingender Eindringlichkeit gelesen, oder genauer: verschlungen, denn sie haben mich in Atem gehalten, sie sind spannender als der intelligenteste Kriminalroman.« Doch sieht Lem seine Heimatstadt nur scheinbar mit den Augen des Kindes und Jugendlichen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit realisiert sie sich zu einer ununterbrochenen Gegenwärtigkeit.
»So war die Zeit denn ein Abgrund, unbeweglich in sich selbst, gleichsam machtlos, untätig. In ihr geschah sehr viel, viel wie in einem Meer, doch sie selbst schien stillzustehen.« Stanisław Lem
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stanisław Lem wurde am 12. September 1921 im polnischen Lwów (Lemberg) geboren, lebte zuletzt in Krakau, wo er am 27. März 2006 starb. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Übersetzer und freier Schriftsteller. Er wandte sich früh dem Genre Science-fiction zu, verfaßte aber auch gewichtige theoretische Abhandlungen und Essays zur Kybernetik, Literaturtheorie und Futurologie. Stanisław Lem zählt zu den bekanntesten und meistübersetzten Autoren Polens. Viele seiner Werke wurden verfilmt.
Stanisław Lem
Das Hohe Schloß
Suhrkamp
Titel der polnischen Originalausgabe:
Wysoki Zamek
erschienen bei Czytelnik, Warszawa 1968
Deutsch von Caesar Rymarowicz
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© 1968 by Stanisław Lem
Nutzung der deutschen Übersetzung mit Genehmigung des Verlages Volk und Welt, Berlin DDR
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-74319-5
www.suhrkamp.de
Nun sehe ich, wie wenig es mir gelungen ist, meinen ursprünglichen Vorsatz zu verwirklichen, mit dem ich ans Schreiben gegangen bin – der Erinnerung zu vertrauen, mich ihrem Befehl zu fügen und sogar, die Reflexionen zügelnd, aus ihr wie aus einem Topf alles, was immer geschehen ist, auf den Tisch zu schütten – in dem Glauben, daß es offenbar wichtig sei, weil sie es festgehalten hatte, so daß sich dieses Häufchen vielleicht wie die bunten Glassplitter eines aufgeschlitzten Kaleidoskops zu einem sinnvollen Muster ordnen würde. Oder vielleicht auch nicht zu einem eindeutigen Muster, sondern zu einer Vielzahl solcher Muster, die sich wechselseitig durchdringen und in der man verschiedene Anordnungen finden kann, und sei es nur im rudimentären, schüchtern verbrämten Zustand, so daß ich meine Kindheit auf diese Weise nicht so sehr in wörtlicher Verdichtung wiedergeben werde, die heute immerhin nur einen abstrakten Begriff darstellt, mich zwar, doch zerpflückt von einem Dutzend Kalendern auf all ihren schwarzen und roten Blättern, als vielmehr dank einer solchen List das Porträt – oder den Mechanismus – der Erinnerung, die ja weder ein mir völlig fremdes, absolut passives Versteck, eine geräumige Leere, der Schreibtisch der Seele mit einer Menge Ritzen und Geheimfächer ist noch mein Ich. Ich bin nicht sie, denn sie verkörpert eine eigenständige Kraft, die nicht an genau den gleichen Stellen begierig, nicht an den gleichen Stellen empfindsam oder gleichgültig ist wie ich – sie hat ja so manches von dem, was ich mir so gern gemerkt hätte, nicht festgehalten. Und umgekehrt – wie oft hat sie das fixiert, woran mir nicht im geringsten gelegen war. Also wollte ich eher sie denn mich selbst in höherem Maße zum Ablegen von Geständnissen veranlassen, damit ihr Bildnis entstünde, für das ich übrigens bereitwillig die Verantwortung übernehmen würde, obwohl ich sie gar nicht im Griff hatte und sie auch weiterhin nicht beherrsche. Ein Experiment sollte es werden, auf dessen Ergebnisse ich wirklich gespannt war, ganz so, als handelte es sich nicht um mich und als sollten die Bilder und Berichte nicht von mir ausgehen, sondern aus dem Munde eines anderen, der ich nicht bin. Es hatte sich nur so ergeben, daß dieser Jemand in mir saß, lange vorher, daß er gewissermaßen in mir versteckt war, so wie die inneren Schichten eines Baumes, aus der Zeit seiner Kindheit und seiner Jugend, von vielen Überlagerungen des Reifealters umgeben sind. In diesem Sinne kann man fast buchstäblich behaupten, daß jenes junge Bäumchen aus einer Phase vor Dutzenden von Jahren in diesem ausgewachsenen verborgen ist. Ich weiß wirklich nicht, wann ich mich zum erstenmal maßlos darüber wunderte, daß ich bin, und zugleich sicherlich etwas darüber erschrocken war, daß es mich überhaupt nicht hätte geben können oder daß ich auch irgendein Stock oder eine Pusteblume, das Bein einer Ziege oder eine Schnecke hätte sein können. Ja selbst ein Stein. Manchmal habe ich den Eindruck, daß das noch vor dem Kriege gewesen sein muß, also zu den hier geschilderten Zeiten, aber ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mich dieses Erstaunen nie mehr verlassen, obwohl es nicht zur Monomanie wurde. Ich habe es später von verschiedenen Seiten angezapft, bin unterschiedlich herangegangen, und es war mitunter so, daß ich dieses Gefühl beinahe schon für völligen Unsinn hielt, für etwas, dessen man sich wie eines Gebrechens schämen müsse. Dann jedoch kehrte wieder die Frage zurück, warum die Gedanken im Kopf eigentlich in die eine und nicht in die andere Richtung gingen, was über sie verfüge und sie dirigiere; eine Zeitlang glaubte ich ziemlich fest daran, daß meine Seele – und eigentlich das Bewußtsein – irgendwo vier oder fünf Zentimeter tief im Inneren des Gesichts verborgen sei, hinter der Nase, ein wenig unterhalb der Stelle, wo sich die Augen befinden. Warum? Ich habe keine Ahnung.
Sicherlich war das eine „Subphilosophie“, ähnlich wie es einst, noch früher, statt des Denkens ein „Unter-“ oder „Vordenken“ gegeben hatte. Und das wollte ich ebenfalls mit dem gesamten Benefiz des Inventars aus der Erinnerung schütteln. Das sollte von selbst geschehen, und die Mühe sollte sich ausschließlich aufs Erinnern, auf das Rütteln jenes metaphorischen Topfes beschränken – aber es ist mir nicht geglückt. Ich sehe, daß ich, einerlei ob willentlich oder nicht, gleichzeitig auch das Erinnerte ordnete, und zwar so, daß es sich zu Spuren formte, die recht deutlich in meine Richtung wiesen, auf mich, den heutigen, den sogenannten Literaten, das heißt auf einen Menschen, der einen der weniger ernsten und eher bedenklichen, beschämenden Berufe ausübt: den des höchst emsigen Ersinnens, das man mit verschiedenen gelehrten oder Gott weiß was verdeutlichenden Bezeichnungen wie „Schriftstellerwerkstatt“ zu versehen pflegt. Was mich betrifft, so besitze ich gar keine solche Werkstatt. Jedenfalls habe ich sie bisher nicht bemerkt. Somit wurde alles, was ich aus dem Sack der Erinnerung schüttete, auf der Stelle, im Fluge gelenkt, freilich unmerklich. Von irgendwelchen drastischen Lügen, von Abänderungen kann hier keine Rede sein. Das erfolgte ganz von selbst und auf jeden Fall ohne Absicht. Im übrigen will ich mich gar nicht rechtfertigen.
Erst jetzt, nachträglich, wie ein Detektiv, der den Spuren des Verbrechens folgt, das in einem prestidigitatorischen Ordnen dessen besteht, was überhaupt nicht geordnet war, als es sich zutrug, und auch nicht in meine Richtung wies – erst jetzt sehe ich in dem Ganzen, das ja immerhin entstanden ist, jenen auf mich, der ich ein Vierteljahrhundert später bin, weisenden Pfeil. Das ist um so seltsamer, weil ich nie der Meinung war, ich sei „zu einem Schriftsteller geboren“ und das hoc erat in votis treffe auf mich nicht zu. Übrigens denke ich weiterhin so. Das bedeutet, daß sich in jener Kindheit und in der aus ihr verbliebenen Rumpelkammer ein ganze Menge einander kreuzender Fährten abzulesender, aufzudeckender, vorwiegend chaotischer Richtungen befunden haben muß, Fährten, die blind endeten, abrissen. Vielleicht waren das auch gar keine Spuren, sondern lediglich sehr viele durch Raum und Zeit voneinander isolierte Inselchen; kein völliges Chaos also, denn allein schon der Umstand, daß es ein Zuhause, eine Schule, daß es Eltern gab, daß ich mir noch als ganz kleiner Wicht einen grünen „Flügel“ an die Nase klebte, aber dann größer wurde, eine Schuluniform trug, schon das bildete eine ziemlich klar umrissene Ordnung. Aber das war wohl eine Ordnung wie auf einem leeren Schachbrett, auf dem man entweder schwarz-weiße Streifen sehen kann, die längs oder quer verlaufen, oder auch solche in der Diagonale, daß sich alles so umstrukturiert, wie wir es haben wollen. Das Schachbrett bleibt weiterhin ein Schachbrett, und wir sehen nichts außer dem, was wirklich darauf ist – abwechselnd weiße und schwarze Quadrate, und nur die Ordnung, die Richtung, die Direktive ändern sich umvermittelt. Etwas merkwürdig Ähnliches ist wohl mit dem hier offenen Schachbrett der Erinnerung geschehen. Ich habe nichts hinzugefügt, habe aber von den vielen Systemen, die ich hätte finden können, eins überbetont. Geschah das darum, weil man unwillkürlich nach einem Leitmotiv, einer führenden Achse, einer Lebenskonsequenz sucht? Um nicht einmal sich selbst einzugestehen, daß man so viele eingeschlagene Richtungen verworfen, unwiederbringlich verloren, vergeudet hat? Oder einfach nur deshalb, weil wir wollen, daß das, was ist, ebenso wie das, was war, stets einen ordentlichen und ausdrücklichen Sinn hat, obwohl es gar nicht so sein muß? Als genügte es nicht, einfach zu leben; ich sage ja nicht – im reifen Alter, wo ein Amöbentum, das Fehlen klaren Sinns untragbar ist – aber in der Kindheit? Ich wollte in aller Rechtschaffenheit das Kind zu Wort kommen lassen, ohne es zu behindern, soweit das möglich ist, statt dessen habe ich mich an ihm bereichert, habe seine Hosentaschen geplündert, die Schubfächer, die Hefte, um mich vor den Älteren zu brüsten, wie gut es sich schon damals angelassen hatte, welche Larven künftiger Tugenden selbst seine kleinen Sünden waren, und um diesen Raub irgendwie zu rechtfertigen, habe ich ihn in einen schönen Wegweiser, beinahe in ein ganzes System verwandelt. Auf diese Weise habe ich noch ein Buch geschrieben – als hätte ich nicht von vornherein gewußt, geahnt, daß es anders nicht sein kann, daß alle Absichten, die dem Protokollieren von Erinnerungen vorstehen, leerer Schein und Trug sind, all jene strengen Vorsätze, von sich aus nichts hinzufügen zu wollen. Ich habe sogar zuviel gesagt, habe kommentiert, interpretiert, habe aus fremden Geheimnissen und Spielen, denn sie sind ja nicht meine, ich habe sie ja nicht mehr, sie existieren nicht, diesem kleinen Jungen ein Grabmal errichtet, habe ihn darin eingeschlossen, aufmerksam besorgt und in aller Gelassenheit, sachlich, als hätte ich über einen Erdachten geschrieben, der nie gelebt hat, den man nach ästhetischen Gesetzen, nach eigenem Willen und nach einem Plan formen kann. Das war nicht fair. So geht man mit einem Kind nicht um.
1
Erinnern Sie sich noch an das Sammelsurium rätselhafter Dinge, die die Liliputaner in Gullivers Taschen fanden? An jene geheimnisvollen und phantastischen Gegenstände, wie den Palisadenkamm, die gewaltige Uhr, die einen rhythmischen Lärm erzeugte, und die vielen anderen, deren Bestimmung völlig unklar war? Einst war auch ich ein Liliputaner. Ich habe mich mit meinem Vater vertraut gemacht, bin an ihm hinaufgekrochen, wenn er in dem Sessel mit der hohen Lehne saß, und habe die Taschen seines schwarzen, nach Tabak und nach Krankenhaus riechenden Anzugs, zu denen er mir Zugang gewährte, durchforscht. In der linken Westentasche trug er einen Metallzylinder, der einer Großwildpatrone glich; man konnte ihn auseinanderdrehen, und dann zeigte er in seinem Inneren eine kleine Pyramide aus übereinandergesteckten Nickeltrichtern – jeder nächstfolgende hatte einen kleineren Durchmesser als der vorherige. Das waren Endoskope. Die benachbarte Tasche enthielt einen Bleistift, der zur Zeit meiner ersten Untersuchungen schon fast abgenutzt war und in einer goldenen Fassung stak, die den Bleistiftstummel mit einem Klicken aus sich herausschob, wenn man auf sie drückte – aber dazu bedurfte es größerer Kraft, als ich sie besaß. Im Gehrock befand sich eine Metallschachtel, die ziemlich beängstigend zuschnappte, mit einer Samteinlage, darin ruhte ein winziges Portemonnaie, nicht für Münzen, denn es enthielt überhaupt nichts außer einem Stückchen Samt, das sich nach dem Aufknöpfen des Verschlusses von selbst auseinanderlegte. Dort war auch ein kleines silbernes Schächtelchen mit einem Schnappschlößchen am Deckel, und darin lag ein silbernes Plättchen, an dessen Unterseite ein flacher dunkellila Gummi befestigt war, aber da durfte man nicht die Finger hineinstecken, weil sie sich gleich tintenblau färbten, und auf der entgegengesetzten Seite, im Gehrock – war noch ein runder Spiegel, der ein Loch in der Mitte und einen Sprung hatte und der an einem schwarzen Band mit einer Klammer hing. Dieser Spiegel vergrößerte stark mein Gesicht, verwandelte das Auge in eine Art gewaltigen Teich, in dem die braune Iris wie ein runder Fisch schwamm, während die massiven Wimpern wie Schilf waren, das rings um den Teich wuchs. In der Weste wiederum stak, an einer goldenen Kette verankert, eine flache Uhr, ebenfalls aus Gold, mit drei Deckeln. Sie hatte Ziffern, die als römisch bezeichnet wurden, und einen kleinen Sekundenzeiger. Die Deckel der anderen Seite konnte ich nicht selbst öffnen, und man konnte das auch nicht immer tun. Kleine Rädchen mit Rubinäuglein lebten dort für sich hin, leuchteten und bewegten sich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!